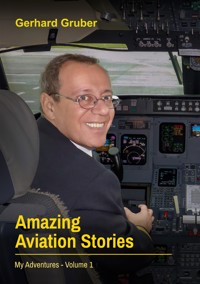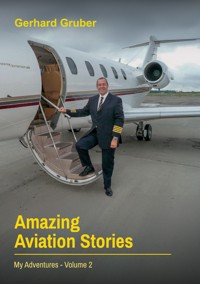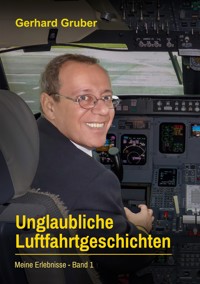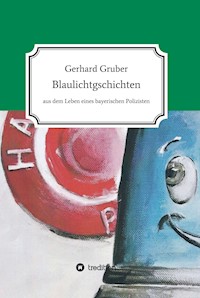Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
55 Jahre Luftfahrt; humorvoll, spannend und hautnah erzählt. In diesem zweiten Band schildert Gerhard Gruber in zahlreichen unterhaltsamen und teils unglaublichen Geschichten seine jahrzehntelangen Erlebnisse in der Welt der Luftfahrt. Mit einem feinen Gespür für Humor und einem Blick hinter die Kulissen erzählt er Episoden, die nicht nur Fachleute faszinieren, sondern auch für Leserinnen und Leser ohne Vorkenntnisse leicht verständlich sind. Ob kuriose Zwischenfälle, exklusive Einblicke in den Alltag auf Flughäfen oder Begegnungen mit Prominenten im Businessjet, jede Geschichte ist authentisch und oft mit historischen Fotos belegt. Wie schon Band 1 lädt auch dieser Band zu einer fesselnden Reise durch die glamouröse Welt des Jetsets ein, eine Welt voller Luxus, spannender Abenteuer und überraschender Momente.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1 - Die Anfänge
1. Mit Hammer und Meißel zum Segelflugschein
2. Der Irrflug der Austria Meise
3. Ein Seilriss, was nun?
4. Kollision in der Luft
5. Mit dem Motorsegler quer durch Europa
6. Modellfliegen im Militärgefängnis
7. Rauch im Cockpit
8. Mit wenig Geld zum Privatpilotenschein
9. Bannerschlepp – Der verhakte Haken
10. Die Star-Fighter – ein gefährlicher Job
11. Das unbemerkte Trudeln
12. Das Duell mit dem Heerespsychologen
13. Fallschirmspringer sind nicht aufzuhalten
14. Die Landung im Getreidefeld
15. Der Eiserne Vorhang in den 80er Jahren
16. Morsen, der Schreck aller Piloten
17. Die Touristenfalle in Barcelona
18. Skrupellos in den Tod geschickt
19. Die Tücken des Zweimot-Trainings
20. Fluglehrer leben gefährlich
21. Der Bordtelefonistenschein, eine echte Rarität
22. Der Kreislaufkollaps des High-Society-Reporters
23. Mit scharfer Munition nach Kairo
24. Der stramme Windsack
25. Hilfsabwurf für die Aubesetzer
Kapitel 2 – Am Flughafen Wien
26. Tödliches Desaster im Nebel
27. Die peinliche Schneeräumung
28. Die geretteten Osterhasen
29. Wegen Verspätung dem Terror entkommen
30. Die misslungene Andockpremiere
31. Die Sicherheit im Wandel der Zeiten
32. Der Ärger mit den Telefonimpulsen
33. Ein neuer Flughafenzaun muss her!
34. Verlockende Angebote
35. Wenn die Polizei ins Radar fährt
36. Ein Luftschiff am Flughafen Wien
37. Der Hollywood-Moment am Vorfeld
38. Meine Erinnerungen an den Absturz der Lauda Air
39. Die infiltrierte Demonstration
40. Vier Wracks für den Fortschritt
41. Die OSCAR-Piste
42. Freud und Leid mit den Wasserbögen
43. Der Kampf gegen die gelbe Fahne
44. Dramatischer Zwischenfall beim Staatsbesuch
45. Schüsse aus dem Staatsflugzeug
46. Die verhängnisvolle Luftschiffjagd
47. Die Ankunft des toten Falcos
48. Begegnungen mit Niki Lauda
49. Das Durchgriffsrecht des Flugplatzbetriebsleiters
50. Die Löcher im WC
51. Vom einfachen Schranken zur „Gruber-Schleuse“
52. Zu viel Sicherheit ist auch nicht gut
53. Warum schneiden wir nicht die Piste in Würfeln?
54. Die Meldung über den betrunkenen DC10-Kapitän
Kapitel 3 – Das Jet-Zeitalter
55. Wo ist mein Flugzeug?
56. Das erste Jet-Typerating
57. Der tiefgläubige Jude
58. Der medizinische Ersatzteiltransport
59. Der erste Businessjet-Simulator Österreichs
60. Frierend von Australien bis Wien
61. Zwei Handbuch-Lacher
62. Als Linienpilot mit Flugangst
63. Die mysteriöse Entführung der Stewardess
64. Der Dollar-Schmuggler
65. Überlebenstraining für die Hohe See
66. Der „Mile High Club“-Bewerber
67. Der geheime Prüfungsflug
68. Feministischer Aufstieg mit Hindernissen
69. Schreck beim Sturzflug
70. Der Traum vom DC-3 Fliegen
71. Langeweile ausgeschlossen
72. Der Ostblock und seine Eigenheiten
73. Mit Pavarotti zur Concorde in London
74. Nein, die Stewardess ist nicht im Flugpreis inkludiert!
75. Mit Wodka ins temporäre Eheglück
76. Der besorgte Bundespräsident Heinz Fischer
77. Die geheime Disco in Tjumen
78. Die magische Kraft der Aufsetzzone
79. Die erste weibliche Jet-Crew Österreichs
80. Flug nach Nirgendwo
81. Druckabfall in der Kabine
82. Hydraulikverlust mit dem Präsidenten
83. Beinahe Crash im Rückwärtsgang
84. Wer ist schuld am Zusammenstoß?
85. Der Unruly Passenger
86. Süßer Sprechausfall
87. Alkohol und der Religionswächter
88. Mit einem Pfefferspray nach Dubrovnik
89. Reifenschaden in Moskau
90. Überraschungen am Strand von Mykonos
91. Die tödliche Enteisung in Chisinau
92. Es ist nicht alles Gold, was glänzt.
93. Mit US-Einreisebeamten ist nicht zu spaßen.
94. Mit dem Verteidigungsminister auf Truppenbesuch im Tschad
95. Heimwärts mit den Champions
96. Unverhofft bis Lima
97. Eine Million Klicks für die Bewusstlosigkeit
98. Wenn der Hut brennt
99. Auch in einem Simulator kann es gefährlich sein
100. Gefangen im Covid-Flieger
Vorwort
Schon beim Schreiben des ersten Bandes war klar: Das war noch lange nicht alles. Zu viele Geschichten, zu viele Begegnungen und unvergessliche Momente aus über fünf Jahrzehnten in der Luftfahrt hatten noch keinen Platz gefunden. Die Resonanz auf Band 1 hat mich dann vollends ermutigt, weiterzumachen – nicht zuletzt wegen der vielen begeisterten Rückmeldungen, die mich tief berührt haben. Dass das Buch bei Amazon eine Fünf-Sterne-Bewertung bekam, war für mich eine echte Überraschung – vor allem, weil ich ursprünglich gar nicht vorhatte, ein Buch zu schreiben.
Auch dieser zweite Band lebt wieder von den Menschen hinter den Geschichten. Stundenlange Gespräche mit alten Weggefährten führten von einem Erlebnis zum nächsten. Gemeinsam haben wir wieder Erinnerungen ausgegraben und mit jeder neuen Anekdote wuchs das Projekt weiter – vielleicht sogar über Band 2 hinaus.
Ich wollte mit diesen Geschichten nie nur für Fachpublikum schreiben. Die Bücher sollten auch für Menschen ohne fliegerisches Vorwissen leicht verständlich sein. Denn gerade sie bekommen hier einen Einblick hinter die Kulissen der Luftfahrtwelt – mit all ihren Kuriositäten, Glücksmomenten, Rückschlägen und Abenteuern. Viele dieser Geschichten haben sich im Umfeld des Jetsets oder der internationalen Luftfahrtelite abgespielt – sie sind wahr, auch wenn sie manchmal unglaublich klingen. Ich kann alle mit Fotos oder Dokumenten belegen.
Wer heute in die Fliegerei einsteigt, kann sich kaum vorstellen, wie rau und improvisiert vieles in den 1970er-Jahren noch war. Als ich 1970 begann, war das österreichische Gesetz für Pilotenlizenzen gerade elf Jahre alt. Sicherheit war oft ein relativer Begriff, und manche Flüge glichen Mutproben. Es war eine andere Zeit – wild, fordernd, gefährlich. Umso mehr hoffe ich, dass junge Aviatiker durch dieses Buch ein Gefühl dafür bekommen, wie alles einmal begonnen hat.
Ein weiterer, ganz persönlicher Aspekt dieses Buches ist mein Wunsch, all jenen, die mich über die Jahre kaum gesehen oder gehört haben, einen Einblick in mein Leben zu geben. Viele Gespräche begannen mit dem Satz: „Ich hatte ja keine Ahnung, was du alles erlebt hast.“ Tatsächlich war ich oft monatelang im Ausland unterwegs – und mit diesen Geschichten möchte ich nun ein wenig davon zurückgeben.
Danksagung
Mein tiefster Dank gilt meiner Frau Sabine. Sie hat von all meinen Buchprojekten wohl am meisten „mitbekommen“ – meist in Form des nächtlichen Tastaturklapperns. Oft habe ich gewartet, bis sie eingeschlafen war, um dann heimlich wieder ins Büro zu schleichen und weiterzuschreiben.
Ein großes Dankeschön geht an meinen Kollegen vom Flughafen Wien, Peter Niedl. Er hat sich mit seiner akribischen Gabe der Tippfehlererkennung freiwillig dem Kampf gegen den Fehlerteufel gestellt. Mit kritischem Blick, unermüdlicher Geduld und vielen hilfreichen Anmerkungen hat er diesen Band entscheidend mitgeprägt.
Ebenso danke ich dem Flughafen Wien, meinem Arbeitgeber über 45 Jahre lang, und der Stadtgemeinde Fischamend für die großzügige Unterstützung bei der Präsentation der Bücher. Auch die Kronen Zeitung und der Kurier halfen mir durch Archivmaterial und Veröffentlichungsfreigaben weiter.
Und natürlich danke ich den rund 100 Gesprächspartnern, die ihre Geschichten mit mir geteilt haben und mir erlaubten, sie namentlich zu erwähnen.
Gerhard Gruber
Kapitel 1 - Die Anfänge
1. Mit Hammer und Meißel zum Segelflugschein
Getrieben von meinem Wunsch zu fliegen, radelte ich im Sommer 1970 als 16-jähriger Schüler dorthin, wo die Flugzeuge landeten. Es war der Flugplatz Kottingbrunn, er hat heute den Namen Bad Vöslau. Etwas unsicher ging ich auf die Gruppe der Segelflieger zu und fragte, ob ich zusehen dürfe. Es dauerte nicht lange, bis ich wusste: da möchte ich dazugehören.
Es waren Ferien und ich fuhr nahezu täglich zum Flugplatz. Schon bald wurde mir der Segelfluglehrer Josef (Pepi) Fischer vorgestellt. Er musterte mich von oben bis unten und sagte trocken: „Du bist zu leicht.“ Ich hätte mit allem gerechnet. Zu jung, zu klein, zu schwach usw., aber zu leicht? Eigentlich dachte ich, je leichter, umso besser.
Pepi Fischer sah die großen Fragenzeigen in meinen Augen und sagte nur: „Ich zeige dir etwas.“ Er ging zum zweisitzigen Schulflugzeug, öffnete die Kabinenhaube und zeigte mir einen Aufkleber im Cockpit. Darauf stand: „Bei zweisitzigen Flügen im vorderen Sitz maximal 100 kg und mindestens 55 kg“. Das war unbedingt einzuhalten. Bei Nichtbeachtung reagiert ein Flugzeug mit kritischen Flugeigenschaften, die im Extremfall zu einem Absturz führen können.
Das Schulflugzeug war ein Bergfalke mit dem österreichischen Kennzeichen OE-0363. Während der Schulung sitzt der Flugschüler vorne und der Fluglehrer hinten. Der hintere Sitz ist etwa im Schwerpunkt des Flugzeugs und hat daher kein Mindestgewicht. Für meinen vorderen Sitz fehlten aber aufgrund meiner 48 kg noch 7 kg. Da niemand im Verein ein ähnlich geringes Gewicht hatte wie ich, war dieses Problem bislang noch nie aufgetreten. Pepi meinte pragmatisch, ich solle mir einfach einen 7-Kilo-Sandsack anfertigen – der würde dann auf den Sitz gelegt, und ich müsste mich daraufsetzen.
Das Anfertigen des Sandsacks war schwieriger als gedacht. Die Profisandsäcke bestehen aus einem dichten Stoff und haben als Füllung Sand mit der richtigen Körnung. Beim Draufsetzen passt sich der Sack dem Gesäß an und ergibt so eine bequeme Sitzschale. Ich hatte weder den Stoff noch den richtigen Sand und musste daher improvisieren.
Mein Sack bestand aus mehreren Einkaufstaschen aus Plastik und als Sand fand ich nur einen ganz feinkörnigen Schließsand. Er wurde von meinem Vater zum Eingipsen von Elektrodosen in die Mauer verwendet. Ich war froh, überhaupt etwas gefunden zu haben, und begann mit dem Füllen. Der Moment der Wahrheit kam, als ich mit dem Sack auf die Waage stieg. Ich war noch immer um 2 kg zu leicht.
Da mein Sack mit Sand schon randvoll war, kam mir die Idee, Metall in den Sand zu geben. Ich suchte das ganze Haus ab und fand in der Werkstätte einige Meißeln und Hämmer. Ich vergrub alle Teile im Sandsack und verklebte ihn mit einigen Metern Isolierband. Die gute Nachricht war, dass er nun das erforderliche Gewicht hatte. Die schlechte Nachricht war, dass er eine eher bauchige Form hatte. Beim Draufsetzen verhinderte der verklebte, feinkörnige Sand jedwede Anpassung an mein Gesäß. Meine Schulflüge endeten daher jedes Mal mit einem schmerzenden Hintern.
Bei jedem Einsteigen in das Segelflugzeug wurde ich mit meinem plumpen und harten Sandsack von den Kameraden mitleidig belächelt. Nach einigen Wochen erbarmte sich ein Vereinsmitglied und überreichte mir einen Profisandsack. Mein Hintern dankte es ihm. Es dauerte noch eine Zeit, bis mein natürliches Wachstum mehr Gewicht auf der Waage anzeigte und ich ohne Sandsack fliegen durfte.
Story #1: mein Schulflugzeug „Bergfalke II“ 1970 in Kottingbrunn
Story #2: die „Austria Meise“ mit fast 3 m Spannweite
2. Der Irrflug der Austria Meise
So wie viele junge Luftfahrtbegeisterte begann auch ich mit dem Modellfliegen. Es war dies eine kostengünstige Methode, um erste aviatische Erkenntnisse zu gewinnen. Mitte der 60er Jahre gab es nur Bausätze, die aus Holzleisten und Holzbrettern bestanden. Man musste alles mit einer Laubsäge ausschneiden. Dafür war es aber erschwinglich und man lernte einiges über Flugzeugbau.
Motoren oder eine Fernsteuerung waren für mich damals unerschwinglich. Meine Flugzeuge wurden daher mit einem Gummiseil gestartet. Nach dem Ausklinken hoffte man, dass das Flugzeug wieder gut landet und nicht an einem Hindernis zerschellt, was leider doch gelegentlich der Fall war.
Es war für mich ein Glücksfall, dass ich 1970 den Obmann des Mödlinger Modellflugvereins kennenlernte. Dies deshalb, weil er ein begnadeter Elektroniker war und mir zu relativ geringem Preis einen Sender für die Fernsteuerung baute. Die Sendefrequenz war damals noch 40,68 MHz und wurde von Originalempfängern der Firma Graupner empfangen. Die Rudermaschinen waren um einiges schwerer als heute und benötigten daher ein größeres Flugzeug.
Mein größtes Segelflugzeug war eine Austria Meise mit knapp 3 Meter Spannweite. Diese rüstete ich auf Betrieb mit Fernsteuerung um und montierte über dem Rumpf einen Verbrennungsmotor. Mit dieser Kombination machte ich eine Reihe von erfolgreichen Flügen. Um mobil zu sein, baute ich für mein Moped einen Anhänger, ähnlich wie ihn die großen Segelflugzeuge haben.
Da mein Enthusiasmus auch vor dem kommenden Winter nicht Halt machte, flog ich auch bei kaltem Wetter. Als Fluggebiet wählte ich ein großes Feld in der Nähe unserer Wohnsiedlung. Was ich nicht wusste, war, dass sich mit sinkenden Temperaturen die Reichweite meiner Fernsteuerung drastisch verringerte.
Schon kurz nach dem Start reagierte meine Austria Meise nicht mehr auf meine Steuerung und flog von mir weg Richtung Wohnsiedlung. Auch ein Hochhalten des Senders und Schwenken der Antenne brachte keinen Erfolg. Verzweifelt sah ich meinem Flugzeug nach, wie es kleiner und kleiner wurde und auch das Motorengeräusch nicht mehr zu hören war.
Ich war etwa einen Kilometer von der Siedlung entfernt und verlor mein Flugzeug aus den Augen, als es in etwa 50 Meter Höhe über die Häuser flog. Betroffen stand ich da, hielt meinen Sender in der Hand und fand mich damit ab, meine Austria Meise nie wiederzusehen. Nach einigen Minuten packte ich meine Sachen für die Heimfahrt zusammen. Ich wollte schon losfahren, als ich auf einmal das vertraute Motorengeräusch wieder hörte. Es wurde immer lauter und schließlich sah ich auch meine Austria Meise wieder.
Zum Glück waren die Ruder nicht genau für einen Geradeausflug eingestellt, sodass sie einen riesigen Kreis flog und auch genau wieder auf mich zuflog. Als sie ganz nah war, reagierte sie auch wieder auf meine Steuersignale. Ich machte sofort eine Landung und war sehr erleichtert. Abgesehen von dem Verlust wäre eine Beschädigung von Fremdeigentum oder sogar eine Personenverletzung bei einem unkontrollierten Absturz durchaus möglich gewesen.
Ich war froh, mit meinem ganzen Stolz wieder nach Hause fahren zu können.
3. Ein Seilriss, was nun?
Um ein Segelflugzeug in die Luft zu bekommen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die gebräuchlichsten sind der Schlepp hinter einem Motorflugzeug und der Windenstart. Letzterer ist um vieles günstiger und war daher meine bevorzugte Variante als Segelflugschüler. Er kostete öS 10,- Schilling, das sind heute 73 Eurocent. Dies war übrigens auch der Preis für eine Schachtel Zigaretten, was mich nach dem ersten Versuch mit dem Rauchen gleich wieder aufhören ließ.
Für einen Windenstart wird ein möglichst großer Flugplatz benötigt. Je länger das Seil zwischen dem Segelflugzeug und der Winde ist, desto höher ist die Ausklinkhöhe. Am Flugplatz Kottingbrunn waren wir in der glücklichen Lage, eine Seillänge von 1 km zu haben. Dies ergab eine Ausklinkhöhe von 400 Meter, bei gutem Wind sogar 440 Meter.
Die Kommunikation war damals im Jahr 1970 noch sehr einfach. Damit der weit entfernte Windenfahrer sah, wann er das Seil einziehen musste, schwenkte der Starthelfer eine große orangefarbige Tafel. Wurde das Seil straff, musste er für das Halten der Tragfläche noch ein paar Meter mitlaufen. Ab dann ging es für das Segelflugzeug rasch nach oben. Die Nase des Flugzeugs zeigte steil in den Himmel und als Pilot hatte man den Eindruck wie bei einem Raketenstart.
Im Vergleich zu allen anderen Startarten ist ein Windenstart jene Variante, die das Flugzeug am meisten beansprucht. Durch das steile Aufsteigen werden die Tragflächen nach oben gebogen und auch das 4 mm dicke Stahlseil muss eine hohe Zugkraft aushalten. Durch die Beanspruchung gab es pro Flugsaison etwa zwei bis drei Seilrisse.
Die größte Kraft auf das Seil war in der ersten Startphase, bei der man das Segelflugzeug steil nach oben steuerte. Das war auch der kritischste Moment für den Piloten und es passierte mir an einem sonnigen Tag im Juni 1971.
Mein Flugzeug schoss mit großem Winkel in die Höhe und in etwa 100 m war mit einem Ruck plötzlich die Zugkraft weg. Um nicht die lebenswichtige Geschwindigkeit zu verlieren, nahm ich blitzartig die Flugzeugnase nach unten. Ich drückte den Steuerknüppel bis zum Anschlag vor und war dabei sogar für einige Sekunden schwerelos. Das nächste Problem war die Entscheidung, wie ich weiterfliegen soll. Hier fielen mir die Worte meines Segelfluglehrers Pepi Fischer ein. Mehrmals mahnte er, bei einem Seilriss in niedriger Höhe auf keinen Fall eine Umkehrkurve zu probieren.
Meine niedrige Höhe schloss die Option einer Umkehrkurve eindeutig aus. Es blieb also nur ein Fliegen nach vorne. Ich fuhr sofort die Bremsklappen aus und steuerte einen Landeplatz am Ende des Flugplatzes an. Ich war froh, dass dieser so groß war. Für die Landung musste ich allerdings noch darauf achten, nicht zu schnell zu sein. Mein Bergfalke wurde in den 50er -Jahren gebaut und hatte keine Bremsen.
Die Landung erfolgte wie geplant und auch die Strecke für das Ausrollen hielt sich in Grenzen. Mein Segelflugzeug kam wenige Meter neben dem Windenfahrer zu stehen. An seinem Gesichtsausdruck konnte ich sehen, dass er genauso froh über den guten Ausgang war wie ich.
Das Seil wurde mit einem behelfsmäßigen Knoten und mit Bügelschraubklemmen provisorisch repariert. Diese Methode dauerte nur wenige Minuten und es konnte bald wieder weitergeflogen werden.
Die aufwendigere Art der Reparatur war das Spleißen. Dabei werden die Litzen des Seils verflochten. Dies wurde meist während der Wintersaison gemacht, um zum Saisonstart wieder ein gutaussehendes Seil zu haben.
Story #3: der steile Aufstieg mit einem Windenstart
Story #4: das verunfallte „Grunau Baby“ am 8.4.1972
4. Kollision in der Luft
Es war der 8.4.1972 und wir waren etwa 15 Klubkameraden, welche die ersten warmen Tage des Jahres zum Segelfliegen genossen. Wir hatten drei Segelflugzeuge im Einsatz. Eines davon war doppelsitzig und wurde auch für die Ausbildung verwendet. Das zweite Flugzeug war ein Grunau Baby II b. Es hatte das Kennzeichen OE-0516 und wurde primär von den jungen Scheininhabern in Flugplatznähe verwendet. Es hatte keine Kabinenhaube, sodass der Pilot mit seinem Kopf im Freien war. Die Langsamflugeigenschaften waren hervorragend, aber die Gleitzahl von 17 war im Vergleich zu moderneren Flugzeugen mehr als schlecht.
Das dritte Segelflugzeug war eine SZD-24 C Foka mit dem Kennzeichen OE-0611. Sie war mit der Gleitzahl von 34 doppelt so gut wie das Baby und auch viel schneller.
Während der Doppelsitzer in der Flugplatznähe blieb, flogen die beiden Einsitzer zum Harzberg bei Vöslau. Jahreszeitlich bedingt waren die Thermiken noch nicht sehr ausgeprägt und deren Suchen sowie der Verbleib in der aufwärts strömenden Luft war schwierig. Ganz besonders für Hubert in der Foka, da diese aufgrund der Geschwindigkeit einen großen Kreisdurchmesser hatte und daher nicht in den optimalen Kern der Thermik kam.
Lukas im Baby hatte es viel leichter. Die geringe Geschwindigkeit ermöglichte kleine Kreise im Kern der Thermik, wo der beste Aufwind war. Was dann geschah, erzählten mir meine Klubkameraden, welche die beiden Flugzeuge beobachteten. In etwa vier Kilometern Entfernung sahen sie das Baby anfänglich unter der Foka. Beide Flugzeuge kreisten in derselben Thermik. Durch die engeren Kreise hatte das Baby ein besseres Steigen und näherte sich der Foka von unten und wollte sie offensichtlich innen überholen.
Dieses Manöver misslang und führte zu einer Kollision der beiden Segelflugzeuge. Wie es genau passierte, kann man nur vermuten. Die Beschädigung der abgestürzten Flugzeuge lässt aber den Schluss zu, dass das Baby mit einer Tragfläche in den Rumpf der Foka krachte. Sowohl der Flügel des Babys als auch der Rumpf der Foka brachen ab und führten zum Kontrollverlust und Absturz beider Flugzeuge.
Ich wurde auf den Absturz aufmerksam, als mehrere Kameraden schrien „die zwei sind abgestürzt“. Wir fuhren zum vermuteten Unfallort und begannen im Wald mit der Suche. Der Absturz wurde auch von Spaziergängern beobachtet, welche sofort die Rettung alarmierten.
Mit nur einer verbliebenen Tragfläche konnte Lukas' Flugzeug lediglich steile Spiralen fliegen. Ohne Fallschirm blieb ihm nichts anderes übrig, als abzuwarten, was geschehen würde. Er stürzte schließlich in einen jungen Wald, dessen Bäume den Aufprall etwas abfederten. Lukas hatte unglaubliches Glück – er überlebte mit einer Gehirnquetschung.
Bei der Foka hing das Leitwerk nur mehr an den Steuerseilen und stürzte daher steil nach unten. Hubert hatte einen Fallschirm und verließ das Flugzeug. Wie man am Wrack erkennen konnte, betätigte er aber nicht den Notabwurf der Kabinenhaube und hatte offensichtlich Probleme beim Aussteigen. Ob es die geringe Höhe war, ob er den Griff zum Öffnen des Fallschirmes nicht fand oder ob er vielleicht bewusstlos war, wurde nie geklärt. Jedenfalls prallte er mit geschlossenem Fallschirm auf den Waldboden und war sofort tot.
Das Erlebnis traf mich sehr. Der Anblick der Unfallszene sitzt mir heute noch in den Knochen.
5. Mit dem Motorsegler quer durch Europa
Zu Beginn meiner Pilotenlaufbahn war ein blauer Motorsegler der Mittelpunkt meines Lebens. Es war ein Scheibe Motorfalke SF25C mit 68 PS und dem Kennzeichen OE-9050. Gegenüber dem früheren Modell hatte er sogar schon den Luxus eines Elektrostarters und musste nicht schweißtreibend mit einem Zugstarter angeworfen werden. Einziger Nachteil war die fehlende Heizung, welche sich besonders bei Kälte schmerzlich bemerkbar machte.
Um die winterlichen Flüge erträglicher zu machen, wurde der Einbau einer Heizung in der Werft von Sportavia-Pützer am Flugplatz Dahlemer Binz geplant. Da auch die drei Motorsegler der Milchstaffel in diese Werft mussten, flogen wir am 4.8.1973 zu viert im Verband Richtung Deutschland.
Die Funkausrüstung in meinem Motorsegler war sehr spartanisch. Die heutigen Funkgeräte haben 2.280 Frequenzen zur Auswahl, mein Funkgerät hatte aber nur sieben Frequenzen. Damit konnte man zwar mit den umliegenden Flugfeldern sprechen, es gab aber keinerlei Möglichkeit, die vielen Flugsicherungsstellen oder einen Wetterdienst zu hören. Eine der sieben Frequenzen war für die Kommunikation zwischen Luftfahrzeugen vorgesehen. Auf dieser gab mir der Formationsführer Kurt Gaschler in seiner Fournier RF-5 die erforderlichen Informationen. Ansonsten hieß es immer dicht hinter Kurt zu bleiben und dort zu landen, wo auch er landete.
Erste Zwischenlandung zum Tanken und für die Zollabfertigung war in Linz, danach ging es nach Nürnberg und zwecks Übernachtung nach Vielbrunn. Dort war ein Flugtag und zur Begrüßung flogen wir noch vor der Landung ein kleines Programm. Nie werde ich das Briefing von Kurt vergessen. „Gerhard, den ersten Anflug machen wir in enger Karo-Formation und du bist der hintere Flieger. Wir werden sehr tief anfliegen und du bleibst auf meiner Höhe. Nur wenn ich crashe, hebst du leicht drüber.“
Als ausländisches Formationsteam waren wir die Attraktion des Flugtages und gefeierte Gäste im Bierzelt. Am nächsten Tag flog die Milchstaffel noch ein eindrucksvolles Programm, bevor wir Richtung Dahlemer-Binz abflogen und am späten Nachmittag knapp vor der belgischen Grenze landeten.
Während der Arbeiten an unseren Motorseglern hatten wir 5 Tage Zeit, welche wir mit Ausflügen und Plaudereien verbrachten. Mit vier Flugzeugen waren wir ein Großkunde, und die Leute der Werft zeigten uns jeden Abend ein neues Lokal. Wie zur damaligen Zeit üblich gab es im Hotel und in jedem Gasthaus Flipper, an denen ich mit meinem Kopiloten Paul Zeise täglich um die Wette spielte.
Am 10.8.1973 stand der Motorsegler mit Heizung fertig vor der Werft und nach einem kurzen Werkstattflug ging es wieder Richtung Heimat. Das Tanken und die Zollabfertigung machten wir wieder in Nürnberg und Linz und landeten um 16 Uhr am Flugplatz in Bad Vöslau.
Ich war sehr stolz, diesen Langstreckenflug in mein Segelflugbuch eintragen zu können. Leider gibt es dieses Zeitdokument nicht mehr, da es mir 1987 in einem Hotel in Amsterdam gestohlen wurde.
Story #5: im Scheibe Motorfalke SF25C vor dem Abflug am 4.8.1973
Story #5: vier glückliche Piloten nach der Landung in Dahlemer Binz
6. Modellfliegen im Militärgefängnis
Da ich bei der Musterung bereits einen Flugschein besaß, wurde ich für die Ableistung des Präsenzdienstes zu den Luftstreitkräften eingezogen. Nach dem Grundwehrdienst am Fliegerhorst Hörsching kam ich zum Militärflugplatz Langenlebarn. Von dieser Basis aus erfolgten die Einsätze auf den Außenlandeplätzen, aber auch die Ausbildungen.
Eine dieser Ausbildungen war der Flieger-Fernmeldekurs am Fliegerhorst Graz-Thalerhof. Er dauerte einen Monat und ich freute mich, dass ich ihn als Kursbester abschließen konnte. Umso größer war die Enttäuschung, als ich am Freitag wieder in die Kaserne in Langenlebarn kam und mich nicht auf der Urlaubsliste für das Wochenende fand.
Es war nicht nur ich, der fehlte, sondern es waren alle 32 Kursteilnehmer, die sich vergeblich am Schwarzen Brett suchten. Offensichtlich hatte man uns vergessen. Nach einigen Minuten ärgern fassten nahezu alle den Plan, einfach ohne Genehmigung die Kaserne zu verlassen. Die Kontrollen waren üblicherweise sehr locker und es war unwahrscheinlich, dass wir auffielen. Wir warteten, bis es dunkel wurde. Dann robbten wir durch ein bekanntes Fluchtloch im Zaun in die Freiheit.
Leider war genau an diesem Wochenende eine Kontrolle. Jene Kameraden, die telefonisch erreicht werden konnten, kamen noch am Samstag in die Kaserne. Ich war bei den etwa 10 Soldaten, die nicht erreicht wurden und kam erst am Sonntag zurück.
Alle, die erst am Sonntag zurückkamen, waren somit mehr als 24 Stunden ohne Genehmigung außerhalb der Kaserne. Dies bedeutet ein militärisches Strafverfahren. Beim Rapport am Montag wurden wir diesbezüglich vom Kompaniekommandanten belehrt.
Einige suchten Zeugen, um das Einrücken am Samstag zu beweisen. Mir war das zu kritisch und außerdem wollte ich keinen meiner Kameraden zum Lügen überreden. Also sagte ich wahrheitsgemäß, wann ich die Kaserne verließ und wann ich wieder zurückkam. Mein Hauptmann pfiff durch die Zähne, ob der Ehrlichkeit. Er schaute sich mein Kursergebnis an und entschied dann für eine Disziplinarstrafe. Das waren zwar auch noch drei Tage Gefängnis, aber es blieb mir eine Meldung an den Staatsanwalt erspart.
Beim Haftantritt erfolgte das Prozedere für Häftlinge. Man nahm mir den Gürtel, die Schnürriemen und alle Tascheninhalte ab. Alles wurde sorgfältig protokolliert und ich bekam eine Bestätigung darüber. Dann ging es ab in die Zelle. Die Einrichtung war sehr spartanisch. Ein Sessel, ein Tisch und eine Holzpritsche, sonst nichts. Zum Zeitvertreib faltete ich aus der Bestätigung einen Papierflieger. Er war bestens geeignet, um aerodynamische Versuche zu machen. Auch bestimmte Flugwege und Ziellandungen konnte ich damit stundenlang üben.
Plötzlich hörte ich am Gang vor der Zelle eine laute Stimme. Es war der kontrollierende Offizier, welcher meinen Zellennachbar völlig betrunken vorfand. Da in der Zelle nichts zu finden war, begann die Suche nach der Alkoholquelle. Es dauerte nicht lange und es wurde ein Doppelliter Wein im Spülkasten des WCs gefunden. Mein Nachbar hatte einen der Wachen überredet, die Flasche dort zu verstecken. Bei jedem Gang zum WC nahm er einen kräftigen Schluck des gekühlten Weines.
Wutentbrannt setzte der Offizier seine Kontrollen fort und kam in meine Zelle. Mit einem forschen „MELDUNG!“ gab er den Befehl, dass ich den vorgesehenen Bericht abgebe. Ich sagte daher: „Herr Leutnant, Flieger Gruber in Disziplinarhaft wegen unberechtigten Verlassens der Kaserne“.
Mit stechendem Blick schaute er sich in der Zelle um und bemerkte mein Flugzeug am Tisch. Mit weit aufgerissenen Augen schrie er mich an: „Was soll das? Geben Sie mir das!“
Mit einem Gefühl zwischen Angst und Triumph sagte ich: „Melde gehorsam, das ist die Bestätigung über die abgenommenen Sachen.“
Nach einer kurzen Nachdenkpause drehte er sich wortlos um, verließ meine Zelle und knallte wütend die Zellentür zu. Ich setzte grinsend meine Flugversuche fort. Irgendwie erinnerte mich das Ganze an die Geschichten des braven Soldaten Schwejk.
Wir waren insgesamt fünf Kameraden im Gefängnis. Mehr Zellen gab es in Langenlebarn nicht. Unsere Gruppe kam am 31.12.1973 wieder raus und hatte somit einen Grund mehr, den Silvester ordentlich zu feiern.
Der Gefängnisaufenthalt hatte auch Vorteile. In den drei Tagen brauchten wir nicht zu exerzieren, es wurde uns das Essen gebracht und warm war es auch. In unserer normalen Unterkunft hatte es kaum über 15 Grad Celsius und das Gefängnis war der wärmste Platz am ganzen Fliegerhorst. Der einzige Nachteil war die 6-monatige Beförderungssperre. In meinem Fall wurde sie aber bald wieder aufgehoben, weil ich Ausbildner wurde und daher einen höheren Rang bekommen musste.
Story #6: mein „Modellflugzeug“ im Militärgefängnis
7. Rauch im Cockpit
In einem Cockpit kann es zu zahlreichen unvorhergesehenen Problemen kommen. Bei der Unterhaltung mit Freunden wurde ich oft gefragt: Was machst du bei einem Triebwerksausfall? Dieses Problem hört sich zwar dramatisch an, ist aber bei kommerziell eingesetzten Flugzeugen der geringste Anlass zur Sorge. Es gibt dafür genaue Verfahren und Tabellen. Die Bestimmungen schreiben vor, dass ein Flugzeug bei einem Triebwerksausfall während des Starts entweder sicher auf der Startbahn stoppen oder sicher weitersteigen können muss. Diese Verfahren werden alle sechs Monate im Simulator trainiert und geprüft.
Ein weit größeres Problem ist Rauch oder Feuer während des Fluges. Solche Ereignisse sind schon bei Zügen, Schiffen oder Fahrzeugen höchst problematisch, bieten aber dort die Möglichkeit stehenzubleiben und zu evakuieren. Bei einem Flugzeug sieht das ganz anders aus. Für das Evakuieren muss gelandet werden, was je nach Position und Flughöhe sehr lange dauern kann. Der ungünstigste Fall ist, wenn das Flugzeug über dem Meer auf Reiseflughöhe und weit weg von einer Landemöglichkeit ist.
Die Statistik zeigt einen eindrucksvollen Wert. Vom ersten Anzeichen eines Feuers oder Rauches bis zur Evakuierung hat man durchschnittlich nur 17 Minuten Zeit. Nach dieser Zeit ist die Besatzung nicht mehr in der Lage, das Flugzeug zu steuern bzw. hat es derart große Schäden, dass es nicht mehr zu steuern ist und abstürzt.
Mein Erlebnis mit Rauch ging zum Glück gut aus. Es war Anfang der 70er Jahre, mit einem Motorsegler der Type Scheibe SF25C am Flugplatz Bad Vöslau. Das Flugzeug kam gerade aus der Wartung und es war ein Werkstattflug zu machen. Der Vorteil eines derartigen Fluges war, dass er mir nicht verrechnet wurde. Als Student kamen mir solche Flüge daher immer sehr gelegen.
Ich war allein an Bord und rollte zur Startbahn. Alles funktionierte bestens und alle Anzeigen im Cockpit waren im grünen Bereich. Nach dem Vollgas war ich aufgrund des geringen Gewichts sofort in der Luft. Plötzlich kam aus dem vorderen Cockpitbereich dunkler Rauch, welcher sich in meiner Nase mit einem beißenden Geruch bemerkbar machte. Binnen weniger Sekunden war das ganze Cockpit voll mit Rauch und ich konnte kaum mehr atmen.
Um Frischluft in das Cockpit zu leiten, öffnete ich das Seitenfenster und hielt die Hand raus. Dies half sehr, den misslichen Zustand erträglicher zu machen. Über Funk meldete ich den Notfall und leitete sofort die Rückkehr zum Flugplatz ein.
Es dauerte etwa eine Minute, dann wurde der Rauch wieder weniger und kurz darauf verschwand er gänzlich. Nur der unangenehme Geruch blieb noch länger. Der vierminütige Flug hat zwar mein Flugstundenkonto nicht sehr vergrößert, aber ich war heilfroh, dass alles gut ausgegangen ist. Eine Überprüfung des Flugzeugs ergab, dass bei der Wartung Öl in den Heizkreislauf kam. Als der Motor im Steigflug auf voller Leistung war, erhitzte der Auspuff das Öl, ließ es verdampfen und in das Cockpit strömen.
8. Mit wenig Geld zum Privatpilotenschein
Mit der Erlangung des Segelflugscheins im Jahr 1971 war das nächste logische Ziel der Privatpilotenschein (PPL). Allerdings war ich dabei mit meinem größten Problem konfrontiert: Ich hatte kein Geld. Beim Segelflugschein konnte ich die geforderten Flugstunden zum Großteil mit Arbeitsstunden verdienen, beim PPL gab es diese Möglichkeit leider nicht. Erschwerend kam dazu, dass zum Erlernen der Theorie ein teurer Kurs besucht werden musste; beim Segelflugschein ging das noch im Selbststudium.
Auch die 40 Flugstunden waren für mich unerschwinglich. Hier kam mir aber eine Gesetzesänderung zugute, welche die im Motorsegler geflogenen Stunden anrechenbar machte. Diese waren preislich viel günstiger und außerdem durfte ich damit schon Passagiere mitnehmen, welche zum Großteil die Kosten übernahmen. Ich habe mit dem Genuss zu fliegen geworben, wo es nur ging, und in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis gab es wenige, die ich nicht dazu überreden konnte. Sogar meine Mutter mit ihrer großen Flugangst setzte sich tapfer zu mir in das kleine Flugzeug.
Ich hatte zwar wenig Geld, aber dafür viel Zeit. Dies ermöglichte mir, jedes Wochenende am Flugplatz zu sein. Es kamen immer wieder neugierige Zuschauer, welche man zu einem Rundflug animieren konnte. Ich hatte dabei sogar einen Stammkunden. Es war ein Bauer aus dem Nachbarort und er liebte es, mindestens einmal im Monat sein Anwesen von oben zu sehen. Einziges Problem war sein Verhalten.
Er kam ausschließlich schwerstens betrunken und mit voller Blase. Vor dem Fliegen stellte er sich daher pinkelnd neben das Flugzeug, um sich zu entleeren. Aufgrund seiner Alkoholisierung hatte er sich nur bedingt im Griff. So kam es immer wieder vor, dass er das Hosentürl wieder zumachte, obwohl er mit dem Pinkeln noch gar nicht fertig war. Das Ergebnis war ein ungeheuerlicher Gestank im Cockpit. Der Vorteil für mich war, dass sonst keiner mit ihm fliegen wollte und ich daher alle seine Flüge bekam.
Alle diese Flüge mit dem Motorsegler kamen mir als Privatpilotenschüler sehr entgegen und es war daher kaum mehr etwas Neues zu lernen. Sowohl die Bedienung des Motors, das Rollen am Boden als auch das Platzrundenfliegen kannte ich von meinen Flügen mit dem Motorsegler. So war es nicht sehr verwunderlich, dass mein Fluglehrer Karl Bohuslavizki bereits nach der 6. Landung sagte: „Du kannst das eh, ich steige jetzt aus und du fliegst allein.“ Ich war darüber mächtig stolz, normalerweise benötigt ein Schüler mindestens 70 Landungen mit dem Fluglehrer, bevor er allein fliegen darf.
Nach dem Alleinflug gab es noch einige Pflichtübungen. Da war unter anderem der Höhenflug, den ich ebenfalls mit dem AUA-Kapitän Bohuslavizki flog. Man musste dabei mindestens 30 Minuten in einer Höhe von wenigstens 3000 m fliegen. Den Alpen-Einführungsflug flog ich mit einer Piper PA-18; mein Fluglehrer dabei war Peter Lambert, mehrfacher Staatsmeister im Motorkunstflug.
Gerüstet mit allen Voraussetzungen wurde ich am 27.10.1975 dem Prüfer Karl Zimmermann für die Privatpilotenprüfung zugeteilt. Nach der bestandenen Theorieprüfung galt es, die praktische Prüfung zu bestehen. Dabei war auch ein Navigationsflug zu machen und den kleinen Ort Wiesmath in der Buckligen Welt zu finden. Das war gar nicht so einfach. Dort schaut ein Hügel aus wie der andere, und es gibt weder eine Bahntrasse noch einen größeren Fluss, an dem man sich orientieren kann.
Obwohl die ganze Ausbildung nur für Sichtflug war, beschäftigte ich mich bereits sehr früh mit dem Instrumentenflug. Dabei fand ich heraus, dass Wiesmath genau auf dem 180-Grad Leitstrahl des Funkfeuers Sollenau lag und stellte daher schon vor dem Prüfungsflug die Frequenz und den Leitstrahl im Flugzeug dafür ein. Während des Prüfungsfluges schielte ich mit einem Auge auf die Anzeige, um ihr zu folgen. Nach Ablauf der vorberechneten Zeit war ich genau über Wiesmath und bestand auch die Praxisprüfung. Ich denke, ich hätte aber das Ziel auch ohne den Leitstrahl gefunden.
Story #8: als Privatpilot in einer Piper PA-18 am Flugplatz Kottingbrunn
Story #9: Freundin und Mutter beim Flicken des Schleppbanners
9. Bannerschlepp – Der verhakte Haken
Vermutlich hat jeder schon einmal einen Bannerschlepp am Himmel gesehen. Banner werden grundsätzlich für Werbung verwendet, vereinzelt aber auch für andere Zwecke. So kann man unter anderem publikumswirksam seiner Angebeteten zum Geburtstag gratulieren.
Ein Banner besteht aus Schnüren, auf denen die Buchstaben oder ein Logo aufgenäht sind. Die einzelnen Teile werden verknüpft oder mit Stangen verbunden. Die vorderste Stange hat unten ein Gewicht, damit das Banner im Fluge vertikal steht.
Ein Start oder eine Landung mit dem Banner würde es zerstören, man muss es daher im Fluge aufnehmen und vor der Landung abwerfen.
Die Aufnahme erfolgt mit einem dreiarmigen Haken, welcher an einem ca. 10 m langen Seil befestigt ist. Das Seil wird in die Schleppkupplung am Heck des Luftfahrzeugs eingeklinkt. Damit der Haken beim Start nicht hinter dem Flugzeug her hüpft und es möglicherweise beschädigt, nimmt man ihn in das Cockpit und wirft ihn nach dem Start zum Fenster raus (man überprüft übrigens sehr sorgfältig, ob das Seil eh hinten eingeklinkt ist).
Das Banner hat vorn eine ca. 15 m lange Seilschlaufe. Diese wird auf zwei 4 m hohe Stangen gelegt. Die Kunst besteht darin, mit dem Flugzeug in einer Höhe anzufliegen, dass der Haken die Schlaufe von den Stangen aufnimmt. Das Banner wird dabei durch Hochziehen des Flugzeuges, entgegen der Flugrichtung, vom Boden abgerollt. Es darf keinesfalls am Boden schleifen.
Das Können, genauer gesagt das Nichtkönnen des Piloten ist durch die Anzahl der Fehlanflüge für alle Zuseher gut sichtbar. Fliegt man zu tief an, verhängt sich der Haken ständig im Boden und hüpft unkontrolliert hinterher.
Des Weiteren birgt ein zu tiefes Anfliegen die Gefahr, dass man das Banner anstatt mit dem Haken mit dem Fahrwerk aufnimmt. Das