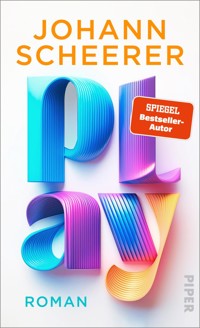9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie geht independent, wenn man ständig bedroht und bewacht wird? Ein Leben im Ausnahmezustand, das verheimlicht werden muss und etliche Lügen nach sich zieht "Ich musterte mich im Spiegel: Sondereinsatzkommandostiefel kombiniert mit einer weißen Jeans, wie sie Farin Urlaub auf einem BRAVO-Poster anhatte, darüber ein muffeliges Pornostar-T-Shirt und eine Militärjacke, die zu sauber aussah, um als linkes Statement zu gelten." Dieser Coming-of-Age-Roman ist eine Offenbarung: Nie ist auf so selbstironische und komische Art über den Wunsch nach Freiheit und Normalität geschrieben worden. Während zu Hause nichts mehr ist wie früher, aber keiner darüber spricht, kann Johann keinen Schritt vor die Tür setzen, ohne ihn vorher anzukündigen. Sobald er im Freien ist, steht er unter Beobachtung. Genau diese Überwachung muss er aber vor Freunden, in der Schule, bei Nebenjobs und Dates und auf Partys verheimlichen. Das scheint sogar zu gelingen, er findet eine Freundin, probt mit seiner Band und bekommt einen Plattenvertrag. Aber er gerät ständig in groteske und peinliche Situationen, weil er gezwungen ist, unehrlich zu sein. Die Ausreden, Halbwahrheiten und Notlügen drohen ihn zu erdrücken. Kann er diesem Lügenleben entkommen? Coming-of-Age unter Extrembedingungen, getrieben von massivem Freiheitsdrang »Berührend und mit lakonischem Witz.« 3sat Kulturzeit
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum ePUB
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher: www.piper.de/literatur
© Piper Verlag GmbH, München 2021
Covergestaltung: zero-media.net, München
Coverabbildung: privat und FinePic®, München
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Epilog
Für die, die wissen, wie es war.
Prolog
»Das macht 2459,70 Euro.«
Ich sah den Typ im verdreckten Blaumann an. Das gefaltete Papier zog eine Schneise in den dunklen Staub, als er mir die Rechnung über den Tresen schob.
»Das sind dann ja …«, ich überschlug die Zahl und setzte neu an: »Sind das 5000 Mark?«
Ich blickte ungläubig durch die Seitenscheiben des hellblauen Volvos meiner Mutter, der neben uns auf der heruntergefahrenen Hebebühne stand. Die Stelle an der Rückseite der Kopfstütze des Fahrersitzes, die ich bei einem kindlichen Anfall von Wut und Langeweile, weil irgendwas nicht so schnell gegangen war, wie ich es gern gehabt hätte, von der Rückbank aus herausgebissen hatte, war gut zu erkennen. Der Schaumstoff hatte sich über die Jahre gelb verfärbt und bröselte in den Fußraum. Diese Kopfstütze, dachte ich, hatten sie offensichtlich nicht repariert.
»Allein 800 Euro für die Kabel«, der Mechaniker hinter dem Schreibtisch zeigte mit seinen öligen Fingern auf die einzelnen Positionen der Rechnung, »1443 Euro für die Arbeitsstunden«, er betonte das Wort Euro so deutlich und doch so beiläufig, als wäre die Währung schon immer da gewesen und nicht erst wenige Tage alt. »Wir mussten ja die ganze Verkleidung abnehmen, um von der zusätzlichen Batterie von vorne ganz nach hinten durchzukommen.«
Ich wusste überhaupt nicht, wovon er sprach.
»Zwei Knöpfe, eine Birne und Fassung, Ölwechsel, alles einmal durchgecheckt.« Er zuckte mit den Schultern und deutete auf die Gesamtsumme. »EC oder bar?« Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Ich hatte den Volvo meiner Mutter in die Werkstatt gebracht, weil ich übermorgen, wenige Monate nach dem Ende des Zivildienstes, den ich direkt nach meinem Abitur im Jahr 2002 angetreten hatte, von Hamburg nach München fahren wollte und von dort mit der Bahn weiter nach Italien. Mit meinem noch frischen Führerschein wollte ich das erste Mal 1000 Kilometer am Stück fahren. Den endlosen Diskussionen mit meiner Freundin Svenja entkommen und allein, nur in Begleitung eines Stapels CDs, einfach mal weg. Testament der Angst von Blumfeld, Bleed American von Jimmy Eat World, Das grüne Album von Weezer, The Strokes’ Is This It,White Blood Cells von den White Stripes, Runter mit den Spendierhosen, Unsichtbarer! von Die Ärzte und natürlich Toxicity von System Of A Down. Und auch wenn ich das Stück Neue Zähne für meinen Bruder und für mich immer skippte, hatte ich noch Wasser marsch! von Superpunk eingepackt.
Ich wollte, begleitet von diesem phänomenalen Soundtrack, im Frühjahr 2003 die Freiheit genießen. Nichts muss, aber alles kann. Meine Mutter fuhr nur noch selten selbst. Seit ein paar Jahren musste sie gefahren werden, und so hatte sie mir erlaubt, ihren Volvo, der die meiste Zeit in der Garage stand, für ein paar Wochen auszuleihen. Sie hatte allerdings darauf bestanden, dass ich ihn vorher durchchecken ließ. Damit er auch bremst, wenn er soll, hatte sie gesagt. Und nun sollte ich 5000 Mark für diesen Check bezahlen? Ich bekam kein Taschengeld mehr. Aber ich konnte von den früheren Einkünften unserer Band ganz gut leben. Trotzdem waren 5000 Mark, ich meine 2459,70 Euro, deutlich mehr, als ich eingeplant hatte.
Ich holte Luft. »Eigentlich wollte ich doch nur die Bremsen checken lassen«, sagte ich vorsichtig und blickte erneut, diesmal aber leicht nach vorn gebeugt, zum Auto, als könnte ich so erkennen, ob die Bremsen neu wären.
»Yo. Steht hier auch: ›Test Bremsbeläge‹ – war alles gut. EC oder bar?«
Langsam richtete ich mich wieder auf und schaute den Mechaniker an. »Wieso mussten Sie dafür die gesamte Verkleidung des Innenraums rausnehmen?«
Er wirkte genervt. »Mensch, Junge, Markus hatte angerufen und gesacht, dass wir die Knöppe hier auch noch machen sollen. Wie bei den anderen Fahrzeugen.«
Ich stand auf dem Schlauch. »Wer ist Markus?«, fragte ich.
»Markus!« Er sagte den Namen etwas lauter, wohl in der Annahme, er würde den Groschen mittels Schalldruck zum Fallen bringen.
Ich zuckte mit den Schultern.
»Markus – Mensch, wie heißt der noch mit Nachnamen?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
Der Mann blätterte in seinen Unterlagen und seufzte. »Da. Markus … Kramer!«
»Ach so. Eine Sekunde bitte.« Ich zog mein Nokia 3310 aus der Hosentasche. Mit zwei Tastendrücken kam ich zum Adressbucheintrag »aaaaaaaaaaaaa« und wählte. Mit dem Handy am Ohr ging ich vor die Tür. Es meldete sich sofort jemand. »Zentrale, hallo?«
»Moin, hier ist Johann, ist Herr Kramer da?«
»Der müsste eigentlich direkt bei dir vor der Werkstatt sein.«
Ich blickte mich um. Kramer kam auf mich zu. Er war nur noch wenige Meter von mir weg. »Alles klar. Danke«, sagte ich in den Hörer und legte auf.
»Moin!«, grüßte ich ihn.
»Alles okay hier bei dir?«, fragte er mich freundlich. Seine schwarze Funktionsjacke, die gerade so seine Hüften bedeckte, trug er offen, obwohl es nur wenige Grad plus hatte. Darunter ein ebenfalls offenes, dickes Karoflanellhemd und darunter eine Schicht, die ich als Skiunterwäsche identifizierte. Das perfekt-unauffällige Outfit, mit dem er für alle Witterungsverhältnisse gewappnet war.
»Ja, alles okay«, antwortete ich beiläufig, »haben Sie mit der Werkstatt irgendwas besprochen?«
Kurz sah er mich an, als wüsste er nicht, was er sagen sollte, doch dann legte er umso schneller los. Seine militärisch gedrillte Sprache, die es schaffte, sogar den unbetonten Wörtern im Satz eine abgehackte Betonung zu geben, schoss auf mich ein. »Du fährst die Woche auf deine Tour, und da wollten wir nur sichergehen, dass wir quasi mit an Bord sind. Wir haben noch zwei Features installiert.« Er sagte wir, als hätte er die Arbeiten selbst durchgeführt. Deine Tour, hallte es in meinem Kopf nach. Ein Teil meines Privatlebens, ein simples Vorhaben, stand vermutlich schon irgendwo auf einem Plan als übergeordneter Punkt einer langen Liste von kryptischen Unterpunkten. Während er sprach, bewegte er sich zum Eingang der Autowerkstatt. Ich würde es nicht verhindern können, dass wir gemeinsam den Raum betraten und der Mechaniker denken müsste, dass ich mir Hilfe geholt hatte. Peinlich. Leider entsprach es noch dazu der Wahrheit.
Kaum war der Satz gesprochen, waren wir auch schon drin, und Kramer winkte dem Mechaniker freundschaftlich zu. »Moin, Frank, alles im Lack?«
»Klar«, antwortete der Mechaniker, der offenbar Frank hieß, »ich schnurr wie geschmiert. Normalzustand.«
Kramer grinste ihn an und sagte: »Zeig mir doch mal deinen Bierdeckel.«
Mit einem Kopfnicken zeigte Mechaniker-Frank Richtung Tisch, und Kramer nahm die Rechnung. Er fuhr mit seinem Zeigefinger über die aufgelisteten Positionen. »Ach so, ja, genau: Wir dachten, es macht Sinn, wenn wir vorne ’nen Überfalltaster einbauen.« Ich atmete tief ein, doch mein Magen zog sich trotzdem unangenehm zusammen. »Da kannste dann im Fall der Fälle direkt mit dem Knie gegendrücken. Müsste von der Höhe her hoffentlich passen.« Hoffentlich?, dachte ich kurz, konnte aber keinen klaren Gedanken fassen. Verstohlen blickte ich mich in der Werkstatt um. Ich hatte das Gefühl, dass Kramer wahnsinnig laut redete. »Und dann dachten wir, es wäre irgendwie am falschen Ende gespart …« Auf einmal wirkte es so, als würden die Wände der Werkstatt über mich hinauswachsen. Hoch in den Himmel. Ich fühlte, wie ich immer kleiner wurde und nur noch mein pochendes Herz, groß wie ein aufgeblasener Airbag, zwischen den kilometerhohen schmutzigen Autowerkstattwänden immer stärker und lauter schlug, während die Stimme von Kramer in ohrenbetäubender Lautstärke fortfuhr, als er lachend sagte: »… sozusagen buchstäblich am falschen Ende gespart, wenn du verstehst, was ich meine, wenn wir im Kofferraum nicht auch einen Notfalltaster anbringen.« Er nickte aufmunternd mit dem Kopf, während er diese letzten Worte sprach, als wollte er mich zum Mitlachen auffordern. Als wäre das alles ein großer Spaß. Ein tolles gemeinsames Hobby, das aber mein Leben war.
Ich sah ihn an. Kniff einmal die Augen zusammen und wischte heimlich meine mittlerweile schweißnassen Handflächen an meiner Jeans ab. Ich blickte hinüber zum hellblauen Volvo. Mein Blick fiel auf den Kofferraum.
Kramer, der meinem Blick folgte, ging ein paar Schritte zum Auto und öffnete die Heckklappe. »Hier.« Er deutete auf einen schwarzen Knopf in der Verkleidung des Kofferraums und dann zu einem weiteren Schalter. »Und hier haben wir ’ne kleine Lampe eingebaut. Die hat ’ne extra Batterie, dass man die anmachen kann, wenn das Auto nicht läuft. Der Schalter dafür ist hier.« Er zeigte auf einen weiteren Knopf und schlug dann die Klappe zu. »Kann losgehen, oder? Mensch, ich erinner mich noch dran, als ich jung war. Direkt nach der Schule bin ich auch erst mal weg. Das wird bestimmt ein super Trip. Mit dem Fahrzeug gleitest du jetzt direkt in die Freiheit.«
Ich sah ihn an. Er blickte auf die Tüte von WOM mit den CDs in meiner Hand. »Soll ich die mal in den Wechsler laden, während du zahlst? Ich kann dich echt gut verstehen. Endlich mal richtig weit weg nach dem ganzen Stress. Würd ich genauso machen. Na ja …«, er lachte, »ich komm ja auch irgendwie mit.« Das Fahrzeug. In die Freiheit gleiten. Der Stress im Zivildienst. Der war vorbei. Da hatte er recht.
Wortlos reichte ich ihm die Plastiktüte. Mechaniker-Frank, der die ganze Zeit in Hörweite von uns gestanden hatte, kam, als hätte er das Stichwort für seinen Auftritt gehört, wieder zum Tisch. »Bar oder EC?«
1.
Wir waren direkt nach der Freilassung meines Vaters im April 1996 nach New York geflüchtet. Amerika bot uns Anonymität und die Gewissheit, nicht verfolgt zu werden. Weder von Verbrechern noch Trittbrettfahrern noch Journalisten. In Hamburg-Blankenese wurden unsere beiden Häuser, die Gärten und die Straße, die diese verband und in der ich aufgewachsen war, auf der ich Fahrrad und später Skateboard fahren gelernt hatte, auf unsere Rückkehr vorbereitet. Ich wusste nicht, was sich verändern würde, geschweige denn wie genau. Meine Eltern hatten von mir gänzlich unbemerkt Pläne gemacht, die in unserer Abwesenheit umgesetzt wurden. Mir war klar, ich fühlte es ja, dass wir alle drei ein, wie es im Fachjargon hieß, erhöhtes Sicherheitsbedürfnis hatten. Mir war nicht klar, wie die Veränderung von Äußerlichkeiten zu einer inneren Ruhe führen sollte. Ich vertraute meinen Eltern und den Menschen, denen sie vertrauten, und war froh, dass ich mich selbst um gar nichts kümmern musste.
»Wir werden erst mal für einige Zeit Sicherheitsleute haben müssen.« Diesen Satz meiner Eltern, wie nebenbei während einer Taxifahrt in Manhattan geäußert, wälzte ich erst mal in meinem Kopf herum. Meinten sie wirklich Bodyguards? Bruchstückweise erinnerte ich mich an das private Sicherheitsunternehmen, das in den letzten Wochen der Entführung die Geldübergabe erfolgreich an der Polizei vorbei organisiert hatte. »Sind das die Geldübergabeleute?«, fragte ich meine Mutter, während ich weiterhin aus dem Seitenfenster sah, in dem sich verschwommen ihr Gesicht spiegelte. Sie nickte. »Ja, die werden bei uns zu Hause ein paar Kameras und wohl auch einen Zaun aufstellen«, sie holte tief Luft, »müssen. Und dann werden die uns wohl auch erst mal begleiten, wenn wir irgendwo hingehen.« Meine Mutter atmete hörbar und kontrolliert aus. Ein Seufzer, der keiner werden durfte.
Wie sollte das denn funktionieren? Welche Frage stellte ich jetzt am besten? Ich war hin und her gerissen zwischen Panik und einer sich unangemessen anfühlenden Vorfreude. Eine sich in meinen Magen fressende brennende Unsicherheit wich einer aufgeregten Mischung aus Angst und unterdrückter Hysterie. Ich würde jemand mit Bodyguards sein.
Ich schaute aus dem Fenster des Taxis auf die langsam grün werdenden Bäume des Central Park. »Was haben die denn dann an?«, fragte ich in die Stille. »Und wie …?« Ich brach die Frage ab, weil ich vergessen hatte, wie sie weitergehen sollte. Aus den Augenwinkeln erkannte ich meine Eltern. Wir saßen alle drei auf der Rückbank. Sie sahen sich an. Dann sah meine Mutter zu mir, und ich drehte den Kopf auch in ihre Richtung. Sie sagte nichts. Schüttelte fast unmerklich den Kopf und zuckte kurz mit den Schultern. »Ich glaub, ganz normal.«
2.
Vom Flughafen in Hamburg holten uns einige Wochen später zwei fremde Männer ab. Daraus, dass sich die Männer und meine Eltern vor dem Flughafen zielsicher aufeinander zubewegten, schloss ich, dass sie sich schon mal gesehen hatten. Die beiden Männer nickten mir zu, und ich streckte ihnen die Hand hin. »Moin, Johann.« Sie kannten also meinen Namen. »Moin«, nuschelte ich. Soweit ich das beurteilen konnte, sahen sie wirklich ganz normal aus. Um nicht zu sagen unauffällig. Der eine trug einen Anzug ohne Krawatte mit einer leichten schwarzen Jacke darüber und stellte sich als Herr Jürgens vor. Den Namen des anderen hatte ich nicht verstanden und traute mich nicht nachzufragen.
Als wir in unsere Straße einbogen, waren die Autos mit den Journalisten verschwunden. Stattdessen standen hier, Stoßstange an Stoßstange, Autos von Objekt- und Personenschützern.
Im Auto hatte ich dem Gespräch von Jürgens mit meinen Eltern gelauscht, während ich so tat, als ob mich das alles gar nichts anginge. »Der Umbau des Gästehauses ist in vollem Gange. Die Kameras sind großteilig gestellt, und der Zaun ist auch in Arbeit. Bis die Einsatzzentrale fertiggestellt ist, wird es allerdings noch ein paar Wochen oder schlimmstenfalls Monate dauern. Bis dahin stehen die Herren mit ihren Privatwagen an der Straße.«
»Haben Sie eigentlich mit den Nachbarn gesprochen?«, fragte meine Mutter, während mein Vater nervös an seinem Daumennagel kaute.
»Nein, Frau Scheerer. Wir wollten niemanden aufschrecken. Ich dachte, es ist angemessener, wenn Sie das übernehmen.«
Meine Mutter nickte. Ich blickte zu meinem Vater und wartete, dass dieser Jürgens fragte, ob jemand schon mit dem Sohn gesprochen habe. Aber den wollte vermutlich auch niemand aufschrecken. Er blickte nur nach vorn. Für den Rest der Fahrt wurde kein Wort gesprochen. Weder wusste ich, welche Fragen zu stellen waren, noch hätte ich sie stellen wollen, während jemand Fremdes dabei zuhörte.
Ich wusste, wie sehr meinen Vater der Anblick dieser vielen Autos in unserer Straße schmerzte. Ich blickte auf die Einfahrt zu unserem Grundstück. Seinen Volvo hatte er bis vor Kurzem immer in die Garage gestellt. Nicht, um ihn zu schonen, sondern um ihn nicht sehen zu müssen.
Als wir aus dem Auto ausstiegen, sagte Jürgens schnell: »Vielleicht ist es eine gute Idee, einen Teil Ihres Gartens, Herr Reemtsma, um einen Carport zu ergänzen. Die Kollegen haben mir berichtet, dass ein Nachbar in den letzten Tagen Schwierigkeiten hatte, aus seiner Ausfahrt herauszukommen.«
»Einen Carport?« Mein Vater betonte das Wort, als würde es sich um einen eiternden Abszess handeln, den man nicht ergänzen, sondern ganz sicher entfernen sollte. »Sie meinen einen Parkplatz, oder was? In meinem Garten?«
Jürgens schien das Problem nicht sofort zu erkennen. »Wir würden diesen Hang hier«, er zeigte auf einen verwilderten Abhang, ein paar Meter von uns entfernt, hinter dem Gartentor, »begradigen, diese Bäume wegnehmen und ein Gitter auf Stahlstelzen in den Hang bauen. Ein einfaches Dach sollte ausreichen. Dann wäre da Platz für sechs Pkw. Die Stahlkonstruktion hält ewig. Da muss man dann nie wieder ran. Nicht in den nächsten hundert Jahren zumindest.«
Er lachte. Ich erinnerte mich an den Satz meiner Mutter. »Wir werden für einige Zeit erst mal Sicherheitsleute haben müssen.« Einige Zeit. Hatte sie den Zeitrahmen unbewusst offen gelassen, oder kannte sie ihn nicht? Bestand die Möglichkeit, dass das hier für immer würde bleiben müssen? Dass man auch an diese Konstruktion nie wieder ranmüsste?
Als mein Vater nichts weiter erwiderte als ein gequältes, aber gerade noch freundliches Lächeln, reagierte Jürgens sofort: »Aber kommen Sie erst mal an. Die Kollegen sind darauf eingestellt, hier bis auf Weiteres am Straßenrand zu sitzen. Das ist kein Problem. Die haben alle schon Schlimmeres erlebt.« Wieder lachte er.
Dadurch erschien er mir ganz sympathisch. Er schaute mich an und zwinkerte mir zu. Dann schloss er die Tür auf und bedeutete uns hereinzukommen. Woher hatte er den Schlüssel? Wir waren Gäste im eigenen Haus.
»Wieso sollte man sich ein Auto in den Garten stellen?« Mein Vater hatte die Tür hinter uns geschlossen und blickte meine Mutter an, als könnte sie darauf eine Antwort geben. »Wozu hat man denn eine Straße?« Sie schmunzelte. »Vielleicht gehört das irgendwie zu deren Job? Nicht nur auf Menschen, sondern auch auf deren Sachen aufzupassen?« Aus ihrem Schmunzeln formte sich ein vorsichtiges Lächeln, das mein Vater nicht erwiderte. »Die wollen das für deren Autos bauen! Ich besitze nur ein einziges Auto, und das passt wunderbar auf den Parkplatz vor dem Tor oder ganz profan in die dafür vorgesehene Autogarage. Und jetzt sollen wir einen Zaun bauen lassen, damit deren Autos sicher in meinem Garten stehen können?« Ich seufzte hörbar, und meine Eltern blickten mich sofort beide an. »Meint ihr nicht, die wissen, was sie tun?«, fragte ich vorsichtig. Das Lächeln verschwand aus dem Gesicht meiner Mutter, und vorsichtig griff sie die Hand meines Vaters, der sie fest drückte. »Vielleicht muss man die jetzt einfach mal ihr Ding machen lassen?« Ich versuchte, meine Meinung als Frage zu betonen, und fast lautlos ergänzte ich: »Hat doch schon mal ganz gut geklappt.«
Am nächsten Morgen wurde ich von einem fremden Mann zur Schule gefahren. Wir wechselten kein Wort miteinander. Er aus Professionalität, das reimte ich mir zusammen. Ich aus Unsicherheit. Die fast schon freudige Aufregung der ersten Stunden wich einem seltsamen Unbehagen. Kein Gefühl, das einer Angst oder gar Panik ähnelte, mehr ein Gefühl, das meinen Körper in eine ständige angespannte Alarmbereitschaft versetzte. Mein Bauch war immer hart. Meine Kiefermuskeln immer zusammengepresst. Hier im Auto fühlte es sich an, als hätte ich Hemmungen, etwas anzufangen, für das es keinen Abschluss gab. Wenn ich jetzt begann, mit dem Mann, den ich nicht kannte, zu reden, was würde er mir mitteilen? Was könnte ich machen, wenn ich ihn nicht mögen würde? Hätte ich die Möglichkeit, ihn abzuwählen? Und selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich es mich trauen? Ich hatte Angst vor der neuen, unheimlichen Nähe zu diesen Fremden. Würde ich dieser Sicherheit jemals wieder entkommen können?
Ein paar Tage später saßen meine Eltern, Jürgens und ich in der Küche meiner Mutter, die noch vor ein paar Monaten eine verkabelte Einsatzzentrale gewesen war, und sprachen darüber, wie wir nun leben sollten. Immer wenn ich in die Ecken der Wohnküche schaute, erinnerte ich mich an die provisorischen Schlaflager der Angehörigenbetreuer.
»Ich weiß noch, wie ich einmal die schwarze Sporttasche mit dem Lösegeld versehentlich unter der Küchenbank hervorgezogen hab, weil ich dachte, es wäre mein Ranzen.« Ich versuchte, die Stille vor dem anstehenden Gespräch zu durchbrechen, und zeigte auf die Aktentasche von Jürgens, die jetzt an der gleichen Stelle stand. »Ich dachte grad, die steht da noch. Voll das optische Déjà-vu.« – »Na ja!«, fiel mir mein Vater fast ins Wort. Und etwas zu laut fuhr er fort: »Die ist jetzt ja eindeutig weg. Dafür bin ich hier.« Unter seinem Bart, der ihm in den 33 Tagen gewachsen war, zeichneten sich seine Kieferknochen ab, die fest aufeinanderbissen. Keiner lachte. Keiner sagte ein Wort. Würden wir ihm jemals von den manchmal heiteren, nahezu albernen Abenden, die sich auf bizarre Weise mit den scheußlichen, angsteinflößenden, grauenerregenden Abenden und Nächten abgewechselt hatten, erzählen können? Wie unplanbar, spontan und unerwartet immer alles gewesen war?
Nun war es wieder so schnell gegangen, wie es damals über uns hereingebrochen war. Wie wir mit Jürgens am Tisch saßen, fühlte sich das Haus schreiend leer an. Nur der zynische Satz meines Vaters hallte noch nach. Immer wieder fragte ich mich, ob mein Vater eigentlich wusste, wie es uns hier ergangen war, während er im Keller gefangen gehalten worden war. Ich wusste bislang kaum etwas über seine Situation. Es schien, als ob keiner von uns wüsste, wie man den Anfang machen könnte. Ich hoffte nur, dass Jürgens irgendeinen Plan hatte.
Als einer der beiden Chefs der privaten Sicherheitsfirma, wie es immer im Fernsehen hieß, stellte er uns anhand von Fotos die neuen Mitarbeiter vor und erzählte ein bisschen was über ihren Werdegang: Bundeswehr, Schießausbilder, Bombenkommando, Rettungssanitäter, Sonderkommando, Mossad, Auslandseinsatz, Personenschützer bei Familie XY. Seine Worte vermischten sich mit den Geräuschen der Baustelle um das Haus meiner Mutter.
»Das ist Herr Kramer. 34 Jahre alt. War lange bei der Bundeswehr.« Ta-ta-ta-ta-ta-ta!!! Mit Presslufthämmern wurden tiefe Löcher in den Boden gerammt, um den neuen zweieinhalb Meter hohen engmaschigen Zaun zu befestigen. »Herr Schmitt hier«, er tippte auf ein weiteres Foto, »war lange Zeit beim MEK. Danach Sonderkommando für …« Rattattattatta!! Die Straße und der Garten wurden aufgebrochen, um Kabel für die Kameras zu verlegen. »Die Herren werden zukünftig immer auch da sein, wo Sie sind. Bestenfalls teilen Sie ihnen vorher mit, was Sie vorhaben, damit sie sich darauf einstellen und entsprechende Maßnahmen ergreifen können.« Ich konnte dem Vortrag nicht mehr folgen. Ich hoffte, dass meine Eltern fragen würden, was für Maßnahmen das wohl sein würden, aber sie schwiegen, genau wie ich. Die Typen auf den Fotos sahen für mich alle gleich aus. Kurze Haare, ernster Blick. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Am Rande bekam ich ein paar Wortfetzen mit, die ich mir in den kommenden Tagen zusammenreimte.
Die Bewachungsmaßnahmen folgten einem ausgeklügelten und ineinandergreifenden System von etwa einem Dutzend Sicherheitsleuten, die abwechselnd für die Vor- und Nachaufklärung sowie die Begleitung von uns dreien zuständig waren. Das System basierte auf der Annahme, dass ein Entführer vor einer potenziellen Entführung das Opfer auskundschaften musste, um seine Gewohnheiten herauszufinden, so wie es die Entführer meines Vaters mit unserer Familie über Monate gemacht hatten. Man folgerte, es wäre nicht völlig unwahrscheinlich, dass wir beispielsweise morgens auf dem Weg zu meiner Schule in einen Hinterhalt geraten könnten. Diese Gefahr sollte mit der Voraufklärung – einer Person, die schon eine gewisse Zeit vorher »guckte, ob einer guckte« – und der Nachaufklärung, die sicherstellte, dass uns keiner hinterherfuhr, ausgeschlossen werden.
Es dröhnte in meinem Kopf. Ich dachte an die vielen Bandproben, die ich verpasst hatte. Kurz vor der Entführung hatte Daniel mich gefragt, ob ich nicht als Sänger und Gitarrist in die Band einsteigen wolle, die er mit Lenny und Dennis gegründet hatte. Das war fast ein Vierteljahr her. Ein Vierteljahr, in dem die drei wahrscheinlich schon zwanzig Mal geprobt hatten und ich meine Versuche, Gitarre zu üben, an einer Hand abzählen konnte. In den fünf Wochen der Entführung meines Vaters hatte ich natürlich nicht zur Bandprobe kommen können. Hatte sagen müssen, dass ich krank war. Hatten sie mich überhaupt vermisst? Danach flohen wir nach Amerika, und als ich wiederkam, war es schwierig, dort anzusetzen, wo ich meine Freundschaften verlassen hatte. Wie sollte ich ein Gespräch beginnen? Unsere Gemeinsamkeiten schienen angesichts der Unterschiedlichkeiten, die uns nun ausmachten, zu verblassen.
Es war Daniel, der schließlich den Kontakt suchte. »Ey, Digga. Wir wollen bald das erste Mal ins Studio gehen. Der Kumpel von Lenny, dieser Bela, hat doch so ein Studio in Langenhorn.«
»Bela?« Ich war gleich hellwach gewesen. »Bela von …«
»Jetzt flipp nicht gleich aus. Nein, natürlich nicht Bela B. von Die Ärzte, sondern Bela, der Freund von Lenny aus Langenhorn. Der heißt halt einfach Bela. So wie du Mongo heißt.«
Es war mir ein bisschen peinlich. Die anderen Jungs ritten immer wieder darauf herum, dass ich ausschließlich Die Ärzte hörte und nicht wie sie Tool, Pearl Jam, Rage Against The Machine oder zumindest Tocotronic. »Wenn wir das durchziehen wollen«, fuhr Daniel fort, »brauchen wir noch ein paar Songs. Bist du eigentlich noch am Start?«
Das war die Frage, die mich selbst umtrieb: War ich eigentlich noch am Start?
Wie sollte ich in all diesem Gedröhne eigentlich Songs schreiben?
»Hast du noch Fragen?«, durchbrach die Stimme von Jürgens das Wummern in meinem Kopf.
Ich blickte zu meinen Eltern und dann zu ihm. »Nö. Ich glaube nicht. Ist alles klar, glaube ich.«
»Okay«, erwiderte er freundlich lächelnd, »ansonsten habe ich dir meine Telefonnummer in das Handy eingespeichert.«
Als ich an das graublaue Nokia 1630 dachte, das er mir gestern gegeben hatte, und versuchte, mir ein Gespräch mit ihm vorzustellen, merkte ich, dass ich seinen Namen vergessen hatte. Ich nickte. »Alles klar. Ich ruf Sie an, wenn was ist.«
3.
Von diesem Tag an verwandelte sich jede bekannte Situation in eine völlig neue Erfahrung.
Sobald ich das Haus verließ, fuhr ein Auto vor. Als es das erste Mal passierte, erschrak ich noch über das schnell heranfahrende Auto in unserer sonst so ruhigen Straße. Aufgeregt öffnete ich die Beifahrertür. Der Mann am Steuer des schwarzen BMWs stellte sich mir vor: »Moin, Johann, ich bin Herr Schmitt. Nicht etwa Schmitts, wie manche denken.« Damit überreichte er mir eine Visitenkarte, auf der »Schmitts Sicherheit« stand. »Die Leute rufen mich immer an und begrüßen mich mit ›Hallo, Herr Schmitts‹, weil die nicht verstehen, dass der deutsche Genitiv keinen Apostroph hat. Die denken, ich heiße Schmitts. Dann erkläre ich denen immer ganz geduldig, dass Schmitts Sicherheit die Kurzform ist für Schmitt seine Sicherheit. Dann fällt der Groschen.« Ich blickte auf die Karte. Meine Aufregung war verflogen. Schmitt fuhr fort: »Kannst auch Holger sagen.«
»Guten Morgen, Herr Schmitts«, sagte ich und grinste ihn an. Ich wusste nicht, was ich mit der Karte machen sollte. Ich war vierzehn Jahre alt und hielt das erste Mal eine Visitenkarte in der Hand. Ich stellte mir vor, wie Schmitt in einem dunklen Büro für Privatdetektive sitzt und Anrufe entgegennimmt. »Schmitt seine Sicherheit« steht auf der Milchglasscheibe seiner Bürotür.
Ich reichte ihm die Visitenkarte unsicher zurück, er nahm sie und steckte sie wieder in sein Portemonnaie. »Das ist meine alte Firma. Ich arbeite jetzt ja für eure.« Ich erinnerte mich dunkel an eines der Fotos, das Jürgens uns gezeigt hatte. Schmitt.Selbstständig im Sicherheitsgewerbe. Ja, da war doch was. Aber ging es hier nicht um unsere Sicherheit und nicht um Schmitt seine? Ich war verwirrt.
Wenn ich mich nachmittags mit Freunden traf, gab ich vorher an, wo das passieren würde, und verbrachte die Zeit vorwiegend damit, mich regelmäßig umzuschauen, ob die Personenschützer nicht zu auffällig irgendwo rumstanden und meine Freunde mitbekamen, dass nun auf mich aufgepasst werden musste. Wir wollten möglichst wenig mit unseren Eltern zu tun haben, obwohl wir alle noch zu Hause wohnten. Und sowenig die Personenschützer meine Eltern waren, so sehr waren sie Erwachsene. Überall, sei es im Kino, im Block House am Othmarschener Bahnhof, wo wir uns nach der Schule regelmäßig Pommes und Knoblauchbrot holten, im Park oder nachts in den Straßen von Klein Flottbek, an all den Orten, an denen wir waren, weil unsere Eltern dort nicht waren, waren nun wieder Erwachsene bei mir. Superuncool.
Ich beschloss, es erst mal nicht anzusprechen. Es war mir unangenehm. Keiner von uns kam aus irgendwie prekären Familienverhältnissen. Wir wohnten mehr oder weniger in Hamburgs reicherem Westen. Trotzdem wurde Lenny regelmäßig von uns aufgezogen, weil er als Einziger in unserer Band Seglerschuhe trug. Es gab auf unserer Schule diese Gruppe von Jungs und vereinzelt auch ein paar Mädchen, die in einer Art Uniform von kurzer blauer Polohose, roséfarbenem Poloshirt und Seglerschuhen ohne Socken auftraten. Und zwar so ziemlich zu jeder Jahreszeit. Sie spielten Polo, so wie Lenny auch, und segelten vermutlich. Ich wusste es nicht, weil ich nur an Lennys Schlagzeugspiel interessiert war. Das war erstaunlicherweise ganz phänomenal. Lennys Vorbild war Dave Lombardo, der Drummer von Slayer. Er hatte sich sogar eine Doppelfußmaschine für sein Drumset gekauft, um extra schnelle Doublebass-Figuren spielen zu können. Die passten zwar nicht zu unserem Stil, machten aber trotzdem ziemlichen Eindruck im Proberaum. Er gehörte nicht zu den Trommlern, die ständig mit ihren Fingern irgendwo drauftippten und mit diesen angedeuteten komplizierten Rhythmen alle in den Wahnsinn trieben. Er war eher ruhig, und ich hatte ihn im Verdacht, dass sein eigentliches Hobby das Polospielen war. Dennis und Daniel spielten ihre Instrumente – Dennis Bass und Daniel Gitarre – beide länger und besser als ich. Dennis machte zu Hause laut Eigenaussage nichts anderes als Daddeln und Zocken. Was so viel hieß wie Videospiele und Bass spielen. Ich war also der schlechteste Musiker unserer Band, was bei Proben sehr stressig wurde. Ich verbrachte viel Zeit damit, meinen Verstärker einzustellen, weil er nicht so klingen wollte, wie ich es mir vorstellte, und weil ich versuchte, von meiner Unzulänglichkeit abzulenken. Noch dazu hatte ich die Befürchtung, dass der einzige Grund, warum sie mich nicht rauswarfen, der war, dass sie nach dieser ganzen Entführungsgeschichte schlicht Mitleid mit mir hatten. Entsprechend souverän versuchte ich mich täglich zu geben. Ich traute mich auch nicht, über Lennys Seglerschuhe zu lachen, hatte ich doch das Gefühl, dass ich selbst viel mehr Angriffsfläche bot als irgendwelche geschmacklosen Schuhe. Immerhin erledigten Dennis und Daniel das für mich, und ich fummelte einfach endlos an meinem neuen Marshall JTM 60 Röhren-Combo-Amp herum.
»Digga, lass mal spielen. Hast du’s gleich mal?«
»Yo, gleich. Vielleicht brauch ich auch ’n anderes Kabel.«
»Was du brauchst, ist ’ne andere Technik. Die gibt’s nicht im Laden.«
»Ach, halt’s Maul und spiel!«
Nach den Bandproben gingen wir meistens noch rüber ins Block House. Wir bestellten immer ein paar Block-House-Brote und viel Sour Creme zum Mitnehmen und aßen sie auf irgendeinem Mauervorsprung. Doch die Unbeschwertheit meiner Freunde fühlte ich nur oberflächlich. Ich alberte mit und suchte gleichzeitig mit den Augen die Männer, die irgendwo in unserer Nähe herumliefen und uns beobachteten. Sobald wir aus dem Keller von Lennys Eltern ans Tageslicht kamen, schrieb ich schnell eine SMS. Manchmal gab ich vor, noch pinkeln zu müssen, um das heimlich auf der Toilette zu machen, manchmal ging ich einfach als Letzter aus dem Haus. »Gehen zum Block House.«
Immer bevor ich das Haus verließ, musste ich eine SMS schreiben, dass ich gleich das Haus verlassen würde. Nach einigen Wochen wurde ich gebeten, den Personenschützern doch bitte mindestens drei Minuten Zeit zu lassen, bevor ich die Tür öffnete. Diese Zeit bräuchten sie, um sich vorzubereiten und den Weg von der Zentrale bis zu unserer Haustür zu schaffen. Wenn meine Eltern mich mal wieder zwingen wollten, mit unseren Hunden spazieren zu gehen, und ich nach zähen Verhandlungen nachgegeben hatte, zückte ich mein Telefon und schrieb eine SMS oder rief, wenn mir das zu umständlich war, einfach kurz drüben an. »Zentrale, hallo?« – »Moin. Ich geh mal mit den Hunden raus.« Dann wartete ich. Irgendwann fingen die Hunde an, jaulend und japsend vor Vorfreude an mir raufzuspringen, sobald ich nur den Hörer vom Telefon anhob oder mein Handy zückte. Diese Pfoten-auf-Parkett-klackernde Nerverei ließ die drei Minuten wie eine Unendlichkeit wirken. Jeder Vorgang meines neuen Lebens, jede Idee musste nun vorbereitet, mitgeteilt und gemeinsam erlebt werden. Meine gerade aufkeimende Freiheit als vierzehnjähriger Jugendlicher fühlte sich erdrückend an. Jeder Hundespaziergang, jeder Nachmittag mit meinen Freunden war eine Aufgabe mit Anleitung. Und dieses neue Leben beängstigte mich. Sollte ich mich nicht eigentlich sicher fühlen? Dass ich überhaupt ein bewusstes Gefühl zu meinem Leben hatte, nervte mich. Meine Freunde waren alle so wahnsinnig gedankenlos und übermütig, dass ich mir immer vorkam wie der Bedenkenträger. Gleichzeitig versuchte ich in der Art und Weise, wie ich mich ihnen gegenüber verhielt, besonders krass zu sein, um sie meine innere Verkrampftheit bloß nicht spüren zu lassen.
Die Kellner und Kellnerinnen im Block House waren oft extrem genervt von uns. Nie setzten wir uns rein, immer wollten wir irgendwelche Extrawünsche, und jedes Mal sammelten wir all unser Kleingeld zusammen, bis es genug war für die gewünschte Mahlzeit oder zumindest einen Kompromiss. Allerdings wollte ab und zu einer von uns doch nur sein eigenes Essen bezahlen, und somit musste die Bedienung diverse Miniaturrechnungen ausstellen, während wir ihr die Mark- und Pfennigmünzen in die Hand rieseln ließen. Draußen vor der Tür schmissen wir dann gern mal die Überreste hinter die Hecke und rannten weg. Ab und zu schrie uns jemand vom Personal hinterher, und wenn wir Pech hatten, schimpfte bei unserem nächsten Besuch jemand mit uns. Wir ließen uns nicht beirren und fragten sogar dreimal nach einer weiteren Extraportion Eis für unsere Apfelschorle.
Sichtlich genervt machte uns einmal ein älterer Gast im Block House an: »Ihr Bengel habt wohl keine Erziehung genossen. Wenn ich euch das nächste Mal mit euren Eltern hier sehe, dann könnt ihr aber was erleben.«
Wir grinsten ihn nur an. »Oooohhhhhh«, sagte Daniel und tat so, als ob er sich alle Fingernägel gleichzeitig abkaute.
»Pass bloß auf!«, schrie der Alte, »so einer wie du wär früher ins Umerziehungslager gekommen!«
»Uuuhhh.« Daniel wackelte mit den Händen, als würde er vor Angst zittern. »Komm, Digga«, sagte Dennis, »lass mal abhauen. Der Nazi soll mal chillen.« Aufgekratzt verließen wir mit einem Becher Eiswürfel das Restaurant. Lenny war nicht dabei, weil er noch Hockey oder Polo oder irgendwas spielen wollte. »Alter, voll der Nazi!«, rief ich Daniel und Dennis zu.
»Ja, echt ey. Voll krass.«
»Ey«, sagte ich, »ich hab ’ne Idee.« Wir liefen um die nächste Ecke, und ich bedeutete Daniel und Dennis, sich mit mir hinter einer Hecke zu verstecken. »Gib mal deine Apfelschorle«, sagte ich zu Dennis.
»Digga – meine Apfelschorle? Bist du behindert? Die hab ich extra für mich gekauft.«
»Alter, trink sie halt aus. Ich brauch nur den Becher.« Dennis sah mich an. »Ex mal«, forderte ich ihn auf.
»Ex ex ex!«, stimmte Daniel an. Dennis ließ sich nicht lange bitten und trank die Schorle in wenigen Schlucken aus.
»Dreht euch mal um.« Dann nahm ich den Becher, öffnete meinen Hosenstall und pinkelte ihn bis drei Finger breit unter den Rand voll. »Gib mal die Eiswürfel.« Ich füllte die Eiswürfel in den Becher und wartete, bis er abgekühlt war. Der gelbe Urin mit dem weißen Schaum sah ziemlich genau aus wie das Getränk, das Dennis gerade geext hatte. »Lass mal zurück.«
Dennis und Daniel grinsten mich an. »Auf jeden, Digga!«
Als wir wenige Minuten später beim Block House ankamen, saß der ältere Herr immer noch in Begleitung einer Frau direkt am Eingang des Restaurants. Wir atmeten kurz durch, dann gingen wir rein.
»Entschuldigung«, sagte Daniel und tippte dem Mann auf die Schulter.
»Mein Freund wollte sich bei Ihnen entschuldigen«, ergänzte ich, ohne dass wir uns vorher abgesprochen hatten.
»Ja, es tut mir leid, dass ich vorhin so laut und ungezogen war, und deshalb«, jetzt stellte ich dem Mann den Becher neben seinen Teller, »möchte ich Ihnen als Wiedergutmachung meine Apfelschorle schenken. Ich habe auch noch nichts davon getrunken.«
Das stimmte sogar, denn Dennis war es ja, der alles geext hatte. Wir konnten uns kaum noch zusammenreißen.
Der ältere Mann schaute uns skeptisch an, aber die Frau legte ihre Hand auf seine. »Komm, Harald, sag was Nettes.«
»Ja, sagen Sie bitte was Nettes«, überspannte ich vorsichtig den Bogen. Harald wusste nicht so recht, wie ihm geschah, und so langsam kriegte ich Angst. Ich hatte den Plan nicht zu Ende gedacht und wollte nicht unbedingt dabei sein, wenn Harald den ersten Schluck nahm.
»Jetzt sag schon was Nettes, Digga!«, rief auf einmal Dennis, der etwas abseits stand, und rannte dann weg. Daniel und ich sahen uns an.
»Egal. Guten Appetit noch«, sagte Daniel und drehte sich um. Er zog mich am Ärmel, und ich bewegte mich auch gen Ausgang.
»Warten Sie nicht so lange mit dem Trinken«, sagte ich, »sonst wird der Apfelsaft warm.«
»Wieder!«, ergänzte Daniel noch, und wir rannten beide prustend bis in den nahe gelegenen Park und schmissen uns dort auf die Wiese.
»Digga, was für ’ne heftige Aktion«, keuchte Dennis.
»Geschieht ihm doch recht, dem Nazi«, prustete ich. Dann erinnerte ich mich, dass ich gar nicht mehr auf mein Handy geschaut hatte. Heimlich fummelte ich es aus der Tasche. Eine neue Nachricht. Ich öffnete sie. »Alles klar. Sehen euch schon. Bleiben in der Nähe.«
4.
»Was fällt dir auf?«, fragte mich einer der Herren, die links und rechts neben mir standen und die ich jeden Tag sah, ohne sie bisher kennengelernt zu haben. Er drückte mir ein Paket in die Hand. Es war Mitte Juni, ein schöner Frühsommertag im Jahr 1996. In diesen Wochen lernte ich nach und nach die neuen Männer kennen. Sie alle waren freundlich. Alle boten mir das Du an, nachdem wir uns zur Begrüßung morgens im Auto die Hand gegeben hatten, doch ich lehnte jedes Mal ab. Wie unterschiedlich diese Männer waren: Manche sahen aus wie Zivilpolizisten, manche eher wie eine Freizeitversion von James Bond. Es waren die kleinen Dinge, die sie gemeinsam hatten. Kaum einer trug einen Ring, ein Armband oder eine Kette. Ich dachte mir, dass es wohl ein zu großes Verletzungsrisiko darstellte. Das kannte ich aus Filmen, wenn die Agenten vor Einsätzen ihre Ringe abnahmen, um während einer drohenden Folter nicht mit ihrer Familie erpressbar zu sein. Sie trugen stabile Schuhe und Jacken, die die im Gürtel- oder Schulterholster steckende Pistole verbargen. Sie besaßen eine Sonnenbrille, auch wenn sie sie nur selten trugen. Manche von ihnen redeten locker, wie ein Automechaniker, manche mit fast militärischem Drill. Keiner aber schien so viel Wert auf Sprache und Aussprache zu legen wie mein Vater, was sie mir gleich näherbrachte. In einer Situation, die komplett neu und durchweg kompliziert war, waren sie die Unkomplizierten. Das gefiel mir sofort.
Ich schaute auf das Paket in meinen Händen. Es war an mich adressiert. »Mein Name ist falsch geschrieben«, erwiderte ich.
»Richtig. Gut. Was noch?«
Ich drehte und wendete das Paket.
»Mach das nicht! Halt es waagerecht. Wenn du die Unterseite sehen willst, halt es nach oben«, sagte der Mann zu meiner Linken scharf.
Ich hob das Paket über meinen Kopf. Mein Blick fiel auf das Nachbarhaus vor uns. Im zweiten Stock stand jemand und beobachtete uns. Als unsere Blicke sich trafen, trat die Person schnell hinter den Vorhang. »Keine Ahnung. Alles normal.«
»Riech mal dran«, forderte mich der Mann zu meiner Rechten auf. Ich blickte wieder nach oben zum Fenster und meinte, die Umrisse der Person immer noch zu erkennen.
»Können wir vielleicht reingehen?«, fragte ich vorsichtig.
»Nein. Das ist die erste Regel. Wenn du dir unsicher bist, ob die Postsendung harmlos ist, bring sie vorsichtig nach draußen. Niemals im Innenraum öffnen.«
Ich seufzte. Es war eine der seltenen praktischen Einführungen in die Verhaltensweisen unseres neuen Lebens. Das meiste schien ich mir durch bloßes Leben selbst beibringen zu müssen. Learning by living. Wie verhalte ich mich, wenn ich eine potenziell gefährliche Postsendung erhalte? Ich verstand gar nicht, was das mit mir zu tun hatte. Wer sollte etwas davon haben, mich in die Luft zu sprengen? Ich traute mich aber nicht zu fragen. Einerseits, weil ich souverän wirken wollte, und andererseits, weil ich Angst vor der Antwort hatte.
Die Personenschützer hatten mir, bevor wir auf die Straße gegangen waren, um vor den Augen der Nachbarn an Paketen zu riechen, ein paar Regeln mit auf den Weg gegeben: Verdächtig ist es, wenn die Sendung keinen Absender hat, der Empfänger falsch geschrieben oder der Brief ungewöhnlich schwer ist, wenn sich Drähte unter dem Umschlag abzeichnen oder Ölflecken zu sehen sind. Ich wusste nicht, wozu ich das alles lernen sollte. Unsere Post wurde, seit es die Sicherheitsleute gab, sowieso von denen in Empfang genommen und durchleuchtet. Ich sollte all diese Verhaltensregeln nur lernen, falls mal ein Fehler passierte und ich versehentlich persönlich einen an mich adressierten Brief als Erster in die Hände bekäme. Ich musste ihn also nach dieser Anleitung checken und dann einen der Männer kontaktieren. Sie würden ihn in sicherer Entfernung für mich öffnen. An der frischen Luft natürlich. Das war der Plan. Ernsthaft! Ich versuchte, mir vorzustellen, wie das Paket mit einem der Personenschützer in sicherem Abstand von mir explodierte und ihn in Stücke riss. Es schien für mich keine Alternative zu geben, als diesen Plan abzunicken. Selbst wenn er mir, als Laie meines neuen Lebens, irgendwie nicht zu Ende gedacht vorkam.
Ich stand etwa zwanzig Meter vom Tor entfernt neben dem noch nicht ganz fertiggestellten riesigen überdachten Carport – ich glaube, meinen Vater störte besonders, dass es dafür kein deutsches Wort gab –, der die schulterhohe Steinmauer überragte. Ich hob das Paket vorsichtig an und führte es zu meinem Gesicht. »Es riecht nach Benzin.«
Zufrieden nickten sich die Männer zu. Sie hatten mir erfolgreich erklärt, wie ich vorerst nicht von einer Paketbombe zerfetzt werden würde. Der eine nahm mir das stinkende Paket aus der Hand. »Das ist sehr verdächtig! Im Normalfall würde ich das Paket jetzt fachgerecht hinter der Mauer öffnen«, er zeigte auf die ehemalige Grundstücksbegrenzung des Gartens, hinter der gerade der letzte vier Meter hohe Kameramast hochgezogen wurde, »und entschärfen.« Er blickte mich ernst an. Ich blickte skeptisch zurück. »Hoffentlich«, ergänzte sein Kollege laut lachend. Ich verzog das Gesicht und schaute wieder nach oben. Es hatte sich eine zweite Person zu der ersten gesellt. Als ich meinen Blick hob, traten beide schnell zurück in den Schatten ihrer Wohnung.
5.
An manchen Wochenenden flog ich nun zu meiner Cousine Julia nach Bergisch Gladbach. Meine Eltern und ich dachten, es wäre gut, ab und zu mal den Kopf frei zu kriegen und Hamburg zu verlassen. Keiner hatte bedacht, dass der belastende Teil Hamburgs immer mit dabei war. Herr Wassmann, ehemaliger Schießausbilder bei der Bundeswehr, der danach in die Privatwirtschaft gegangen war, war ein äußerst sympathischer, sogar in meinen Augen relativ jung aussehender Mann, mit dem ich gern zu tun gehabt hätte, wären die Umstände einfacher gewesen. Für einen kurzen Moment auf einem der Flüge erwischte ich mich sogar bei dem Gedanken, ob es nicht eine Option wäre, eine Schießausbildung bei der Bundeswehr zu machen. Die Aussicht, mit so lockeren Typen zu tun zu haben, war nicht die schlechteste. Doch Julias Blick, als ich ihr von dieser Option erzählte, holte mich wieder zurück in die Realität.
»Cousin!«, sagte sie eindringlich. Sie nannte mich niemals beim Vornamen, sondern immer nur Cousin, was mir gefiel. Wir hatten beide keine Geschwister, und unser tatsächlich existierendes Verwandtschaftsverhältnis immer wieder zu betonen hatte etwas Beruhigendes. »Cousin. Sag mal, hat man dir ins Hirn geschissen? Du gehst ganz bestimmt nicht zum Bund. Geht’s noch?!«
Sofort wurde mir klar, dass sie natürlich recht hatte. Doch es war und blieb schwierig, mich immer wieder aufs Neue abzugrenzen und abzuwägen, was nun ging und was nicht.
Sobald mich Julia vom Bahnhof in Bergisch Gladbach abholte, verschwand Wassmann aus unserem Blickfeld. Er nickte uns immer noch einmal zu, machte ein Handzeichen mit abgespreiztem Daumen und kleinem Finger, das ich aus dem hawaiianischen Surferkontext als Hang Loose kannte, in diesem Fall aber nur bedeutete, dass ich ihn anrufen sollte, wenn was ist. Dann stieg er in ein Auto, das uns künftig in sicherem Abstand umkreiste. Wo er schlief, wusste ich nicht. Die Vorstellung, er würde in dem Auto vielleicht sogar schlafen, war mir unangenehm. Ich dachte daran, wie er, betont locker vermutlich, erklären würde, dass er zusammengekauert auf der Rückbank, so bundeswehrmäßig, auf dem Parkplatz vor Julias Haus schlafen würde. Ich wusste, dass ich ihm dann eigentlich anbieten müsste, dass er auch bei Julia schlafen könnte, was ich aber natürlich weder verfügen konnte noch wirklich wollte. Ich entschied mich also dafür, es nie zur Sprache zu bringen. Vielleicht, redete ich mir ein, brauchte er tatsächlich nur sehr wenig Schlaf. Vielleicht war er so ausgebildet worden, dass er die zwei Nächte, die ich meistens bei Julia war, einfach wach blieb. Vielleicht war das für ihn kein Problem. Ehrlich gesagt fragte ich mich sowieso, wer eigentlich aufpasste, wenn er schlief.
Julia und ich hatten als Kinder oft zusammen gespielt, wir waren gemeinsam mit unseren Eltern zusammen weggefahren, und spätestens seit meinem Kurzbesuch bei ihr während der Entführung verstanden wir uns wortlos. Wortlose Freundschaften waren etwas, das mir sehr gefiel. Ich war froh über Julia, die nie Fragen stellte und mit der ich lange Ausflüge zum Haus unserer verstorbenen Großmutter mütterlicherseits machte. Heimlich schlichen wir um das Haus, das uns noch so vertraut war, doch in dem jetzt andere Menschen wohnten. Trotz der Verfolgung durch Wassmann fühlte es sich an wie früher, als wir noch zu zweit durch den anliegenden Wald streifen konnten, um uns vor Räubern und Dieben zu gruseln. Als diese unheimlich aufregende Bedrohung nur eine gruselige Idee war.
»Ey, Cousin!«, rief Julia bei einem unserer Streifzüge, als sie ein paar Meter weiter im Unterholz Wassmann entdeckte. Mit gedämpfter Stimme fuhr sie fort: »Wie nervig ist das eigentlich für dich?« Sie deutete mit dem Kopf in seine Richtung. »So auf ’ner Skala von 9 bis 10.«
Ich lachte und zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung. Darüber kann ich mir keine Gedanken machen. Ich kann’s ja eh nicht ändern. Die sind eigentlich ganz nett.«
»Klar sind die eigentlich ganz nett«, antwortete sie und schaute mich an, als wäre ich irgendwie schwer von Begriff. »Ich bin auch eigentlich ganz nett. Trotzdem würdest du nicht 24/7 mit mir abhängen wollen.«
»Na ja, würde ich vielleicht schon«, antwortete ich, »wenn ich müsste.«
Julia blickte mich an. »Was ich damit sagen will, Cousin: Wenn du jemanden zum Reden brauchst, du weißt schon: Wer hat zwei Daumen, ein Auge und ist ’n geiler Typ zum Reden?«
Ich schmunzelte. Julia kniff ein Auge zu und zeigte mit ihren beiden Daumen auf sich. Mir gefiel es, dass sie sich als Typ bezeichnete, obwohl sie ein Mädchen war. Und obwohl sie ein Jahr jünger war als ich, hatte sie diese unglaubliche Souveränität und etwas an sich, das mich beruhigte. Sie war die Person, mit der man reden konnte, es aber nicht musste. Optimal für mich.
Diese Reisen gaben mir ein ganz neues Gefühl der begleiteten Selbstständigkeit. Da ich es nicht gewohnt war, alleine zu fliegen, war die Begleitung ganz komfortabel. Meine Eltern waren nicht dabei, aber ich war trotzdem nicht allein. Hier, wo ich niemanden kannte und mich selbst erst zurechtfinden musste, wirkte die Anwesenheit von Wassmann nicht wie ein Schutz vor etwas unkalkulierbar Übermächtigem, sondern mehr wie eine angemessene Hilfestellung. Die personifizierte Meld-dich-wenn-was-ist-Option, ohne sich bei den Eltern melden zu müssen. Wassmanns Art zu reden erinnerte mich an meinen Erdkundelehrer Herrn Röder, der auch auf eine lange Karriere als Berufssoldat zurückblicken konnte. Sobald es in der Klasse lauter wurde, drückte er den Rücken durch, die Brust heraus und schrie in einem scharfen und kurzen Ton, bei dem sich sein Bauch ruckartig einzog, der Rest seines Körpers aber eingefroren zu sein schien: »Achtung! Ruhe!« Wir fanden das natürlich unheimlich hilflos.
Wassmann hatte nichts von dieser Hilflosigkeit, auch wenn seine aufrechte Haltung und seine kehlige und knappe Art, die Worte zu betonen, mich an Röder erinnerten. Seine dunkelgrüne Jacke mit den vielen Taschen, die ihm bis über den Po ging und knapp das Holster seiner Waffe und den Leatherman, die er am Gürtel trug, verdeckte, passte gut zu seiner hellen Cargohose und den schwarzen Stiefeln. Er schien lässig und gleichzeitig auf alles vorbereitet zu sein. Wenn er mit mir sprach, tippte er mit der Fußspitze seines rechten Fußes auf den Boden. Ich dachte, es könnte davon kommen, dass er nicht mehr marschieren durfte, sein Körper aber Schwierigkeiten hatte, sich damit abzufinden. Das Tappen war noch dazu absolut unrhythmisch, was mich immer total nervös werden ließ, wenn ich ihm zuhörte.
Auf dem Weg zum Hamburger Flughafen erzählte er mir einmal, dass es eine relativ große bürokratische Anstrengung sei, die Waffen seiner Kollegen und seine eigene innerhalb Deutschlands per Flugzeug zu transportieren. Formulare mussten ausgefüllt und Personendaten mit Scheinen und Ausweisen belegt werden. »Die Waffe geht am Flughafen durch so viele Hände, die ist nachher übersät mit Fingerabdrücken«, erzählte er mir, »eigentlich die perfekte Vorbereitung für einen Mord.« Wassmann sah mich grinsend an. »Die Waffe wird in einem versiegelten Umschlag direkt dem Piloten übergeben, und der muss sie unter seinen Sitz legen. Nach dem Landen wandert sie an speziell autorisiertes Bodenpersonal, das das Eisen dann direkt vor dem ersten Passagier rausholt. Dann wird sie der Flughafenpolizei übergeben, und ich hol sie bei den Kollegen am Schalter ab.« Kollegen. Das Wort hallte in meinem Kopf nach. Er konnte also backstage beim Flughafen. Ich staunte.
Bei der Ankunft am Kölner Flughafen stand ich dann am Gepäckband direkt neben der Luke mit dem schwarzen Vorhang aus dicken Gummistreifen, die sekündlich neue Gepäckstücke hervorbrachte, und versuchte, einen Blick auf die Menschen zu erhaschen, die die Koffer so unsanft auf das Band beförderten.
Ende der Leseprobe