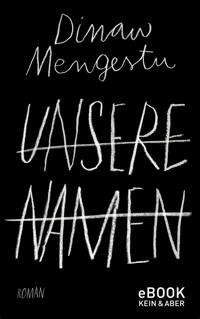
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kein & Aber
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer verschlafenen Kleinstadt im Mittleren Westen verliebt sich die junge Sozialarbeiterin Helen in den Afrikaner Isaac. Die Welten, aus denen sie stammen, scheinen unvereinbar, die Kluft zwischen ihnen zu groß. Um sie zu überbrücken, fängt Helen an, die Schatten in
Isaacs Vergangenheit auszuleuchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
INHALT
» Über den Autor
» Über das Buch
» Buch lesen
» Impressum
» Weitere eBooks von Kein & Aber
» www.keinundaber.ch
ÜBER DEN AUTOR
Dinaw Mengestu, 1978 in Addis Abeba geboren, emigrierte 1980 mit seiner Mutter und seiner Schwester in die USA. Für seine zwei bisherigen Romane Zum Wiedersehen der Sterne und Die Melodie der Luft erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und wurde vom New Yorker auf der renommierten Liste »20 Under 40« geführt. Dinaw Mengestu lebt mit seiner Familie in New York.
ÜBER DAS BUCH
In einer verschlafenen Kleinstadt im Mittleren Westen verliebt sich die junge Sozialarbeiterin Helen in den Afrikaner Isaac. Die Welten, aus denen sie stammen, scheinen unvereinbar, die Kluft zwischen ihnen zu groß. Um sie zu überbrücken, fängt Helen an, die Schatten in Isaacs Vergangenheit auszuleuchten.
Eine eindringliche Liebesgeschichte, die mit Klarheit und Sinn fürs Widersinnige den Abgrund universeller Fragen auslotet.
Für Anne-Emmanuelle, Gabriel und Louis-Selassie
Teil I
ISAAC
Als Isaac und ich uns an der Universität zum ersten Mal begegneten, taten wir beide so, als wären uns der Campus und die Straßen der Hauptstadt so vertraut wie die staubigen Pfade der Dörfer, in denen wir aufgewachsen waren und bis vor wenigen Monaten gelebt hatten. Dabei hatte keiner von uns jemals zuvor eine Stadt betreten oder eine Ahnung davon, was es bedeutete, auf derart engem Raum mit so vielen Menschen zusammenzuleben, deren Gesichter, geschweige denn Namen, wir niemals alle kennen würden. Die Hauptstadt boomte damals, war voller Menschen, Geld, neuer Autos und Gebäude, die man nach der Unabhängigkeit eilig hochgezogen hatte, in einem ekstatischen Rausch, der von der Aussicht auf einen sozialistischen, panafrikanischen Traum befeuert wurde. Laut Präsident und Radio konnte dieser Traum noch immer, fast zehn Jahre später, jeden Moment Realität werden. Als Isaac und ich in die Hauptstadt kamen, wiesen viele neu errichteten Gebäude bereits erste Zersetzungserscheinungen auf, weil man sie vernachlässigt oder ganz vergessen hatte, doch es lag immer noch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in der Luft, und wir waren wie alle anderen da, um unseren Anteil daran einzufordern.
Auf der Busfahrt in die Hauptstadt legte ich alle Namen ab, die meine Eltern mir gegeben hatten. Ich war fast fünfundzwanzig, jedoch in jeglicher Hinsicht sehr viel jünger. In dem Moment, in dem der Bus die Grenze nach Uganda überquerte, ließ ich meine Namen hinter mir zurück. Wir näherten uns dem Victoriasee, und ich wusste, dass Kampala nun nicht mehr weit war. Schon damals hatte ich beschlossen, diese Stadt in Gedanken nur »die Hauptstadt« zu nennen. Kampala klang zu klein für die Metropole, die ich mir vorstellte, und war zudem eindeutig mit Uganda verknüpft. »Die Hauptstadt« hingegen war namenlos und keinem Land verpflichtet. Wie ich gehörte sie niemandem, also konnte sie auch jeder für sich beanspruchen.
Die ersten Wochen in der Hauptstadt verbrachte ich damit, die jungen Männer zu imitieren, die in Grüppchen auf dem Universitätsgelände und in den angrenzenden Cafés und Bars herumlungerten. Damals wollte jeder ein Revolutionär sein. Auf dem Campus und in den ärmeren Vierteln, wo Isaac und ich lebten, gab es Dutzende Lumumbas, Marleys, Malcolms, Césaires, Kenyattas, Senghors und Selassies, junge Männer, die jeden Morgen nach dem Aufwachen als Erstes die schwarzen Hüte und olivgrünen Anzüge ihrer Helden anlegten. Da ich mich nicht mit ihnen messen konnte, ließ ich mir zumindest die wenigen Haarstoppel am Kinn wachsen, kaufte eine gebrauchte grüne Hose, die ich jeden Tag anzog, auch nachdem der Stoff an den Knien eingerissen war, und betrachtete mich als »Revolutionär im Werden«, auch wenn ich ursprünglich mit ganz anderen Ambitionen in die Hauptstadt gekommen war. Ein Jahrzehnt zuvor hatte nämlich an der dortigen Universität eine wichtige Zusammenkunft afrikanischer Schriftsteller und Gelehrter stattgefunden, von der ich in der Zeitung gelesen hatte, einer Zeitung, die bereits eine Woche alt war, als sie endlich unser Dorf erreichte. Von da an hatte jenes Schriftstellertreffen meine jugendlichen Träume und Pläne beflügelt, die bis dahin nur darin bestanden hatten, die ländliche Provinz so bald wie möglich hinter mir zu lassen. Endlich wusste ich, wohin ich gehen und was ich dort werden wollte: ein berühmter Autor, der, umgeben von Gleichgesinnten, im Herzen der wohl großartigsten Stadt des ganzen Kontinents lebte.
Ich traf schlecht vorbereitet in der Hauptstadt ein. Nachdem ich ein Dutzend Mal die immer gleichen viktorianischen Romane gelesen hatte, ging ich davon aus, dass die Sprache dieser Bücher das richtige Englisch war, und sagte »Sir« bei jeder Gelegenheit. Niemand, dem ich begegnete, nahm mir den Revolutionär ab, und ich brachte nicht den Mut auf, öffentlich meinen Plan zu verkünden, Schriftsteller zu werden. Bis ich Isaac kennenlernte, hatte ich keinen einzigen Freund in der Hauptstadt gefunden. Mit meinen langen dünnen Beinen und dem schmalen Gesicht würde ich eher einem Professor ähneln als einem Kämpfer, behauptete er. Deshalb nannte er mich anfangs auch so: »Professor«, beziehungsweise »der Professor«. Es war nicht der letzte Spitzname, den er mir verpasste.
»Und was ist mit dir?«, fragte ich ihn. Ich ging davon aus, dass er wie so viele andere einen zweiten, offiziellen Namen hatte, bei dem er gerufen werden wollte. Er war kleiner und breiter als ich und hatte muskulöse Arme, über die sich ein dichtes Netz aus Adern zog. Zwar besaß er den Körperbau eines Soldaten, nicht jedoch das Gesicht und das Auftreten, dazu lächelte und lachte er zu oft. Es war für mich nicht vorstellbar, dass er jemals jemanden verletzen könnte.
»Fürs Erste bleibt es bei Isaac«, antwortete er.
Isaac war der Name, den ihm seine Eltern gegeben hatten. Bis wir aus der Hauptstadt fliehen mussten, blieb es der einzige Name, den er tragen wollte. Seine Eltern waren in der letzten Gefechtswelle kurz vor der Unabhängigkeit gestorben. »Isaac« war ihr Vermächtnis an ihn, und als seine Revolutionsträume ihr Ende fanden und er vor der Entscheidung stand, das Land zu verlassen oder zu bleiben, war dieser Name sein letztes und wertvollstes Geschenk an mich.
Von Anfang an war das Leben in der Hauptstadt für Isaac schwieriger als für mich. Diese Stadt war nicht meine Heimat und würde es – wie ich mit der Zeit verstand – auch nie werden. Bei Isaac lag der Fall ein wenig anders. Uganda war sein Land, und Kampala dessen Mittelpunkt. Seine Familie kam aus dem Norden und gehörte einem jener Stämme an, deren Mitglieder besonders groß und dunkel waren, und von denen ein Mann in Cambridge beschlossen hatte, dass sie kriegerischer waren als ihre kleineren Cousins im Süden. Wären die Briten im Land geblieben, wäre es ihm gut ergangen. Als Kind war er so aufgeweckt gewesen, dass man erwogen hatte, ihn später ins Ausland zu schicken, vielleicht mit einem Staatsstipendium auf eine Privatschule in London. Doch dann schien das gesamte koloniale Experiment in einem einzigen langen, blutigen Nachmittag zu enden, und Jungen wie Isaac wurden zum zweiten Mal zu Waisen. Obwohl er nur wenige Wochen vor mir in der Hauptstadt eingetroffen war, hatte er vom Hörensagen und aus Geschichten genug über sie erfahren, um eines ganz sicher zu wissen: Er würde problemlos seinen Platz in ihr finden und es bis ganz nach oben schaffen, egal, in welche gesellschaftlichen Zirkel es ihn letztlich verschlagen würde. Die Tatsache, dass er zum Zeitpunkt unseres Kennenlernens noch immer arm und gänzlich unbekannt war, stellte offenkundig den größten Anlass für Frust dar. Allerdings hatte ich den Verdacht, dass es noch andere Ursachen für seine Wut und seinen Kummer gab, die er sich nicht eingestand.
Isaac und ich wurden Freunde wie zwei streunende Hunde, die auf der Suche nach Nahrung und Gesellschaft jeden Tag denselben Pfad entlangkamen. Beide hatten wir uns im Osten der Stadt eine Unterkunft gesucht, in jener schwer zugänglichen, hügeligen Region, in der es immer wieder zu Erdrutschen kam. Er wohnte bei Freunden von Verwandten, die sich bereit erklärt hatten, ihn auf dem Boden ihres Wohnzimmers schlafen zu lassen, ich hatte ein Feldbett im Hinterzimmer eines Kurzwarenladens gemietet, das an den Wochenenden als improvisierte Bar für den Besitzer und seine Freunde diente. An Freitagen und Samstagen durfte ich erst gegen zwei oder drei Uhr morgens zurück in mein Quartier kommen, nachdem der Inhaber und seine Freunde sich mit den Mädchen aus der Nachbarschaft in meinem Bett vergnügt hatten. Da ich kein Geld hatte und nicht wusste, was ich sonst tun sollte, streifte ich durch das Viertel, ein Labyrinth aus schmalen, zerklüfteten Pfaden, die sich den Berghang hinauf wanden, bis sie auf eine der frisch asphaltierten Straßen stießen, die es nun überall in der Stadt gab. Von dort aus hatte man einen guten Blick über unser Elendsviertel. Es erstreckte sich schräg abfallend in einem Tal, das einst grün und fruchtbar gewesen war und auf dessen üppigen Wiesen die Rinder gegrast hatten. Durch die Bevölkerungsmassen, die während der letzten Jahre in die Hauptstadt geströmt waren, hatte es sich in eine dichte Ansammlung von Wellblechhütten und Stromleitungen verwandelt, um die sich flache, mit Müll und Fäkalien gefüllte Gräben zogen. Zwei Mal sah ich Isaac dort oben auf dem Hügel, bevor wir zum ersten Mal miteinander sprachen. Beide Male stand er am Straßenrand und starrte nicht etwa auf die unter ihm liegende Stadt, sondern auf den vorbeifahrenden Verkehr, als bereitete er sich innerlich darauf vor, sich vor ein Auto zu werfen. Wir begrüßten uns gegenseitig mit einem knappen Nicken. Keiner von uns hätte ausführlicher grüßen können, ohne den anderen zu beunruhigen, und hätte ich Isaac nicht kurz darauf an der Universität gesehen, hätten wir vielleicht Jahre damit zugebracht, uns vom Straßenrand aus zuzunicken. Einige Tage nach dem zweiten Aufeinandertreffen jedoch entdeckte ich ihn auf dem Campus, wo er sich genau wie ich die größte Mühe gab, zugehörig zu wirken, indem er sich in der Nähe einer Studentenclique herumdrückte. Es war die zweite Augustwoche, der Start des neuen Semesters, und so drängten sich auf jedem Quadratzentimeter des zentralen Campusrasens die Studenten. Die gewaltigen Palmen, die die Grünflächen flankierten, verliehen dem Universitätsgelände den Schein tropischer Üppigkeit. Als ich Isaac sah, wusste ich sofort, dass er nicht hier war, weil in Kürze seine Vorlesungen und Seminare begannen, sondern weil er genau wie ich das Gefühl hatte, hierherzugehören, als Teil der künftigen geistigen Elite. Wie ich erzählte er jedem, den er kennenlernte oder dem er begegnete, dass er Student sei, und wie ich war er überzeugt davon, dass er genau das eines Tages sein würde.
Uns verband also das Wissen, dass wir beide Lügner und Hochstapler waren und zudem schlecht gewappnet für die Rolle, die wir zu spielen gedachten. Die Gruppe Studenten, neben der wir uns aufhielten, hatte sich um einen Tisch in der Mitte der Rasenfläche geschart, wo ein junger Mann mit sorgfältig gestutzter Afrofrisur eine Liste mit Forderungen vorlas. Wären Isaac und ich uns der Gegenwart des jeweils anderen nicht bewusst gewesen, hätten wir uns sicher vom Ruf des jungen Mannes nach besseren Dozenten, geringeren Gebühren und größeren Freiheiten für die Studierenden mitreißen lassen. Doch wir hatten uns sofort gegenseitig bemerkt und wurden deshalb nie wirklich Teil der Versammlung. Sobald sich unsere Blicke einmal begegnet waren, nahmen wir nur noch das vage vertraute, aber möglicherweise feindselige Gesicht des jeweils anderen wahr. Wir waren wie zwei Menschen, die sich unerwartet mitten in der Wüste begegneten, nachdem in Wochen der Einsamkeit die Überzeugung in ihnen gereift war, die Welt wäre ein unbewohnter Ort. In unserem Elendsviertel spielten wir füreinander keine große Rolle. Hier hingegen zählte nichts anderes mehr.
Isaac wartete, bis die Ansprache des jungen Mannes geendet hatte und seine letzten Worte verklungen waren: »Das ist unsere Universität!« Es folgte kurzer Applaus. Damals gehörte angeblich alles uns: die Stadt, das Land, Afrika. Alles existierte nur, um von uns in Besitz genommen zu werden. Zumindest in dieser Hinsicht unterschied sich unser Verhalten nicht von dem der Engländer, die vor uns das Sagen gehabt hatten. Viele junge Männer, die damals an der Universität der Hauptstadt studierten, sollten dies später eindrucksvoll unter Beweis stellen, indem sie sich mit den Reichtümern ihres Landes die Taschen füllten.
Sobald die Reihen der Studenten sich ein wenig gelichtet hatten, ging Isaac zum Angriff über und kam mit großen, federnden Schritten auf mich zu. Seine Schultern hoben und senkten sich dabei rhythmisch, es war eine beinahe animalische Art der Fortbewegung. Ich fühlte mich wie ein gejagtes Tier und dachte: Gleich hat er mich. Obwohl mir körperlich keine Gefahr drohte, sollte ich doch recht behalten mit dem Gefühl, dass etwas Entscheidendes auf dem Spiel stand. Isaac blieb vor mir stehen, zögerte ein paar Sekunden und sagte dann: »Lass uns irgendwo hingehen und uns unterhalten.«
Diese konspirative Ausdrucksweise war typisch für ihn. Während der nächsten Monate sagte er immer wieder Dinge wie: »Wir müssen reden, und zwar unter vier Augen.« Oder: »Gehen wir woandershin, wo uns keiner hört.« Isaac gab einem stets das Gefühl, wichtig und besonders zu sein.
Ich nickte zustimmend. Von Anfang an fiel ich seinen Manövern anheim, ergab ich mich seiner Realität, denn sie verlieh mir zum ersten Mal, seit ich in der Hauptstadt war, ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Wir gingen, bis wir den Campus weit hinter uns gelassen hatten und uns in einem Stadtteil befanden, den ich zuvor noch nie betreten hatte. Isaac hörte nicht auf zu reden. Er hatte seine völlig eigene Geschichtsauffassung – halb Fakt, halb Mythos – und brannte darauf, sie mit mir zu teilen. Jeder seiner Diskurse begann mit »Wusstest du eigentlich, dass …«, seinem Äquivalent zu »Es war einmal …«.
»Wusstest du eigentlich«, sagte er beispielsweise, »dass vor einem Jahrzehnt noch keine Afrikaner in der Nähe der Universität wohnen durften? Die Briten wollten dort einen neuen Palast für den König bauen. Wenn sie den Zweiten Weltkrieg verloren hätten, hätten sie das ganze englische Volk hergebracht, und das Universitätsviertel wäre nur ihnen vorbehalten gewesen. Alles sollte genauso aussehen wie in London, damit die Leute nicht so traurig waren über die Niederlage. Außen herum sollte eine hohe Mauer stehen, und alle Landkarten sollten geändert werden, damit es so aussah, als würde London in Afrika liegen. Allerdings hat es nicht funktioniert, denn jedes Mal, wenn sie anfangen wollten, die Mauer zu bauen, hat sie jemand in die Luft gesprengt. Und so fing der Unabhängigkeitskrieg an.«
Ich lauschte ihm gebannt, weil ich wusste, dass Isaac mit seinen Geschichten in erster Linie unterhalten wollte. Ob ich ihm glaubte oder nicht, spielte keine Rolle. Wir suchten uns ein Café in einer Straße, in der aus niedrigen Wellblechhütten heraus Jeans, T-Shirts und bunt gemusterte knöchellange Kleider verkauft wurden. Ähnliche Straßen gab es in der ganzen Stadt, auf dem ganzen Kontinent. Was diese einzigartig machte, waren die vierstöckigen, immer paarweise auftretenden Betonklötze, die in den letzten Jahren im Abstand von etwa fünfzig Metern aus dem Boden geschossen waren. Man hatte sie in aller Eile und schlampig errichtet, um die Privatunternehmen unterzubringen, die sich angeblich zuhauf in der Hauptstadt niederlassen würden. Trotz der Menschenmengen auf den Straßen und der vielen kleinen Läden, die sich im Schatten der Betongebäude drängten, schien ihr Leerstand ein schlechtes Omen zu sein, vielleicht, weil er etwas über die unmittelbare Zukunft aussagte, beziehungsweise die Tatsache, dass diese nicht eingetreten war.
Ich zeigte auf ein Gebäudepaar mit verdunkelten Fenstern auf der anderen Straßenseite. »Und wer soll da wohnen?«, fragte ich.
Isaac streckte die Arme aus. »Das sind keine Wohnhäuser«, erklärte er. »Guck doch nur, wie hässlich die sind. Bald wird es in der ganzen Stadt so aussehen. Das ist zumindest der geheime Plan der Regierung. Wir bauen diese Ungetüme, damit die Briten nie wieder zurückkommen wollen.« Er legte einen Finger an seine Lippen. »Das bleibt natürlich unter uns.«
»Natürlich«, versicherte ich. Ich konnte noch nicht einschätzen, wann er von mir erwartete, dass ich ihn ernst nahm, und wann nicht.
Nachdem wir auf der Terrasse des Cafés Platz genommen hatten, bestellte Isaac Tee für uns. Als die Bestellung kam, war ihm der Tee nicht mehr heiß genug, weshalb er ihn umgehend zurückgehen ließ. Offenbar wollte er mich mit der Gewandtheit beeindrucken, mit der er Befehle erteilte, in diesem Fall den Befehl, eine Tasse mit etwas heißerem Wasser zu bringen. Er schlug die Beine über, lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und sagte: »Du gehst also auch zur Uni.«
»Ja«, antwortete ich.
»Jeden Tag?«
»Jeden Tag.«
Erst nach seiner zweiten Frage und meiner zweiten Antwort waren wir uns sicher, dass wir über dasselbe sprachen. Isaacs Gesichtszüge entspannten sich. Er gab das ständige, ein wenig gezwungen wirkende Grinsen auf, das er seit unserem Aufeinandertreffen auf dem Campus aufgesetzt hatte.
»Mein Großvater wollte, dass ich Medizin studiere«, fuhr er fort. »Aber ich habe andere Pläne.«
»Was willst du denn studieren?«
»Wir sind hier in Afrika. Es gibt also nur ein Studienfach, das infrage kommt«, erklärte er. Nachdem er mehrere dramatische Sekunden hatte verstreichen lassen und vergeblich auf eine Reaktion meinerseits gewartet hatte, seufzte er und sagte: »Politik. Etwas anderes haben wir hier nicht.«
Ich hatte noch nicht gelernt, mit derselben aufgesetzten, aber überzeugenden Autorität zu sprechen. Als Isaac mich fragte, was ich studieren wollte, musste ich meinen ganzen Mut zusammennehmen: »Literatur.«
Er schlug mit der Hand auf den Tisch.
»Das passt ja perfekt«, sagte er. »Du siehst nämlich aus wie ein Professor. Welche Art von Literatur willst du denn studieren?«
»Alles«, antwortete ich, und diesmal klang ich sogar beinahe selbstsicher – ich glaubte fest an mein Vorhaben. Dabei hatten sich viele der Schriftsteller, die an dem legendären Treffen an der Universität teilgenommen hatten, längst aus dem Staub gemacht, als Isaac und ich dieses Gespräch führten. Einige lebten angeblich im Exil in Amerika, von anderen munkelte man, sie seien tot oder arbeiteten für ein korruptes Regime. Ich träumte trotzdem immer noch davon, einer von ihnen zu werden.
HELEN
Als ich Isaac kennenlernte, war ich schon fast eine »nicht mehr ganz so junge Frau«, wie meine Mutter es ausgedrückt hätte. Ihrer Ansicht nach machte mich mein fortgeschrittenes Alter verwundbar, auch wenn ich selbst das nie so empfand. Dabei war ich in einem Haushalt aufgewachsen, in dem es deutlich einfacher gewesen wäre, ein Junge zu sein. Meine Mutter war eine Flüsternde. Sie sprach grundsätzlich leise, damit mein Vater sich nicht aufregte oder in eine seiner düsteren Stimmungen verfiel. Das behielt sie auch dann noch bei, als er sie längst verlassen hatte. Wir wohnten in einem ruhigen, fast ländlichen Städtchen im Mittleren Westen, wo die Meinung anderer alles bestimmte. In den Augen meiner Mutter war der äußere Schein das Wichtigste überhaupt. Die Risse, die in der Fassade jeder halbwegs normalen Familie auftreten konnten, mussten sorgfältig zugespachtelt werden, damit es niemand mitkriegte, wenn man die Hypothek nur mit Mühe bezahlen konnte oder wenn die eigene Ehe schon lange vor Unterzeichnung der Scheidungspapiere vorbei war. Sie schien von mir zu erwarten, dass ich genauso leise sprach wie sie, was ich als kleines Mädchen womöglich noch getan habe. Andererseits sagt mir meine Intuition, dass das mit ziemlicher Sicherheit nie der Fall war. Ich taugte nicht zur Flüsternden, dafür mochte ich meine Stimme zu sehr. Bücher las ich beispielsweise nur selten stumm, weil ich jede Geschichte laut hören wollte. Also nahm ich meine Lektüre oft mit in unseren Garten, der groß genug war, dass unsere Nachbarn mich nicht hörten, wenn ich den Text lauthals in die Welt hinausbrüllte. Dort las ich selbst im Winter, wenn die Äste der Bäume unter der Last von Schnee und Eis durchhingen und die wenigen Hühner, die wir besaßen, in den Keller gebracht werden mussten, damit sie nicht erfroren. Viel später, als ich älter war und mir das Gras fast bis zu den Knien ging, weil sich niemand mehr um den Garten kümmerte, begab ich mich wieder mit einem Buch in der Hand in den Garten, einfach nur, um zu schreien.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























