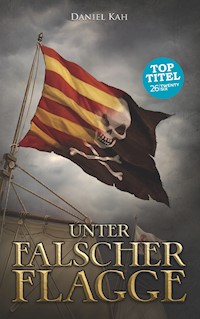
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ende des 17. Jahrhunderts. Mit glänzenden Versprechen nach Ruhm und Reichtum locken die Kolonien der Neuen Welt all jene Abenteurer, die es wagen ihre Heimat zu verlassen. Aber nicht alle handeln im Einklang mit dem Gesetz. Piraten haben es auf die Gold- und Silberlieferungen der spanischen Schatzflotte abgesehen. In Madrid plagen König Carlos II. unterdessen andere Sorgen. Ohne leibliches Kind ist seine Erbfolge ungewiss und die mächtigen Königshäuser Europas bringen bereits Figuren in Stellung, um ihre Erbansprüche am spanischen Weltreich geltend zu machen. Im drohenden Konflikt um Spaniens Thron haben nur die etwas zu gewinnen, die vorausschauend planen und entschlossen handeln. Eine Chance, die sich der aufstrebende Stadtrat David Ramon Zamino nicht entgehen lassen will. Ohne zu ahnen, dass er die Schicksale gänzlich Unbeteiligter entscheidend beeinflussen wird...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 648
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Anno Domini 1695
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
Anno Domini 1696
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
Anno Domini 1697
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
Anno Domini 1698
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
Anno Domini 1699
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
Anno Domini 1700
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
Anno Domini 1701
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Anno Domini 1702
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Prolog
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 25. April 1518
Welch wundersame Wendung das Schicksal für mich bereithält, und eine nicht ungefährliche dazu. Ich, der unbedeutende Schreiber von Diego Velazquez de Cuellar, dem Gouverneur von Kuba, wurde beauftragt, eine Expedition auf das neu entdeckte Festland zu begleiten.
Mein Auftrag lautet: Protokoll führen, Karten zeichnen und Reiseerlebnisse festhalten. Die normalen Seeleute können kaum lesen, wie sollen sie denn je fähig sein zu schreiben? Außerdem ist Gouverneur Velazquez der Meinung, dass man dem Seemannsgarn der Matrosen nicht trauen könne und er einen zuverlässigen, neutralen Mann auf einem dieser Schiffe brauche. Trotz der Ungewissheit ob der vor uns liegenden Dinge, erfüllt es mich mit Stolz und Freude, dass ich jener Mann sein soll.
Der Neffe des Gouverneurs wird die Unternehmung anführen, ein gewisser Juan de Grijalva. Ich wurde dem Schiff von Kapitän Pedro de Alvarado zugeteilt. Er soll ein fähiger Seemann und Soldat sein, wie mir der Gouverneur auf meine besorgte Nachfrage hin versicherte. Mit vier Schiffen werden wir in See stechen, insgesamt sind etwa 250 Männer an Bord. Es liegt noch viel Arbeit vor mir, bevor wir in vier Tagen auslaufen. Das Wichtigste wird sein, genügend Schreibwerkzeug und Zeichenpapier vorrätig zu haben. Wenn es mir ausgehen sollte, werde ich bei den Wilden kaum Nachschub bekommen.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 27. April 1518
Heute habe ich im Hafen von Santiago de Kuba Kapitän Alvarado kennengelernt. Eine beeindruckende Gestalt von kräftigem Körperbau mit bemerkenswert blonden Haaren. Wenn er spricht, neigt er zu ausladenden Gesten und seine durchdringende Stimme vermag sogar den hintersten Winkel eines Schiffes zu erreichen. Ich habe nach unserem kurzen Treffen keine Zweifel daran, dass er eine bunte Schar unterschiedlichster Charaktere zu führen vermag.
Zu meinem Leidwesen muss ich berichten, dass er zunächst wenig begeistert war, mich in seiner Mannschaft zu haben. Er könne keinen Neuling auf dem Schiff gebrauchen, der nur im Weg stehen werde und dafür einen Teil der knappen Vorräte verzehre, polterte er mich an. Ich erklärte ihm, dass ich auf Geheiß des Gouverneurs das Unternehmen als Chronist begleiten solle. Zusätzlich versicherte ich, dass ich mein Möglichstes tun werde, nicht gänzlich unnütz zu sein und lernwillig sei. Zur Antwort brummte er etwas Unverständliches, schien aber soweit besänftigt. Dann zupfte er die gezwirbelten Spitzen seines gepflegten markanten Bartes zurecht und lud mich im Anschluss auf sein Schiff ein, die San Sebastian.
Ein Dreimaster von etwa 30 Metern Länge, mit bauchigem Rumpf und glatt beplankter Außenwand. Ich hatte schon einige solcher Schiffe gesehen und setzte auf einem Ähnlichen vor vielen Jahren von Spanien nach hier über. Wie lange das jetzt her ist ... Seitdem habe ich keinen Fuß mehr auf ein Deck gesetzt. Ein mulmiges Gefühl beschleicht mich bei dem Gedanken daran, dass dies für die nächste Zeit mein Zuhause sein wird. Immerhin scheint diese Bauweise sich über viele Jahre bewährt zu haben. Ein hoffnungsvolles Zeichen.
Es gibt drei Decks. Im Unterdeck werden Vorräte und Tauschwaren für die Eingeborenen gelagert. Im Zwischendeck befinden sich unsere Schlafstätten und eine Waffenkammer. Ich hoffe, dass es uns erspart bleiben wird, letztere zu betreten. Ebenso wie ich den Einsatz der Kanonen auf dem Hauptdeck gerne vermieden sähe. Mir wurde gesagt, dass wir auf einer friedlichen Erkundungsfahrt sein werden und nicht in den Krieg ziehen. Ein kurzes Heckkastell gibt es ebenfalls, wo Kapitän Alvarados Schlafgemach untergebracht ist und einen Kommandoraum mit allerlei nautischem Werkzeug und den Seekarten des bislang bekannten Meeres. Dies wird meine Arbeitsstätte für die nächsten Wochen sein. Oder sogar Monate? Ich vermag es nicht zu sagen.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 29. April 1518
Heute Morgen legten wir bei sonnigem Wetter ab und nahmen Kurs Richtung Osten an der Küste entlang. Auf meine Nachfrage bei Kapitän Alvarado, warum wir nicht nach Westen segeln würden, wo nach meiner Vorstellung das Ziel läge, schaute er mich nur verständnislos an. Unser Bestreben sei es selbstverständlich, das kubanische Eiland zu umsegeln, um so einen weitaus kürzeren Weg durch unbekannte Gewässer zu haben, erläuterte er mir. Dies leuchtete ein. Ich kam mir naiv vor, ob der vorlauten Frage. Besser ich beschränke mich auf meine Aufgaben, anstatt mich an nautischen Ratschlägen zu versuchen.
Unsere Mannschaft besteht hauptsächlich aus Soldaten, die zu diesem Unternehmen abkommandiert wurden, sowie ein paar Glücksrittern, die sich freiwillig angeschlossen haben. Den Gesprächsfetzen nach, die ich aufschnappen konnte, sind sie eher auf Kampf und Reichtümer aus, als auf die Entdeckung unbekannter Länder und Kulturen. Ich hoffe aus tiefstem Herzen, dass ihre Erwartungen enttäuscht werden.
Wir haben außerdem zwei Geistliche an Bord, die den Eingeborenen, sofern wir welche treffen, die Botschaft unseres allmächtigen Gottes verkünden. Hoffentlich teilen sie meinen Wunsch, dass dies eine friedliche Unternehmung bleibt und keine Missionierung mit Feuer und Schwert.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 6. Mai 1518
Vor zwei Tagen haben wir, in der Absicht unsere Vorräte aufzufüllen, vor einem kleinen Fischerdorf geankert, bevor wir die beruhigende Sicht auf das Festland verlieren. Leider war dies nicht von Erfolg gekrönt. Wie soll ein Ort mit einer Handvoll Einwohnern vier vollbesetzte Segelschiffe mit ausreichend Nahrung und Wasser für mehrere Wochen versorgen? So gab dann Kommandant Grijalva recht bald das Signal zum Aufbruch. Später erfuhr ich den Namen des Ortes. Havanna. Durchaus klangvoll für diesen unbedeutenden Flecken Erde, so finde ich.
Nun segeln wir auf dem offenen Meer. Vor wenigen Stunden haben wir die letzte Landzunge Kubas aus den Augen verloren und fahren mit Kurs Südwest Richtung unbekannter Gefilde. Beim Blick auf das weite Meer überkommt mich immer ein seltsames Gefühl von Freiheit und Hilflosigkeit zugleich. In zwei bis drei Tagen sollten wir wieder Land sehen, so wurde mir berichtet. Eine Vorstellung, der ich mit Freude entgegenfiebere.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 10. Mai 1518
Land in Sicht! Endlich erklangen die lang ersehnten Worte. Der Aussichtsposten im Krähennest hatte ein Stück Land erspäht, was sich bald als eine kleine vorgelagerte Insel herausstellte. Dank klarer Sicht erblickten wir rasch ein weiteres, größeres Land dahinter. Zunächst segelten wir ein Stück voller Neugier an der Küste des neu entdeckten Eilandes entlang, was sich, zur Überraschung aller bald als bewohnt herausstellte! Ich bemerkte kleine Siedlungen mit Hütten aus Lehm und Holz, ebenso einige pyramidenförmige Bauten aus Stein. Die Bewohner besaßen kupferfarbene Haut und deuteten aufgeregt auf unsere Flotte, als sie uns bemerkten. Dann gab Kommandant Grijalva per Flaggensignal den Befehl zum Ankern und bestimmte eine Gruppe, zu der ich mich sogleich freiwillig meldete, die per Ruderboot einen Landgang wagten. Das durfte ich mir nicht entgehen lassen!
Zusammen mit Kapitän Alvarado, den zwei Missionaren und einigen Bewaffneten ruderten wir gemeinsam Richtung Küste. Eine kleine Kiste mit Tauschobjekten hatten wir ebenfalls an Bord. Wir trafen auf eine bislang unbekannte Zivilisation, was mich mit ungeahnter Aufregung und Neugier erfüllte. Ich sog alles auf, was ich mit meinen Sinnen wahrnahm. Der Geruch der See erschien plötzlich salziger. Das Blau des Wassers, das strahlende Weiß des Strandes und das satte Grün der Palmen leuchteten weitaus kräftiger als gewöhnlich. Das Plätschern der winzigen Wellen, die sanft an Land brachen. Alles war so viel intensiver als im heimischen Santiago de Kuba. Nicht, dass es irgendwie anders gewesen wäre, aber der Augenblick einer völlig neuen Erfahrung erhob es zu etwas Besonderem.
Gern hätte ich an dieser Stelle das Treffen mit den Eingeborenen geschildert, doch dazu kam es leider nicht. Verängstigt ob der Neuankömmlinge zogen sie es vor, sich ins Landesinnere zurückzuziehen und ihr Dorf schutzlos zurückzulassen. Schade, wie ich finde, doch kann ich es ihnen kaum verdenken. Ob ich an ihrer Stelle anders reagiert hätte?
Die Befehlshaber entschieden, dass wir für eine Weile in ihrem Dorf blieben und darauf warteten, bis die Einwohner zurückkehrten. Vielleicht ergäbe sich doch noch die Gelegenheit zur Kontaktaufnahme, wenn die Bewohner etwas Mut gefasst hätten. Doch selbst nach mehreren Stunden bekamen wir keine Menschenseele mehr zu Gesicht. So nahmen wir ein paar Vorräte mit, die wir in den Hütten fanden, füllten die Wasserschläuche und kehrten zu den Schiffen zurück. Trotzdem konnte ich mich niemals des Gefühls erwehren, dass wachsame Augenpaare jeden unserer Schritte begleiteten.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 13. Mai 1518
Nachdem wir vor drei Tagen die Insel tatenlos verlassen mussten, segelten wir an der Küste des dahinterliegenden Festlandes entlang nach Süden. Drei weitere Siedlungen erspähten wir von Bord aus. Leider reagierten deren Bewohner ebenso furchtsam und flohen ins Landesinnere, sobald sie uns entdeckt hatten. Somit gibt es in diesen Tagen wenig Neues zu berichten.
Gleich werden wir die Heilige Messe zum Hochfest Christi Himmelfahrt an Deck des Flaggschiffs von Kommandant Grijalva feiern. Wir ankern in einer Bucht, die ich nachher auf meiner Karte verzeichnen werde. Ich denke, ich nenne sie zu Ehren des Herrn und heutigen Festtages „Bucht der Himmelfahrt“.
Morgen segeln wir Richtung Norden weiter, um dort an der Küste entlang unser Glück zu versuchen. Hoffentlich gelingt es uns bald, Kontakt zu den Menschen hier aufzunehmen. Ich bin wissbegierig, was wir von ihrer Lebensweise erfahren können.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 20. Mai 1518
Wir haben eine Landzunge umfahren und segeln weiter Richtung Westen. Eine Handvoll unbewohnter Inseln passierten wir ereignislos und die Stimmung der Mannschaft verschlechterte sich zunehmend. Das Wetter in den letzten Tagen war drückend heiß und keine Abkühlung durch einen Regenschauer in Sicht. Unsere Vorräte gehen langsam zur Neige, Trinkwasser wird rationiert. Ein Landgang wäre dringend vonnöten, doch ohne Kenntnis dieses unbekannten Landes ist dies ein riskantes Unterfangen, was uns wertvolle Zeit kosten könnte. Hinter jeder nächsten Landzunge kann die lang ersehnte Flussmündung liegen, die das kostbare Trinkwasser verspricht.
Wir sahen in den letzten Tagen vermehrt winzige Siedlungen mit nur wenigen Hütten. Zwar flohen die Einwohner diesmal nicht, sondern beobachteten unsere kleine Flotte voller Neugier, aber der Aufwand und Zeitverlust eines Landganges ist zu groß. Ein trauriger Umstand, aber in unserer derzeitigen Situation kann ich dieses Vorgehen nachvollziehen.
Einzig erwähnenswert ist die Sichtung eines steinernen Turmes von durchaus beachtlicher Größe. Ich vermute, dass es eine Art Tempel zur Huldigung ihrer Götzen ist. Aussichtsplattformen oder Wehrgänge entdeckte ich keine, weshalb ich einen militärischen Zweck ausschließe. Selbst auf die Entfernung hin kann man leicht erahnen, dass diese Menschen in Sachen Bauwesen über beachtliche Fähigkeiten verfügen, obwohl sie sonst eher primitiv entwickelt zu sein scheinen.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 26. Mai 1518
Der Küstenverlauf führt uns Richtung Süden. Noch immer haben wir keinen Fluss ausmachen können. Anhand unseres zurückgelegten Weges schließe ich darauf, dass wir bislang eine große Halbinsel umrundet haben. Selbst am Horizont konnten wir in den letzten drei Wochen weder Berg noch Hügel erkennen, was die Tatsache, dass wir bislang keine Flüsse entdeckten, weniger überraschend erscheinen lässt. Aber wir halten es nicht mehr lange ohne Wasser aus. Wir brauchen dringend eine Lösung.
Kapitän de Alvarado äußerte unlängst, dass wir an der nächsten Siedlung landen werden, da die Menschen dort offensichtlich Zugang zu Trinkwasser haben müssen. Wenn sie es nicht freiwillig mit uns teilten, dann nähmen wir es uns gewaltsam. Eine Vorstellung, die ich ganz und gar vermieden sehen möchte. Ich habe mich nicht dieser Expedition angeschlossen, um einem fremden Volk als erstes mit Gewalt zu begegnen und sie anschließend auszurauben. Auch wenn es unsere Lage noch so verzweifelt sein mag.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 27. Mai 1518
Nun ist leider geschehen, was ich gestern bereits befürchtet hatte. Kaum hatten wir eine größere Siedlung entdeckt, steuerte Kapitän de Alvarado sein Schiff umgehend in Gefechtsposition und ließ eine Salve Kanonenschläge an den Strand regnen. Ausgehungert, durstig und mit plumpem Geschrei stiegen die Männer kampfeslustig in die Landungsboote und ruderten schwer bewaffnet mit Arkebusen und Säbeln Richtung Strand. Die Besatzungen der anderen Schiffe taten es ihnen nach kurzem Zögern gleich. Ich blieb an Bord der ‚San Sebastian‘. Die überraschten Einwohner schickten zwar ein paar Pfeilsalven auf unsere Leute, flohen aber nach kurzem Gefecht in die Wälder.
Als ich später hinzukam, lagen zahlreiche Tote und Verletzte am Strand. Hauptsächlich auf Seiten der Einwohner, doch auch unsere Soldaten waren nicht immun gegen die Pfeilspitzen, so dass wir viele Verletzte und einen Toten zu beklagen hatten. Nichts war geblieben vom Zauber der ersten Landung, den ich vor scheinbar unendlich langer Zeit erleben durfte.
Stattdessen erfüllten Schmerzensschreie, der Geruch frischen Blutes und Pulverdampf die Luft. Vorsichtig näherte ich mich einem abseits liegenden verletzten Eingeborenenkrieger. Er hatte eine schwere Wunde am Bauch und nicht mehr lange zu leben. In seinen Augen lag kein Hass, nur Traurigkeit. Ich versuchte, ihn zu beruhigen und mit ihm zu sprechen, ihn zu fragen, wo wir hier sind, obwohl ich ihre Sprache nicht verstand. Er antwortete in einer Klangfarbe, die ich nie zuvor gehört hatte. Mehrmals vernahm ich die Silben „Yuc a tan“, bevor er starb. Fortan soll diese Halbinsel so in meinen Aufzeichnungen vermerkt sein.
Später wurde ich Zeuge eines heftigen Wortgefechtes zwischen Kommandant Grijalva und Kapitän de Alvarado. Anscheinend war er mit der kriegerischen Vorgehensweise ebenfalls nicht einverstanden. Doch die meisten Männer waren zufrieden, dass sie Nahrung und Wasser hatten. Auf welche Art dies erreicht wurde, spielte für sie keine Rolle. Leider blieb es nicht nur bei den Vorräten. Die Anspannungen des Gefechts, in dem jeder Augenblick der Letzte sein konnte, und die Wut über die eigenen Opfer, ließ die Männer glauben, dass weitere Plünderungen als Entschädigung gerechtfertigt seien. Zwar besaßen die Eingeborenen nicht viel, was von Wert war, aber der Fund eines prachtvollen goldenen Armreifs - vermutlich gehörte er dem Anführer dieses Dorfes - machte rasch die Runde unter den Männern. Das Schmuckstück weckte die Aufmerksamkeit Kommandant Grijalvas, der ihn umgehend an sich nahm.
Der Blick eines Menschen verrät viel über seine Absichten. Das gierige Funkeln, das ich heute bei vielen sah, lässt mich nichts Gutes für unsere weitere Reise erahnen.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 31. Mai 1518
Die Kunde von unserem aggressiven Verhalten vor vier Tagen hatte sich in diesen Landen anscheinend herumgesprochen. Nachdem wir vom Ort der schändlichen Plünderung aufbrachen, segelten wir Richtung Süden. Wir entdeckten zwei weitere Siedlungen, die aber erst kürzlich verlassen worden waren. Heute dann erspähten wir viele kleinere dunkle Punkte am vor uns liegenden Strand. Genaueres erkannte ich aber nicht, da wir aufgrund der niedrigen Wassertiefe nur fernab der Küste fahren.
Wie sich kurz darauf herausstellte, waren es schmale, lange Boote aus Holz, die mit Kriegern besetzt auf uns zu steuerten. Erstaunlicherweise wurden sie nicht gerudert oder gesegelt. Stattdessen stachen die Männer mit einer Art breitem Holzbalken ins Wasser, um sich fortzubewegen. Dabei erreichten sie eine erstaunliche Geschwindigkeit, so dass sie schnell näher kamen. Die Kapitäne gaben das Signal zum Beidrehen in Gefechtsstellung. Kurz darauf erfüllten Kanonenschläge die Luft. Die Einschläge im Wasser schüchterten die Kämpfer merklich ein, bis schließlich eins ihrer Boote getroffen wurde und in tausend Splitter zerbarst. Sofort war ihr Kampfesmut erloschen und die Angreifer flohen, so schnell wie sie gekommen waren, wieder an Land.
Ich vernahm lautes Gelächter und Spottgesänge unserer Soldaten, die sich, ob der Überlegenheit in der Waffentechnik, unangreifbar fühlten. Die Eingeborenen sind im Kampf nur mit primitiven Messern, Speeren, Äxten, Schleudern sowie Pfeil und Bogen bewaffnet. Zum Schutz tragen sie simple Lederschilde, aber keinerlei Rüstungen. Gegen unsere geschmiedeten Waffen und Gewehre können sie nichts ausrichten.
Wir segelten unaufhaltsam gen Westen und passierten eine größere Siedlung. Ich vermute, dass von dort die Krieger stammten, die uns angegriffen hatten. Diese war jedoch ebenfalls menschenleer.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 2. Juni 1518
Endlich stießen wir auf eine Flussmündung! Mit Abstand die größte, die wir auf unserer Reise bisher entdeckt hatten. Der Fluss war breit und schiffbar, sodass Kommandant Grijalva den Befehl gab, flussaufwärts ins Landesinnere zu segeln. Es dauerte nicht lange, da stießen wir auf zahlreiche Einheimische, die an den Ufern Bäume fällten. Andere spitzten die Enden anschließend an. Ich hatte den Verdacht, dass sie im Begriff waren, Wehranlagen zu errichten. Und es bestand für mich kein Zweifel, dass sie sich gegen uns richteten, da ich bislang keinerlei derartige Bauten gesehen hatte. Wer wollte es ihnen verdenken?
Sobald sie uns entdeckten, brach Hektik unter den Arbeitern aus, wilde Gesten und laute Rufe wurden in unsere Richtung geschleudert. Selbst ohne Kenntnis ihrer Sprache wusste ich, dass dies mit Sicherheit keine freundliche Begrüßung bedeutete.
Es dämmerte, als das Signal zum Ankern gegeben wurde. Die Kapitäne der drei Begleitschiffe wurden zu Kommandant Grijalva gerufen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ich kann nur hoffen, dass man beschlossen hat, sich den Bewohnern nun in Frieden zu nähern und zukünftige Kampfhandlungen ausbleiben. Auch wenn wir militärisch weit überlegen sind, so sitzen wir in diesem Fluss doch in der Falle. Wenn die fremden Krieger die Oberhand gewinnen sollten, könnten wir nicht aufs Meer hinaus fliehen. Auf Gnade dürften wir nach unseren Taten wohl nicht zu hoffen wagen. Verdient hätten wir ohnehin keine.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 3. Juni 1518
Kaum war der Morgen angebrochen, näherten sich von beiden Seiten des Flusses zahlreiche der bekannten Langboote und kreisten uns ein. Ich konnte sie nicht alle zählen, aber es schienen wohl an die hundert, vollbesetzt mit bewaffneten Männern. Ich schätze, dass sie uns an Mannstärke etwa um das Zwanzigfache überlegen waren. Wenn jetzt ein Schuss fiele, wäre ein Blutbad unausweichlich und unser Tod gewiss.
Bange Augenblicke vergingen. Keiner wusste, was passieren würde. Ich weiß nicht genau, wie sie sich verständigten, doch irgendwann wurde ich gerufen, Kommandant Grijalva und einige Offiziere an Land zu begleiten. Wir sollten uns mit dem Anführer der Eingeborenen treffen. Endlich war es soweit! Wir standen im Begriff, zum ersten Mal unter zivilisierten Umständen Kontakt zu dem uns unbekannten Volk aufnehmen. Mit zitternden Händen und weichen Knien stieg ich ins Beiboot. Die Ruderschläge, die uns an Land trugen, kamen mir schwerfällig vor und es schien mir eine Ewigkeit, bis wir endlich die Fremden begrüßten.
Im Nachhinein betrachtet war meine Ungeduld wohl etwas naiv, schließlich hätten sie uns töten können, um unserer Truppe mit einem Streich die Anführer zu nehmen. Doch soweit kam es zum Glück nicht.
Ihr Anführer trug einen Kopfschmuck, der vermutlich als eine Art Krone fungierte und seine höhere Stellung symbolisierte. Er war mit zahlreichen farbenfrohen Federn geschmückt, die von Vögeln stammten, die ich nie zuvor gesehen hatte. Außerdem besaß er einen umhangartigen Überwurf aus einem gelblichen Fell mit schwarzen Tupfen - wohl von einem einheimischen Tier - sowie goldene Armreifen, ähnlich denen, die wir in dem Dorf vor ein paar Tagen fanden. Ansonsten hatte er, wie auch seine wachsame Leibgarde, bis auf einen Lendenschurz nur wenig am Leib, was wir als Kleidung bezeichnen würden. Sein gestählter Körper war von unzähligen Narben gezeichnet, die ihn als kampferprobten Krieger auswiesen, der sich den Respekt seiner Männer in zahlreichen Schlachten verdient hatte.
Der Austausch mit den Ureinwohnern gestaltete sich schwierig, da niemand die Sprache des anderen verstand. Mit großen Gesten und einfacher Zeichensprache gelang es dann doch, sich einander mitzuteilen. Ich schnappte fremdartige Wortlaute auf, die ich mir bekannten Begriffen zuzuordnen versuchte, was mir nicht so recht gelingen wollte. Doch in einem war ich mir sicher: Dieses Volk bezeichnet sich selbst als „Maya“, und so werde ich sie in Zukunft auch benennen.
Schließlich versuchten sich beide Parteien am Tauschhandel, denn jeder war neugierig, was das jeweils fremde Volk vorzuweisen hatte. Kommandant Grijalva zog den goldenen Armreif hervor und gab dem Häuptling zu verstehen, dass er mehr davon haben wollte. Freudig ließ dieser einen seiner Männer aussenden. Im Gegenzug bot er dem Häuptling etwas Essgeschirr und silberne Kerzenständer an. Doch daran bestand wenig Interesse, denn der Blick des Stammesführers klebte an der halbvollen, dunkelgrünen Rumflasche, die einer der Offiziere mitgenommen hatte, um vielleicht nicht nüchtern in den Tod zu gehen, den er zu befürchten schien.
Der Maya deutete mehrmals darauf, um zu verdeutlichen, dass er danach verlangte. Schließlich befahl Kommandant Grijalva dem Offizier, sie auszuhändigen, der sie nur widerwillig herausrückte. Doch der Häuptling war weniger am Rum als an der Flasche interessiert, denn sogleich schüttete er den Inhalt aus, begleitet vom erschrockenen Blick des Vorbesitzers, und betrachtete sie staunend von allen Seiten. Prüfend hielt er sie ins Licht und lächelte nach abgeschlossener Betrachtung zufrieden. Kurz darauf kam der Ausgesandte mit einem Lederbeutel zurück und übergab ihn Kommandant Grijalva. Mit großen Augen und offenen Mündern durchsuchten die Männer den Beutel und entdeckten goldene Halsketten, Ringe, Schalen und kunstvoll gearbeitete Figuren. Lachend setzte der Häuptling Kommandant Grijalva einen goldenen Stirnreif auf.
Auch ich kann nicht leugnen, dem Glanz des Geschmeides für einen Augenblick erlegen zu sein. Vor uns lag ein Haufen Gold, von dem sich eine Familie in Spanien ihr ganzes Leben lang hätte ernähren können. Man einigte sich darauf, dass sechs der dunkelgrünen Glasflaschen ein angemessenes Geschäft wären. Sechs Flaschen Rum für ein ganzes Vermögen!
Natürlich gab Kommandant Grijalva zu verstehen, dass er noch mehr vom Gold verlangte. Doch dies konnte oder wollte ihm der Häuptling nicht erfüllen, deutete aber immer wieder nach Westen und dann auf das Gold. Gab es dort ein Land, das noch reicher ist als dieses? Ich brauche kein Hellseher zu sein, um zu wissen, wohin unsere Reise weitergeht.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 4. Juni 1518
Wir segeln flussabwärts Richtung Meer, um uns dort nach Westen zu wenden. Die Stimmung auf unseren vier Schiffen war ausgelassen. Immer wieder ließen die Männer den Kommandanten hochleben. Nicht nur, dass er sie friedlich aus dieser brenzligen Situation befreit hatte; er hatte zusätzlich einen Haufen Gold für einen geradezu lächerlichen Gegenwert eingetauscht. Lange wird es an den Ufern jenes Flusses Geschichten über die Taten von Juan de Grijalva geben. „Rio Grijalva“ erscheint mir ein durchaus passender Name. Diese Ehre hatte er sich mehr als verdient.
Nur Kapitän Alvarado wollte die ausgelassene Stimmung nicht teilen. Immer wieder schimpfte er auf Grijalva und warf ein, dass man mehr Gold aus den Mayas hätte pressen sollen. Er war überzeugt, dass sie noch viel mehr davon besaßen, aber zu geizig waren, es uns zu geben. Notfalls müsse man sie mit Gewalt dazu zwingen, so seine Worte.
Ich bin froh, dass Kommandant Grijalva hier die Befehle gibt und deutlich mehr Sinn für Diplomatie aufbringt. Ich muss immer wieder über diesen ungleichen Handel nachdenken. Erkennen die Mayas ihren eigenen Reichtum nicht? Oder stufen sie andere Werte höher ein?
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 12. Juni 1518
Immer Richtung Westen führte unser Weg. Heute machten wir Halt an einem Ort, der uns durch auffällige Gebäude in Erinnerung blieb. Ich erkannte zahlreiche der steinernen Türme, die wir schon einmal gesehen hatten. Interessanterweise waren nur wenige Menschen hier, die bei unserer Landung sofort das Weite suchten. Wohnbehausungen erkannte ich keine und bei näherer Betrachtung der steinernen Monumente hielt ich es für eine Art Kult- oder Begräbnisstätte. Schlanke Türme aus Stein, ähnlich eines Obelisken, mit kunstfertigen Reliefs verziert, auf denen Köpfe eines Hundes oder einer Katze gemeißelt waren. Kleine Pyramiden mit Einbuchtungen für Opfergaben gab es ebenfalls zu entdecken. Besonders fielen mir die fein gearbeiteten Schnitzereien auf einem dunkelgrünen glänzenden Material ins Auge. Es war glatt und spiegelte, ähnlich wie mattes Glas. Könnte das der Grund für das große Interesse der Mayas an unseren Rumflaschen gewesen sein? Ist es ihnen sogar heilig, wenn sie es hier an diesen Orten verwenden? Eine gewisse Ähnlichkeit kann ich nicht abstreiten, doch die Unterschiede sind deutlich erkennbar, zumindest wenn man den Umgang mit Glas gewohnt ist.
Leider wurde mein Erkundungsausflug in die Kulte der Eingeborenen jäh unterbrochen, als ich einen weiteren handfesten Streit zwischen Kapitän Alvarado und Kommandant Grijalva vernahm. Kapitän Alvarado murrte lautstark, dass wir doch auf der Suche nach Gold seien und nicht unsere Zeit mit Steinhaufen verschwenden sollten. Kommandant Grijalva wies ihn entschieden zurecht; er habe Befehle zu befolgen und seine Entscheidungen nicht in Frage zu stellen. Dennoch stimmte er zu, dass hier an diesem Ort nichts von Wert sei und man umgehend wieder aufbreche.
Schade, ich hatte Kommandant Grijalva für einen weitsichtigeren Mann gehalten. Gern hätte ich mich länger hier umgesehen. So viel kann man über dieses Volk lernen, wenn man nur mit offenen Herzen und wachen Augen ihre kulturellen Errungenschaften betrachtet. Sind sie doch gänzlich anders als die unseren.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 15. Juni 1518
Einschneidende Ereignisse haben diesen Tag geprägt, doch will ich von vorn beginnen.
Wir entdeckten eine Flussmündung, ähnlich der des Rio Grijalva. Doch diesmal war sie nicht - wie wir vermuteten - das Ende eines großen Stroms, sondern stellte sich als riesige Lagune heraus, die mehreren Flüssen oder Seen als Mündung diente. Kommandant Grijalva gab das Zeichen zum Ankern, um Kundschafter auszusenden. Ich begab mich in meine Stube, um neues Zeichenpapier für die Kartographierung zu holen, als es passierte.
Unser treues Schiff, die San Sebastian nahm plötzlich Fahrt auf. Überrascht ging ich an Deck und stellte fest, dass Kapitän Alvarado den Befehl zum Weitersegeln gegeben hatte. Mit den Worten, „Ich will keine Zeit mehr verlieren“, hielt er Kurs auf die Mündung eines schiffbaren Flusses.
Erst vier Stunden später hatten uns die restlichen drei Schiffe unserer Flotte eingeholt. Kommandant Grijalva verlangte, an Bord zu kommen, um eine Unterredung mit Pedro de Alvarado zu führen. Zu zweit zogen sie sich in die Kapitänskabine zurück, doch das Gebrüll der beiden Männer war für alle zu hören. Kapitän Alvarado beklagte sich über die zögerlichen Befehle und mangelnde Entscheidungsfreude; im Gegenzug fuhr ihn Kommandant Grijalva an, dass er ein Risiko für die gesamte Expedition sei und sich unverantwortlich allen Beteiligten gegenüber zeige.
„Ihr werdet auf der Stelle mitsamt Schiff und Mannschaft nach Kuba zurückkehren und nicht mehr Teil dieser Erkundungsfahrt sein! Von nun an segeln wir mit drei Schiffen weiter“, vernahm ich von der anderen Seite der Tür. Kommandant Grijalva verließ daraufhin wortlos das Deck. Ich weiß nicht, ob ich ihn jemals wiedersehen werde.
Das aufgeregte Gemurmel der Mannschaft verstummte, als nach einer Weile Kapitän Pedro de Alvarado an Deck trat. Trotzig verkündete er, dass wir auf dem schnellsten Wege nach Santiago de Kuba heimkehren würden. Dort werde man uns einen triumphalen Empfang bereiten, wenn wir von den Entdeckungen der Goldschätze berichteten. Beweise, er hielt eine Handvoll der ertauschten Schmuckstücke hoch, und Aufzeichnungen, dabei deutete er auf mich, hätten wir genug.
Ich kann nicht sagen, ob ich glücklich oder traurig darüber bin. Einerseits freue ich mich, bald nach Hause zu kommen und endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu haben; andererseits blicke ich wehmütig den drei verbliebenen Schiffen um Kommandant Juan de Grijalva nach. Wahrscheinlich werden sie viele lehrreiche Begegnungen mit den Maya haben.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 25. Juli 1518
Kapitän Pedro de Alvarado behielt Recht. Unser Empfang in Santiago de Kuba war triumphal. Gouverneur Diego Velazquez de Cuellar war hellauf begeistert von den Schilderungen der Ereignisse. Besonders bei der Stelle, an der wir das Gold eingetauscht hatten, lachte er lauthals auf. Mit einem wohlbekannten Funkeln in den Augen hakte er mehrmals nach, um alles über die Herkunft der Schätze zu erfahren. Kapitän Alvarado drehte und bog die Ereignisse in seinen Schilderungen so geschickt, dass Gouverneur Velasquez ihm die Lorbeeren der Reise zusprach und Kommandant Grijalva wie ein weinerlicher Zauderer dastand. Meine Sicht der Dinge war eine gänzlich andere, doch im Rausch des Goldes hatte der Gouverneur kein Interesse mehr an meinen Schilderungen.
Die Hoffnung auf festen Boden muss ich allerdings aufschieben. Ich sitze im Augenblick an Bord eines Handelsschiffes in Richtung Spanien. Mit dem goldenen Armband des Häuptlings im Gepäck, mit meinen Berichten und Karten soll ich umgehend nach Madrid an den Königshof reisen, um seiner Majestät König Carlos I. Bericht zu erstatten. Ich kann nicht in Worte fassen, welche Ehre das für mich ist.
Tagebuch des Pepe Iboja, Eintrag vom 21. September 1518
Dies ist der letzte Eintrag in meinem Tagebuch und erneut sind unerwartete Ereignisse die Ursache. Die Audienz bei König Carlos I. war ein großes Erlebnis für mich. Vielleicht das größte meines Lebens. Ich war so nervös wie nie zuvor, als ich die Geschehnisse der Reise schilderte, doch dessen schäme ich mich nicht. Aufmerksam lauschte der König meinen Ausführungen, betrachtete interessiert das mitgebrachte Schmuckstück und studierte die von mir gezeichneten Karten. Die Zwischenfragen beantwortete ich Seiner Majestät nur allzu gern.
Als die Audienz zu Ende ging und ich mich verabschiedete, bemerkte der König das kleine, ausgefranste Tagebüchlein in meiner Tasche. Auf die Frage, was dies sei, antwortete ich wahrheitsgemäß. Er fragte, ob dies die Tage der Expedition umfasse, was ich ebenfalls bejahte. Ich kann es immer noch nicht fassen, dass er mich anschließend fragte, es behalten zu dürfen. Ihn würden meine inneren Ansichten mehr interessieren als ein wohlformulierter Vortrag bei einer Audienz. Respektvoll gestand er mir eigene Bedingungen zu, falls ich dem zustimmte, schließlich sei es ein persönlicher Gegenstand. Zudem versicherte er mir, dass es immer in seinem privaten Besitz bliebe und ich keinerlei Konsequenzen zu erwarten habe, egal, was dort geschrieben stünde. Wie hätte ich ihm diesen Wunsch abschlagen können…
So sitze ich hier am Schreibtisch des Königs und verfasse die letzten Zeilen. Denn dies war meine Bedingung. Ich wollte einen Abschluss schreiben, bevor ich mein Werk in erlauchte Hände gebe. Allein die Vorstellung, dass mein König sich für die Gedanken eines unbedeutenden Schreibers - meine Gedanken - je interessieren könnte, macht mich sprachlos. Etwas Größeres gibt es für mich nicht.
Anno Domini 1695
1. Kapitel
Madrid, Spanien
Laut keifte eine Frauenstimme aus einem Zimmer des Königsschlosses. Ihr Schall bahnte sich seinen Weg entlang durch einen Kuppelgang mit kunstvollen Mosaiken aus Flechtbändern und Rauten bis hinaus ins Freie. Dort übertönte er das sanfte Plätschern des Wasserspeiers, das bislang die einzige Geräuschquelle an diesem sonnigen Frühlingstag war. Eine Magd, die den großen Säulengang rund um den Garten im Innenhof kehrte, horchte kurz auf, war aber nicht überrascht. War es doch ein Umstand, der in der letzten Zeit immer häufiger vorkam. Es musste die Königin sein, die wieder einmal im Streit mit ihrem Ehemann lag. Maria Anna von Pfalz-Neuburg, Gemahlin von Carlos II. und Königin von Spanien, war außer sich. Ihre gewöhnlich blasse Haut war vor Aufregung gerötet und ihr schmales Gesicht mit der spitzen Nase ließ sie wie einen Raubvogel auf der Jagd nach Beute erscheinen. In diesem Fall war das Opfer ihr eigener Ehemann.
„Das Bild kommt weg“, schrie sie. Ihre Stimme überschlug sich und der Akzent ihrer deutschen Muttersprache ließ ihre Worte härter klingen.
„Und es kümmert mich nicht, dass es die Tradition so verlangt. Es ist eine Beleidigung für mich und unsere Ehe!“
Dabei deutete sie energisch auf ein kunstvoll gefertigtes Porträt, das an der Wand neben vielen weiteren hing. Das Bild zeigte eine anmutige schlanke Frau in einem schwarzen Festtagsgewand mit goldbestickten Verzierungen. Ihre langen dunklen Haare fielen akkurat über die unbedeckten Schultern, während sie dem Betrachter ein freundliches Lächeln entgegenwarf. Eine Plakette aus Messing wies sie als Marie Louise d’Orléans aus.
„Solange deine verstorbene erste Frau hier hängt, denkst du nur an sie! Aber ich bin nun einmal diejenige, welche die undankbare Aufgabe hat, einem entstellten Mann wie dir einen Erben schenken zu müssen. Falls du dazu überhaupt in der Lage bist.“
Sie wirbelte herum und verließ den Saal, ohne die Antwort ihres Gatten abzuwarten.
„Das Bild bleibt hängen. Ich will es so.“, seufzte König Carlos leise, als Maria Anna längst gegangen war.
In den Vorstellungen der Leute auf dem Land, die ihren König ihr ganzes Leben nicht zu Gesicht bekamen, war er ein stolzer Herrscher, dem die Treue seiner Untertanen gewiss war. Die stattliche Statur musste respekteinflößend sein und wenn er mit voller Stimme sprach, verstummten alle Geräusche, um seinen weisen Worten Gehör zu schenken. Doch die Wirklichkeit konnte nicht weiter davon entfernt sein. Schon als Kleinkind war er oft krank gewesen und in der Entwicklung hinter seinen Altersgenossen weit zurück. Von Geburt an hatte er einen vorgeschobenen Unterkiefer, was ihm Schwierigkeiten beim Sprechen und Kauen bereitete. Mit seinem hageren Körperbau, den schulterlangen, glatten braunen Haaren und großen Augen, wirkte er wie ein Kind im Körper eines Erwachsenen. Hatten seine Ahnen stolze Beinamen wie „der Schöne“ oder „der Gerechte“, sprach man hinter vorgehaltener Hand über ihn nur als „der Verhexte“.
Carlos war traurig. Er sehnte sich nach seiner verstorbenen Gemahlin. Sie war eine der wenigen Menschen gewesen, die Liebe für ihn empfunden hatte. Während er vor sich hin träumte, lief ihm ein Speichelfaden aus seinem verzerrten Mundwinkel, den er hastig mit einem zerknitterten Seidentüchlein abtupfte. Es passierte, wenn er das Schlucken vergaß, besonders aber in Momenten großer Aufregung. Gerne hätte er beschwichtigende Worte gewählt, um mit seiner neuen Frau nicht im Streit auseinanderzugehen, doch fielen sie ihm immer viel zu spät ein. Allgemein sprach er wenig. Aufgrund des schiefen Mundes verstanden ihn seine Gesprächspartner, wenn überhaupt, nur schlecht. Wenn er nicht wieder von Krankheit geplagt wurde, was selten genug vorkam, fiel es ihm schwer, sich in schwierigere Themen einzuarbeiten oder den Berichten der Bittsteller zu lauschen. Meist konnte er ihre Anliegen nur bedingt nachvollziehen, alles erschien ihm immer so kompliziert. Er saß dann auf dem Thron im Audienzsaal, nickte, und versuchte ein aufmerksames und zugewandtes Bild abzugeben. Meist überließ er die Regierungsaufgaben seiner ehrgeizigen Frau und dem Stab aus Ministern und Beratern. Lieber zog er sich zurück und lauschte den Klängen der Hofmusiker, wenn sie Harfe, Cembalo oder Zimbel spielten.
Diesmal führte ihn sein Weg aber in die königliche Bibliothek, wo er seinen größten Schatz aufbewahrte, ein Buch, das ihm Trost und Heiterkeit in schwierigen Stunden spendete. Der Raum wirkte trotz des helllichten Tages und der großen Fenster immer ein wenig düster, was vor allem an den deckenhohen Regalen aus Birnenholz lag. Zielsicher steuerte er das gesuchte Fach an und nahm vorsichtig das kleine Büchlein heraus. Der dunkle Ledereinband lag kühl in der Hand. Er war abgegriffen und hatte an ein paar Stellen die Farbe verloren. Die vergilbten Seiten zeugten ebenfalls davon, dass dieses Werk sehr alt und mit Vorsicht zu behandeln war. Nachträglich war vor einigen Jahrzehnten noch ein Titel in goldenen Lettern in den Einband geprägt worden: „Reisetagebuch des Pepe Iboja“. Er setzte sich in einen großen, weich gepolsterten Sessel und schlug ehrfurchtsvoll die erste Seite auf. Als er zu lesen begann, sah er vor seinem inneren Auge die fernen Länder, fremden Völker, unerschrockenen Abenteurer und goldenen Schätze, die den Reichtum seines Reiches begründeten.
2. Kapitel
Port Royal, Jamaika
Die dicken Tropfen eines heftigen Wolkenbruchs hatten die lehmigen Straßen und Gassen in kürzester Zeit aufgeweicht. Erste Pfützen bildeten sich. Die Dämmerung hatte eingesetzt und niemand war bei diesem Wetter vor der Tür, nur aus einigen Fenstern schien schwaches Licht nach draußen. Mit schnellen Schritten stürzte eine schmächtige Gestalt aus dem Wirtshaus hinaus ins Freie und bog sofort auf die Straße, ohne ihr Tempo zu verringern. Auf dem rutschigen Untergrund geriet sie ins Straucheln, fing sich und beschleunigte umgehend wieder ihre Schritte. Gleich hinter ihr polterte ein großgewachsener Mann aus der Türe der Schänke und wollte sogleich die Verfolgung aufnehmen. Aber er unterschätzte die Gefahr des Untergrundes. Er rutschte aus und fiel der Länge nach in eine Pfütze, sodass er mit einem Schlag von Kopf bis Fuß nass war. Unter heftigem Gezeter setzte er der Gestalt wieder nach, die jedoch durch das Malheur ihren Vorsprung hatte ausbauen können.
„Sofort stehen bleiben! Haltet den Dieb!“, keuchte der Mann.
Doch es war niemand in der Nähe, der ihn hätte hören oder zu Hilfe eilen können. Das Regenwasser lief ihm in die Augen und behinderte seine Sicht. Etwas verschwommen sah er gerade noch, wie die Person seitlich auf ein eingestürztes Haus zuhielt und flink über einen Haufen Schutt aus Steinen und Holz kletterte. Ihr Ziel war ein mannshoher Spalt in der verbliebenden Rückwand des Gebäudes, der auf eine weitere Straße führte. Fluchend tat er es ihr gleich, er hatte keine Zeit zu verlieren. Mit großen Schritten machte er sich daran das Hindernis aus gebrochenen Steinen und geborstenen Balken zu überwinden. Doch sein Fuß verhakte sich. Er verlor das Gleichgewicht und prallte mit der Hüfte auf eine steinerne Kante. Ein Fehler, der schmerzhafte Folgen hatte. Humpelnd erreichte er den Spalt in der Wand und sah im letzten Augenblick, wie sich der Dieb mit der Beute auf und davon machte. Eine weitere Verfolgung erschien sinnlos. In den Gassen, bei schlechter Sicht und mit schmerzender Hüfte war es aussichtslos, seine hart verdienten Reales wieder zu bekommen.
„Na warte, Bursche, wenn ich dich in die Finger kriege, dann…“, drohte er mit der Faust noch hinterher.
Mit schmerzverzerrter Miene machte er sich fluchend auf den Rückweg, vorbei an eingestürzten Häusern und Haufen aus Schutt. In besseren Tagen waren dies Wohnhäuser wohlhabender Männer gewesen, doch jetzt waren es nur noch Ruinen, wie so vieles in dieser Stadt.
Linda Ashworth-Thomas lag der lederne Beutel schwer in der Hand und er hatte es spürbar schwieriger gemacht, das Gleichgewicht zu halten, als sie soeben den Berg aus Schutt bezwungen hatte. Doch diese Einschränkung hatte sie nur allzu gern in Kauf genommen, bedeutete sie doch einen vollen Magen für die nächsten Tage oder, mit etwas Glück, sogar Wochen. Das würde sie herausfinden, sobald sie im Versteck die Beute zählte. Die Hälfte davon musste sie später an ihren Komplizen Tom abgeben, der vorhin so vortrefflich den Mann im Wirtshaus abgelenkt hatte. Anschließend war es ein Leichtes gewesen, dem unvorsichtigen Händler den Beutel vom Gürtel zu schneiden. Doch das kleine Messer, das sie dafür immer benutzte, war alt und nicht mehr das schärfste, sodass der Mann den Beutezug zu früh bemerkte und sie um ein Haar gepackt hätte. Nur knapp war sie seinem Griff entkommen und hatte auf die Straße fliehen können. Eine gehörige Tracht Prügel wäre da die mildeste zu erwartende Bestrafung gewesen. Zum Glück hatte sie sich wieder einmal auf ihre flinken Beine verlassen können.
Aber wieso sollte Tom jedes Mal die Hälfte der Beute bekommen? Klar, er war es, der die Ziele auskundschaftete und dann den Lockvogel spielte. Immerhin war er vier Jahre älter als sie und sah schon ziemlich erwachsen aus, was die meisten Opfer keinen Verdacht schöpfen ließ, wenn er sie in belanglose Gespräche verwickelte und den Betrunkenen spielte. Aber das Risiko, auf frischer Tat ertappt zu werden, trug am Ende sie, während er immer den Unwissenden mimen konnte. Diesmal wollte sie ein paar Münzen für sich zur Seite schaffen, bevor sie Tom im Versteck traf. Die letzte Warnung, die ihr Verfolger ihr hinterher gebrüllt hatte, klang ihr noch in den Ohren. Hatte er sie ‚Bursche‘ genannt? Sie musste grinsen. Ich bin doch aber ein Mädchen, fast schon eine richtige Frau, dachte sie bei sich. Sie war vollkommen durchnässt und die Kleidung klebte ihr eng am Körper, als sie den Weg zu ihrem Versteck einschlug.
Ihr Ziel waren die Überreste eines ehemaligen Lagerhauses am Rande des zerstörten Hafenviertels von Port Royal. Das Resultat der Katastrophe von vor knapp drei Jahren. Hierhin verirrte sich kaum jemand. Nur einige Waisenkinder, die ihre Eltern in den Fluten des Tsunamis verloren hatten, fanden ihre Heimat in den Ruinen der Gebäude. Eines von ihnen war Linda. Von der einst blühenden Stadt war nur ein Trümmerhaufen geblieben. Die unbändige Naturgewalt hatte Tod und Zerstörung gebracht und verheerende Folgen gehabt. Weil der sandige Untergrund, auf dem sie erbaut worden war, keinen Widerstand leisten konnte, war die halbe Stadt fortgerissen und ins Meer gespült worden. Die Zeiten, in denen einige ehrbare Kaufleute und viele weit weniger ehrbare Piraten, Diebe, Mörder und andere Halunken, ihren Reichtum im berüchtigten Port Royal zur Schau stellten und mit vollen Händen ausgaben, waren lange vorbei. Der Trubel auf den Straßen, das Gegröle und Geschrei in den Tavernen und Dirnenhäusern war mit einem Mal verstummt. Fortgespült von den Fluten des Meeres, das sie einst reich gemacht hatte. Wer nicht, wie viele Tausende an jenem Tag, gestorben war, war geflohen und nie mehr zurückgekehrt.
Als sie bei den Ruinen ankam und ihren angestammten Platz erreichte, zog sie ihre nasse Kleidung aus und legte sie sorgfältig zum Trocknen unter dem noch überdachten Teil aus. Der Wind peitschte den Regen durch die offenen Wände der Mauerüberreste. Sie fröstelte und beeilte sich, eine Decke aus zusammengenähten Stoffresten überzuwerfen. Sie musste wieder an den Mann denken, der sie für einen Jungen gehalten hatte. Obwohl ihre erste Monatsblutung eine Weile zurücklag, hatten die zarten Brüste erst vor kurzem sichtbar zu wachsen begonnen. Sie war ein bisschen stolz darauf, auch wenn die meisten anderen Mädchen in ihrem Alter weiter entwickelt waren. Ihr ansonsten drahtiger Wuchs und die kurzen struwweligen schwarzen Haare trugen ihr Übriges dazu bei, dass ihr Geschlecht oft verwechselt wurde.
Es würde eine Weile dauern, bis Tom zurückkehrte und von den anderen Waisenkindern war nichts zu sehen, wahrscheinlich hatten sie sich zum Schutz vor dem Wetter in die hintersten Ecken verkrochen. Sie setzte sich auf eine trockene Stelle und blickte durch ein Stück der eingestürzten Seitenwand aufs Meer hinaus. Der Stein war kalt. Sie schauderte. Hoffentlich würde er bald die Wärme ihres Körpers annehmen und es etwas angenehmer machen. Im Wasser sah sie Spitzen von aufragenden Steinplatten und hölzernen Balken. Es musste bald Ebbe sein, denn nur bei Niedrigwasser konnte man den versunkenen Teil der Stadt sehen und sogar betreten, wenn auch nur für wenige Stunden. Dort fing man dann in den Pfützen zwischen den Steinen Krabben, Muscheln und Fische, die einem den Magen füllten. Der Weg durch die algenbewachsenen Überreste war jedoch mühselig und gefährlich. Eine Unachtsamkeit reichte aus, um auszurutschen und sich den Knöchel zu verstauchen oder schmerzhafte Abschürfungen zu erleiden. Zum Glück hatte sie das für die nächsten Tage nicht mehr nötig.
Ab und zu nahm sie das Risiko auf sich, um zu der Stelle zu gelangen, wo einst die Werkstatt ihres Vaters gestanden hatte. Er war ein angesehener und fähiger Schiffszimmermann, der in guten Zeiten sogar einige Gesellen zur Anstellung gehabt hatte. Damals gab es mehr als genug zu tun, wenn die Freibeuter von ihren Kaperfahrten zurückkehrten, im Hafen anlegten und ihre ramponierten Schiffe auf Vordermann gebracht haben wollten. Oft hatte sie ihn als Kind dabei beobachtet, wie er mit den sonderbarsten Gestalten über den Preis feilschte. Von rauen, ungewaschenen Männern mit fehlenden Armen und Holzbeinen, die durch ihre Zahnlücke Lieder pfiffen bis hin zu Schönlingen, die sich, in allerlei bunte Tücher gehüllt, benahmen wie der König von England höchstselbst. Sie alle benötigten die Dienste ihres Vaters. Als sie älter war, half sie ihm dabei, Zapfen und Nieten zu sortieren oder die Planken mit warmem Pech zu bestreichen. ‚Kalfatern‘ nannte ihr Vater das immer, es diente zur Versiegelung. Sie konnte Klinker- von Kraweelbau unterscheiden und wusste, welche Vor- und Nachteile diese jeweils hatten. Ihr Vater lachte jedes Mal, wenn sie wieder mithelfen wollte und versuchte dann, sie zurück zur Mutter in die Küche zu schicken. Das sei keine Arbeit für ein Mädchen, hatte er stets gemahnt, ließ sie aber meistens gewähren.
An ihrem zehnten Geburtstag, dem letzten, den sie zusammen feiern konnten, schenkte er ihr einen selbstgeschnitzten Anhänger in Form eines Fisches, der an einem Lederriemen befestigt war. Vier Jahre war das her. Sie trug ihn noch immer als Kette um den Hals, er war ihr wertvollster Besitz. Um kein Geld der Welt hätte sie ihn verkauft oder eingetauscht, so groß könnte ihr Hunger niemals sein. Er war nicht größer als der Daumen eines Kindes und doch so kunstvoll gefertigt, dass man sogar kleinste Details wie Schuppen, Augen und Zähne erkennen konnte. Sie griff unbewusst danach, als ihr eine Träne über die Wange lief. Es war das Einzige, was von ihrer Familie geblieben war. Glatt poliert lag er warm und weich in der Hand und ein beruhigendes Gefühl von Geborgenheit ergriff sie.
„Welch schöner Anblick zu später Stunde!“, riss sie plötzlich eine laute Stimme aus ihren Gedanken.
Tom war zurückgekehrt und Linda wusste nicht sofort, was er damit sagen wollte. Sein schiefes Grinsen verriet ihr aber, dass er nicht den Sonnenuntergang gemeint haben konnte. Hastig sprang sie auf und schlang die Decke enger, doch Tom winkte nur lachend ab.
„Lass nur, ist schließlich nicht das erste Mal, dass ich dich nackt sehe“, zwinkerte er. „Jetzt mach nicht so ein Gesicht, das verzieht nur deine süßen Sommersprossen“, feixte er. Doch rasch verfinsterte sich seine Miene, als er ernst fragte: „Wo ist die Beute? Hast du sie schon gezählt?“
Sein Lächeln war plötzlich verschwunden. Linda schüttelte den Kopf und deutete mit dem Kinn auf den Platz, an dem ihre nassen Sachen lagen. Prüfend hob Tom den ledernen Beutel und wog ihn so in der Hand, dass die Münzen im Inneren verheißungsvoll klimperten. „Mir scheint, er ist etwas kleiner und leichter geworden, seitdem ich ihn zum letzten Mal am Gürtel des Kaufmanns sah, was meinst du?“
„Als ob du das beurteilen könntest, du hast ihn ja gerade zum ersten Mal in der Hand“, entgegnete Linda trotzig.
Tom ignorierte den Einwand und fragte scharf: „Du hast also nicht zufällig etwas für dich selbst herausgenommen und versteckt?“
„Wo zum Teufel soll ich hier in dieser Bruchbude irgendetwas verstecken?“ Linda fühlte sich ertappt, zwang sich aber zur Ruhe. Sie durfte sich nichts anmerken lassen. Tom musterte sie eindringlich von oben bis unten. Im Blick seiner dunklen Augen erkannte sie ein gieriges Flackern.
„Ich denke, ich werde dich durchsuchen müssen.“
Er machte einen Schritt auf sie zu, während er seine Hand in Richtung ihrer Taille ausstreckte.
„Lass mich in Ruhe“, entgegnete Linda unwirsch und wich von den grabschenden Fingern zurück.
Tom hatte offenbar nicht mit Widerstand gerechnet.
„Du könntest etwas mehr Dankbarkeit zeigen für die Dinge, die ich für dich getan habe!“, fuhr er sie an. „Die anderen Mädchen hier zeigen sich deutlich erkenntlicher, wenn ich ihnen die Möglichkeit gebe, sich ein paar Münzen zu verdienen. Schließlich könntet ihr stattdessen auch im Dirnenhaus arbeiten, aber die Gäste dort werden nicht so freundlich sein wie ich es bin.“
„Du bekommst immer deinen Anteil, also lass mich in Ruhe“, erwiderte Linda mit zitternder Stimme.
„An deiner Stelle wäre ich in Zukunft etwas respektvoller. Ohne mich wäre euer Leben, oder wie immer ihr das hier nennen wollt, deutlich schwieriger. Und was meinen Anteil betrifft: Er kann gar nicht hoch genug sein.“
Mit diesen Worten griff Tom mit der Faust in den ledernen Geldbeutel und nahm sich eine so große Ladung Münzen heraus, dass einige davon klimpernd zu Boden fielen.
„Das sollte für dieses Mal angemessen sein.“
Sprach- und hilflos stand sie eine Weile da. Linda wollte protestieren, doch Tom hatte die Hand schon in seine Umhängetasche verschwinden lassen. Kurz darauf war sie wieder allein.
Verärgert zählte sie den Rest, der ihr geblieben war, und klaubte die heruntergefallenen Münzen auf. Tom hatte weit mehr genommen, als ihm zustand, aber was hätte sie machen sollen? Er war einen Kopf größer und viel stärker als sie. Wenigstens hatte er schnell von ihr abgelassen und sie dachte angewidert an das, was hätte passieren können. Sie schob den Gedanken schnell beiseite. Zwar war sie um einen Teil betrogen worden, doch unversehrt davon gekommen. Gleich bei Tagesanbruch würde sie sich aufmachen und die zur Seite geschafften Münzen aus ihrem Versteck holen. Die Sonne war inzwischen untergegangen und es war noch einmal merklich kühler geworden. Linda legte sich auf ihre Schlafstätte, die sie mit getrockneten Algen, Seetang und anderen Pflanzenresten gepolstert hatte. Wenigstens wurde ihr langsam wärmer. Morgen würde ihre Kleidung wieder trocken sein, dachte sie noch, als ihr bereits die Augen zufielen.
3. Kapitel
Saragossa, Spanien
Die Nüstern des Pferdes bebten, als es vor dem Rathaus anhalten und sich die wohlverdiente Pause genehmigen durfte. Sein Reiter, gekleidet in der weithin bekannten roten Uniform der königlichen Botenreiter, hatte auf den letzten Kilometern ein schnelles Tempo angeschlagen und das Tier wenig geschont. Sein Auftrag erforderte höchste Eile. Er fragte sich zum Aufenthaltsort des Adressaten der Nachricht durch, bis er schließlich vor einer mächtigen Tür aus Eichenholz stand. Wie ein Wall hielt sie ungebetene Besucher ab und ließ kein Geräusch nach draußen dringen. Eine Plakette informierte, um wessen Zimmer es sich handelte: Stadtrat David Ramon Zamino war dort in goldenen Lettern zu lesen. Nicht weit von der Tür saß ein untersetzter Mann mit Halbglatze hinter einem viel zu kleinen Schreibtisch in einer Nische des Flures - der Sekretär des Stadtrates.
„Ist Señor Zamino anwesend?“ fragte der Bote, ohne sich Zeit für die üblichen Begrüßungsfloskeln zu nehmen.
„Ja, aber er möchte nicht gestört werd…“, aber der Bote hatte bereits die schwere eiserne Klinke in der Hand und drückte sie herunter.
„Halt, Sie dürfen da nicht so einfach herein!“, rief der Sekretär, während er versuchte, sich eilig aus seinem Stuhl hochzustemmen, um den ungebetenen Besucher aufzuhalten.
Doch als er sich mitsamt seinem fülligen Bauch an der Schreibtischkante vorbei gezwängt hatte, war die Tür längst wieder ins Schloss gefallen.
„Antonio, ich sagte doch ausdrücklich, dass ich heute niemanden empfangen will!“, erklang eine strenge Stimme.
David Ramon Zamino war ein Mann mitte vierzig und saß an einem großen Schreibtisch, halb verborgen hinter Bergen aus Papier. Die eng geschnittene Robe ließ ihn hager wirken und der Stoff aus grauem Leinen betonte seinen ohnehin blassen Teint. Die Augen lagen tief in ihren Höhlen und huschten über den Tisch, immer auf der Suche nach einem neuen Fixpunkt in den ausgebreiteten Unterlagen. Ein dünner Film aus Schweiß hatte sich auf der Stirn gebildet. Seit einigen Stunden arbeitete er mit höchster Konzentration. Ungebetene Besucher konnte er nicht leiden, vor allem wenn er die Finanzaufstellungen des Kämmerers überprüfte.
„Ich habe eine Botschaft von Juan Manuel Fernández Pacheco, Vizekönig von Aragonien und Herzog von Escalona, für den Stadtrat David Ramon Zamino“, erklang die Stimme des Eindringlings.
Überrascht blickte er auf und erkannte sofort die Uniform.
„Was will der Vizekönig ausgerechnet von mir? Sprich!“, entfuhr es ihm unwirscher, als er beabsichtigt hatte.
„Darüber weiß ich nichts. Meine Aufgabe ist mit der Übergabe des Briefes erfüllt.“
Mit diesen Worten legte der Bote einen mit dem königlichen Wappen versiegelten Umschlag auf eine freie Fläche des Schreibtisches.
„Ich danke euch! Verzeiht meine Schroffheit, normalerweise verabscheue ich ungebetene Besucher“, entschuldigte er sich.
„Nichts für ungut. Gehabt euch wohl“, verabschiedete sich der Bote und ließ den Stadtrat wieder alleine in seinem Büro zurück.
Beinahe wäre er an der Tür mit dem Sekretär zusammengestoßen, der es inzwischen zur Tür geschafft hatte, um seinen Herren über den Besucher zu informieren.
„Lasst es gut sein, Antonio“, winkte David Ramon Zamino ab. „Wenn Ihr euch mit der gleichen Leidenschaft euren Aufgaben widmen würdet, wie Ihr es mit den Köstlichkeiten aus der Küche tut, könntet Ihr mir sogar eine Hilfe sein. Ich habe eine präzise Anweisung erteilt und wünsche, dass sie ebenso präzise ausgeführt wird: Ich möchte nicht gestört werden!“
Antonio verbeugte sich tief: „Verzeiht, Herr, es wird nicht wieder vorkommen.“
Der Stadtrat ließ den Brief mit dem königlichen Siegel unberührt an der Stelle liegen, wo ihn der Bote platziert hatte. Neugier gehörte nicht zu den Eigenschaften, die ihn auszeichneten. Viel mehr als unerledigte Aufgaben hasste er nur, bei eben diesen gestört zu werden. So beendete er zuerst seine Arbeit und notierte Anmerkungen zu möglichen Einsparungen. Zwar würde das wieder zu wortreichen Auseinandersetzungen mit dem Schatzmeister führen, dessen war er sich sicher. Doch er durfte in seinem Bemühen nicht nachlassen, die Verschwendung von Steuergeldern einzudämmen. Als er fertig war, betrachtete er zufrieden sein Werk.
Schließlich wandte er sich dem Brief zu. Vorsichtig brach er das Wachssiegel, öffnete ihn und begann aufmerksam zu lesen. Schon die ersten Zeilen nach den üblichen Höflichkeiten steigerten sein Interesse. Nachdem er die Lektüre beendet hatte, saß er eine Weile regungslos da. Nachdenklich strich er sich durch das schüttere Haar und blickte versonnen in den Raum, in dem er täglich seine Arbeit verrichtete. Der Holzboden war blank poliert, frische Blumen in Porzellanvasen verströmten einen lieblichen Duft. An den Wänden hingen Ölgemälde von ihm unbekannten Künstlern, die selbst einem Kenner ein Staunen entlockt hätten. Ein Kronleuchter tauchte den Raum in warmes Licht. Schon immer war ihm die Einrichtung zu prunkvoll und verschwenderisch, doch in diesem Augenblick fand er sie dem Anlass angemessen. Er nahm Papier und Feder und begann, sich Notizen zu machen.
„Antonio!“, rief er.
Der Sekretär steckte kurz darauf den Kopf durch die Tür.
„Womit kann ich dienen?“
„Ich habe dir eine Liste erstellt mit letzten Besorgungen, die du noch für mich zu erledigen hast. Danach werden sich unsere Wege trennen“, dabei hielt er ihm das beschriebene Stück Papier entgegen.
„Trennen? Ich befürchte, ich verstehe nicht ganz, Señor Zamino“, erwiderte Antonio ratlos. David Ramon Zamino erhob sich aus seinem Stuhl, straffte sich, strich sein schlichtes Leinengewand glatt und erklärte mit klarer Stimme:
„Ich wurde soeben an den Hof unseres geliebten Königs in Madrid gerufen, um dort in Zukunft repräsentative Aufgaben im Sinne unseres schönen Aragoniens zu übernehmen. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mein Dienst hier beendet ist und ein neuer Stadtrat die Geschicke Saragossas zu lenken versuchen wird. In drei Tagen werde ich aufbrechen. Ich bin sicher, du wirst ihm ebenso treu dienen, wie du mir gedient hast.“
Überrumpelt rang Antonio nach Worten.
„Aber… Señor… in drei Tagen … so bald schon. Soll ich noch eine Abschiedsfeier vorbereiten?“
Abwehrend hob David die Hand.
„Wie du weißt, bin ich weder ein Freund von Sentimentalitäten noch von überflüssigen Ausgaben. Also keine großen Worte und erst recht keine Feier.“
Antonio nickte ergeben und verließ das Büro.
Der späte Abend war sternenklar. Die Kutsche nach Madrid würde am nächsten Morgen bereitstehen. In den letzten zwei Tagen war David Ramon Zamino damit beschäftigt gewesen, sich auf die bevorstehende Reise und sein Leben in Madrid vorzubereiten. Alles war gepackt und von den wenigen Menschen, die er schätzte, hatte er sich verabschiedet. Nur eines blieb noch zu tun. Er zog sich einen Umhang mit Kapuze über, der ihn vor allzu neugierigen Blicken schützte. Zielsicher steuerte er durch die schmalen Gassen der Stadt auf ein Haus im Handwerkerviertel zu, das sich nicht von den umliegenden unterschied. Er blickte sich prüfend nach allen Seiten um, doch niemand war zu sehen. Als er vor der Tür stand, war ihm unbehaglich zumute, obwohl er wusste, dass er nichts zu befürchten hatte. Er zwang sich zur Ruhe und klopfte. Zweimal – Pause – einmal – Pause – einmal. Er lauschte. Auf der anderen Seite war kein Geräusch zu vernehmen. Ein wenig ungeduldig wollte er gerade das Signal wiederholen, als sich die Tür mit einem kaum hörbaren Knacken öffnete.
„Herein, ich habe Euch schon erwartet“, sprach eine leise Stimme aus der Dunkelheit.
Erst als David die Tür hinter sich geschlossen hatte, zündete der Gastgeber eine kleine Öllampe an und gab sich zu erkennen. Vor David stand ein mittelgroßer Mann mit athletischer Figur und kurzen schwarzen Haaren. Eine ganz und gar durchschnittliche Erscheinung, wären da nicht seine eisblauen Augen gewesen, die jede Bewegung zu verfolgen und jedes noch so kleine Detail der Umgebung wahrzunehmen schienen. David spürte den Blick des Gastgebers auf sich ruhen, der ihn von Kopf bis Fuß musterte. Ein kurzes Nicken war Begrüßung genug und löste die Spannung. Erst jetzt bemerkte er, dass er seit dem Eintritt unbewusst den Atem angehalten hatte. Er zog einen Beutel unter seinem Umhang hervor. Prall gefüllt drückten sich die Umrisse von Münzen durch das Leder, während der dünne Leinenfaden Mühe hatte, alles zusammenzuhalten.
„Wie vereinbart.“
Er reichte ihn seinem Gegenüber, der den Beutel mit einer fließenden Bewegung unter der Kleidung verschwinden ließ.
„Danke!“
Ohne ein weiteres Wort verließ David das unscheinbare Haus und machte sich erleichtert auf den Heimweg. Es gab nichts Unerledigtes mehr.
Am nächsten Morgen registrierte David Ramon Zamino zufrieden, dass die Kutsche pünktlich zur vereinbarten Zeit vor dem Haus stand. Das Gepäck war bereits verstaut worden und nach ein paar letzten Anweisungen an den Hausverwalter stieg er ein, gab dem Kutscher ein Signal und die großen Speichenräder rumpelten über das Kopfsteinpflaster der Stadt Richtung Süden. Abgesehen vom Wagenführer und einem Bewaffneten auf dem Kutschbock war er allein. Als sie die Tore Saragossas und das Kopfsteinpflaster hinter sich gelassen hatten, beruhigte sich die Fahrt. Es war Spätsommer und der wolkenlose Himmel kündigte einen heißen Tag an, der für diese Jahreszeit typisch war. Am Fenster zogen gemächlich vereinzelte Eichen und Pinien als grüne Tupfer zwischen den goldgelben Weizenfeldern vorbei. Die Bauern waren längst auf den Beinen und brachten die Ernte ein, bevor es in der Mittagszeit zu heiß zum Arbeiten wurde. Er stellte sich vor, er wäre als Sohn eines Bauern geboren worden. Dann stünde er ebenfalls dort auf dem Feld und schnitt mit einer Sense die Weizenhalme, während ihm der Schweiß über die Haut lief. Wäre er gut und fleißig bei der Feldarbeit gewesen? Seine Talente lagen in anderen Bereichen, körperlich harte Arbeit gehörte nicht dazu. Aber zum Glück waren seine Eltern keine Bauern. Beide stammten zwar aus einfachen Verhältnissen, doch sein Vater hatte es zu einem angesehenen Baumeister und einigem Wohlstand gebracht. So hatte er ihm das Studium der Rechtskunde an der Universität in Saragossa bezahlen können. Jenseits aller Vorstellungskraft für einen Mann mit dem Stand eines Bauern. Für sie war es unmöglich, das Geld dafür aufzubringen, wenn ihr Horizont überhaupt so weit reichte, dies in Betracht zu ziehen. Wie viele unentdeckte Talente und Genies wohl auf den Feldern Spaniens ihre Bestimmung verpassten? Wie viele Söhne von adligen oder reichen Familien hatte er auf der Universität kennen gelernt, die weder über ausreichend Intellekt noch Ehrgeiz verfügten? Er war keiner von ihnen gewesen. Ihm war es gelungen, seine Ziele zu erreichen. Mit Geduld, den richtigen Verbündeten, Ellbogeneinsatz gegenüber Konkurrenten und immer mit einem klaren Plan, hatte er es geschafft, das höchste Amt der Stadt zu bekleiden. Unter seiner Führung war Saragossa in den letzten Jahren erblüht und hatte den Status als wohlhabende Hauptstadt Aragoniens weiter festigen können. Seine Eltern wären mit Sicherheit stolz gewesen, wenn sie es erlebt hätten.
Nun also die Berufung an den Königshof. Sonst wird dies ausschließlich Adligen zuteil, doch die Verdienste als Stadtrat und die Stunden erniedrigender Schmeichelei gegenüber Vizekönig Juan Manuel Fernández Pacheco, schienen sich endlich ausgezahlt zu haben. Der Brief mit dieser Nachricht kam zwar überraschend, aber nicht unverhofft.
Als vor einem Jahr die ersten Gerüchte zu vernehmen waren, dass die Königinmutter Maria Anna von Österreich ihren Sohn dazu überreden konnte, einen Hofstaat nach französischem Vorbild einzuführen, hatte er die Situation gleich erkannt und die richtigen Schritte eingeleitet, um die nächste Stufe auf der Leiter zu erklimmen. Dass der Vizekönig selbst nach Madrid hätte umziehen wollen, war unwahrscheinlich und nicht üblich. Also hatte nur der einzige ernsthafte Konkurrent, ein Graf aus Huesca, ausgeschaltet werden müssen. Ein paar gut platzierte Münzen an den richtigen Stellen, Gerüchte und gefälschte Beweise hatten genügt, um ihn ausreichend in Misskredit zu bringen. Er, David Ramon Zamino, war am Ziel. Ein Zwischenziel. Sein Ehrgeiz war zu groß, um sich darauf auszuruhen. Zunächst musste er die Gepflogenheiten des königlichen Hofstaates besser kennen und einschätzen lernen. Anschließend würden sich neue Türen und Möglichkeiten eröffnen, die es zu nutzen galt. So hatte er es schon immer gemacht. Und so würde er es auch in Zukunft handhaben. Immer ein Schritt nach dem nächsten. Wie die anderen Abgesandten in Madrid, alle adliger Abstammung, auf ihn, den Emporkömmling aus gewöhnlichem Hause, wohl reagierten? Ablehnung und Ignoranz waren mindestens zu erwarten, darüber machte er sich keine Illusionen. Es wurde endlich Zeit, die alten Muster aufzubrechen. Eigene Fähigkeiten sollten eine größere Rolle spielen als das Geburtshaus.





























