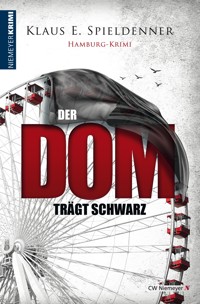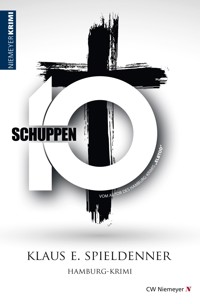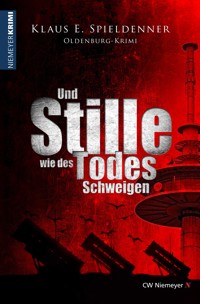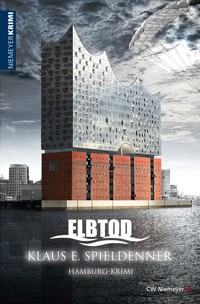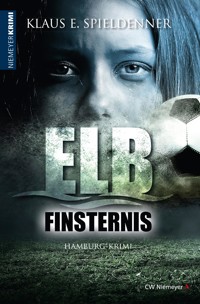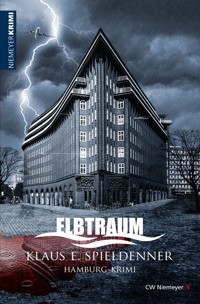7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CW Niemeyer
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Anna-Lena und Sebastian, zwei jung verliebte Schüler des Graf-Anton-Günther-Gymnasiums in Oldenburg, geraten an einem schönen Maitag auf ihrer Heimfahrt mit dem Linienbus in eine Geiselnahme. Der als Werder-Bremen-Fan verkleidete Entführer und seine Helfer verlangen die Freilassung einer politischen Gefangenen und ein hohes Lösegeld. Doch warum stellt der Mann das Fahrzeug der VWG auf dem Sportplatz von Blau-Weiß Bümmerstede ab? Und was wollen die Männer mit den Krügerrand-Goldmünzen? Die junge Kommissarin Sandra Holz wittert mehr als nur Geldgier und politische Hintergründe. Warum verhalten sich einige ihrer Kollegen während des Einsatzes so sonderbar? Und was hat Stadtrat Bruns mit der Entführung zu tun? Sie kramt in alten Schicksalen und findet Fragen über Fragen, die überall hinführen – nur nicht zum Ziel.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Blicke, die sagen es geht nicht mehr,Gedanken, die nicht mehr wissen wohin.Tränen, der Verzweiflung in den Augen.Zittern, obwohl du nicht frierst.Erinnerungen, die wehtun dagegen anzukommen.Traurigkeit, die man nicht beschreiben kann.Ein letzter Blick, umdrehen, gehen und wissen, dass es für immer ist.Wenn Tränen leise sterben.„Wenn Tränen leise sterben“ von Bärle1 (Franzi)
Der Roman spielt hauptsächlich in allseits bekannten Stätten, doch bleiben die Geschehnisse reine Fiktion. Sämtliche Handlungen und Charaktere sind frei erfunden.
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar über www.dnb.de© 2020 CW Niemeyer Buchverlage GmbH, Hamelnwww.niemeyer-buch.deAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: C. RiethmüllerEPub Produktion durch CW Niemeyer Buchverlage GmbHeISBN 978-3-8271-8391-0
Klaus E. SpieldennerUnter FlutlichtOldenburg-Krimi
Prolog
Die Temperatur an diesem Septembermorgen in der russischen Stadt Ufa entsprach nicht der eines klassischen Badetages. Kühler Wind wehte aus Richtung des Urals. Der Sommer im Jahr 1972 hatte sich früh verabschiedet. Die beiden Zwölfjährigen, die in kurzen Hosen am Strand des Belaja-Flusses herumalberten, störte das jedoch nicht.
„Lass uns eine Höhle in den Sand graben, Grischa!“
„Ja, das ist eine gute Idee.“
Die Jungen liefen ein Stück auf das blaugraue Wasser zu und warfen sich voller Übermut in den feuchten Sand. Mit bloßen Händen begannen sie eine Mulde auszuheben. Schon nach wenigen Minuten schwitzten sie, und Michail, der größere, stöhnte: „Hätten wir doch die Schippen mitgenommen!“ Wie von Sinnen gruben sie und warfen den feuchten Sand weit hinter sich.
Einen Kilometer entfernt spuckte das riesige Kohlekraftwerk der am westlichen Abhang des Urals gelegenen Stadt seinen schwarzen Rauch hinüber zum Ufa-Fluss, der sich dort, nach einer Strecke von über neunhundert Kilometern, mit der Belaja vereinigte. Die Jungs hatten kein Auge dafür. Sie schufteten, als hieße es, einen Verschütteten aus einem Erdloch zu bergen.
Etwas weiter entfernt saßen auf einer Decke zwei ältere Frauen in typisch baskirischer Landeskleidung. Eingehüllt in bunte Leinenkleider, gestickte Lederstiefel an den Füßen und die wärmende Fellmütze auf dem Kopf, schauten sie stumm auf das Wasser und die beiden spielenden Jungen.
Die Mulde im Flusssand war inzwischen schon recht tief und nur die Köpfe der Buben waren noch zu sehen. Die Hosen feucht, die Haare voller Sand, unterbrachen sie ihre Arbeit.
„Was ist, wenn wir uns nicht mehr wiedersehen, Michail?“
Der zwei Monate ältere, etwas kleinere der beiden schaute traurig seinen Freund an, hatte aber keine Antwort.
„Sag, was ist, wenn sie uns für immer trennen?“ Grischa fing an zu weinen.
Michail legte seinen Arm um Grischas Schultern und zog ihn zu sich heran. „Sie können uns zwar trennen, aber es wird nicht für immer sein, mein Bruder.“
Grischa konnte nicht aufhören zu weinen. Er dachte an ihre gemeinsamen sommerlichen Badetage, die Wanderungen durch die Wälder rund um ihre Stadt, und die kalten Winter, die sie mit Schlittschuhlaufen und Schneeballschlachten verbrachten. Und an ihre gemeinsame Schulzeit, die heute nach sechs Jahren mit ihrer Trennung endete.
„Warum kann ich nicht hierbleiben, Michail?“
„Es geht wohl nicht.“
„Lass uns einfach weglaufen. In die Wälder. Wir verstecken uns und bleiben zusammen.“ Grischa hörte auf zu weinen und lächelte sogar wieder etwas.
„Grischa, du bist nicht ganz bei Trost.“
„Ist dieses Land, in das ich fliege, sehr weit entfernt von hier?“, fragte Grischa den Freund nach einer Weile.
„Mama sagte etwas von dreitausendfünfhundert Kilometern.“
„Das ist weiter als nach Moskau!“ Grischa warf eine Hand voller Sand über den Rand der Mulde. Ein Teil fiel zurück auf die Köpfe der beiden. Doch es störte sie nicht.
„Sicher doppelt so weit“, sagte Michail.
„Michail, versprich mir, dass wir uns wiedersehen!“ Grischa hielt ihm die Hand hin und Michail ergriff sie.
„Ich verspreche dir, Grischa, bei meinem Leben, dass ich dich irgendwann finden und wiedersehen werde.“
„Ich verspreche dir das Gleiche, Michail.“
„Auf ewig Freunde?“
„Auf ewig Freunde.“
Sie schüttelten sich die Hände. Und jetzt liefen beiden die Tränen an den Wangen hinab.
Die Frauen waren aufgestanden.
„Es ist das Beste, Praskowja, wenn du Grischa Antonov zu dir nach Europa mitnimmst. Nach dem plötzlichen Tod seiner Eltern wird er es dort sicher besser haben. Und ich kann ihn nicht versorgen. Es fällt mir schon mit Michail und seinen Geschwistern schwer genug.“
„Du hast recht, Schwester. Es war gut, dass du mir geschrieben hast. Es wird ihm in Karl-Marx-Stadt an nichts mangeln.“
„Sieh nur, die beiden sind wie Brüder …“
Die Frauen schauten den Jungen noch eine Weile zu. Dann riefen sie nach ihnen und alle spazierten gemeinsam in die Stadt zurück.
Grischa und Michail hielten sich an den Händen. So, als ob sie sich nie wieder loslassen würden.
Kapitel 1
„Schau mal, Basti, der Typ da“, sagte Anna-Lena. „Der ist ja völlig ausgeflippt!“
Sebastian Frohnau drehte sich um und warf einen Blick aus dem Rückfenster des Omnibusses. „Der spinnt ja wirklich. Bei dieser Hitze mit grün-weißer Mütze und Schal rumzurennen … ein echter Werderfan.“ Der Sechzehnjährige lachte Anna-Lena zu, ergriff ihre Hand und drückte sie.
Der Maitag war, wie die letzten Tage auch, extrem heiß und die Schüler hatten an diesem Freitag mit Hitzefrei gerechnet. Vergebens. Jetzt freuten sie sich auf das bevorstehende Wochenende. Ausgelassen alberten sie im Schulbus herum.
Auch andere Insassen der Linie 315 bemühten sich, einen Blick auf den vorbeilaufenden Mann in Grün-Weiß zu erhaschen. Der weiße Bus mit der gelben Schnauze und der bunten, großflächig aufgebrachten Werbung einer Großbank hatte soeben an der Oldenburger Haltestelle Sandkruger Straße/Ecke Westerholtsweg gestoppt. Viele Gymnasiasten, die vor knapp einer Viertelstunde an der Graf-Anton-Günther-Schule eingestiegen waren, hatten das Fahrzeug an den letzten Haltestellen schon verlassen. Gerade waren erneut drei Jugendliche ausgestiegen. Trotzdem war der Bus noch immer gut gefüllt.
Anna-Lena lachte. „Der will wohl mit uns mitfahren?“ Sebastian sah gerade noch, wie der schlanke Typ im ungewöhnlichen Outfit in der vorderen Tür des Oldenburger VWG-Busses verschwand. An den im Mittelgang stehenden Mitschülern vorbei konnte Sebastian nicht nach vorne in den Bus schauen, dafür waren es zu viele. So wandte er sich gelangweilt wieder seiner Freundin zu.
Josef Nortbrook war ein erfahrener Busfahrer. Seit der Schließung seines Drogeriemarktes in Sandkrug vor einundzwanzig Jahren war er ausschließlich für die Verkehr und Wasser GmbH, kurz VWG gefahren. Man hatte ihm vor einigen Jahren Altersteilzeit angeboten und der inzwischen Vierundsechzigjährige hatte damals dankbar zugestimmt. Normalerweise wurde er seit drei Monaten nur noch für die Rücktour der Oldenburger Schüler eingesetzt. Dazu hin und wieder etwas Linie.
An diesem Morgen aber war alles anders gelaufen. Sonnkamp, ein erst vierzigjähriger Kollege, hatte Nortbrook am Vorabend zu Hause angerufen und ihn gebeten, heute ausnahmsweise auch die morgendliche Tour mit zu übernehmen. „Josef, ich muss morgen dringend zur Zulassungsstelle, will den neuen Wagen schon am Wochenende nutzen. Wenn dir das recht ist, kann ich nachmittags wieder einsteigen und den Bus ab Sandkrug für den Rest des Tages übernehmen.“
Nortbrook hatte Verständnis. Es passte ihm eigentlich auch ganz gut. Die Überstunden konnte er brauchen und wenn Kollege Sonnkamp bei der Fünfzehnuhrfünfundreißig-Tour an der Schule zustieg, konnte Nortbrook später in Sandkrug direkt vor seiner eigenen Haustür aussteigen. Er hatte sich also von seiner Ehefrau Hildegard in der Frühe dieses vierten Mai nach Oldenburg fahren lassen und den modernen Mercedes Benz Citaro gegen sechs Uhr auf dem Firmengelände in der Felix-Wankel-Straße übernommen.
Fünfzig Minuten später waren an der Haltestelle Hatterwüsting die ersten Schüler Richtung Oldenburg eingestiegen. Knapp dreißig Minuten danach war die erste Tour abgeschlossen gewesen und die Schüler sicher in den Klassenräumen des Graf-Anton-Günther-Gymnasiums angekommen.
Inzwischen hatte Josef Nortbrook weitere drei Touren hinter sich gebracht. Alles Linie. Diese Schülerfahrt jetzt war die Letzte für heute, und als Sportbegeisterter freute er sich schon auf ein sonniges Fußballwochenende. Kollege Sonnkamp hatte, wie versprochen, vor wenigen Minuten auf einem Sitz nahe des hinteren Ausganges Platz genommen. Er unterhielt sich, wie Nortbrook im Spiegel sah, lebhaft mit einer Schülerin.
Drei Jugendliche hatten an der Haltestelle Westerholtsweg vor wenigen Augenblicken den Bus aus dem vorderen Ausgang verlassen. Nortbrook schaute kurz auf die Uhr: 15 Uhr 47, sie lagen gut in der Zeit. Er drückte den Knopf, der die Tür schloss. Doch als die Pneumatik den Vorgang einleitete, sprang ein Mann herein, und Nortbrook stoppte sie sofort. Der Blutdruck des Fahrers stieg leicht an. Wahrscheinlich verwechselte ihn der grün-weiß Gekleidete mit einem Linienbus, war sein erster Gedanke, obwohl ja draußen am Fahrzeug groß genug Schülerbus stand. Das wäre nichts Neues. Dieses Versehen erlebte Nortbrook öfters und meist gab es lange Diskussionen, bis der Fahrer die oft uneinsichtigen Fahrgäste wieder hinauskomplimentiert hatte.
„Hallo, das ist kein Linienbus. Ich befördere …“ Er starrte auf die Pistole, die der Mann auf ihn richtete. Nortbrook wich auf seinem Fahrersessel zurück.
„Tür zu“, brüllte der Bewaffnete ihn an, und da es in den lautstarken Unterhaltungen der Jugendlichen unterzugehen drohte, noch einmal: „Tür zu!“
Nortbrook versuchte, den Adrenalinschub, der durch seinen Körper schoss, zu unterdrücken, und gehorchte. Er schaute noch wie gewöhnlich zur Sicherheit in den Gangspiegel, bevor er den Knopf zum Verschließen der Tür drückte. Dabei sah er, wie sein Kollege aufsprang und sich durch die Schüler im Mittelgang nach vorne drängte.
„Was soll das?!“, brüllte Sonnkamp den Mann in WeißGrün an. Der drehte sich erschrocken um.
Dann gab es einen lauten Knall.
Sebastian und Anna-Lena hatten den Werder-Fan längst vergessen.
„Wollen wir uns morgen treffen und etwas unternehmen?“, fragte sie ihren Freund, der mit seinen schulterlangen Haaren und seiner eher feingliedrigen Figur ein wenig feminin wirkte.
„Sicher, Leni – wir könnten ins Schwimmbad gehen, die haben seit ein paar Tagen geöffnet.“
„Eine gute Idee, lass uns …“
Der Rest des Satzes ging in einem ohrenbetäubenden Knall unter. Einige Schüler griffen sich, die Gesichter schmerzverzerrt, mit beiden Händen an die Ohren. Sebastian dachte sofort an einen Verkehrsunfall, aber dann fiel ihm ein, dass der Bus ja stand.
„Sebastian, was war das?“ Auch Anna-Lena hielt sich eine Hand ans Ohr.
Wolle – er hieß eigentlich Wolfgang und ging mit den beiden in dieselbe Klasse – rief: „Da vorne hat einer geschossen!“ Sebastian sprang von der Rückbank hoch. Vorn schrien die Jugendlichen laut auf.
„Der Typ im Werder-Dress läuft Amok“, schluchzte ein Mädchen aus der Parallelklasse.
Das Wort Amok war eigentlich seit Winnenden ein NoGo in Schülerkreisen. Sebastian allerdings konnte sich seine Späße nicht verkneifen, ein Reflex, mit dem er sich zu beruhigen versuchte. „Warum sollte der so etwas tun? Werder steht hinter Bayern auf dem zweiten Tabellenplatz. Wenn Bremen morgen zu Hause gegen Bayern gewinnt, ist Werder Deutscher Meister. Der Typ müsste uns also eher einen ausgeben …“ Er merkte selbst, dass sein Scherz nicht ankam, und verstummte.
Josef Nortbrooks Kopf dröhnte und das laute Fiepen in den Ohren machte ihm Angst. Vor Jahren hatte er sich bei einem Unfall mit einem Silvesterkracher einen Tinnitus zugezogen. Es hatte trotz Infusionen und Tabletten Monate gedauert, bis die Beschwerden nachgelassen hatten. Damals war er lange krankgeschrieben gewesen und hatte erst nach einem halben Jahr seinen Fahrdienst wieder aufnehmen können. Nun war dieses unselige Geräusch im Kopf wieder da und er konnte sich nicht konzentrieren. Dazu kamen die verzweifelten Schreie und Rufe der Jugendlichen im Wagen. Nur langsam fand er zurück ins Geschehen. Plötzlich begriff er: Der laute Knall stammte von einem Schuss aus der Waffe dieses seltsamen Mannes, und sein Kollege Sonnkamp lag ausgestreckt auf dem Boden des Busses. Neben ihm bildete sich eine Blutlache und er bewegte sich nicht mehr.
Nortbrook verstand: Der Grün-Weiße war kein Fahrgast. Da lief eine schlimme Sache. Er schloss eingeschüchtert die Bustür und betete, dass sein Kollege nicht tot war.
Der Mann mit der Pistole hatte die verlorene Fassung wiedergewonnen und gab lautstark Befehle. „Die Schüler, die vorne stehen: sofort nach hinten! Und alle, die keinen Sitzplatz haben: sofort hinsetzen! Auf den Boden. Und aufrücken, ganz nach hinten!“
Nortbrook nutzte die Zeit, sich den Mann anzuschauen. Er konnte sich jetzt wieder besser konzentrieren, und auch das Pfeifen in seinem Kopf ließ langsam nach. Das Alter des Typs war schlecht zu schätzen. Er war nicht sonderlich groß. Vielleicht einen Meter fünfundsiebzig, und eher schlank. Durfte so um die fünfzig sein. Der Mann war glatt rasiert und das war auch schon das Einzige, was der Busfahrer unter der tief heruntergezogenen Werdermütze von dessen Gesicht erkennen konnte. Den grün-weißen Schal hatte der Mann lässig um den Hals geschlungen und sein Oberkörper war durch eine grüne Warnweste verdeckt. Nortbrook wunderte sich, er kannte nur gelbe oder orangefarbene Warnwesten. Die Beine des Mannes steckten in einer dreiviertellangen Jeansshorts, dazu trug er weiße Socken und Tennisschuhe. Es waren wohl keine Markenschuhe. Zumindest konnte Nortbrook kein Logo erkennen. Aber dafür stand der Mann auch zu nah an seinem Tresen.
Den Schülerinnen und Schüler im Fahrzeug sah man ihre Fassungslosigkeit an. Starr vor Angst, konnten sie ihre Augen kaum von dem am Boden liegenden Sonnkamp abwenden.
„Habt ihr nicht gehört, was ich sage?“, brüllte der Mann mit der Pistole. „Durchrücken! Und der Rest setzt sich auf den Boden. Ich möchte im vorderen Busbereich keinen mehr sehen.“
In Panik sprangen die Jungen und Mädchen von den vorderen Sitzen auf und flüchteten nach hinten. Einer stolperte, prallte gegen die vor ihm laufenden Mitschüler und brachte sie fast zu Fall. Der Junge sah sich um und schrie verzweifelt auf, als ihm bewusst wurde, dass er auf den schwer verletzten oder womöglich toten Sonnkamp getreten war.
Inzwischen hatten sich alle, die keine freie Sitzbank mehr fanden, auf dem grau gepunkteten Kunststoffboden im hinteren Bereich zusammengekauert. Nun war der vordere Fahrzeugteil leer bis auf Nortbrook und den Bewaffneten. Und mitten im Gang lag der regungslose Sonnkamp.
„Die Handys bleiben aus!“, kam die nächste Anweisung des Mannes und er ergänzte, „und wenn ich irgendwo ein Handy sehe, überlebt derjenige das nicht.“
Die Schüler saßen zusammengepfercht eng beieinander. Mädchen hielten sich weinend in den Armen. Jungs waren ängstlich zusammengerückt.
„Basti, was hat der Mann vor?“ Anna-Lenas Augen waren voller Panik und Sebastian versuchte seine eigenen Ängste für sich zu behalten.
„Bleib ruhig, Leni. Was immer da los ist, uns wird nichts geschehen.“ Aber er sah ihr an, dass seine Worte nicht die gewünschte Wirkung erzielten.
Inzwischen hatte Sebastian durch seine erhöhte Position auf der Rückbank über die im Mittelgang sitzenden Mitschüler hinweg freien Blick in den vorderen Busbereich. Er sah den grün-weiß Gekleideten beim Fahrertresen und auf dem Gang liegend Sonnkamp. Sebastian kannte den Busfahrer, er war schon oft mit ihm gefahren. Die Mädels hatten Sonnkamp den Spitznamen George gegeben. Sie waren wohl der Ansicht, er hätte Ähnlichkeit mit George Clooney. Sebastian fand das nicht.
„Hier, anlegen. Dann fahren Sie los.“
Nortbrook hatte sich aus seiner Starre gelöst und schaute auf die ausgestreckte Hand des Mannes, auf der eine verchromte Handfessel lag, mit geöffneten Gliedern. Der Fahrer verstand nicht und wies auf den verletzten Sonnkamp am Boden: „Mein Kollege benötigt dringend einen Arzt!“ Er konnte die Angst in seiner Stimme selber hören. Der Mann warf nur einen kurzen Blick nach unten, dann hielt er Nortbrook wieder die Handschellen hin. Der Busfahrer griff wie in Trance das kalte Metall. Er musste den Mann wohl fragend angeschaut haben, denn der sagte: „An der linken Hand festmachen. Das andere Ende am oberen Teil des Lenkrades.“
„Und wie soll ich den Bus dann lenken?“
„Das geht schon. Los, festmachen!“ Der Bewaffnete machte eine drohende Bewegung mit der Pistole, und Nortbrook gehorchte.
Er befestigte die obere Schlaufe der Fessel am Lenker und drückte dann den unteren Teil über seine linke Hand. Der Mann mit der Waffe beobachtete ihn genau, bemühte sich aber, auch die Jugendlichen nicht aus den Augen zu lassen.
Die Fessel schnitt Nortbrook ins Handgelenk und er ärgerte sich, sie so festgezogen zu haben.
Anscheinend zufrieden sagte sein Gegenüber: „Und jetzt losfahren.“
Der Motor des Busses lief noch immer. Nortbrook setzte den Blinker und gab etwas Gas, um von der Haltestelle auf die Straße zu gelangen. Vorsichtig bewegte er den Bus auf die Sandkruger Straße und beschleunigte ihn. „Wohin?“
Der Entführer rührte sich nicht und gab keine Antwort. Nortbrook bemühte sich, trotz innerer Unruhe und spürbar erhöhtem Blutdruck, das Fahrzeug auf der stark frequentierten Straße zu halten.
Sebastian war, was Elektronik anging, ein Freak. Vielleicht auch, weil sein Vater als Elektroingenieur dem Jungen das vorlebte. Vor wenigen Tagen, an Sebastians sechzehntem Geburtstag, hatte Bernd Frohnau seinem Sohn ein zwei Jahre altes Smartphone abgetreten. Der Junge hatte sich eine Playstation 3 gewünscht und die natürlich auch noch bekommen. Aber fast noch mehr hatte er sich über das gebrauchte Handy gefreut. Sein altes Samsung hatte vorher auch gute Dienste geleistet, war aber mit der Funktionalität des modernen Smartphones nicht vergleichbar. Jetzt empfand er es als seine Mannespflicht, etwas zu unternehmen. Allein schon wegen seiner großen Liebe Anna-Lena. Aber was genau konnte er hier auf der Rücksitzbank des Busses tun? Die Polizei über das Geschehen zu informieren, wäre eine gute Idee. Aber das Handy hatte er in der Schultasche. Und die lag, fast unerreichbar, vor Anna-Lenas Füßen. Ohne dass es dem Typen vorne auffiel, käme Sebastian kaum an das Handy heran.
„Hast du einen Lippenstift in Reichweite?“, fragte er Anna-Lena, die neben ihm kauerte.
„Was willst du … einen Lippenstift!?“
„Ja, sag: Hast du einen?“
„Nein, aber warum?“
„Ich hätte damit einen Hilferuf ans Fenster schreiben können.“ Sebastian erinnerte sich an einen Krimi, in dem das so abgelaufen war.
„Lass das, Sebastian.“ Die Stimme seiner Freundin klang nun wieder ruhiger. „Es ist bestimmt ein Missverständnis oder so was. Wir werden das bald hinter uns haben.“
Sebastian nickte. Doch er teilte ihre Hoffnung nicht.
Der Busfahrer hatte auf der bislang geraden Sandkruger Straße kein Problem, sein Fahrzeug trotz der Handfessel sicher zu lenken. Aber was, wenn es um Kurven ging?
Als hätte der Bewaffnete seine Gedanken gelesen, wies er Nortbrook an: „Die nächste links rein.“
„Den Sprungweg?“
Der Mann nickte.
Das wäre doch eh unser Weg gewesen, dachte Nortbrook und bemühte sich, trotz der Behinderung durch die Fessel das Lenkrad auf der Abbiegespur in die geforderte Richtung zu drehen. Er musste anfänglich mit der rechten Hand etwas nachhelfen, dann lief es besser.
Kapitel 2
Sie hatten die Sandkruger Straße verlassen und fuhren nun zügig den fahrzeuglosen Sprungweg hinauf. Der bewaffnete Mann stand immer noch beim Fahrer und hielt sich mit der freien Hand an der gelben Stange fest. Nortbrook hätte ihn so wegschubsen können. Aber was hätte das gebracht? Sicher, wenn der Mann unglücklich aufkäme und bewusstlos liegen bliebe … Doch die Jugendlichen wären sicher keine große Hilfe, und er selbst war am Lenkrad festgekettet. Nein, das brachte nichts. Erst einmal abwarten. Er versuchte seinen Puls auf ein ruhiges Niveau zu bringen. Kurz ging sein Blick zum Kollegen. Der bewegte sich noch immer nicht. Nortbrook hatte inzwischen die Hoffnung auf ein Lebenszeichen von Sonnkamp aufgegeben.
Der Mann in Grün-Weiß ließ die Jugendlichen im hinteren Teil nicht aus den Augen. Dem zweiundfünfzigjährigen Russen fiel auf, dass es stickig warm geworden war im Bus. Ein süßlicher Geruch von Velours, Kunststoff und Schweiß lag in der Luft. Das Einatmen verursachte ihm leichte Übelkeit. Es musste die Aufregung sein, redete er sich ein. Er schaute kurz auf den regungslosen Mann am Boden. Das hatte er nicht gewollt. So hatte die Sache nicht laufen sollen. Was musste auch eine zusätzliche erwachsene Person im Fahrzeug sein? Das war sonst nie der Fall! Er hatte Stunden an diversen Oldenburger Bushaltestellen verbracht und die Schülerbusse genauestens beobachtet.
„Schalten sie die Klimaanlage ein!“, herrschte er den Fahrer an.
Der schaute kurz auf das Armaturenbrett vor sich. Die Anlage lief wegen der sommerlichen Temperaturen seit Fahrtbeginn auf Hochtouren. „Die ist an.“
„Dann schalten Sie sie höher!“
„Sie steht schon auf Maximalleistung, mehr geht nicht.“ Nun nahm auch der Russe, durch das ängstliche Stöhnen und Weinen aus den hinteren Bankreihen, das monotone Surren der Klimaanlage wahr. Ein Blick nach oben zur Busdecke, und er sah die vielen Luftaustrittsöffnungen, die sich bis nach hinten erstreckten. Er atmete tief ein. Wieder stieg Übelkeit in ihm hoch. Er würgte leicht und war sich nach dem schlechten Start der Entführung nicht mehr sicher, dass alles wie geplant laufen würde.
„Da vorne an dem Schild halten Sie den Wagen rechts an. Und stellen Sie ihn so ab, dass andere Fahrzeuge an uns vorbeikommen. Ich möchte nicht, dass wir ein Hindernis darstellen und dadurch irgendwer hinter uns anhalten muss!“
Der Fahrer hatte verstanden. Er verlangsamte die Geschwindigkeit des mehr als zehn Meter langen Fahrzeugs und brachte es zum Stehen. Der Bus befand sich nun genau vor einem unbefestigten Weg, der zwischen zwei dichten Gebüschen begann.
„Vordere Tür auf!“
Nortbrook versuchte eine Erklärung für den sonderbaren Halt zu finden. Ihm fiel auf die Schnelle nichts Plausibles ein. Aber er gehorchte. Zischend öffnete sich die Tür und sogleich strömte warme, unverbrauchte Luft ins Fahrzeuginnere.
Wie aus dem Nichts tauchte eine vermummte Gestalt im vorderen Eingang des Fahrzeugs auf und blieb dort stehen. Nortbrook erschrak gewaltig.
„Alles klar?“, rief der Fremde dem Bewaffneten zu. Dann sah er den am Boden liegenden Mann. „Um Gottes Willen, was ist passiert? Hast du …?“
Der Bewaffnete nickte ernst, ohne den Blick von den verängstigten Jugendlichen im Bus zu lassen. „Es war keine Absicht, aber der Kerl ist wie irr auf mich losgestürmt. Da hat sich der Schuss gelöst.“
Nortbrook glaubte Bedauern in der Stimme des Mannes zu hören. Der Fahrer war sich inzwischen sicher, dass der grün-weiß Gekleidete kein Deutscher war. Er beherrschte die deutsche Sprache zwar recht gut, aber irgendetwas in seiner Stimme klang fremd. Nortbrook tippte auf einen Russen, war sich aber nicht sicher.
Der zweite Mann war von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet und man sah nur seine vor Aufregung blinzelnden Augen in den Löchern der Gesichtsmaske. Nortbrook war aufgefallen, das der Neue seine Worte herauszischte. So, als wolle er verhindern, dass jemand seine Stimme wiedererkannte. Er konnte aber auch einen Sprachfehler haben. Der Mann war von der Statur größer als sein Kumpan. Und auch muskulöser.
„Hast du sie nicht alle? Was hatten wir abgemacht? Noch so ein Ding und du wirst die Suppe alleine auslöffeln!“
„Mach, wir haben keine Zeit. Der muss raus.“ Der Entführer zeigte mit zittriger Hand auf Sonnkamp.
Der zweite Mann stieg in den Bus, und mit ihm strömte eine intensive Parfumwolke in das Fahrzeug. Er beugte sich erst zögernd über die am Boden liegende Gestalt. Kopfschüttelnd schaute er hoch zu seinem Kumpan. Dann begann er den bewegungslosen Sonnkamp an den Beinen nach draußen zu ziehen. Das erwies sich als nicht so einfach und der Vermummte stöhnte laut vor Anstrengung. Zentimeter für Zentimeter zog er Sonnkamp zum Ausgang, sichtlich bemüht, bei dem Mann nicht noch mehr Schaden anzurichten. Bei den Stufen angekommen, schob er erst den Kopf des Mannes vorsichtig über die Türschwelle, dann den Körper. Als Sonnkamp endlich außerhalb des Busses war, legte der Schwarzgekleidete ihn seitlich im Gebüsch ab. Nortbrook konnte es genau verfolgen.
Der Bewaffnete wartete, bis sein Kumpel draußen verschwunden war, dann rief er laut nach hinten: „Alle Jungen verlassen sofort den Bus. Langsam und nacheinander. Nur die Mädchen bleiben. Doch vorher werden die Handys …“ Er schaute sich suchend um, und sein Blick verharrte bei einem Eimer, den Nortbrook für den Abfall vorgesehen hatte. „… die Handys werden dort hineingeworfen.“ Der Mann zeigte mit der Waffe auf den grünen Kunststoffeimer. „Los geht’s. Die ersten Jungen raus.“
Im Zeitlupentempo und wie in Trance erhoben sich die männlichen Schüler. Voller Angst ergriffen sie ihre Schultaschen, blieben dann aber eingeschüchtert stehen.
„Alle Taschen und Schulranzen bleiben im Wagen!“, brüllte der Mann. „Und jetzt einer nach dem anderen raus. Aber ohne die Handys!“ Er zeigte mit dem bewaffneten Arm kurz zur offenen Tür. „Und ihr lauft Richtung Wald. Und wehe, einer von euch dreht sich die nächste Zeit um! Mein Kollege draußen wird euch genauestens beobachten.“ Wieder machte er einen drohenden Schwenk mit der Waffe.
Der zweite Mann hatte sich ebenfalls neben der Tür aufgestellt. So, als wolle er Macht demonstrieren.
Zögernd und ängstlich ging Wolle als Erster auf die beiden Bewaffneten zu.
„Los, diese Richtung!“
Der Junge warf widerwillig sein Handy in den Eimer, ließ seine Schultasche fallen und schob sich dann, mit kalkweißem Gesicht, an den beiden Männern vorbei. Er sprang aus dem Bus und rannte um sein Leben.
Nach und nach fielen weitere Mobilfunkgeräte scheppernd in den Eimer, und weit mehr als ein Dutzend Jungen verließen den Bus und verschwanden im wenige Meter entfernten Gehölz. Den zurückgebliebenen Mädchen stand die Panik in die Gesichter geschrieben. Einige weinten und schluchzten laut.
Der schmächtige Entführer ging einen Schritt auf die fünf Schülerinnen zu, die am Boden kauernden. „Setzt euch jetzt alle auf die frei gewordenen hinteren Bänke. Aber vorher werft ihr alle eure Handys in den Eimer!“
Aufgescheucht verließen die Mädchen ihre Plätze und gehorchten. In Windeseile suchten sie im hinteren Teil einen freien Sitz. Bis auf eine Schülerin wurden alle fündig. Die quetschte sich mit hilflosem Blick in ihrer Not zu zwei anderen Mädchen auf eine Bank.
„Halt!“ Der Mann zeigte auf die eingeschüchterte Schülerin. „Du kannst auch verschwinden.“
Mit verweintem Gesicht, dem anzusehen war, dass sie ihr Glück noch kaum glauben konnte, schob sich das Mädchen, den Blick auf dem Boden gerichtet, an den beiden Männern vorbei. Dann sprang sie beherzt aus dem Bus und lief schluchzend los. Sie verlor einen Schuh, ohne es überhaupt wahrzunehmen, und rannte laut schreiend Richtung Wald.
Der zweite schwarz gekleidete Mann war kurz nach draußen verschwunden. Nun kam er mit zwei großen grünen Sporttaschen zurück und warf sie auf den sonst als Stehund Abstellfläche genutzten Platz gegenüber der hinteren Bustür. Dann verschwand er noch einmal für wenige Sekunden und kam mit einer schuhkartongroßen Kiste wieder, die er vorsichtig vor sich her trug. So, als ob er eine Palette Eier über ein schmales Brett balancierte.
Nortbrook war ungeheuer erleichtert, dass die Männer wenigstens ein Teil der Jugendlichen freigelassen hatten. Den angeordneten Plätzetausch konnte er über den Gangspiegel verfolgen. Über die im Bus installierte Überwachungsanlage zählte er hinten noch achtzehn Schülerinnen. Auf dem Monitor, der über ihm angebracht war, konnte er alle Businsassen genau erkennen.
Als der schwarz gekleidete Mann die Kiste in den Bus trug, wunderte sich Nortbrook etwas über dessen übertrieben vorsichtigen Gang. Der Typ blieb nun im Eingang stehen. Aus seinem seltsamen, mit Klebestreifen umwickelten Paket hingen seitlich bunte Drähte heraus.
Jetzt glaubte Nortbrook zu wissen, um was für eine Art von Kiste es sich hier handelte.
Inzwischen stand der Bus schon einige Minuten am Sprungweg und Nortbrook hoffte, dass ein vorbeikommendes Fahrzeug anhielt und ihnen Hilfe anbot. Ob es an der Hitze lag, dass so wenig Verkehr war? Bisher war nur ein einziges Auto vorbeigefahren – natürlich ohne anzuhalten.
Der Schwarzgekleidete stellte die Kiste auf dem Tresen seitlich des Fahrers ab. Nortbrook wurde es eiskalt, trotz der hohen Temperatur der Luft, die durch die offene Tür in den Bus drang. Der Maskierte zog einen Gegenstand aus der Tasche und machte sich über Nortbrooks Kopf zu schaffen.
Nortbrook hielt vor Schreck die Luft an. Der Oberkörper des Mannes war im toten Winkel des Spiegels, so konnte er wenig sehen. Aber was genau passierte da über ihm? Der Verbrecher hantierte nur wenige Zentimeter vom Kopf des Fahrers. Nortbrooks Atemreflex meldete sich zurück, er sog tief Luft ein und roch den Schweiß des Mannes. Doch über dem Körpergeruch lag der noch intensivere Duft eines Parfums. Ein angenehmer, ihm bekannter Duft, glaubte sich Nortbrook zu erinnern. Doch er musste weit ausholen, um die Verbindung zu finden. Dann fiel es ihm ein: Sie hatten damals in ihrer Drogerie hin und wieder ein sündhaft teures Parfum nur für besonders betuchte Kunden bestellt. Das roch ähnlich. Wie hieß es noch gleich?
Der Mann warf inzwischen Gegenstände im hohen Bogen auf den Einzelsitz links des vorderen Einstiegs. Laut krachten zwei Verbandkästen und ein Warndreieck auf das Kunstleder. Jetzt verstand Nortbrook. Der Mann machte oben in der Verbandablage Platz für die Bombe.
Und tatsächlich hob der Mann neben ihm die Kiste über den Kopf des Fahrers. Dann war ein mechanisches Geräusch zu hören. Eine Klappe wurde verschlossen. Danach war Ruhe. Der Schwarzgekleidete warf Nortbrook noch einen Blick zu, dann stieg er aus dem Bus.
Jetzt fiel dem Busfahrer auf, dass es sich bei dem schwarzen Overall des Mannes um eine Technikermontur handelte. Denn auf der Rückseite war eine weiße Schwinge und darunter stand HONDA.
Nortbrook kam sich wie in einem Film vor. Er erwartete jederzeit, dass jemand „Schnitt“ oder „Klappe“ rief. Doch nichts geschah.
Stattdessen kam der Schwarzgekleidete zurück. Dieses Mal hielt er eine Kette in beiden Händen. Wie die übergroße Kette eines Grünkohlkönigs, fiel Nortbrook der dumme Vergleich ein. Dann wurde ihm klar, was an dieser Kette hing wie reife Früchte.
Nortbrook hatte nie einen Krieg erlebt. Er war in Berlin geboren worden und dazu ein „weißer Jahrgang“, er hatte also nie „gedient“. Aber eine Handgranate erkannte er sofort.
Auch Sebastian war das sonderbare Gelispel des Schwarzgekleideten aufgefallen. Als dann die Aufforderung des Grün-Weißen „Alle Jungen verlassen den Bus“ gekommen war, war er erst einmal sitzen geblieben. Er wollte Anna-Lena nicht alleine lassen. Das wäre feige gewesen. Zugleich fiel ihm ein, dass sein Äußeres, speziell die lange Mähne, ihm in dieser Situation zugute kam. Dem Entführer würde erst mal gar nicht auffallen, dass ein männlicher Schüler im Bus verblieben war.
Sebastian fand sein heroisches Verhalten irgendwie aufregend. Seine Filmhelden hätten es ebenso gemacht und so fühlte er sich sicher. Ihm würde schon nichts zustoßen. Sollte der Schwindel auffliegen, würde der Typ ihn höchstens aus dem Bus werfen, wie die anderen männlichen Schüler auch.
Anna-Lena flüsterte ihm zu: „Du musst auch gehen!“ Sebastian schob sich die dunklen Locken tiefer ins Gesicht und grinste frech. „Werde dich doch nicht allein lassen mit den Typen.“
„Aber Basti …“ Dann schwieg Anna-Lena. Sie fand es beruhigend, dass er ihr zur Seite stand.
Sebastian besaß etliche Computerspiele und war schon als digitaler Rächer, Söldner und stolzer Held vor seinem Computermonitor groß rausgekommen. Auch die DVDSammlung des Vaters mit einer großen Filmauswahl war ihm nicht fremd. Doch dieses Szenario hier erschloss sich ihm nicht. Und, ähnlich wie Nortbrook, wartete auch er vergebens auf die „versteckte Kamera“.
„Was soll die Kiste?“, wollte Anna-Lena wissen, die genau wie die anderen beobachtete, was vorn geschah. Und auch die beiden neben ihr sitzenden Mädchen schauten fragend den langhaarigen Jungen an, der bei ihnen geblieben war.
Sebastian ahnte durchaus etwas, aber er war sich nicht sicher. Also sagte er nur „Vielleicht Verpflegung? Die wollen wohl nicht, dass wir hungern.“
Aber sein Versuch, die anderen zu beruhigen, blieb ohne Wirkung.
Jetzt kam der Schwarzgekleidete eilig nach hinten auf sie zu. Er trug eine Kette mit zwei grünen Gegenständen in beiden Händen und begann sie an den grauen Türbügeln mit Messingschlössern zu befestigen.
„Basti, was soll das jetzt?“, flüsterte Anna-Lena. Sebastian konnte nicht antworten. Er hatte Probleme, auch nur zu atmen. In Computerspielen hatte er Hunderte von Handgranaten auf virtuelle Feinde geworfen. Und nun befanden sich zwei von den Dingern kaum eine Armlänge von ihm entfernt.
Einige der Mädchen begannen laut zu weinen.
Eine kurzhaarige Schülerin sprang von ihrem Sitz auf und wollte nach vorne zum Ausgang rennen. Sie prallte gegen den schwarz gekleideten Mann. „Lassen Sie mich raus. Bitte, lassen Sie mich gehen! Meine Eltern werden Ihnen sicher ihr ganzes Geld geben. Aber lassen Sie mich gehen. Bitte …?“
Der Mann packte sie an den Schultern und schob sie grob zurück auf ihren Sitz. „Wenn ihr diesen Tag überleben wollt, dann macht so etwas nicht noch einmal!“, zischte er und ging zurück zum Fahrer.
Sebastian war klar, es musste sich um eine Geiselnahme handeln. Entweder war der Grund eine Lösegeldforderung oder ein Racheakt. Er versuchte sich Filme und Computerspiele in Erinnerung zu rufen, die das Thema Entführung und Geiselnahme behandelten. Vielleicht bekam er so hilfreiche Informationen dazu. Dann fiel ihm das Handy ein
„Sebastian, du musst auch gehen!“, sagte Anna-Lena leise.
Er schaute nach vorn und machte sich noch etwas kleiner. „Auf keinen Fall“, flüsterte er zurück. „Schieb mal meine Tasche zu mir rüber, Leni.“
Seine Freundin zögerte erst. Ihr Blick wanderte zum bunten Ranzen vor ihren Füßen. Sie wusste, der war Sebastians ganzer Stolz. Schon sein Vater hatte ihn während seiner Schulzeit benutzt und das abgetragene Stück gerne an den Sohn abgetreten. Der musikbesessene Sebastian hatte das Glattleder nach und nach mit den Logos seiner Lieblingsbands beklebt und mit bunten Stiften die Songnamen von Metallica, Eric Clapton, Led Zeppelin und anderen aufgemalt. Nothing else matters, One, The Unforgiven, und Tears in heaven las sie, und ihre Gedanken waren für einen Moment weit entfernt von der Gefahr, die sie umgab.
„Anna-Lena, die Tasche!“, raunte Sebastian ihr zu.
Sie schob Sebastians Lederranzen mit ihrem Turnschuh vorsichtig zu ihm hinüber.
Vorne hatte man offenbar zu tun und war abgelenkt. Den Kopf gerade, den Blick nach vorn, schaffte Sebastian es, den Ranzen zu öffnen, und fummelte sein Smartphone heraus. Überhastet steckte er es in seinen Hosenbund. Genau rechtzeitig, denn der Bewaffnete wies im selben Moment an: „Schmeißt alle Taschen nach vorne!“
Kapitel 3
Anna-Lena hatte die Minuten, seit der Mann zugestiegen war, wie abseits jeglicher Realität erlebt. Als Tochter eines wohlhabenden Sandkruger Großschlachters war sie wohlbehütet aufgewachsen. Nie hatte sie etwas entbehrt oder Leid erfahren. Mutter Isolde und Vater Eiken Bruns hatten ihrem einzigen Kind alle Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt. Bis vor knapp einem Jahr war das Mädchen noch von einem Chauffeur zur Graf-Anton-Günther-Schule gebracht worden, und natürlich auch wieder abgeholt. Erst als die hübsche Blonde sich mit ihrem Klassenkameraden Sebastian näher angefreundet hatte, waren ihr die gut gemeinten familiären Fesseln zu eng geworden. Mit Mühe hatte sie ihre Eltern überredet, im Schülerbus mitfahren zu dürfen.
Nun saß sie auf der Rückbank der Linie 315, wünschte sich Papa und Mama herbei und begann leise zu wimmern.
Der Schwarzgekleidete war zum wiederholten Male verschwunden und kehrte nun mit einer zweiten Kette zurück. Er übergab sie seinem Kollegen vorsichtig an der Bustür. Dann raunte er dem grün-weiß Gekleideten noch etwas zu und verschwand draußen im Dickicht. Die Worte, so glaubte Nortbrook, mussten den Mann erschreckt haben, denn der wich schlagartig zurück. Er strauchelte fast und musste sich, seine gefährliche Last in den Händen, an einer Bank festhalten.
Er fing sich aber schnell wieder. „Tür zu!“, herrschte der Mann den Fahrer an, und sofort drückte Nortbrook den roten Knopf. Der Typ hatte die Waffe in die Tasche der grünen Warnweste gesteckt. Für einen Moment glaubte der Busfahrer wieder eine Chance zu sehen, den Mann zu überwältigen. Doch dann fiel ihm sein Handicap, die Handfessel ein. Und die Handgranaten machten ihm Angst.