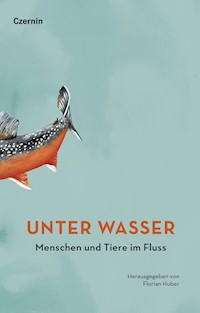
Unter Wasser E-Book
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Czernin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bäche, Flüsse und Seen beeindrucken seit jeher mit ihrer Schönheit und Unergründlichkeit: Schriftstellerinnen wie Margaret Atwood, Ingeborg Bachmann, Ilse Aichinger, Anne Weber und ihre Kollegen Mark Twain, Günter Grass, Ernest Hemingway, Friedrich Hölderlin, Arno Schmidt oder Marcel Proust haben dem Lebensraum Wasser in Gedichten, Reportagen und Erzählungen nachgespürt. Quallen, Fische, Frösche und Biber leben noch heute in großer Zahl und häufig unbemerkt in unseren Feuchtgebieten. Doch die Lebensgrundlage zahlreicher Tiere und Menschen ist bedroht, denn immer mehr Gewässer werden verschmutzt, durch Staudämme künstlich verändert oder trocknen aus. »Unter Wasser« bietet Einblicke in das verborgene Leben im Fluss und formuliert damit ein literarisch vielstimmiges Plädoyer für den Wert der Wasserwelten und ihren Schutz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Herausgegeben von Florian Huber
UNTER WASSER
Menschen und Tiere im Fluss
Herausgegeben von Florian Huber
UNTER WASSER
Menschen und Tiere im Fluss
Czernin Verlag, Wien
Huber, Florian (Hg.): Unter Wasser. Menschen und Tiere im Fluss / Florian Huber
Wien: Czernin Verlag 2022
ISBN: 978-3-7076-0758-1
Die ursprüngliche Rechtschreibung der einzelnen Beiträge wurde beibehalten.
Der Verlag dankt den Rechteinhabern für die Genehmigung zum Abdruck. Sollten darüber hinaus nachweislich Rechteansprüche bestehen, bitten wir um Mitteilung.
© 2022 Czernin Verlags GmbH, Wien
Umschlaggestaltung und Satz: Mirjam Riepl
ISBN Print: 978-3-7076-0758-1
ISBN E-Book: 978-3-7076-0759-8
Alle Rechte vorbehalten, auch das der auszugsweisen Wiedergabe in Print- oder elektronischen Medien
Inhalt
Tomas Espedal (*1961)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Francis Ponge (1899–1988)
Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko (1932–2017)
Kurt Lanthaler (*1960)
Matsuo Bashō (1644–1694)
Mark Twain (1835–1910)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Kenneth Grahame (1859–1932)
Jules Renard (1864–1910)
Gilbert White (1720–1793)
Gerold Späth (*1939)
Theodor Fontane (1819–1898)
Christine Busta (1915–1987)
Gerold Späth (*1939)
Sigmund Freud (1856–1939)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Friedrich Nietzsche (1844–1900)
Anne Weber (*1964)
Carl (1812–1855) und Theodor Colshorn (1821–1896)
Gerhard Roth (1942–2022)
Émile Zola (1840–1902)
Barbara Köhler (1959–2021)
Friedrich Engels (1820–1895)
Gottfried Keller (1819–1890)
Ivo Andrić (1892–1975)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Wolfgang Hilbig (1941–2007)
Margaret Atwood (*1939)
Reinhard Kaiser-Mühlecker (*1982)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Günter Grass (1927–2015)
Marcel Proust (1871–1922)
Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Walter Benjamin (1892–1940)
Robert Musil (1880–1942)
Annemarie Schwarzenbach (1908–1942)
Jules Renard (1864–1910)
Arno Schmidt (1914–1979)
Wilhelm Müller (1794–1827)
Ingeborg Bachmann (1926–1973)
Hans Bethge (1876–1946) / Mibu no Tadamine (ca. 860–920)
Oskar Loerke (1884–1941)
Hermann Löns (1866–1914)
Sarah Kirsch (1935–2013)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Honoré de Balzac (1799–1850)
Paulus Hochgatterer (*1961)
Jules Renard (1864–1910)
Claude Simon (1913–2005)
Seamus Heaney (1939–2013)
Ernest Hemingway (1899–1961)
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
John von Düffel (*1966)
Thomas Wolfe (1900–1938)
Ilse Aichinger (1921–2016)
Nachbemerkungen
Nachweise
Herausgeber
Tomas Espedal (*1961)
Morgen. Sonne. Der Fluss fließt quer durchs Haus. Ich lag in meinem Bett lange wach und lauschte dem Fluss, der zum Fenster und zur Tür hereinfloss, durch die Wände und von der Decke herab, er quoll aus dem Boden hoch und füllte das Schlafzimmer mit Wasser. Ich träumte, dass ich einschlief, um nie mehr zu erwachen. Ich blieb der Schlafende, ein Körper, dem es nicht gelang, den Schlaf zu verlassen, ein Gesicht, dem es nicht gelang, die Augen zu öffnen. Am Morgen erwache ich schweißgebadet, als hätte ich gekämpft; ich habe gekämpft, um aus dem Fluss zu kommen, aus dem Schlaf.
Alfred Edmund Brehm (1829–1884)
Der Binnenländer, der nur Flußfische kennt, gewinnt, ungeachtet der Verschiedenheit dieser, keinen Begriff von der Verschiedenartigkeit der Gestalt der flossentragenden, schuppenbekleideten Wirbeltiere. Sie stehen hierin keiner anderen Wirbeltierklasse nach, können vielmehr mit jeder wetteifern. Allerdings sind die meisten, wie unsere gewöhnlichen Süßwasserfische, spindelförmig gestaltet; diese Grundgestalt aber ändert in der mannigfaltigsten Weise ab und geht in die sonderbarsten Formen über, auch in solche, die uns als häßliche Verzerrungen erscheinen wollen. Der Leib streckt sich zur Schlangen- oder Wurmgestalt, plattet sich seitlich ab, daß er bandförmig wird, oder zieht sich gleichzeitig auch in der Längsausdehnung zusammen und rundet sich zur senkrecht stehenden Scheibe, drückt sich von oben nach unten nieder, verbreitert sich in waagerechter Richtung und setzt seitlich noch flügelartige Anhänge an; einzelne Teile verlängern sich, sozusagen, maßlos, wandeln sich unförmlich um, verdrehen und verzerren sich, andere verschmelzen miteinander, andere verschwinden gänzlich. Keine Wirbeltierklasse weiter zeigt so sonderbare, so unverständliche Anhängsel, ich möchte sagen, Zutaten zu dem regelmäßigen Baue, als die der Fische, keine eine ähnliche Vielseitigkeit in Anordnung der Gliedmaßen und Sinneswerkzeuge.
Francis Ponge (1899–1988)
Böschungen der Loire
Roanne, 24. Mai 1941
Nichts mehr soll mich abbringen von meiner Bestimmung: das Objekt meiner Wißbegier keinem Vorzeigen irgendeines gelegentlichen Wortfunds zu opfern, auch nicht dem Arrangieren einiger solcher Funde zu einem Poem.
Immer wieder zurückkommen auf das Objekt selbst, auf das Rohe an ihm, auf das, was es unterscheidet: unterscheidet vor allem von dem, was ich (bis zu diesem Moment) schon über es geschrieben habe.
Meine Arbeit sei die einer ständigen Berichtigung meines Ausdrucks (ohne den a-priori-Vorsatz von der Form dieses Ausdrucks) zugunsten des rohen Objekts.
Indem ich »an« der Loire schreibe, an einer Böschung dieses Flusses, sollte ich also meinen Blick, meinen Geist, unablässig darin eintauchen: jedesmal, wenn er über einem Ausdruck trocken geworden sein wird, ihn neu in das Wasser des Flusses tauchen.
Das große Recht des Objekts anerkennen, sein unwandelbares Recht, jedem Poem gegenüberstellbar … Kein Gedicht ist je ausgenommen von einer Nichtigkeitsbeschwerde seitens des Gedicht-Objekts, auch nicht von einer Anklage der Fälschung.
Das Objekt ist immer wichtiger, interessanter, rechtsfähiger (voll ausgestattet mit Rechten): es hat mir gegenüber keinerlei Pflicht, ich bin es, der im Blick auf es alle Pflichten hat.
Was die obigen Zeilen nicht klar genug sagen: ich darf auf eine poetische Form nie aus sein, nie dabei stehenbleiben – und doch ist diese ein notwendiger Moment im Verlauf meines Wissen-Wollens, weil sie ein Spiegelspiel ermöglicht, das gewisse verborgene Aspekte des Objekts zum Vorschein bringen kann. Der Zusammenstoß der Wörter, die verbalen Analogien sind eines der Mittel, das Objekt zu erforschen.
Niemals versuchen, die Dinge arrangieren. Die Dinge und die Poeme sind unversöhnbar.
Es geht darum, sich bewußt zu sein, ob man ein Gedicht machen oder einem Ding gerecht werden will (in der Hoffnung, daß der Geist dabei gewönne – die Gelegenheit zu einem neuen Schritt fände).
Es ist das zweite Glied der Alternative, für das mein Sinn (ein heftiger Sinn für die Dinge, und für den Fortschritt des Geistes) sich ohne Zögern entscheidet.
Meine Bestimmung ist also klar …
Danach soll es mich wenig kümmern, ob man das Ergebnis »Gedicht« nennen wird. Was mich betrifft: der kleinste Verdacht poetischen Geschnurres zeigt mir schon, daß ich bei dem alten Spiel mittue, und läßt mich schleunigst das Weite suchen.
Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko (1932–2017)
Der Morgen war höllisch heiß, ohne einen Tropfen, das Gras war welk vor Hitze.
Charlie, der irische Wolfshund, lag, mit heraushängender Zunge und keuchend, im Schatten und bewachte seine Herrin. Ksjutas Sense sauste nicht mit der gewohnten Heiterkeit dahin, sondern rauschte unfroh durch das Gras und blieb oft an den geknickten Halmen, die sich an die Erde preßten, stecken. Sogar die Taigaerdbeeren, die im Gras wuchsen, konnten sich nicht mehr zu voller Purpurröte aufraffen, dem Geschmack nach ähnelten sie ohnehin schon den getrockneten. Nur in der Tiefe der Taiga konnten sie sich an kleinen schattigen Stellen retten, auf der ungeschützten Wiese hielten sie es nicht aus und gaben den Saft der verdurstenden Luft ab. Die Blätter der Birken, der Espen, der Erlen, ja sogar die Lärchen- und Kiefernnadeln blickten trübe. Die Wolken von Mückenschwärmen, die gewöhnlich über dem Kopf schwirrten, waren, wer weiß wohin, verschwunden. Sie verbargen sich sowohl vor der schrecklichen Hitze als auch vor grimmiger Kälte. Nur selten hörte man Bienen summen. »Im Frühjahr saugt sich die Biene sogar an der Weide satt …«, dachte Ksjuta, »und vom Klee gibt’s den besten Ertrag, aber das Gras da – lauter Mist. Alles ist ausgetrocknet und ausgebleicht. Da will auch die Biene in den Schatten …« Je leiser es in der windstillen Taiga wurde, um so deutlicher war hinter den Bäumen das Rauschen des unsichtbaren Flußes zu hören – ein einladendes Geräusch, wie es ihr schien.
Ksjuta, die sich bemühte, das geknickte Gras an der Wurzel abzuschneiden, stieß die Sense mit einem linkischen Schwung in die Erde und ließ sie so zurück. Auf den vom Vater genähten weichen Stiefeln aus Saffianleder folgte sie mit sanften Schritten der Stimme des Flußes, und bald verwandelte sich diese Stimme zum nahen, schillernden Funkeln hinter den Stämmen. Unterwegs knüpfte Ksjuta das weiße, schwarzgetupfte Kopftuch auf und befreite damit die Haare, die sich sogleich über die Schultern wie eine Flachswoge ergossen. Sie schöpfte kurz Atem. Entlang des Weges begann sie die Kleidung von sich zu werfen: das Tuch auf die Blüten des wilden Rosmarins, die aufgeknüpfte Bluse auf einen Weidenstrauch, den schwarzen, engen Büstenhalter auf die bloßgelegten Wurzeln einer alten Lärche, um möglichst schnell den erhitzten Körper in den frischen Atem des Wassers zu tauchen. Die Stiefel, den Rock und die blaue Sporthose mit dreifachem Gummiband warf sie erst weg, als sie schon am Fluß war, auf der engen Dohlensandbank. Vor dem Blick eines Fremden hatte Ksjuta keine Angst – der Platz war einsam.
Nachdem sie von allem befreit war, was sie am Leib hatte, fühlte sich Ksjuta federleicht, und es schien, ein zufälliger Windstoß hätte sie aufheben und in weite Fernen tragen können. Aber es war windstill, und nach einer Minute wurde es Ksjuta sogar nackt zu heiß, am Ufer stehenzubleiben. Sie stieß mehrmals den Fuß ins Wasser und kreischte vor der wie Feuer brennenden Kälte, die ihren Weg über die Felsen des Sajan-Gebirges genommen hatte … Charlie tauchte unter, sprang augenblicklich wieder heraus und schüttelte sich geräuschvoll ab.
Ksjuta wählte eine andere Stelle aus, zwischen zwei Untiefen, wo das Wasser sanfter und wärmer war, und ging sachte hinein. Sie quietschte auf, tauchte dann aber bis zur Brust ins Wasser, fühlte an den Beinen die angenehm kitzliche Berührung einer hin und her getriebenen Plötze und kraulte dann mit kräftigen, hastigen Zügen los.
Der Platz, wo es keine schnelle Strömung gab, war nur klein, und von neuem geriet sie in die wie Feuer brennende eiskalte Strömung, die sie mit sich forttrug. Da begann sie, mit dem Fluß zu spielen. Bald tauchte Ksjuta in die reißende, eiskalte Strömung, bald befreite sie sich wieder von der Umklammerung, klatschte mit den Händen gegen die Wellen, und mühte sich wieder zur warmen, kaum bewegten Bucht. In der Strömung war es äußerst schwer, sich gegen ihren Sog zu stemmen. Aus alter Gewohnheit markierte sie mit dem Auge einen Baumstrunk am Ufer und bemühte sich, ihm gegenüber auf gleicher Höhe zu bleiben, um nicht unmerklich von der Strömung abgetragen zu werden. Als sie dann winzige Wasserstrecken zurückgewinnen wollte, verdoppelte sie die Zahl ihrer Züge, und obwohl es schien, daß sie sich nicht von der Stelle rühre, bewegte sich Ksjuta dennoch ganz langsam vorwärts, befand sich bereits jenseits ihres Merkzeichens, des Baumstrunks, und gelangte, fast völlig erschöpft, in die stille Bucht, wo sie, die von der Anstrengung ausruhenden Arme weit von sich gestreckt, auf dem Rücken schaukelte.
Kurt Lanthaler (*1960)
Delta | Das Delta
Da, wo der Große Fluß nicht mehr ist, ist das Delta. Ist das Land des Wassers, il paese dell’acqua.
Ich wollte, vor Jahren schon, einer Eßgenossin das Delta beschreiben. Wir saßen, an eine Hauswand gelehnt, in der letzten Sonne, hatten fürs erste gut gespeist, blickten auf einen Berg und bereiteten uns so gemächlich auf den nächsten Gang vor.
– Wo kommst du eigentlich her?, sagte sie.
– Aus dem Delta, sagte ich.
– Und das heißt?, sagte sie.
Ich versuchte es.
– Nun, nach sechshundertfünfzig Kilometern durch ein gutes Dutzend Provinzen, einmal quer durch dieses Oberitalien also, hat der Po so gut wie alles eingesammelt, was es zu sammeln gibt, Mitbringsel aus den Bergen halb Italiens, aus den Hügeln und den Hochebenen, Wasser und Abwässer und Sedimente und Sofas, das eine Mal drängt man es ihm auf, das andere Mal klaut er, einerlei, er schiebt alles mit sich Richtung Meer und breitet sich dann aus. Das ist das Delta. Hier nimmt der Große Fluß sich das Meer, wie er sich das Land nimmt, das er dem Meer genommen hat. Seit immer schon. Schiebt sich ins Meer, schafft sich neues Land und überschwemmt es dann wieder. Ab und zu. Ein Hin und Her, das seit jeher sozusagen vollautomatisch abläuft, sich selbst organisierend.
– Das sollte dir als jungem Ingegnere aber nicht recht sein, sagt die Eßgenossin und grinst. So ganz ohne deine eingreifende Hand.
– Selber Ingegnere, sage ich.
– Ingenieuse, bitte.
– Versonnen, wie du auf den Berghang da siehst, denkst du sicher wieder an Tunnel.
– Könnte durchaus sein. Samt triaxial und dilatometer.
– Nun, sage ich, ein kleinwenig kann man, wenn es unbedingt sein soll, dem Großen Fluß schon nachhelfen. Du suchst dir den richtigen Ort, steckst ein paar Äste ins Wasser, legst eine Handvoll Schilfrohre quer und wartest ab. Der Fluß baut dir einen Damm daraus. Und schon hast du, wenn du lang genug wartest, so etwas wie Land. Wenn das nicht Ingenieurskunst ist, meine Liebe.
– Ist es.
– Nur schon deshalb, weil der Damm mit Sicherheit irgendwann brechen wird, auf jeden Fall aber früher als du denkst, und der Fluß sich alles wieder nehmen wird, und zwar so lange, wie es ihm beliebt. Erst dann spricht man zu Recht von der Kunst des Ingenieurs.
– Unverbesserlicher Optimist, du.
– Falls du jetzt noch Gräben ziehst, um das Wasser wieder ablaufen zu lassen, falls du Pumpen baust und Räder drehst, den Ochsen spielst oder dann doch den Ochsen selbst im Kreis gehen läßt, hast du dich angelegt mit dem Großen Fluß. Falls du irgendwann schlauer wirst und dich mit dem Hin und Her zwar nicht anfreundest, weil du ja kein Fluß bist, aber immerhin irgendwie arrangierst, weil das als Mensch so deine fragwürdige Art ist, lebst du im Delta, zwischen Mücken und Fischen und Aalen und Vögeln. Kann man, bis auf die Mücken, alles mit Genuß essen, schmeckt hervorragend, wenn man weiß, wie. Und fliegt einem, sozusagen, ungefragt ins Maul. Wenn man die Tricks kennt. Und die hat man bald gelernt. Nach einem halben Leben spätestens. Und was ist das schon, in einem Delta.
– Wenn man jung genug ist, nicht viel.
Jung waren wir tatsächlich, damals. So jung, wie das Delta alt war. Il Grande Fiume, der Große Fluß, der Po und seine Deltaarme.
Po di Volano, Po di Goro, Po di Gnocca, Po delle Tolle, Po della Pila, Po di Maistra, Po di Venezia, Po di Levante. Die Kanäle, die scoli, die valli, die Sümpfe, die Lagunen, die sacche, die scanni, die Dünen, die Dämme, die Gräben, die isole, die golene, die Auen, das Schwemmland, die Marsch, die Inseln, la foce, die Mündung. Das Delta eben.
– Ich kann nicht sagen, sagt sie, ich hätte alles verstanden.
– Da hast du schon recht, sage ich, das geht uns allen so. Wer im Delta lebt, sieht es nicht. Und wer nicht im Delta lebt, versteht es nicht. Was auf das selbe hinausläuft.
– Du und das Delta und der Deich, und ich und der Berg und der Tunnel, sagt die Eßgenossin. Ist wie Hoch- und Tiefbau.
– Ich würde keinen Deich bauen können. Mich haben die Deiche nie wirklich interessiert. Ich wollte immer nur wissen, was hinter dem Deich ist. Wie bei dem Berg da. Als ich das allererste Mal in die Berge kam, ich war den Fluß hochgewandert wie der Aal, um dann noch weiterzuziehen, so weit, wie der Aal nicht zieht, stand ich eines Tages mitten in den Bergen, verschreckt. Und stellte fest, ich mußte hinauf, um hinüber zu sehen. Ich ging über die Berge, nicht auf die Berge. Und als ich im Nebel auf dem Gletscher stand, frag mich bitte nicht, wie ich da hinkam, das ist eine völlig andere Geschichte, und ich weiß nicht, ob ich sie wirklich erzählen sollte, ich habe bei meinen Wildereien mäßig Glück gehabt, aber als ich mich aufs Schmuggeln verlegen wollte, war’s ganz aus und das eine Mal besonders blamabel. Dabei ist das doch alles eins, das Schmuggeln und das Wildern.
– Vielleicht doch erzählen, sagt die Eßgenossin, blamabel klingt gut.
– Der Reihe nach, sage ich. Dann kommt uns unter Umständen der nächste Gang dazwischen und ich hab das Maul voll und Glück gehabt.
– Wir werden sehen. Lenk nicht ab.
– Nun gut. Im Nebel auf dem Gletscher dachte ich: Du siehst nichts, da ist nichts mehr, außer dir und dem Nebel, und bald bist du auch noch verschwunden im Nebel. Und doch fühlt es sich an, als würde der Gletscher sich bewegen. Und nicht du. Und plötzlich hatte ich das Gefühl, mitten im Delta zu stehen. In diesem Nebel, der alles schluckt im Delta, Gegend, Gelände, Geräusche, Gerüche, Gegenüber. Da wußte ich, daß es Zeit wurde, die Berge zu verlassen. Und suchte mir ein Meer ohne Delta.
– Und das gibt es?
– Wenn man es nicht zu genau nimmt, ja.
– Das sollte einem Ingegnere doch leichtfallen, oder?
– Wobei: Das Meer. Als Kind hatte ich gedacht, als Kind war ich überzeugt gewesen, convintissimo, felsenfest, daß der Große Fluß, also das, was ich von ihm kannte, weit größer sei als das Meer, ungleich ausgedehnter. Nicht im geringsten vergleichbar. Natürlich, ohne Frage. Das Meer war nur so etwas wie ein Anhängsel des Großen Flusses, eine Ausstülpung, so etwas wie die Blase des Schweines, wenn sie nach der Schlachtung aufgeblasen wird.
– Langsam bekomme ich wieder Hunger, sagt die Eßgenossin. Wenn auch nicht direkt auf Schweinsblase.
– Wobei das durchaus auch ein Rezept abgeben würde, sage ich. El bombolòn.
– Ich weiß ja nicht.
– Es ist wie draußen im Delta. Du mußt es versuchen. Vorher weißt du es wirklich nicht. Du hältst die Hand ins Wasser, im Gehen, vom Boot aus, und schmeckst, ob es schon Salzwasser ist oder noch süß. Oder beides.
– Das ist dann Brackwasser, und mir wäre wieder nicht geholfen.
– Ciappà!, sage ich. Chapeau! Da kommt unser Essen.
Matsuo Bashō (1644–1694)
Der alte Teich.
Ein Frosch springt hinein.
Das Geräusch des Wassers.
Mark Twain (1835–1910)
Zwei oder drei Tage und Nächte gingen vorbei





























