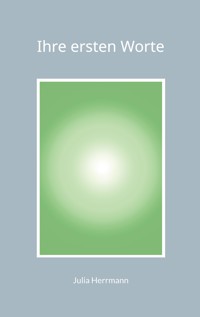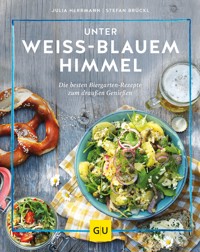
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: GU Themenkochbuch
- Sprache: Deutsch
Ob an der Elbe, am Rhein oder im Erzgebirge: eine Prise Süden macht das Leben überall locker und leicht – deshalb sind bayerische Biergarten-Schmankerl auch im Norden so beliebt wie in Ost und West. Unter weiß-blauem Himmel verbindet den Trend zum Picknick-Genuss mit der Liebe zum Regionalen, und weil sich in einem bayerischen Biergarten die unterschiedlichsten Typen treffen, ist bei den Rezepten vom bayerischen Klassiker bis zu internationalen Neuinterpretationen alles beieinander, mal deftig, mal süß, mit und ohne Fleisch – garniert mit Biergarten-Geschichten rund um Steckerlfisch & Co. Obatzda, Wurstsalat, Vitello Florello, Superbowl-Schichtsalat oder Brezen-Panzanella – wie gut, dass Genuss im Freien überall möglich ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Impressum
© eBook: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
© Printausgabe: 2022 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München
GU ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, www.gu.de
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Bild, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeder Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages.
Projektleitung: Dr. Maria Haumeier
Lektorat: Katrin Wittmann
Korrektorat: Anne-Sophie Zähringer
Bildredaktion: Nafsika Mylona
Covergestaltung: ki36 Editorial Design, Sabine Krohberger
eBook-Herstellung: Lea Stroetmann
ISBN 978-3-8338-8438-2
1. Auflage 2022
Bildnachweis
Coverabbildung: Mathias Neubauer
Illustrationen: Julia Herrmann
Fotos: Adobe Stock: S. Hoss, WoGi, freebird7977, bernardbodo, Thorsten Link; AWL Images: Christian Mueringer; Getty Images: iStock Editorial/Filmfoto, Tom Chance, Nikada, Rosmarie Wirz, Matt Porteous, Johner Images, Frizi, iStockPhoto/Ben185, Aisylu Akhmadieva, BFC/Ascent Xmedia; HUBER IMAGES: Reinhard Schmid, Francesco Carovillano; JAHRESZEITEN VERLAG: Walter Schmitz, Gulliver Theis, Christina Körte; laif: Jens Schwarz, Frank Siemers, Martin Kirchner, Dagmar Schwelle; lookphotos: Peter von Felbert; mauritius images: Bruno Kickner; picture alliance: STOCK4B/VisualEyze; plainpicture: Andreas Süss, Thomas Degen; Seasons Agency: Jalag/Tim Langlotz, Jalag/Gregor Lengler, Jalag/Christina Körte, Gräfe und Unzer Verlag/Klaus-Maria Einwanger, Jalag/Anna Mutter, Jalag/Gregor Lengler, Jalag/Darshana Borges, Jalag/Walter Schmitz, Jalag/Natalie Kriwy; stocksy: Studio Firma; unsplash: Maria Dobelmann
Fotografie: Mathias Neubauer, Seligenstadt
Foodstyling: Manuel Weyer, Mainz
Syndication: www.seasons.agency
GuU 8-8438 04_2022_02
Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.
Die GU-Homepage finden Sie im Internet unter www.gu.de
www.facebook.com/gu.verlag
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
wir wollen Ihnen mit diesem E-Book Informationen und Anregungen geben, um Ihnen das Leben zu erleichtern oder Sie zu inspirieren, Neues auszuprobieren. Wir achten bei der Erstellung unserer E-Books auf Aktualität und stellen höchste Ansprüche an Inhalt und Gestaltung. Alle Anleitungen und Rezepte werden von unseren Autoren, jeweils Experten auf ihren Gebieten, gewissenhaft erstellt und von unseren Redakteur*innen mit größter Sorgfalt ausgewählt und geprüft.
Haben wir Ihre Erwartungen erfüllt? Sind Sie mit diesem E-Book und seinen Inhalten zufrieden? Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und wir freuen uns, wenn Sie diesen Titel weiterempfehlen, in ihrem Freundeskreis oder bei Ihrem Online-Kauf.
KONTAKT ZUM LESERSERVICE
GRÄFE UND UNZER VERLAG Grillparzerstraße 12 81675 München
Backofenhinweis
Die Backzeiten können je nach Herd variieren. Die Temperaturangaben in unseren Rezepten beziehen sich auf das Backen im Elektroherd mit Ober- und Unterhitze und können bei Gasherden oder Backen mit Umluft abweichen. Details entnehmen Sie bitte der Gebrauchsanweisung.
Endlich gescheide Biergarten-Rezepte!
DER BIERGARTEN IST EINE BAYERISCHE INSTITUTION. DOCH DAS PARADIES HAT EINEN ENTSCHEIDENDEN MAKEL: WARUM DIESES BIERGARTEN-KOCHBUCH DRINGEND NOTWENDIG IST!
Wir saßen im Biergarten! Die Sonne schien durch das rot gefärbte Blätterdach, die Kastanien warfen ihr Schattenmuster in den Kies. Über den Bierbänken lag ein Geräuschteppich aus Stimmen, Lachen und Gemurmel, als spiele hier ein Biergartenorchester eine Symphonie der Behaglichkeit, in das ein unsichtbarer Dirigent ein verheißungsvolles Klirren und Klimpern gemischt hatte. Unsere Kinder tobten auf dem Spielplatz und kamen höchstens mal bei uns vorbei, um zu fragen, ob sie nicht doch Spezi statt Apfelschorle haben dürfen. Der Biergarten kommt dem Himmel auf Erden ziemlich nahe! Doch leider hat das irdische Paradies einen Haken. Hier trat plötzlich ein riesiger Hund ins Biergarten-Bild und deckte den Makel unerbittlich auf: Eine Dogge näherte sich unserem Biertisch und störte die Gemütlichkeit. Wir fürchteten uns ein wenig, schließlich war der Vierbeiner fast auf Augenhöhe mit uns. Das Urviech von einem Hund reckte den Schädel über die aufgereihten Speisen, orientierte sich kurz und schnupperte am Schnitzel einer Freundin. Schnell brachte sie dieses in Sicherheit anstatt sich selbst. Julias Mann sorgte sich um seine Schweinshaxe – doch das Herz des vierbeinigen Monsters schlug bereits deutlich schneller für etwas anderes: Der Hund wendete sich vom Schnitzel ab, schnappte sich die große Breze, die wir in die Mitte des Tisches gelegt hatten, damit alle mitessen können, und verschwand hast-du-nicht-gesehen zwischen den Bierbänken. Eine ältere Dame mit einer losen Hundeleine in der Hand hatte die Verfolgung aufgenommen und rief uns halb außer Atem zu: »Tut ma leid, aber wenn er a Brezen sieht, ist er nicht mehr zum Halten.«
Diese Geschichte erzählt zwar auch von der schlechten Erziehung Münchner Hunde, doch dahinter steckt mehr. Die Dogge führte uns exemplarisch vor, woran die große Biergartenherrlichkeit krankt: Wir Gäste stehen ja vor derselben Auswahl und entscheiden uns dann oft – wie der Hund! – für das bayerische Grundnahrungsmittel, die Breze, und nicht für: labbrige Pommes, fettiges Fleisch (kein Mensch weiß woher), letscherte Saucen, langweiligen Obazden, der nicht so heißen darf, und nichtssagenden Kartoffelsalat. Vor allem als Vegetarierin ist man im Biergarten oft aufgeschmissen und hat stets nur die Wahl zwischen Pommes und Obazden. Als Fleischfresser ist die Auswahl größer, aber die Qualität noch schlechter. Im Biergartenparadies fließt zwar Bier wie Milch und Honig, aber das Essen lässt zu wünschen übrig. Die Süddeutsche Zeitung schreibt sogar: »Es ist ein offenes Geheimnis, dass in den Biergärten und Wirtshäusern der Stadt zum Großteil Convenience auf den Tisch kommt. Die vom langen Warmhalten ausgetrockneten Schweinsbraten, die Kartoffelknödel aus der Tüte und Fleischpflanzerl vom Fließband sollte man Besuchern jedenfalls nicht als kulinarische Heimatkunde zumuten.« Natürlich ist das Essen nicht in allen Biergärten so schlecht, aber in vielen. Die gemeinen bayerischen Biergarten-Tifosi würden jetzt fragen: Braucht’s des wirklich? Nein, des braucht’s wirklich nicht. Zum Glück haben wir im Biergarten die weltweit einmalige Gelegenheit, unser Essen selbst mitzubringen. Daraus sollte sich doch etwas machen lassen – dachten wir uns. So entstand die Idee für dieses Kochbuch: die besten Biergarten-Rezepte zum Draußen-Genießen!
Eine gscheide (bayer. für sehr gut, richtig, vernünftig) Biergartenküche soll Tradition und Moderne vereinen. Beim Wort Biergarten fallen einem sofort Speisen wie Obazda, Wurstsalat oder Steckerlfisch ein. Viele traditionelle Gerichte spielen auch in unserem Kochbuch eine Rolle, mal klassisch, mal innovativ. Auch die Breze gehört zu Bayern und zum Biergarten wie die Pedale zum Radlfahren – eine Kindheit ohne dieses Hauptnahrungsmittel ist hier zwar möglich, aber sinnlos. Deswegen haben wir neue Rezepte rund um dieses verschlungene Gebäck kreiert wie etwa eine Brezen-Panzanella. Da wir vor allem auf saisonale und regionale Produkte setzen, interpretieren wir internationale Gerichte bayerisch wie etwa die Ceviche mit Hechtfilet und Radi. Natürlich passen auch viele österreichische, italienische oder französische Gerichte wunderbar zum Biergarten – was das angeht, sind wir kulinarische Kulturimperialisten! Im Biergarten gilt: Alles geht, nichts muss. Aber eine zweckmäßige Bedingung ergibt sich dann doch: Die Gerichte müssen praktisch zu transportieren sein! Bestenfalls mit dem Rad. Deswegen sind alle unsere Rezepte nicht nur für den Biergarten geeignet, sondern auch für Radausflüge am Rhein, ein Picknick am Elbstrand oder im Wienerwald, eine Wanderung in den Alpen, im Bayerischen Wald oder im Erzgebirge, eine Brotzeit im Görlitzer Park in Berlin, in einem Waldstück bei Zürich, auf einer Elsässer Autobahnraststätte, für einen Tag am Bodensee oder an der Nordsee – kurz gesagt: Es sind Rezepte zum Draußen-Genießen, egal wo! Dank der Dogge wird mit diesem Buch nicht nur der Biergarten zum Paradies unter Kastanien, zum Himmel auf Erden, sondern auch alle anderen Ausflugsziele.
Die Geschichte des Biergartens
DER BIERGARTEN IST EIN BAYERISCHES URGESTEIN. ER HAT BIERREVOLUTIONEN ERLEBT, LOLA MONTEZ GESEHEN UND VIEL IRRSINN DER BAYERISCHEN GESCHICHTE ÜBERDAUERT.
Der Biergarten ist eine bayerische Institution. Seit über 200 Jahren pilgern Einheimische und Touristen unter die altehrwürdigen Kastanienbäume, unterhalten sich und genießen auf Bierbänken im sommerlichen Schatten eine Mass Bier. Dabei reicht der Bekanntheitsgrad von Biergärten weit über Bayern hinaus. Das zeigt ein Blick in das moderne Weltlexikon Wikipedia: Dort existiert die »Biergarten«-Seite in allen größeren europäischen Sprachen, dabei wird Biergarten stets deutsch geschrieben, außer im Englischen, wo sie mit Beer Garden auf Anglisierung setzen. Wurscht (bayer. für egal), gemeint ist immer dasselbe: Der Biergarten nach bayerischem Verständnis. Denn richtige Biergärten gibt es vor allem in Bierfranken und Oberbayern mit dem Epizentrum München. Aber was ist denn jetzt ein gscheider (bayer. für sehr gut, richtig, vernünftig) Biergarten? Der Duden definiert Biergarten als »Gartenwirtschaft, in der vor allem Bier ausgeschenkt wird«. So weit, so gut. Doch da könnte schon die Frage aufkommen, was das jetzt speziell mit Bayern zu tun hat und weshalb diese süddeutschen Sturschädel dieses Wort für sich reklamieren. Tatsächlich ist der Unterschied zwischen einem bayerischen Biergarten und einem – sagen wir – badischen fundamental: In bayerischen Biergärten dürfen Sie Ihr Essen selbst mitbringen! Getränke müssen Sie kaufen, Speisen können Sie kaufen. Doch Vorsicht: Auch in Bayern ist nicht überall Biergarten drin, wo Biergarten draufsteht! Das Wort ist zum Inbegriff für Gemütlichkeit, Behaglichkeit und bayerische Lebenslust avanciert. Deshalb wird es gerne vor den Marketing-Karren gespannt. So nennen Gaststätten ihren Außenbereich häufig Biergarten, obwohl es Wirtsgärten sind. In Bayern ist das eigentlich nicht erlaubt und wie es für den Freistaat in der Bürokratischen Republik Deutschland (BRD) üblich ist, gibt es dazu eine eigene Biergartenverordnung. In der wird geregelt, was ein Biergarten ist: »Kennzeichnend für den bayerischen Biergarten im Sinne der Verordnung sind vor allem zwei Merkmale: 1. der Gartencharakter und 2. die traditionelle Betriebsform, speziell die Möglichkeit, dort auch die mitgebrachte, eigene Brotzeit unentgeltlich verzehren zu können, was ihn von sonstigen Außengaststätten unterscheidet.« Dieses Prinzip trägt maßgeblich zur ungezwungenen Atmosphäre im Biergarten bei, zu seiner sozialen Funktion und seiner Beliebtheit. Aber der Reihe nach: wie es zu dieser erstaunlichen und gleichzeitig grandiosen Regelung kam und was der bayerische Biergarten im Laufe der Jahrhunderte sonst noch alles erlebt hat – eine Spurensuche.
Am Anfang war das Bier. Und das Bier war bei den Menschen – nein! Eben nicht, zumindest nicht im Sommer. Ab 1539 verbot die bayerische Brauordnung das Bierbrauen zwischen Georgi (23. April) und Michaeli (29. September). Der Grund dafür dürfte den Berlinern unter Ihnen bekannt vorkommen: der Brandschutz. Der Brandschutz kann also nicht nur die Eröffnung eines Flughafens um neun Jahre verzögern, sondern auch Bierprobleme bereiten. Bierbrauen funktioniert im Prinzip seit hunderten von Jahren gleich: Zunächst wird die sogenannte Maische hergestellt. Dafür kocht man Malz in Wasser auf, um Zucker aus Stärke zu gewinnen. Nach dem Läutern kocht man in der Würze, wie die Maische jetzt heißt, Hopfen. Daraus lösen sich Bitterstoffe, die das Bier haltbar machen, und Aromastoffe, die das Bier schmackhaft machen. Anschließend kommt Hefe ins Bier, um den Gärprozess in Schwung zu bringen. Beim Gären wird der Zucker in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt. Es gibt verschiedene Hefen, die eine bestimmte Gärtemperatur brauchen: Helles Bier etwa ist untergärig und gärt unter 10° Celsius.
Dieser kurze Exkurs ins Reich des Brauwesens zeigt das Problem der damaligen Zeit: Zum Bierbrauen braucht es kochendes Wasser, kochendes Wasser benötigt Hitze – und die erzeugte im 16. Jahrhundert offenes Feuer. Feuer ist allerdings eine gefährliche Sache, weshalb es zu zahlreichen Bränden kam, vor allem in den Sommermonaten. Deswegen das Verbot. Nun ist es weder heute, noch war es damals denkbar oder gar wünschenswert, dass im Sommer – gerade im Sommer! – kein Bier zur Verfügung steht. Auf Vorrat brauen allein, reichte nicht aus. Denn bei warmen Temperaturen kann untergäriges Bier nicht gären, außerdem wurde das gängige Bier schnell schlecht. Deshalb erfanden die Brauer einige Tricks, um über die warme Jahreszeit zu kommen. Zum einen verwendeten sie größere Mengen an Hopfen und Malz. Das Bier enthielt so mehr Bitterstoffe, wurde malziger und stärker und somit haltbarer. Zum anderen legten sie tiefe Keller an, in denen sie das Bier kühlten. Über den Kellern pflanzten sie Kastanien – der optimale Baum! Die Rosskastanie ist ein Flachwurzler, sie schlägt ihre Arme nicht tief ins Erdreich, sondern wurzelt vor allem in die Breite. Außerdem hat sie eine dichte Baumkrone mit großen schattenspendenden Blättern. Manche dieser Rosskastanien schützen ihre Gäste noch heute – 200 Jahre später! – vor der Sonne und wenn es sein muss, auch vor Regen. Durch den Schatten der Bäume erwärmten sich die Bierkeller unter der Erde nicht so stark. Um auf Nummer sicher zu gehen, karrten die Brauer bereits in den Wintermonaten Unmengen an Eis aus den großen Seen und der Isar mit Pferdekutschen und Eselkarren in die unterirdischen Keller. Dann brauten sie im März das letzte Bier und lagerten es in den Bierkellern ein. In der Regel hielt es sich dort bis Ende September, wenn die neue Brausaison begann. Zunächst wurde das leichtere und nicht so lange haltbare Bier getrunken und anschließend das stärkere. Dieses untergärige Bier nannte man Märzen, weil es vor allem im März gebraut wurde (und Aprilen seltsam klingt). Ab 1810 begannen die Münchner damit, jedes Jahr im September auf einem riesigen Fest die Restbestände des Märzen auszutrinken – schließlich gab es bald frisches Bier! Das war zwar nicht der ursprüngliche Grund für das Volksfest, aber doch eine wunderbare Fügung. Das Fest firmiert heute nicht unter dem Namen Septemberfest sondern Oktoberfest, auch wenn es stets im September und nur wenige Tage im Oktober stattfindet – die Münchner nahmen es mit den Monaten offenbar noch nie so genau. Noch heute wird auf der Wiesn vorrangig Märzen ausgeschenkt. Es heißt allerdings oft einfach Oktoberfestbier, weil der findige Brauer Gabriel Sedlmayer das Märzen 1871 so taufte und die anderen Brauereien der Spaten-Brauerei den Werbetrick bald nachmachten. Die Wiesn beherbergt heute übrigens auch die größten Biergärten der Welt: Im Außenbereich der Zelte darf jeder seine Brotzeit selbst mitbringen. Das hat mit den Essensständen außerhalb der Zelte zu tun. Wer dort einen Steckerlfisch oder eine Pizza kauft, kann beides an einem Tisch der großen Zelte essen. Wie üblich müssen die Getränke gekauft werden – doch so weit sind wir in unserer Geschichte noch gar nicht!
Durch die Bierkeller war das Lagerproblem also gelöst. Nun konnten sich die Brauereien eigentlich zurücklehnen und warten, bis der Elektroherd und der Kühlschrank erfunden werden und alle wären glücklich und zufrieden. So lief es natürlich nicht. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurde es einigen Brauern zu blöd, die Fässer nur vom Bierkeller zum Wirt zu kutschieren. So fingen sie an, das Bier selbst an Ort und Stelle auszuschenken und zu verkaufen. Die Gäste ließen sich nicht lumpen: kühles Bier im Kastanienschatten? Wer konnte da schon widerstehen? Nun lässt sich denken, dass die Wirte von dieser Entwicklung not amused waren. Schließlich verloren sie ihre Gäste an einen Direktvermarkter. Was tut man in dieser Situation? Das Kartellamt oder das Handelsministerium gab es Anfang des 19. Jahrhunderts noch nicht, also beschwerten sie sich direkt beim König. Es klingt verwunderlich, aber sogar ein Autokrat fällt hin und wieder eine weise Entscheidung. So erlaubte der bayerische König Max I. Joseph 1812 den Brauereien, ihr Bier direkt am Lagerort auszuschenken, allerdings mit einer Prämisse: Sie durften kein Essen ausgeben, die Gäste mussten ihre Mahlzeit also selbst mitbringen. Damit war der Biergarten, wie wir ihn heute kennen, geboren! Diese Regelung hat immer noch Bestand. Ein astreiner Lobbystreit mit positiven Folgen für die Bürger – das erlebt man auch nicht alle Tage. Besagter Monarch überraschte übrigens noch ein zweites Mal mit einer sinnvollen Erfindung: Bereits zwei Jahre zuvor, 1810, feierte er die Hochzeit des Kronprinzen Ludwig mit Therese von Sachsen-Hildburghausen auf der nach ihr benannten Theresienwiese mit den restlichen Märzen-Vorräten, Essen und einem Pferderennen und lud dazu die gesamte Bevölkerung ein. So hob er das Oktoberfest aus der Taufe – auch das gibt es 200 Jahre später immer noch. Vielleicht war Max Joseph deshalb ein vergleichsweise beliebter »Diktator«.