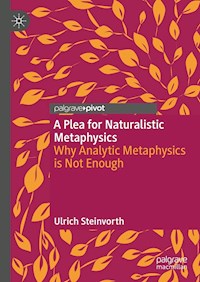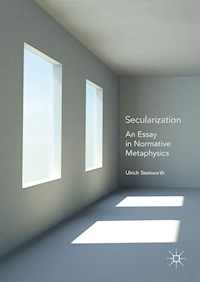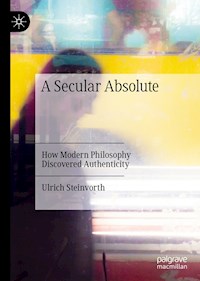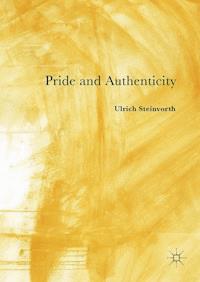Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Was ist eine Demokratie, und wann ist sie liberal? Ist Politik legitim, wenn sie der Volkssouveränität oder wenn sie den Menschenrechten entspricht? Was kann und was sollte man von der Politik erwarten, was ist überhaupt Politik? Ulrich Steinvorth sucht in diesem Buch neue Antworten auf diese in der gegenwärtigen politischen Lage brandaktuellen Fragen. Ausgehend von Aldous Huxleys Fabel »Brave New World«, die eine Gesellschaft beschreibt, in der eine Minderheit mit technischen Mitteln die Mehrheit so manipuliert, dass sie ihre Unterdrückung als Beglückung empfindet und selbst Menschenrechtsverletzungen hinnimmt, wirft Steinvorth die oft gestellte Grundsatzfrage auf, was überhaupt Politik oder das Politische ist. Er unterscheidet das (am Gesellschaftsvertrag und an Nutzenmaximierung orientierte) ökonomische vom (nicht an Nutzenmaximierung orientierten) politischen Modell als den beiden wichtigsten Theorieansätzen in der politischen Theorie und kritisiert das ökonomische Modell in seiner vermutlich stärksten Form, nämlich in der, die John Rawls ihm gegeben hat. Rawls verlangt von der Politik den Schutz der Selbstachtung aller, den nur eigengesetzliche Subgesellschaften geben können, wie Locke den Schutz der eigengesetzlichen Familie und Wirtschaft. Den Schutz eigengesetzlicher Gesellschaftssphären finden wir als Ziel der Politik auch bei Hegel und, in ausbaufähiger und auf gegebene politische Aufgaben anwendbarer Form, bei Max Weber. Dessen Wertsphären macht Steinvorths Buch, mit Anleihen bei so verschiedenen Autoren wie Aristoteles und Csikszentmihalyi, zur Grundlage seiner politischen Theorie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ulrich Steinvorth
Unterdrückung durch Beglückung
Eine liberale Revision der politischen Philosophie
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://portal.dnb.de› abrufbar.
eISBN (PDF) 978-3-7873-4336-2
eISBN (ePub) 978-3-7873-4375-1
www.meiner.de
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2023. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten. Konvertierung: Bookwire GmbHFür Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1. Huxleys Brave New World
2. Agrippas Fabel und zwei Politikmodelle
3. Das antike Politikverständnis
4. Die Willensprämisse
5. Warum dies Buch nicht kürzer ist
Teil I: Das ökonomische Modell
6. Kulturkrise?
7. Wittgensteins Gnosis
8. Heideggers deutsches Dasein
9. Poppers Fallibilismus
10. Rawls’ rekonstruktiver Infallibilismus
11. Rawls’ Gerechtigkeitsgrundsätze
12. Rawlskritiken
13. Mulligans Meritokratie
14. Selbsteigentum
15. von Platz’ Entfremdung
Teil II: Das politische Modell
16. Rawls’ Selbstachtung
17. Walzers Gerechtigkeitssphären
18. Lockes Liberalismus
19. Webers Sphärenbegriff
20. Handlungs- und sphärenimmanente Vollkommenheit
21. Reale und idealtypische Wertsphären
22. Die Bedeutung autotelen Handelns
23. Bodins Souveränität
24. Wie Locke zum Demokraten wurde
25. Was begründet der Gesellschaftsvertrag?
26. Menschenrechte und Volkssouveränität
27. Glokalität statt Nationalität
28. Kontroll- statt Willensdemokratie
29. Eine subsidiäre Rätedemokratie autoteler Beamter
30. Identität und Globalisierung
31. Können Selbstideale repressionsfrei sein?
32. Was die Autotelienorm verlangt
33. Wie die Autotelienorm zu begründen ist
34. Von der Nation zur Wertsphäre
35. Liberale Identität und Öffentlichkeit
36. Warum prometheische Scham falsch und wozu Disziplin gut ist
Literatur
Les utopies apparaissent bien plus réalisablesqu’on ne les croyait autrefois.
Nicolas Berdjaev im Préface zu HuxleysBrave New World
Vorwort
Die politische Philosophie unterscheidet sich von andren Themenfeldern der Philosophie durch die deutlichere Diskussionsbedürftigkeit ihres Gegenstands, der Politik, und durch ihre sachliche und historische Einheit. Ihre späteren Autoren kommentieren die früheren und machen sie zu Klassikern. Ästhetik, Moraltheorie und Epistemologie empfangen ihre Studenten mit einem dissonanten Chor dunkler Antworten auf unklare Fragen. Die Fragen der politischen Philosophie scheinen dagegen klar: Was ist Politik, worum geht es in ihr, worum sollte es gehen; worin besteht ihre Gerechtigkeit oder Legitimität? Auf diese Fragen geben ihre Klassiker, Platon und Aristoteles, Hobbes und Locke, Rousseau und Kant, Hegel, Marx und Rawls verschiedene, aber verständliche Antworten, die die jeweils letzte Generation politischer Philosophen erneut bedenkt und den veränderten Gesellschaften anpasst.
Doch die leichtere Zugänglichkeit der politischen Philosophie hat einen Haken. Sie erschwert den Bruch mit Annahmen, die man schon immer machte. Sie scheinen bewährt oder doch nicht einfach ersetzbar, mögen sie auch problematisch sein. Zu den anerkannt problematischen Annahmen gehört die Erwartung, Politik könne als Angelegenheit einer Nation statt nur als die der gesamten Menschheit erörtert werden. Die Moraltheorie glaubte nie an diese Möglichkeit, und die Ökonomie ließ sie früh fallen. Politische Philosophen erkennen zwar an, Politik müsse global sein, glauben aber wie Rawls, auf nationaler Ebene beginnen zu können. Dadurch stärken sie den Nationalismus und vernachlässigen die öffentlichen Anliegen, deren Entdeckung, Erörterung und Bewältigung Aufgabe der Politik und heute nur global möglich sind. Eine ebenso lieb gewordene wie fatale Annahme ist der Glaube, Politik sei legitim, wenn ihr die Mehrheit der Betroffenen zustimmt. Dies ist das Dogma der Volkssouveränität.
Die folgenden Ausführungen entwerfen eine politische Philosophie, die die Dogmen der Volkssouveränität und der Beschränkbarkeit der Politik auf eine Nation verwirft und dennoch demokratisch und liberal ist. Das ist unmöglich, sagen Sie? Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie Ihren Unglauben in Neugier verwandeln könnten! Der Romanautor Aldous Huxley hielt die Legitimierung der Politik durch das Volk für falsch und ihre Beschränkung auf Nationen für unmöglich und blieb doch liberal und demokratisch. Sollte das Philosophen unmöglich sein? Philosophie ist weniger unterhaltsam als ein guter Roman, aber sie kann unmissverständlicher die Gründe und Folgen liebgewordener Irrtümer zeigen.
Ich brauchte lange, um zu verstehen, warum die Dogmen der Volkssouveränität und der Beschränkbarkeit der Politik auf eine Nation falsch und welch konstruktive Ideen für einen reformierten Liberalismus in Aristoteles’ Begriff der autarkeia und Max Webers Begriff der Wertsphäre verborgen sind. Geholfen haben mir dabei vor allem Fragen von Studenten in Vorlesungen und Seminaren, die ich in verschiedenen Erdteilen zur politischen Philosophie gehalten habe, und Einwände von Kollegen, besonders meines Freunds von der juristischen Fakultät, Hans Peter Bull. Ich danke auch Esther Neuhann, die eine frühere Fassung dieses Buchs gelesen und klug kommentiert hat, und den Personen aus nichtwestlichen Zivilisationen, die meinen Horizont erweitert haben, vor allem Yumin Ao.
Hamburg, Dezember 2022
Einleitung
1. Huxleys Brave New World
Einer der ersten Autoren, die auf die Gefahren des Dogmas der Volkssouveränität und ihr Potential zur Rechtfertigung krassen Unrechts hinwiesen (ohne von einem solchen Dogma zu reden), war Aldous Huxley. In seinem Roman Brave New World (1932) beschreibt er eine Gesellschaft, in der eine Minderheit mit Hilfe moderner Techniken die Mehrheit in einen Zustand versetzt, den sie selbst als Glück und als Grund versteht, der Politik ihrer politischen Führer zuzustimmen. Unterdrückung durch Beglückung war zwar schon immer ein Erfolgsrezept für Herrscher. Aber in Huxleys Roman ist die Technik ein Werkzeug, nicht nur die Umwelt unsren Wünschen, sondern Wünsche und Willen der Beherrschten denen der Herrschenden anzupassen.
Huxley verstand seinen Roman als Fabel (1958/2000: 7,10 et al.), die von der heutigen Politik erzählt, zu der er »ever more effective methods of mind-manipulation« rechnete, mit deren Hilfe zwar »elections, parliaments, Supreme Courts and all the rest« erhalten bleiben. Aber die
underlying substance will be a new kind of non-violent totalitarianism. All the traditional names, all the hallowed slogans will remain exactly what they were in the good old days. Democracy and freedom will be the theme of every broadcast and editorial – but democracy and freedom in a strictly Pickwickian sense. Meanwhile the ruling oligarchy and its highly trained elite of soldiers, policemen, thought-manufacturers and mind-manipulators will quietly run the show as they see fit. (2000: 86)
Nicht der böse Wille der Herrschenden führt zum sanften Totalitarismus, sondern die moderne Technik, eine der größten Leistungen unsrer kreativen Vernunft. Ihr blinder Gebrauch vernichtet das Selbst, das wollen könnte, denn, wie Hannah Arendt (1973: 457) in ihrer Analyse des harten Totalitarismus sagte, wir sind nur »conditioned reflexes, … marionettes without the slightest trace of spontaneity«. Ein sanfter Totalitarismus aber ist deshalb leicht möglich, weil wir auf ihn nicht vorbereitet sind:
Everything in our background has prepared us to know and resist a prison when the gates begin to close around us … We take arms against such a sea of troubles, buttressed by the spirit of Milton, Bacon, Voltaire, Goethe and Jefferson. But what if there are no cries of anguish to be heard? Who is prepared to take arms against a sea of amusements? To whom do we complain, and when, and in what tone of voice, when serious discourse dissolves into giggles? What is the antidote to a culture’s being drained by laughter? … our philosophers have given us no guidance in this matter. (Postman 19895/2005: 156 f.)
Unsre Philosophen haben uns durch ihr Dogma der Volkssouveränität irregeführt. Die Bürger in Huxleys Schöner neuen Welt halten die Politik, die ihnen ihr Selbst raubt, für gerecht; die Leser halten sie für abscheulich; die meisten Philosophen ebenso, aber nach der vorherrschenden Philosophie ist legitim, was die Zustimmung der Regierten findet. Der Abscheu Huxleys und seiner Leser vor seiner Schönen neuen Welt ist mit dieser Legitimitätsidee unvereinbar. Wie können wir besser vorbereitet sein? Wir sollten erkennen, dass ein Widerspruch zwischen den bekannten Eingangsformeln gerichtlicher Entscheidungen, Im Namen des Volkes und Im Namen des Gesetzes, besteht. Dieser Widerspruch führt zur Grundfrage dieses Buchs, was Politik ist und was sie sein sollte; was sie eigentlich ist.
Die Frage wurde oft gestellt und beantwortet. Wir müssen die früheren Antworten mitbedenken, um zu verstehen, wie der harte und der sanfte beglückende Totalitarismus möglich wurden. Die Geschichte der politischen Philosophie erschlägt uns jedoch durch die Fülle ihrer Aussagen. Für ihr Verständnis brauchen wir einen Filter, der das für unser heutiges Interesse Relevante vom Irrelevanten trennt. Als solchen Filter gebrauche ich die Frage, ob man Politik ökonomisch verstand oder nicht.
Das ökonomische Politikmodell, das heute vorherrscht, begünstigt Huxleys schöne neue Welt, da es wie die beglückten Bürger Politik an ihren ökonomischen Leistungen misst. Doch das dem ökonomischen entgegengesetzte Modell, das man daher vorziehen möchte, leidet unter der Schwäche, das spezifisch politische Nichtökonomische nicht geklärt zu haben. Eine Fabel, die älter ist als Huxleys Fabel, erhellt die Bedeutung der Unterscheidung zwischen ökonomischer und nichtökonomischer Orientierung.
2. Agrippas Fabel und zwei Politikmodelle
Der römische Historiker Titus Livius (–59 – +17), mit Kaiser Augustus befreundet (Tacitus, Annalen 4.34,3), berichtet in seiner Geschichte Roms von einem Streit zwischen Plebejern und Patriziern im Jahre 494 v. Chr., fünfzehn Jahre nach der Vertreibung des letzten Königs von Rom. Als ein Teil der Plebejer Rom verlassen hatte und Roms Ende drohte, entsandten die Patrizier den Konsul Agrippa, der den Plebejern die Fabel vom Bauch und den Gliedern erzählte. Die Glieder werfen dem Bauch vor, nichts zu tun, als zu genießen, und führen ihm keine Nahrung mehr zu, bis sie selbst hungern. Da erkennen sie die Dienste des Bauchs und versorgen ihn wieder. Auch die Plebejer verstanden und kehrten nach Rom zurück. Doch sie nahmen nicht, wie die Fabel erwarten lässt, ihre alten Dienste auf, sondern setzten in Verhandlungen das mächtige Amt der Volkstribune durch (Ab urbe condita 2,32,8–12).
Livius hält den Plebejern und Patriziern seiner Zeit, ein halbes Jahrtausend nach Agrippa, eine Moral vor, die Ernst Bloch (1970: 172 ff.) »eine der ältesten Soziallügen« nannte. Denn die Fabel vom Bauch und den Gliedern – weit verbreitet (Peil 1985: 199), auch der legendäre Fabeldichter Äsop erzählte sie – macht einen politischen Verband zu einem Organismus und seine Mitglieder zu seinen Organen, obwohl die Mitglieder Organismen sind und der Staat ihr Organ. Ich nenne die Vorstellung, eine politische Assoziation sei ein Organismus und kein Organ, die Willensprämisse. Sie ist auch heute noch wirksam. Mit ihrer Hilfe kann Livius seinen und uns Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts auf die Frage auch dieses Buchs, wozu Politik da ist, antworten: dazu, Individuen mehr zu geben, als sie ohne eine politische Assoziation hätten. Doch was ist dies Mehr? Ist es ökonomisch?
Livius unterstellt, Plebejer und Patrizier erwarteten vom politischen Verband, von Rom, eine Verbesserung, aber möchte zeigen, dass die erwartete Verbesserung nicht nur ökonomisch ist. Auch die Plebejer, so Livius, halten Rom nicht nur für den Ort, mehr Brot sicherer zu essen, sondern für den, etwas zu sichern, was nicht in der Sicherung ökonomischer Interessen aufgeht, etwas, was den Menschen auf eine Ebene hebt, auf der er für Bedeutenderes lebt als für sein individuelles Wohl; für etwas spezifisch Politisches, das politischen Gehorsam, politische Loyalität und sogar Enthusiasmus fordern kann. Dies Spezifische scheint Livius im Bild des politischen Organismus, der Willensprämisse, andeuten zu wollen.
Die politische Philosophie der Neuzeit misstraute der Annahme eines spezifisch politischen Höheren, das von den Individuen das Opfer ihres Lebens fordern kann – dulce et decorum est pro patria mori, es ist süß und ehrenvoll, fürs Vaterland zu sterben, wie Livius’ Zeitgenosse Horaz (Carmina 3,2,13) dichtete –, und hielt ökonomische Interessen für das entscheidende Motiv für politische Assoziationen. Die Willensprämisse und der von ihr nahegelegte Patriotismus aber überlebten dies Misstrauen. Ein Ziel dieses Buchs ist zu zeigen, dass politische Assoziationen tatsächlich dem Leben eine über das Ökonomische hinausgehende Bedeutung geben, dass aber die Willensprämisse und jeder mit ihr assoziierte Nationalismus falsch sind, ein milder Patriotismus ebenso wie Chauvinismus und Faschismus.
Die Alternative zwischen ökonomischer und politischer Orientierung, vor die Livius die Plebejer gestellt sieht, kehrt in der Geschichte der politischen Philosophie als Konkurrenz zwischen dem ökonomischen und dem politischen Politikmodell wieder. Das ökonomische Modell setzt der Politik das Ziel, ökonomische Vorteile zu vermehren und die Lasten politischer Verbände, Steuerzahlungen und andre Gehorsamspflichten, gerecht zu verteilen. Der politischen Philosophie macht es zur Aufgabe, erzwingbare Normen zu begründen, und erwartet ihre Begründung von einer Vereinbarung – dem »Gesellschaftsvertrag« – zwischen Partnern, die ihr Interesse an Nutzenmaximierung eint, in einer Zweckrationalität, heute dargestellt in der Spieltheorie, die schon Patrizier und Plebejer aus Agrippas Zeit leitete. Ihre Regeln der Zusammenarbeit sind die Normen der Gerechtigkeit. Heute vertritt John Rawls das ökonomische Politikmodell mit größter Plausibilität; er steht daher im Mittelpunkt des ersten Teils dieses Buchs.
Das politische Modell herrschte in der Antike vor. Nach ihm geht es in der Politik um Herstellung und Schutz von Handlungsweisen, in denen Menschen spezifisch politischen Interessen folgen. Politik ist gut für etwas, das es ohne sie nicht gäbe: die politika, wie Aristoteles, die res publica, wie Cicero, die öffentlichen Anliegen, wie ich das nenne, was es erst durch Politik gibt. Den Nutzen aller, das Gemeinwohl, zu maximieren und das durch Zusammenarbeit Gewonnene gerecht zu verteilen, sieht das politische Modell zwar auch als ein Anliegen, aber öffentlich wird es nur als Anliegen der Politik, privat verfolgt man es auch außerhalb der Polis im oikos, dem privaten Haushalt, dem die Ökonomie ihren Namen verdankt. Livius’ Plebejer und Patrizier mögen Nutzenerwägungen gefolgt sein: eine Polis, ein politischer Verband, wurde ihre Koexistenz erst, als es um öffentliche nichtökonomische Anliegen ging.
Auf den ersten Blick können sich die Anhänger des ökonomischen Politikmodells von Livius’ Bericht bestätigt sehen. Denn blieben Plebejer und Patrizier nicht zusammen, um ihren Nutzen zu maximieren, vor allem, um nicht den militärischen Angriffen benachbarter Poleis hilflos ausgeliefert zu sein? In der Tat wird in den Anfängen Roms das wichtigste Motiv für das Zusammenbleiben von Plebejern und Patriziern der militärische Schutz gegen ähnliche politische Verbände gewesen sein. Zwar verwies schon Adam Smith, einer der wichtigsten Fürsprecher des ökonomischen Modells, auf das ökonomiewidrige Potential des Kriegs, als er bemerkte, »the one thing more important than opulence is defense« (Creveld 2017: 39). Doch das römische Reich, in dem Livius schrieb, hatte keine äußeren Feinde mehr zu fürchten.
Nicht in der Kriegsführung sah jedenfalls Livius das spezifisch Politische, sondern, wie Augustus und andre Zeitgenossen, in dem, was nur Rom bieten konnte: Künste, Literatur und Philosophie, die die Römer an den Griechen bewunderten und in denen sie ihnen nacheiferten; eine Technik, vor allem zur Unterstützung des Militärs, in der sie die hellenistischen Reiche und die Karthager übertrafen, und einen internationalen Handel, der nur unter ihrem Schutz möglich war. Sie fanden etwas, wofür erst Max Weber den Begriff lieferte: Wertsphären, in denen man Dingen wie Künsten und Wissenschaften um ihrer selbst willen nachgeht, die aber den Schutz der Politik verlangen. Als solche Schutzmacht wollten Livius und Augustus Rom rechtfertigen. Daher folgten sie einem politischen Politikmodell.
3. Das antike Politikverständnis
Die neuzeitlichen Vertragstheoretiker dagegen folgten dem ökonomischen Modell. Sie entsprachen damit der Auffassung der neuzeitlichen Wissenschaft, nach der alle Wesen durch ihre Eigenschaften kausal prädeterminiert sind. Den Menschen sahen sie wie alle übrigen Lebewesen durch das Streben nach Selbsterhaltung vorherbestimmt, das beim Menschen dank seiner Intelligenz längerfristige Planung und Nutzenmaximierung einschließt. Diese Sicht verfestigte sich zu der Parole, der Mensch sei homo oeconomicus, und zur Hoffnung, alles Geschehen aus möglichst wenigen Gesetzen, vielleicht sogar nur einem allumfassenden Naturgesetz, einer Theory of Everything, einer ToE, abzuleiten (zu deren Kritik: Nagel 2012: 42).
Trotzdem konnte sich die Neuzeit in ihrem Politikverständnis nicht allzu verschieden von dem der Antike verstehen, weil Cicero, die Autorität für antike und neuzeitliche Theoretiker, den Staat (res publica) in seiner Schrift De re publica (wörtlich Über die öffentliche Sache) definiert als »coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis communione sociatus«, als »Verbindung einer durch den Konsens des Rechts und die Gemeinsamkeit des Nutzens vereinten Menge« (1,39, meine Übersetzung). Diese Definition findet auch heute Beifall. Aber man versteht die Rechts- und Nutzengemeinschaft überwiegend als ökonomisch bestimmt. Was jedoch Plebejer und Patrizier zu ihrem »coetus«, ihrem Zusammengehen, brachte, so hätte vermutlich Cicero gesagt, war mehr als eine ökonomische Gemeinsamkeit. Für diese Auffassung konnten er und Livius sich auf Aristoteles berufen.
Aristoteles unterscheidet die Polis von der Familie und dem Dorf durch ihre autarkeia (Pol. I 1, 1252b30). Diese Autarkie ist keine ökonomische Unabhängigkeit, denn für die Ökonomie sorgt der oikos, der Haushalt (Pol. 7, 1326b26 ff.), die der Ökonomie den Namen gab. Autark versteht Aristoteles als das, »was für sich genommen das Leben wählenswert und ohne Mangel macht« (NE 1097b15). In der Autarkie der Polis ist das Handeln sich selbst genug. Was aber heißt das? Autarkie wird meist als Bedingung des Glücks (Aristoteles’ eudaimonia) verstanden (etwa Kenny 1992: 23 f.), nicht als ein vom Glück unabhängiges Ziel. Aber in seiner Politik geht es Aristoteles um Klärung dessen, was das Leben der Polis dem Leben im Haushalt oder im Dorf voraushat, nicht um das, was das Leben von Individuen gut macht (nach Aristoteles ihre eudaimonia). Die Autarkie der Polis gibt dem Leben eine Qualität, die grundsätzlich unabhängig von Glück ist. Nicht autark ist das Leben, das nur solchen Zielen folgt, die man auch außerhalb der Polis verfolgt: Nutzen, Reichtum, Macht. Das Handeln dagegen, das nur in der Polis möglich ist, ist autark in dem Sinn, dass es sein Ziel in sich selbst enthält und Selbstzweck ist, wie das Handeln in Kunst und Wissenschaft, ein Handeln, das Livius und Augustus vermutlich als Sinn und Zweck des Römischen Reichs betrachten wollten. Obwohl Aristoteles das Handeln in der Polis als »gut leben« – eu zen – (Pol. 1252b29) vom bloßen Leben außerhalb der Polis unterscheidet, besteht das Gute dieses Lebens nicht in Annehmlichkeit, sondern darin, dass es seinen Zweck in sich enthält.
Für solches Handeln fand der Aristokrat Aristoteles Beispiele im Leben seiner Standesgenossen. Sie feiern und philosophieren, jagen und machen Politik, nicht wie Kaufleute, um Geld, oder wie soziale Aufsteiger, um Macht zu gewinnen, sondern aus Leidenschaft für die Sache, ohne weiteren Grund. Aristoteles hatte einen Standesdünkel, der auch auf seine Idee politischer Autarkie abfärbte. Er fand das Muster der Autarkie jedoch nicht nur unter Aristokraten, sondern auch im Olymp. Dessen Götter handeln aus bloßer Lust an den Handlungen, die sie vergöttlichen. Apoll steht für Handlungen der Kunst, Athene für die Wissenschaft und den disziplinierten Krieg, Ares für den Krieg (s. genauer Creveld 1991: 92), Artemis für die Jagd, Hephaistos für das technische Erfinden, Aphrodite für die Erotik; jeder Olympier für eine Handlung, die ihren Zweck in sich selbst enthält.
Die olympischen Götter verkörpern die Autarkie, die die Sterblichen in der Polis erreichen können. Aristoteles’ Theologie wird oft nur nach seinen Aussagen über Gott, den unbewegten Beweger seiner Metaphysik, verstanden. Daher übersieht man, wie Richard Bodéüs (1992) zeigte, seine Übereinstimmungen mit alltäglicheren Annahmen der Griechen über die Götter.
Aristoteles reformiert jedoch die Ideen von Autarkie. Ruhm war etwas, wofür Aristokraten leben wollten, aber im Streben nach Ruhm tut man Dinge nicht mehr um ihrer selbst willen (NE 1, 1095b24). Auch den Krieg erkennt Aristoteles nicht als autarkes Handeln an, was er für viele Helden bei Homer, aber auch sonst oft genug gewesen ist (Creveld 1991: 226). Denn für die Vernunft dient der Krieg der Sicherung des Friedens und ist kein Selbstzweck (NE 19, 1177b9) – eine Annahme, der Philosophen gern folgten, die aber der Vernunft mehr Ehre tut, als sie tragen kann. Der Politik jedenfalls geht es zuerst um Autarkie (NE 1, 1097b9 ff.), nicht Gerechtigkeitsdurchsetzung. Gerechtigkeit ist eine erfreuliche Folge der Autarkie; sie setzt sich durch, wenn Bürger autark handeln.
Mit der autarkeia, so impliziert Aristoteles, erreicht der Mensch sein telos, den Sinn und Zweck seiner Existenz. Erst in der Polis können wir durch die nur in ihr mögliche gesellschaftliche Arbeitsteilung unsre spezifischen Fähigkeiten entdecken und betätigen, die vielfältigen Fähigkeiten des logos, des Vernunft-, Sprech- und Wollensvermögens, die kein Tier besitzt und deren Betätigung typischerweise autark ist. Weil autarkeia Arbeitsteilung und Tausch voraussetzt, folgt die Polis zwar auch ökonomischen Interessen. Aber das spezifisch Politische in ihr ist ein Handeln, das seinen Zweck in sich enthält.
Um Aristoteles’ Politikmodell von der Assoziation zur ökonomischen Autarkie und von andren die Antike kennzeichnenden Bedingungen zu befreien, ersetze ich den Begriff der Autarkie durch den der Autotelie und nenne Handlungen, die man wie eine olympische Gottheit um ihrer selbst willen tut, autotel. Zu autotelen Handlungen rechne ich auch die Aufmerksamkeitszustände, in die uns das Lesen von Romanen oder Abhandlungen, das Hören von Musik oder das Sehen eines Dramas, aber auch Liebe und Hass versetzen können, da sie in autotelen intellektuellen und emotionalen Tätigkeiten bestehen.
Das Wort »autotel« hebt hervor, dass die Handlungen ihr Ziel, telos, in sich selbst, autos, haben. Mit diesem Wort übernehme ich den Begriff, den eine wachsende Literatur von Psychologen (Csikszentmihalyi 1990), Literaturkritikern (Winters 1947) und Sporttheoretikern (Giamatti 1989, Warwitz 2021) für eine Handlungsweise gebrauchen, die Csikszentmihalyi als »flow« bekannt machte. Ich stütze mich nicht auf ihre Aussagen; ein Zitat soll jedoch schon eine Besonderheit autotelen Handelns hervorheben:
An autotelic person needs few material possessions and little entertainment, comfort, power, or fame because so much of what he or she does is already rewarding … such persons … depend less on external rewards that keep others motivated to go on with a life of routines. They are more autonomous and independent because they cannot be as easily manipulated with threats or rewards from the outside. At the same time, they are more involved with everything around them because they are fully immersed in the current of life. (Csikszentmihalyi 1997: 117)
Diese Beschreibung trifft autoteles Handeln jedoch nur bedingt. Sie trifft nicht seine Eigenart, handlungsimmanente Vollkommenheitskriterien zu enthalten und intrinsisch motiviert zu sein. Gerade für die Politik, für deren Idealtyp ich autoteles Handeln annehme (Abschn. 21), lässt sich oft schwer entscheiden, ob ihr Ziel im oder außerhalb des Handelns liegt; ob es auto- oder heterotel ist. Das Kriterium ist, ob das Handeln intrinsisch motiviert ist, d. h. dem der idealtypischen Politik immanenten Ziel folgt. Ist das Handeln heterotel, so ist es extrinsisch motiviert. Wir werden sehen (Abschn. 20 u. 36), wie wichtig die intrinsische Motivation für das autotele Handeln ist. Auch Ziele nenne ich autotel und heterotel, je nachdem, welche Art Handlungen sie anstreben. Auto- und heterotele Handlungen sind leicht daran zu unterscheiden, dass heterotele Ziele wie Glück und Geld sich im Gegensatz zu autotelen Zielen durch verschiedene Handlungen erreichen lassen.
Aristoteles zeichnete als autark das Handeln aus, durch das sich die Polis vom oikos unterscheidet. Hätten seine Nachfolger diesen Ansatz weiterentwickelt, wäre unsere Geschichte vielleicht besser verlaufen. Dass dies nicht geschah, gehört zum Unglück, das der langsame Untergang der Polis für die Welt bedeutete, der zu Aristoteles’ Zeit begonnen hatte und den schon Thukydides beklagte. Mit der Polis ging der Sinn für autoteles Handeln unter. Heterotele Ziele wie das Überleben, Macht und Reichtum wurden vorherrschend. Aristoteles selbst trug zum Vergessen autotelen Handelns bei, da er der Politik die Aufgabe zuwies, das gute Leben zu ermöglichen. Obwohl er autarkes Handeln zum guten Leben zählte, galt nun ein gutes Leben als Ziel der Politik, das man nicht als autark verstand. Sein Verweis der Politik auf die Sicherung des guten Lebens fand Gefallen in Islam und Christentum, weil die Religiösen das religiöse Leben als das gute Leben betrachteten.
Als aber Europa in den nachreformatorischen Religionskriegen unterzugehen drohte, erkannten, wie ich ausführen werde (Abschn. 23 und 24), politische Philosophen es als das dringendste öffentliche Anliegen, die Politik von der Vorherrschaft der Religion zu befreien. Sie sprachen dem Fürsten auf einem Territorium das alleinige, auch religiöse Instanzen ausschließende Recht auf Gesetzgebung zu, die sogenannte Souveränität. Als Aufgabe der Politik durfte nicht mehr das gute Leben zählen, da Religionsvertreter beanspruchten, darüber mehr zu wissen als der Fürst. Aufgabe der Politik sollte nun nur noch das sein, was der Fürst für richtig hielt, da die politischen Philosophen voraussetzten, sein Machtinteresse werde für das Überleben seines Staates und damit gegen den Untergang eintreten, der den europäischen Staaten von den Religionskriegen drohte.
Aristoteles’ politisches Politikmodell wurde museal. Das ökonomische Politikmodell war ein Weg, die Politik als unabhängig von der Religion und ihren Annahmen zu erkennen. Wie allen rationalen Menschen geht es nach diesem Modell auch dem Fürsten um die Nutzenmaximierung seiner Fürstenstellung, zu der sein Staat gehört; er wird ihn nicht um eines vermeintlichen ewigen Seelenheils willen vernichten. Nutzenerwägungen verbinden die Menschen zur Anerkennung nicht zuerst von Gerechtigkeitsnormen, wie Rawls und die andren Vertragstheoretiker des 20. Jahrhunderts glaubten, sondern zur Anerkennung der Souveränität der Fürsten, ihres alleinigen Gesetzgebungsrechts. Darin stimmten im 17. Jahrhundert die Gesellschaftsvertragstheoretiker mit ihren absolutistischen Vorgängern überein.
Das ökonomische Politikmodell drängte sich der westlichen politischen Theorie auch deshalb auf, weil der Westen von zwei Gewalten, einer geistlichen und einer weltlichen Macht, beherrscht wurde, die man als Religion und Politik unterschied. Während Aristoteles Politik als Handeln in der Polis vom Handeln im oikos unterschied, unterschieden die Christen die Sorge für das weltliche von der für das geistliche Wohl. In der Sorge für das weltliche Wohl geht es zwar nicht nur um die Wirtschaft, sondern auch um den Schutz der Bürger vor Krieg und Krankheit. Trotzdem ist das Weltliche, dessen Sorge man der Politik zuwies, mehr oder weniger ökonomisch, während das gute Leben, das Aristoteles als Zweck der Politik ansah, nun eher als Ziel der geistlichen Gewalt galt. Wenn wir uns dagegen nicht mehr von zwei Gewalten beherrscht sehen, liegt das ökonomische Politikverständnis weniger nahe.
Mehr als zwei Jahrtausende nach Aristoteles schrieb Kant der Natur und dem Genie in der Kunst das Erschaffen schöner Gegenstände zu und definierte »Schönheit« als »Form der Zweckmäßigkeit eines Gegenstandes, sofern sie ohne Vorstellung eines Zwecks an ihm wahrgenommen wird« (KdU § 1.7). Er entdeckte wieder, dass etwas genial sein kann, weil es zwar zweckmäßig ist und sogar Sinn erkennbar macht, aber keinem außer ihm liegenden Zweck dient. Das hätte politische Philosophen dazu anregen können, den Schutz eines Handelns, das gerade dadurch sinnvoll ist, dass es keinem äußeren Zweck dient, zum Ziel der Politik zu rechnen. Doch zu Kants Zeit waren politische Philosophen zu fest davon überzeugt, dass Politik dem Allgemeinwohl oder der Macht dient, in jedem Fall einem heterotelen Ziel.
Trotz ihrer Bindung ans ökonomische Politikmodell blieb die neuzeitliche politische Philosophie an Aristoteles’ politischem Modell interessiert. Rawls griff sogar auf ein »aristotelisches Prinzip« zurück, um ein ökonomisches Modell zu verteidigen. Dieser Rückgriff wird sich allerdings als Beginn eines neuen politischen Politikmodells erweisen (Abschn. 16).
4. Die Willensprämisse
Die Willensprämisse ist eine Annahme über jeden politischen Verband. Sie versteht politische Verbände als Organismen mit eigenem Willen und ihre Mitglieder als deren Organe und bietet einen Ansatz, Politik nicht ökonomisch aufzufassen. Der Ansatz ist zwar falsch, weil der politische Verband ein Organ für Menschen ist, die selbst voneinander unabhängige Organismen bleiben. Aber der politische Verband ist ein gemeinsames Organ seiner Mitglieder, und wegen dieser Gemeinsamkeit können die Mitglieder ein Organ, je wichtiger es ist desto eher, als einen Organismus verstehen, von dem sie nur Organe sind.
Die Willensprämisse finden wir in der Antike außer in der Fabel vom Bauch und den Gliedern in der idealen Polis vorausgesetzt, die Platon mit einem aus Kopf, Herz und Bauch zusammengesetzten menschlichen Organismus vergleicht; in der Neuzeit in Hobbes’ Leviathan, dem mit dem Staat geschaffenen »Mortall God« (Lev Ch. 17, 227), den das Titelbild der Erstauflage von 1651 als einen aus einer Menschenmenge gebildeten gekrönten Mann mit Schwert und Bischofsstab zeigt. Wir begegnen ihr nicht in expliziten Annahmen, sondern in Bildern und Vergleichen wie bei Agrippa, Platon und Hobbes.
Ob ein Autor der Willensprämisse folgt und den Staat als Organismus versteht oder nur annimmt, der Staatswille sei der Wille des Herrschers oder der Bürger, ist manchmal schwer zu entscheiden. Die meisten neuzeitlichen Theoretiker verwerfen die Annahme, das Gesellschaftliche könne mehr sein als die Summe des Individuellen, und sind insoweit Kritiker der Willensprämisse. Auch Hobbes vertritt in den ersten Kapiteln seines Leviathan einen Individualismus und folgt doch der Willensprämisse. Besonders entschieden tut es in der Neuzeit Rousseau, wenn er dem Staat eine volonté générale zuspricht, einen Gemeinwillen, den er von der volonté de tous, dem Willen aller, unterscheidet. Der Gemeinwille, so Rousseau, ist immer richtig, weil er der Wille des Staates ist, der im Gesellschaftsvertrag gezeugt wird; der Wille aller dagegen, den wir heute als demokratisch legitimierten Willen betrachten, irrt gewöhnlich so, wie das Volk gewöhnlich in seinen politischen Urteilen irrt. Doch auch Rousseau expliziert die Willensprämisse nicht; vielleicht hielt er sie für selbstverständlich.
Die Willensprämisse legt nahe, den politischen Verband als zentrale Organisation mit einem Willen zu konzipieren. Ihr Gebrauch bei Agrippa (oder Livius), Platon, Hobbes und Rousseau dient daher auch einer politischen Zentralgewalt. Tatsächlich aber fehlte Agrippas Rom eine Zentralgewalt; es war kein Staat, es war ein Ämterverband. Wir sollten von Anfang an erkennen, dass Politik, was immer sie sein mag, nicht notwendig zentral, sondern auch als Ämterverband organisiert sein kann. Hätten sich die Plebejer in Agrippas Rom als Glieder eines Organismus verstanden, dann hätte Agrippas Fabel sie zur Wiederaufnahme ihrer früheren Tätigkeiten veranlassen müssen. Wie aber Livius als Historiker berichtet, verhandelten sie mit den Patriziern und setzten das Volkstribunat durch, eines der mächtigsten Ämter der römischen Republik. Sie bastelten mit den Patriziern am politischen Mechanismus, den jeder politische Verband darstellt, und drehten an dessen Stellschrauben.
Es gab in der römischen Republik kein Parlament und keine über öffentliche Anliegen entscheidende Regierung. Es gab Ämter für verschiedene Aufgaben und Anliegen, meist besetzt von zwei Beamten, die einander kontrollierten, nur ein Jahr lang amtierten und zwei Jahre warten mussten, bevor sie ein neues Amt bekleiden durften. Es gab verschiedene Volksversammlungen, die Beamte wählten. Die einzige längerfristige politische Institution war der Senat, der ehemalige Beamte umfasste. Nur in Kriegs- und Krisenzeiten konnten Senat und Konsuln für ein halbes Jahr einen dictator ernennen; ein höheres Amt durfte nur einnehmen, wer sich auf rangniederen Ämtern bewährt hatte (Bleicken 2000, Lintott 1999). Die Römer zu Agrippas Zeit kannten keinen Willen eines Organismus, den die Willensprämisse unterstellt.
Trotzdem konnte die Willensprämisse früh auch in dezentral organisierten politischen Verbänden aufkommen. Denn auch für diese war der Krieg wichtig, und Krieger entwickeln gern die Idee einer Einheit, die fortlebt, wenn sie sterben müssen. Wie die Kriege überlebte die Willensprämisse den neuzeitlichen Individualismus, der jeden von Individuen unabhängigen Willen von Kollektiven leugnet.
Noch wichtiger war, dass die Willensprämisse den Herrschenden half. Sie ermöglichte ihnen, das wichtigste öffentliche Anliegen der Neuzeit zu bewältigen: die Religionskriege zu beenden. Dies gelang mit Hilfe der Idee, der Fürst sei souverän. Das hieß, nur er hatte das Gesetzgebungsrecht, da nur er den Willen seines politischen Verbands verwirklichte. Aristoteles fordert von der Politik, ein autarkes gutes Leben zu ermöglichen. Dies Ziel war religiös aufgeladen und erlaubte den in der Reformation aufgebrochenen Konfessionen, die Staaten in Kriege und Konflikte zu treiben. Sie hätten zu Europas Untergang geführt, hätten Politiker und ihre Theoretiker nicht den Einfluss der Religion verringert. Dazu mussten sie inhaltliche Aufgabenbestimmungen der Politik hinsichtlich dessen, was »gut« in der Gesellschaft ist, durch die Aufgabe ersetzen, den Staatswillen zu verwirklichen, den Willen, den die Willensprämisse annimmt. Als Ludwig XIV., der Inbegriff des absoluten Souveräns, 1655 vor dem Parlament in Paris erklärte »L’état, c’est moi«, behauptete er, einen solchen Organismus zu verkörpern.
Die Idee des Staatsorganismus überlebte den Absolutismus, denn Hobbes’ und Lockes Gesellschaftsvertragstheorien, die auf Bodins Theorie des absoluten Souveräns folgten, machten aus der Staats- eine Volkssouveränität. Das Volk ersetzte den Monarchen und der Volks- oder nationale den Staatsorganismus (Abschn. 23 u. 25), aber die Willensprämisse blieb unbezweifelt. Politische Philosophen hatten zwei weitere paradox entgegengesetzte Gründe, den Staat als Organismus mit eigenem Willen zu betrachten: den Glauben an ein staatsunabhängiges Naturrecht, das als Wille jedes legitimen Staats gelten konnte, aber auch den entgegengesetzten Glauben, Recht sei erst die Schöpfung des Staates, durch den er einen eignen Willen erhält. Genauer besehen aber degradiert ein staatsunabhängiges Recht den Staat zum Büttel des Rechts, und der Glaube an ein nur vom Staat geschaffenes Recht macht ihn zum Büttel der Individuen, die das Recht vereinbaren.
Grundsätzlich lassen sich die absolutistische Staats- und die demokratische Volkssouveränität zwar auch ohne Willensprämisse vertreten. Man kann den Staat als Organisation verstehen, die eine Ordnung durchsetzt, und kann das Volk zum Souverän und zur Quelle legitimer Gesetzgebung erheben, ohne einen Willen zu erwähnen. Aber ohne Willensprämisse bleiben die Souveränitätstheorien blass. Das zeigt sich in Max Webers Definition des politischen Verbands, die keinen Willen erwähnt:
Politischer Verband soll ein Herrschaftsverband dann und insoweit heißen, als sein Bestand und die Geltung seiner Ordnungen innerhalb eines angebbaren geographischen Gebiets kontinuierlich durch Anwendung und Androhung physischen Zwangs seitens des Verwaltungsstabes garantiert werden. Staat soll ein politischer Anstaltsbetrieb heißen, wenn und insoweit sein Verwaltungsstab erfolgreich das Monopol legitimen physischen Zwanges für die Durchführung der Ordnungen in Anspruch nimmt. (WuG 1980: 29)
Weber definiert Politik durch den Willen eines Verbands, der durch physischen Zwang »Ordnungen« durchsetzt, was immer sie sind (analog definiert er den »hierokratischen Verband« durch »psychischen« Zwang, WuG 1980: 29). Dagegen spricht, dass wir keinen Verband als politisch betrachten, der nicht öffentliche Anliegen wahrnimmt. Wir haben inhaltliche Vorstellungen von der Politik, zu denen gehört, dass sie Gerechtigkeit und einen Gemeinnutzen sichert, wie Cicero annahm. Weber aber glaubt auf inhaltliche Vorstellungen verzichten zu können, weil er der Souveränitätstheorie folgt, nach der der Souverän, sei er Monarch oder Volk, eine Ordnung schafft, die legitim ist, nicht weil sie mit vorstaatlichen Gerechtigkeitsnormen übereinstimmt, sondern weil ein Souverän sie will. Zwar kann er sagen, er verstehe den politischen Verband als Herrschaftsmechanismus, nicht -organismus. Dann aber fragt sich, warum Individuen mit dem politischen Apparat nur dessen Bestand und nicht einen Zweck sichern wollen, für den sie den Apparat schaffen.
In der Tat beschrieb Weber den Herrschaftsapparat als Selbstzweck, weil er Politik als Selbstzweck, als autoteles Handeln verstand, als ein Handeln, das ebenso wie andre Handlungsweisen – der Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft und andrer »Wertsphären« – sphärenimmanenten Normen folgt. Das halte ich für eine Erkenntnis, auf die ich sogar die Thesen dieses Buchs stütze. Die sphärenimmanenten Normen der Politik aber sind nicht die der Machtmaximierung, wie Weber annimmt, sondern der Wahrnehmung öffentlicher Anliegen. Diese legen die Politik auf politikspezifische Ziele fest. Weber dagegen kann nur deshalb politische Verbände allein durch den Willen definieren, eine Ordnung gleich welchen Inhalts durch Zwang durchzusetzen, weil seine Leser an die Willensprämisse glaubten und den politischen Verband als Organismus mit einem Willen statt als Organ mit einer Aufgabe sahen.
Im Aufsatz zur Politik als Beruf verstand Weber, wie wir sehen werden (Abschn. 19), Politik als autotele Tätigkeit, die nicht der Macht, sondern der Wahrnehmung öffentlicher Anliegen dient. Zur Verteidigung der Definition der Politik durch das Machtziel in WuG hätte er vielleicht darauf bestanden, dass die Staaten in ihrer Geschichte so viele Ziele verfolgten, dass man sie nur durch das Machtziel definieren könne. In der Tat war der Staat zum Selbstzweck der Machtmaximierung geworden; daher konnte Weber den politischen Verband entsprechend definieren. Das schien sogar wissenschaftlich. Die Erfahrung lehrt uns zum Überdruss, dass es in der Politik um Macht geht. Aber der Überdruss ist die Folge enttäuschter Erwartungen. Den Erwartungen müssen Politiker, um sich an der Macht zu halten, wenigstens vorgeben zu folgen. Heuchelei ist der Tribut des Lasters an die Tugend, sagte La Rochefoucauld; in der Politik ist sie die Anerkennung der normativ für richtig gehaltenen Politik. Normativ aber hält man nicht die Mehrung der eignen Macht für das Ziel der Politik, sondern Ziele wie das Allgemeinwohl oder die Wahrnehmung öffentlicher Anliegen. Dieser Auffassung folgt Weber im Aufsatz zur Politik als Beruf, aber nicht in seiner zitierten Definition politischer Verbände.
Diese Definition des Politischen erlaubte es Weber auch, am Wertfreiheitsideal der Gesellschaftswissenschaften festzuhalten (Objektivität 1904; Wertfreiheit 1917). Denn inhaltliche Angaben zur Aufgabe der Politik wie die, öffentliche Anliegen wahrzunehmen, legen den Staat auf deren Erfüllung fest und berechtigen den Wissenschaftler, staatliches Handeln hinsichtlich dessen zu bewerten, wie weit es seinem inhaltlichen Ziel entspricht. In jedem Fall entsprach Webers Definition der Zeitstimmung. Schopenhauer hatte Natur und Geschichte als Ausdruck eines blinden Machtwillens und Nietzsche den Staat als Ungeheuer gezeichnet, für das Macht Selbstzweck ist (Zarathustra. 1954, Werke 2: 313–6). Das tat schon Hegel, der den Machtwillen (wie es auch Nietzsche versuchte) positiv bewertete. Er unterstellte die Willensprämisse, als er es für die weise Vorstellung der »Völker« hielt, dass gegen die »objektive Sittlichkeit«, die auch den Krieg rechtfertigen kann, »das eitle Treiben der Individuen«, die um ihr Leben fürchten und die Moral anrufen, »nur ein anwogendes Spiel bleibt«. Ob die »Substantialität«, als deren »Akzidentelles« er die Individuen betrachtet (Rph § 1.45z), der Staat oder das Volk ist: Hegel sieht den Staat als Träger eines Herrschaftswillens, der wie Webers politischer Verband Selbstzweck ist.
Welche Bedeutung die Willensprämisse für Weber wie für seine Zeitgenossen konkret annahm, zeigt seine Beschreibung der Sphäre der Politik in der Zwischenbetrachtung seiner Wirtschaftsethik der Weltreligionen. Er beschreibt dort Politik als etwas, wofür man im Krieg zu sterben bereit ist, in »Hingabe und bedingungsloser Opfergemeinschaft der Kämpfenden« für eine der »modernen politischen Gemeinschaften«. Der Krieg »leistet … etwas, seiner konkreten Sinnhaftigkeit nach, Einzigartiges: in der Empfindung eines Sinnes und einer Weihe des Todes, die nur ihm eigen ist«. Einzigartig ist aber nicht, dass der Tod im Krieg dem Leben Sinn gibt. Weber sagt zwar: »Daß, warum und wofür er [der Einzelne] den Tod bestehen muß, kann ihm … so zweifellos sein, daß das Problem des ›Sinnes‹ des Todes … gar keine Voraussetzungen seiner Entstehung findet«, fügt aber in diesen Satz ein: »und außer ihm [dem Krieger] nur dem, der ›im Beruf‹ umkommt« (Zw 548). »Im Beruf« heißt für Weber, wie später deutlicher wird, im Leben für jede Wertsphäre. Ob »Beruf« oder Krieg, beide können »eine Theodicee des Todes« liefern (549). Was den »Tod im Felde« vom Tod in den andren Wertsphären unterscheidet, ist, dass er »in dieser Massenhaftigkeit nur hier« (548) stattfindet. In allen andren Sphären stirbt der Einzelne als Einzelner oder mit einigen Gleichgesinnten für seine Sphäre; nur im Krieg findet der Einzelne einen besonderen Sinn in einer den Tod einschließenden Hingabe »als Massenerscheinung« (548). Nur die Politik kann den Krieg ausrufen und nur in ihm kann der Einzelne Sinn im Tod »als Massenerscheinung« finden.
Während Liberale solche Todesbereitschaft heute als Folge eines illusionären Nationalismus ansehen, erlaubte der formale Politikbegriff Weber, im Tod der Massen im Krieg die »Weihe« des Todes zu finden, an der Kriegsverherrlichung festzuhalten und ohne Vorbehalt (und ohne seine geliebten Gänsefüßchen) Pathos, Gemeinschaftsgefühl, Hingabe und die »bedingungslose Opfergemeinschaft der Kämpfenden« zu preisen. Er unterstellte eine Gemeinschaft, die weiterlebt, wenn viele, wenn nicht alle ihrer Glieder untergehen, gemäß dem auf alten Kriegsdenkmälern zu lesenden Spruch »Deutschland muss leben, und wenn wir sterben müssen« (entnommen einem Gedicht – »Soldatenabschied« – von Heinrich Lersch aus dem Jahr 1914). Weber fiel auf die Willensprämisse zurück.
Müssen wir die Willensprämisse aber nicht als die richtige Annahme verstehen, dass politische Verbände mit zunehmendem Alter Traditionen und Regeln entwickeln, die ihre eigene Dynamik haben und den Staat zu mehr machen als einem Mechanismus? Man denkt ja auch oft von der Sprache als einem Organismus mit eigenem Leben. In der Tat ist politisches Handeln wie das Handeln in Wissenschaft und Kunst etwas, das eine eigne Natur und sogar Willen hat. Aber die Willensprämisse versteht nicht das politische Handeln als organisch, sondern politische Verbände. Diese aber sind immer nur Organe oder Mittel. Die Willensprämisse wäre weniger attraktiv, würde man zwischen politischem Verband und Politik, dem politischen Handeln, unterscheiden.
Dass der Liberale Weber das Politische als etwas beschrieb, wofür im Krieg die Massen zu sterben bereit sind, griffen rechtsradikale Zeitgenossen gern auf. In seinem Aufsatz Der Begriff des Politischen (1927) bestimmte Carl Schmitt das Politische in provozierender Unklarheit als etwas, für das »die Unterscheidung von Freund und Feind« »spezifisch« ist (1963: 26). Der Feind sei als »hostis« zu verstehen, gegen den »ein ganzes Volk« Krieg führt, auch wenn er nicht »schädlich« ist. Er sei auch kein persönlicher Feind, er sei »eben der andere, der Fremde, und es genügt zu seinem Wesen, daß er in einem besonders intensiven Sinne existenziell etwas anderes und Fremdes ist, so daß im extremen Fall Konflikte mit ihm möglich sind, die weder durch eine im voraus getroffene generelle Normierung, noch durch den Spruch eines ›unbeteiligten‹ und daher ›unparteiischen‹ Dritten entschieden werden können« (1963: 27).
Der mit den Zeitumständen unbekannte Leser fragt sich, wie es einen »in einem besonders intensiven Sinne existenziell« Fremden geben kann, der weder böse noch schädlich und trotzdem ein Feind ist, gegen den man Krieg führt und in dessen Bekämpfung das Politische besteht. Doch seine Unbestimmtheit erlaubte Schmitt, als »existentiell« Fremden ebensowohl Juden wie Kommunisten und andren Gruppen Bürgerrechte abzuerkennen. Für die politische Theorie war an Schmitts Definition verheerend, dass er »das Politische« als etwas bestimmt, das Menschen notwendig gegeneinander kämpfen lässt (noch heute inspiriert dieser Gedanke Chantal Mouffe 2005: 4, vgl. 9. Sie »felt that the critique that Schmitt makes of liberalism was a really powerful one«). Schmitt kritisierte zwar zu Recht Webers (und Kelsens) »empty legal functionalism« (Adair-Toteff 2022: 146, ein lesenswerter Artikel) und brachte einen Inhalt zurück in die Politik. Aber der Inhalt war die Ausgrenzung des Fremden, die den Krieg als »Mittel physischer Tötung« (Schmitt 1963: 33) des Fremden rechtfertigt. Seine Definition des Politischen kann nur akzeptabel erscheinen, wenn man einen politischen Verband als einen Organismus versteht, der seinen eigenen Willen hat, dem Glieder fremd sein können, auch wenn sie zum Verband gehören, und der sie als fremd ausstoßen und vernichten darf. Dies Verständnis entspricht der Willensprämisse. So alt sie ist, hat sie Kraft genug, zu verblenden und Absichten zu rechtfertigen, die man ohne sie verachten würde.
5. Warum dies Buch nicht kürzer ist
Dieses Buch sollte eine kurzgefasste Alternative zum vorherrschenden ökonomischen Politikmodell entwerfen, das im Unterschied zu andren Alternativen dessen Liberalismus teilt und das politische Modell von patriotischen Ideen befreit. Drei Umstände machten das Buch länger. Erstens sind moderne Gesellschaften und ihre Politik auf Wissenschaft und Technik gegründet, die in Galileis und Newtons deterministischer Physik gründen. Die neuzeitliche Physik stand auch bei der neuzeitlichen politischen Philosophie Pate und legte ihr deterministische und reduktionistische Ideen nahe, auf die ich schon in diesem Abschnitt eingehen werde, um es später kurz halten zu können. Zweitens stieß ich auf die Bedeutung der gerade erläuterten Willensprämisse für die Idee der Volkssouveränität; sie machte Ausführungen zur Geschichte der politischen Philosophie notwendig (Abschn. 23–26). Drittens musste ich die metaphysische Frage beantworten, »what humans are for«, um über den Technikgebrauch urteilen zu können, dessen Regulierung wir zu den wichtigsten aktuellen öffentlichen Anliegen zählen müssen.
Der erste Umstand ist zentral. Die moderne Wissenschaft erklärte seit dem 17. Jahrhundert alles Geschehen (das explanandum) durch Ableitung aus Anfangsbedingungen und Naturgesetzen (das explanans; vgl. Hempel 1965). Sie implizierte bei Anwendung auf das Handeln des Menschen dessen Prädetermination. Diese Konsequenz verband die moderne Physik mit der Antike, die in der Tragödie die Menschen einem Fatum unterworfen sah, das in der wissenschaftlichen Erklärung aus Anfangsbedingungen und Naturgesetzen wiederkehrte. Doch ihr Prädeterminationsglaube hinderte die Antiken nicht, obwohl es der Logik widerspricht, an Normen zu glauben: an Gesetze, denen wir ebenso folgen wie nicht folgen können und für deren Befolgung wir verantwortlich und zu bestrafen oder zu belohnen sind.
Aristoteles stützte diesen Glauben auf das Argument, Menschen seien für Handlungen verantwortlich, die sie überlegen können (NE 3, 1–3). Überlegung setzt die Fähigkeit voraus, einen Handlungsimpuls zu stoppen und zu ihm Nein zu sagen; das scheint Aristoteles’ impliziter Grund für die Annahme zu sein, dass wer überlegt handeln kann, für sein Handeln verantwortlich ist. Trotzdem hielt er unser Leben für prädeterminiert; ähnlich die Stoiker, die ein Verneinungsvermögen ausdrücklich annahmen (Bobzien 2021: 200 f.). Erst Augustin begriff die Fähigkeit, zu bewusstwerdenden Impulsen ebenso Nein wie Ja zu sagen, als Willensfreiheit (Steinvorth 2020, Ch.8; 2021: 31–35; Frede 2011: 177 f.), obwohl mit vielen Einschränkungen (Frede 2011: 153 ff.). Seine Annahme der Willensfreiheit war die rational zwingende und von seinem christlichen Glauben unabhängige Konsequenz aus der auch von Aristoteles bejahten Annahme unsrer beim Überlegen ausgeübten Fähigkeit, zu bestimmten Impulsen Nein zu sagen.
Das Verneinungsvermögen erlaubt, wie Viktor Frankl gesagt haben soll, einen Raum »zwischen Reiz und Reaktion« anzunehmen und darin »die Macht unserer Wahl« und »unsere Freiheit« gegründet zu sehen. Wie Tugendhat (2001: 138 f.) formulierte: »Wir sind nicht fest verdrahtet«. Versteht man Willensfreiheit als Verneinungsvermögen, so versteht man sie als Eigenart unsrer Intelligenz: als ein Vermögen, etwas zu verstehen, ohne ihm zuzustimmen oder es für wahr zu halten (de Waal 2005: 201–19 findet bei Bonobos ein Verneinungsvermögen, doch mangels propositionaler Sprache hat ihr Vermögen vermutlich nicht die Folgen des menschlichen Verneinungsvermögens; vgl. Creveld 2015: 10 f.).
Der freie Wille ist keine Entwicklung des Begehrungsvermögens, sondern eines praktisch werdenden Erkennens, das auch das Begehren stoppen, nach Gründen für oder gegen das Stoppen suchen und selbst – da es durch dies Vermögen zu einem Selbst oder Subjekt wird – entscheiden kann, wann es genug gesucht hat. Den Zusammenhang von freiem Willen und Erkennen sieht auch Nagel (2012: 119; ähnlich Hodgson 2012), doch keinen zwischen Verneinungs- und Begründungsvermögen; daher schließt er eine darwinistische Erklärung der menschlichen Vernunft und der Willensfreiheit aus (s. Abschn. 34). Dagegen scheint mir das Verneinungsvermögen das missing link zwischen tierischem Erkenntnis- und Begehrungsvermögen und menschlicher Vernunft und Willensfreiheit in deren darwinistischer Erklärung zu sein.
Das Verständnis der Willensfreiheit als Verneinungsvermögen verschafft Augustins Begriff der Willensfreiheit bis heute Anerkennung (vgl. Frankfurt a. M. 1988: 10). Nur Kant scherte aus. »Die Freiheit« des Willens, definiert er, ist »eine reine transzendentale Idee, die erstlich nichts von der Erfahrung Entlehntes enthält, zweitens deren Gegenstand auch in keiner Erfahrung bestimmt gegeben werden kann« (B 561). Diese Worte treffen die Freiheit der Autonomie, Descartes’ »vollkommene Freiheit« (Abschn. 8), in der wir nur Gutes tun, verfehlen aber die Willensfreiheit, die uns zu üblem Handeln befähigt.
Wie immer wir aber Willensfreiheit verstehen, Normen kann es im Unterschied zu Naturgesetzen nur geben, wenn wir ein Verneinungsvermögen haben. Die Norm, nicht zu töten, wäre keine Norm, könnten wir nichts daran ändern, ob wir töten oder nicht. Nach antikem wie nach neuzeitlichem Prädeterminationsglauben sollte es jedoch nur Gesetze und keine Normen geben können, da vorherbestimmt ist, wie wir handeln. Trotzdem hielt die Antike an der Verantwortlichkeitsidee fest. Dieser Widerspruch führte die aristotelische Physik zu der Annahme, die Naturgesetze bestimmten die Natur nicht ausnahmslos.
Nur die leichten Elemente Luft und Feuer, die zu den äußeren himmlischen Sphären als ihrem natürlichen Ort streben, folgen in der aristotelischen Physik den Naturgesetzen. Die schweren, Wasser und Erde, sinken in den Mittelpunkt der Sphären, die Erde, und können wegen ihrer Trägheit von den Naturgesetzen abweichen (Byrne 1995, Steinvorth 2021: 18). Die Erde ist der Ort, zu dem das Unvernünftige herabsinkt, die Hölle mangelnder Gesetzesbefolgung. Folgt ein Mensch nicht den Naturgesetzen, so verfehlt er wegen seiner schweren Materie seine Natur. Normen sind versagende Gesetze, die eine vernünftige Natur diktiert. Dies Verständnis entspricht zwar der Erfahrung, dass wir uns unfähig fühlen können, einem von uns anerkannten Gebot zu folgen (»der Geist ist willig, doch das Fleisch…«), aber macht Verantwortlichkeit zum Mysterium. Heutige Wissenschaftstheoretiker stehen der antiken Sicht näher, wenn sie wie Cartwright (1999: 78) annehmen, Naturgesetze seien »true, but not universal«. Aber das Problem, wie wir verantwortlich sein können, lösen sie so wenig wie die aristotelische Physik.
Galileis und Newtons Entdeckung der Geltung der Naturgesetze in den himmlischen wie in der irdischen Sphäre, die der Stolz der neuzeitlichen Physik war, stellte der Philosophie das große Problem, das sie bis heute beherrscht: ob auch menschliches Handeln aus Anfangsbedingungen und Naturgesetzen ableitbar ist. Hobbes (1840: 253) und spätere Materialisten (Skinner 1969) sahen sich zu Recht als Anhänger der neuzeitlichen Wissenschaft, wenn sie Verantwortlichkeit als Beeinflussbarkeit durch Strafe und Lohn, durch negative und positive Verstärkung, verstanden. Descartes dagegen glaubte, er müsse, um die Willensfreiheit zu retten, von der bisher anerkannten Substanz, der Materie, der res extensa, die neue Substanz der res cogitans, des Geistes, unterscheiden. Er zeigte zwar wie Skinner, dass man auch das angeborene Verhalten von Jagdhunden, bei einem Schuss aufzuschrecken, mittels Verstärkung durch neue Verhaltensweisen ersetzen kann (beim Schuss still zu bleiben; 1989, Art.43–50), und folgerte, auch bei Menschen könne man angeborene Ängstlichkeit durch Mut ersetzen. Er unterstellte aber, zu solcher Selbstbewegung sei nur Geist, keine Materie fähig. Während Descartes die res cogitans für besser erkennbar hielt als die res extensa, weil sie im Denken gegeben sei, fasste Kant sie als unerkennbares Ding an sich und machte die Annahme einer zweiten Substanz noch unplausibler, da er Descartes’ Problem, wie Denken und Materie interagieren können – dass sie es tun, hielt Descartes für offensichtlich – unlösbar machte: Wie soll man eine Interaktion zwischen zwei Substanzen verstehen, von denen eine notwendig unbekannt ist? Ebenso unbegreiflich müssen auch Willensfreiheit und Verantwortlichkeit sein.
Die Ansetzung einer zweiten Substanz ist jedoch unnötig, wie die Kybernetik zeigen kann (wegweisend Rosenblueth et al. 1943), obwohl sie dazu kaum genutzt wurde. Wir können Organismen als kybernetische Systeme verstehen, deren Bewegungen in einem Nervenzentrum mit den Bewegungszielen verglichen und gemäß den Zielen korrigiert (»rückgekoppelt«) werden (Popper 1972: 30 ff. nennt das Zentrum die »automatische Steuerungsanlage« eines nach einem »genetischen Dualismus« von Verhaltenssteuerung und Ausführung zu erklärenden Organismus). Zielorientiertes Verhalten wird willensfrei, wenn ein Organismus durch Mutation die Fähigkeiten erlangt, (i) seine Reaktion auf manche Reize zu überlegen, (ii) zwischen genetisch bedingten Regeln, nach denen er entscheidet, willkürlich zu wählen, (iii) jede mögliche Entscheidungsregel durch die Regel zu ersetzen, nur Regeln zu folgen, die er als autonom anerkennen kann. Fähigkeit (i) finden wir bei Amöben, (ii) bei Mäusen (man sehe sich Videos an, die Mäuse vor Mausefallen zeigen), (iii) bei Menschen.
»Do I really think that conscious thought can make my brain do things?« fragt der deterministische Neurowissenschaftler Brooks (2008: 156). Die Antwort ist Ja. Libets (1999) Versuche zeigen zwar, dass bewussten Entscheidungen nichtbewusste Nervenprozesse vorausgehen. Was sonst kann man erwarten? Aber sie zeigen nicht, wozu wir uns entscheiden. Unser Verneinungsvermögen wirkt auf unsre überlegten Entscheidungen wie ein Zufallsgenerator. Es macht uns für Handlungen, die wir überlegen können, verantwortlich, aber nicht frei im Sinn von sich selbst findend oder autonom. Urteilen setzt ein Verneinungsvermögen, mithin Willensfreiheit voraus, aber keine Autonomie, mit der Kant Willensfreiheit gleichsetzte (Steinvorth 2020, Ch.8; 2021: 28–37).
Auch der heute populäre Kompatibilismus nimmt Willensfreiheit an, hält aber an der Prädetermination fest (Dennett 1984). Er behauptet mit den Deterministen, die schließliche Wahl des Ja oder Nein sei determiniert. Diese Behauptung macht den Determinismus zu einer nie falsifizierbaren These. Der Verfechter der Willensfreiheit kann dagegen empirisch angeben, wann und in welcher Hinsicht jemand willensfrei ist und wann nicht, etwa, wenn er sich von einem Tick oder einer Sucht nicht befreien kann. Der Determinist kann zwar zeigen, dass unsre Willensfreiheit ebenso illusionär sein kann wie die gesamte Wirklichkeit (»das Leben ein Traum«), aber nur bei Verzicht auf Unterscheidungen, für die wir gute Gründe anführen können. Der Kompatibilismus ist nur plausibel, weil er Willens- und Handlungsfreiheit nicht unterscheidet (vgl. McKenna und Coates 2019, sec. 2.1). Handlungsfreiheit ist die Fähigkeit, dem eignen Willen zu folgen. Sie ist verletzt, wenn ich ein Zimmer nicht verlassen kann, in dem ich eingesperrt bin. Sie ist offensichtlich mit dem Prädeterminismus vereinbar.
Aber warum soll sich der politische Philosoph mit der Frage herumschlagen, ob es Willensfreiheit gibt? In der Politik geht es schließlich um Handlungsfreiheit! Es ist wieder die moderne Technik, die diese früher vielleicht vernünftige Selbstbescheidung der politischen Philosophie unmöglich macht. Die Technik macht es möglich, uns von »außen« zu steuern und das Selbst aufzuheben, das man für handlungsfrei halten konnte, ohne nach seiner Willensfreiheit zu fragen. Sind wir handlungsfrei, wenn wir frei sind, unser Zimmer zu verlassen, oder sind wir so manipuliert, dass wir es wollen? Vor einigen Jahrzehnten bewegte die Frage nur wenige Experten (Rees 2003: 2–13), heute kann jeder lesen, durch
»Human Enhancement« – also durch die Verbesserung des Menschen durch den Einsatz technischer Mittel wie Prothesen, Nanotechnologie oder Implantate – entstehen Cyborgs. Ein Mensch, der sich ein künstliches Auge einsetzen lässt, könnte auch Dinge sehen, die ihm heute verborgen bleiben. Ein Mensch mit künstlichem Ohr hört Frequenzen, die er jetzt nicht vernehmen kann. Die Möglichkeiten … lesen sich für Technikfetischisten wie ein Versprechen, für Skeptiker wie das Grauen. Durch neue Möglichkeiten, Erbgut … zu verändern, können schon bald Designerbabys geschaffen werden. Cyborgs könnten sich … gegenüber anderen Menschen Vorteile verschaffen, weil sie schneller laufen, mehr tragen, besser sehen, rasanter denken können. Und ist die radikalste Vision, das Hochladen (»Uploading«) des menschlichen Hirns auf eine Festplatte, schon der Weg in die Unsterblichkeit? … Ob und wie sich der Mensch selbst verändert, hängt auch von ethischen und rechtlichen Einschränkungen ab. (Teetz 2019)
Die moderne Technik kann uns so verändern, dass wir ihren Veränderungen zustimmen – sogar dann, wenn sie uns nicht beglücken. Wir können uns auch in der Politik nur dann einen eignen Willen zuschreiben, wenn wir uns nicht nur Handlungs-, sondern auch eine von ihr unterscheidbare Willensfreiheit zuschreiben. Denn ein Subjekt der Handlungsfreiheit kann es nur geben, wenn es ein Selbst gibt, das zu bewusstwerdenden Impulsen so gut Nein wie Ja sagen kann. Haben wir dies Vermögen, dann haben wir ein Selbst, das handlungsfrei sein kann. Dies Selbst ist uns durch unsre genetischen Anlagen gegeben und durch gentechnische und andre Eingriffe zerstörbar. Es ist das Subjekt der Willensfreiheit, ohne die wir bei Menschen nicht mehr entscheiden können, ob sie frei handeln.
Wie die moderne Technik durch ihre Destruktionskraft seit dem Atombombenbau ein »game changer« der Politik wurde, da wir seitdem unter dem Damoklesschwert der »near-instant, neartotal, annihilation« leben (Creveld 2017: 153), ebenso radikal hat sie durch ihre »konstruktive« Kraft die Politik umgestürzt. Philosophie, die klären will, was Politik ist, muss auch klären, welche modernen Techniken zulässig sind. Sie kann sich nicht darauf beschränken zu erklären, eine Technik dürfe nicht unsre Handlungsfreiheit einschränken. Sie muss die Erhaltung der Willensfreiheit als Bedingung der Zulässigkeit einer Technik anerkennen. Eine Konsequenz ist, dass die politische Philosophie nicht dem Modell einer Theorie folgen kann, die ihre Explananda aus Gesetzen und Antezedensbedingungen ableiten und politische Handlungen und Institutionen auf einfachere Elemente reduzieren kann.
Einige Demokratietheoretiker glauben, und damit komme ich zum zweiten Umstand, der dies Buch verlängerte, die Idee der Volkssouveränität fordere, das Volk über die Zulässigkeit moderner Techniken entscheiden zu lassen. Aber die Idee der Volkssouveränität ist unvereinbar mit der Idee der Menschenrechte. Ihre Unvereinbarkeit bestätigte meine Vermutung, in der Orientierung der Politik an Wertsphären den Kern einer revidierten liberalen politischen Philosophie zu finden. Sie bestätigte auch meine Vermutung, wir bräuchten eine verbindliche Antwort auf die metaphysische Frage, die heute eher Nichtphilosophen als Philosophen stellen, nämlich »what humans are for« (so Kelly 2016: 48, der auch gleich antwortet: »Humans are for inventing new kinds of intelligences that biology could not evolve«). Wie können wir ohne rationale Metaphysik allgemeinverbindlich über den Technikgebrauch urteilen?
Genug zu den Gründen, die dies Buch verlängerten. Wen die Kritik des ökonomischen Politikmodells langweilt, kann (aber sollte nicht) das Buch verkürzen, indem er mit Teil II beginnt. Weitere Annahmen und Absichten des Buchs beschreibt der Beginn von Abschnitt 27. Doch wen wird seine These überzeugen, Politik sei die Wahrnehmung öffentlicher Anliegen, die heue an autotelem Handeln in Wertsphären und nicht an Nationen orientiert sein und zu einschneidenden sozialen und politischen Reformen führen muss? Führt uns Putins Ukrainekrieg nicht vor, dass Politik noch immer national und sogar kriegsbereit sein muss? Mir scheint der Krieg eher zu zeigen, wohin wir kommen, wenn wir weiter Politik als Wahrnehmung nationaler Interessen sehen. Wir müssen erkennen, dass der Staat ein Auslaufmodell der Politik ist. Politik fordert kriegsähnliche Ambitionen, aber weder Staaten noch Kriege.
Ich habe dies Buch geschrieben, um die Berufung auf die Volkssouveränität als Quelle von Irrtum und Unrecht bloßzustellen. Ich tat es so, wie man nach der These des Buchs handeln soll: für die Sache, nicht den Erfolg; autotel. Dies Gebot ist das Gewissen des Philosophen und jedes Experten, denn »a conscience that takes cost into consideration is not a conscience at all« (Creveld 2015: 8). Natürlich ist meine These keine Ableitung aus unbezweifelbaren Axiomen, schon deshalb bleibt sie Zweifeln ausgesetzt. Sie wird jedoch bestätigt durch die Erfahrung, dass niemand politisch konstruktiv wird, der im Namen des Volkes auftritt, sondern wer gegen die Blindheit der Mehrheit öffentliche Anliegen erkennt und für ihre Wahrnehmung kämpft. Solche Anliegen sind heute der Klimawandel, die technikbedingte Arbeitslosigkeit (Keynes 1930; vgl. Walsh 2018: 193 ff. über die Wahrheit technikbedingter Arbeitslosigkeit) und die Technikentwicklung selbst, deren Gefahren ökonomieorientierte ebenso wie sich aufs Volk berufende Politiker gern leugnen.
Dass sich Politik an autotelem Handeln orientieren muss, diese These zieht die Konsequenz aus Annahmen geschätzter Autoren wie Aristoteles, Locke und Weber und stimmt in wichtigen Prämissen überein mit Thesen zeitgenössischer Psychologen (Csikszentmihalyi), Biologen (Prum, de Waal), Kriegshistoriker (van Creveld) und Philosophen (Nagel). Dass öffentliche Anliegen heute radikale Reformen verlangen, darin sind die Experten der heute wichtigsten Techniken einig (Kelly 2016, Walsh 2018). Und wie viele Zeitgenossen folge ich einer verbreiteten naturalistischen, aber antireduktionistischen Tendenz und hoffe sie mit diesem Buch zu bestätigen.
Unklarheit darüber, wozu das Leben gut ist, macht alle Menschen angesichts des überlebensbedrohenden Klimawandels und die Europäer angesichts des Kriegs im eignen Haus konservativ. Alle wollen die Natur bewahren und einige sogar als Überlebensbedingung den Patriotismus aufwärmen. Aber wozu die Erhaltung gut ist, sagen sie nicht. Dagegen argumentiere ich, dass wir unser Leben bewahren sollten, um Dinge um ihrer selbst willen zu tun, wie Menschen es schon immer taten, doch nun im Wissen, dass wir autoteles Handeln nicht durch Krieg und Patriotismus erreichen, sondern durch konstruktive Wertsphären.
Horaz, dem wir das Wort verdanken, es sei süß, fürs Vaterland zu sterben, aber auch den »Wahlpruch der Aufklärung« »Sapere aude! Habe Mut dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!« (Kant 1784, Anfang; Horaz: Epist. I,2, 40 f.), empfahl den Dichtern (Ars Poetica 343 f.), zu unterhalten und zu belehren, die Süße von Luxusspielereien mit der sauren Arbeit für einen Nutzen zu verbinden. Zwar muss man in der Poesie und Philosophie Vollkommenheitsstandards folgen, die Nutzenorientierung verbieten. Aber ihre Befolgung gibt dem Leben einen Sinn, für den man leben und sterben kann. Darin könnte Horaz einen Nutzen gesehen haben. Allerdings lässt er dem Patriotismus keinen Platz.
Anerkennung und Schutz der Sphärenstandards sind, was Ci Jiwei über die Demokratie in China sagt: »a matter of dire necessity rather than moral luxury« (2019: 252). Für das Überleben der Zivilisation ist es heute bitter notwendig, autotel in Wertsphären zu handeln.
TEIL I
DAS ÖKONOMISCHE MODELL
6. Kulturkrise?
Webers und Schmitts Definitionen der Politik bezeugen eine Erschütterung traditioneller Werte, die zu dem gehört, was noch heute als Krise der westlichen Zivilisation gilt. Man redet gern von einer Krise der westlichen Zivilisation, doch gab es je eine Zeit, die nicht krisenverdächtig war? Mag unsre Zeit auch uneins sein über Kriterien der Wahrheit, der Gerechtigkeit und sonstiger normativer Orientierungen, ist das nicht eher ein Zeichen weiser Toleranz als ein Krisensymptom? Zwar können wir auf diese Frage angesichts der politischen Uneinigkeit in der Lösung aktueller Weltprobleme kein schlichtes Ja erwarten. Trotzdem ist der Verdacht, die Rede von einer Krise unsrer Zeit erkläre sich aus dem Bedürfnis der Medien nach Sensationen, nicht unbegründet. Denn Dürren, Überschwemmungen, Flüchtlingsströme und ihre Abwehr allein belegen noch keine Krise der westlichen Zivilisation.
Um die Wende zum 20. Jahrhundert standen jedoch Wissenschaftler und Philosophen vor Entdeckungen in der Logik, Mathematik und Physik, die mit überlieferten Ideen und Maßstäben unvereinbar waren. Schon weit zurück im 19. Jahrhundert hatten zwar Marx und Nietzsche an den Grundfesten der bürgerlichen Ordnung gerüttelt, und ihre Kritik hatte eine Parallele im Aufstand der Impressionisten gegen die Grundregeln der europäischen Malerei gefunden, der die Kritik der Philosophen zu einem Element in einer allgemeineren Rebellion machte. Aber Philosophen und Künstler waren schon immer Rebellen gewesen; die Naturwissenschaften, seit Galilei und Newton die geistigen Führer der Neuzeit, blieben unerschüttert.
Allerdings hatte schon 1826 Nikolai Lobatschewski, und etwa gleichzeitig unabhängig von ihm Janos Bolyai, gezeigt, dass das Modell eines Systems unerschütterlich wahrer Erkenntnisse, Euklids Geometrie, die auch die Physiker als Modell für ihre Theorien