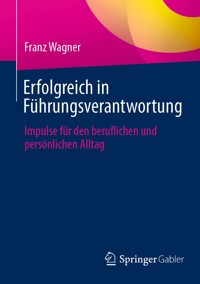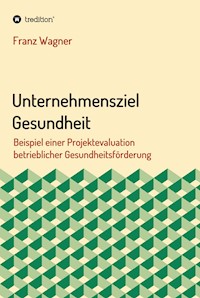
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
An einem konkreten Beispiel (Unternehmenskonzern) wird die begleitende Projektevaluierung bei der Implementierung von Maßnahmen betrieblicher Gesundheitsförderung dargestellt. Im Fokus stehen Akzeptanz bei den Mitarbeiterinnen und Einschätzung der Wirksamkeit der Maßnahmen in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Franz Wagner
Unternehmensziel Gesundheit
Beispiel einer Projektevaluation betrieblicher Gesundheitsförderung
© 2017 Franz Wagner
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7345-9275-1
Hardcover:
978-3-7345-9276-8
e-Book:
978-3-7345-9277-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Franz Wagner ist Mitarbeiter der JKU Linz mit den Arbeitsschwerpunkten Bildung, Kommunikation und Gesundheit.
Inhaltsverzeichnis
1. Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
1.1 Grundlagen und Ausgangspunkte
1.2 Wirtschaftliche und gesellschaftliche Aspekte
1.3 Wechselwirkung: Arbeit und Gesundheit
1.4 Anliegen und Ziele von BGF
1.5 Die vier Grundprinzipien der betrieblichen Gesundheitsförderung
1.6 Das Konzept betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) und seine Umsetzung
1.7 Vier Schritte zum gesunden Unternehmen
1.7.1 Diagnose
1.7.2 Planung
1.7.3 Umsetzung
1.7.4 Evaluation
1.8. Projektspezifische Aspekte von BGF
1.8.1. Informationen
1.8.2. Anreize schaffen
1.8.3. Kooperationen auf institutioneller Ebene
1.8.4. Sensibilisierung für gesundes „Altwerden“
1.8.5. Schulung von Multiplikatoren
1.8.6. Finanzielle Förderungen
1.8.7. Pilotprojekte
1.8.8. Zugang zu Unternehmen
1.9. Nutzen und Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung
1.10. Projekt WEG: Erfolgsfaktor Gesundheit
1.10.1. Entstehung und Konzept
1.10.2. Der Projektkreislauf
1.10.3. Hürden in der Umsetzung
1.10.4. Bilanz: WEG rechnet sich
1.10.5. Modellcharakter
2. Das Projekt BGF im Konzern X1X2
2.1. Die Situation bei X1X2
2.2. Der Konzern und seine Kernsegmente
2.3. Die Unternehmensgrundsätze
2.4. Organisatorische Rahmendaten und Geschichte des Projekts
2.4.1. Zur Diagnosephase
2.4.2. Zur Planungsphase
2.4.3. Zur Umsetzung und Evaluierung
2.5. Arbeits- und Organisationsplan des Projekts
3. Methodik und Forschungsdesign
3.1. Evaluation und Evaluationsforschung
3.1.1. Generelle Ziele von Evaluationsforschung
3.1.2. Bedingungen für das Evaluationsprojekt
3.2. Qualitative Sozialforschung
3.2.1. Ziele qualitativer Sozialforschung
3.2.2. Leitprinzipien qualitativer Sozialforschung
3.2.3. Das Problem des Fremdverstehens
3.2.4. Techniken qualitativer Inhaltsanalyse
3.2.5. Ablaufmodell der Inhaltsanalyse
3.3. Methodisches Forschungsdesign des Projekts
3.3.1. Fokusgruppendiskussionen
3.3.2. Leitfadeninterviews
4. Methodische Schritte und Datenauswertung
4.1 Fokusgruppendiskussionen
4.1.1. Ausgangssituation und Vorbereitung
4.1.2. Diskussionsverlauf und Leitfragen
Plenumsdiskussion
Kleingruppendiskussion
Abschlussrunde
4.1.3. Protokollierung
4.1.4. Detailergebnisse zum Projekt
Informationsfluss
Präsenz des Projektes
Probleme
Allgemeine Verbesserungsvorschläge
Verbesserung der Informationsweitergabe
Erwartungen an das Projekt
Wirkung des Projektes
Erfolgskriterien
Voraussetzungen für den Projekterfolg
4.1.5. Detailergebnisse: BGF-PartnerInnen
Erwartungen, Wünsche und Ansprüche
Erfolgskriterien der Umsetzung im Alltag
4.1.6. Detailergebnisse: Wichtige Maßnahmen und Prioritäten
Auswertung Standort A
Auswertung Standort B
4.1.7. Detailergebnisse: Gesamteinschätzung des Projekterfolges
4.2. Einzelinterviews mit den BGF-PartnerInnen
4.2.1. Ausgangssituation und Zielbestimmung
4.2.2. Methodenwahl
4.2.3. Durchführung der Einzelinterviews
4.2.4. Datenerfassung
4.2.5. Inhaltsanalyse nach Philipp Mayring
Paraphrasierung
Generalisierung
Reduktion
Zusammenführung der Reduktionen
4.2.6. Schwierigkeiten bei der Auswertung
4.2.7. Ergebnisse der Einzelinterviews
Gesprächsleitfaden
Ergebnisse zu den einzelnen Dimensionen:
Betriebliche Gesundheit und das Projekt
Rolle, Identifikation und Aufgaben
Die betrieblichen Rahmenbedingungen
Projektkoordination und Kooperation
Bedarfserhebung und Programmgestaltung
Erfolgskriterien und Nachhaltigkeit
Zusätzliche Dimensionen und Kriterien
4.2.8. Bereichsspezifische Ergebnisse
4.3. Reflexionsworkshop
4.3.1. Rolle und Selbstverständnis der BP
4.3.2. Einschätzung Projektverlauf und Maßnahmenebene
Bilanz: MitarbeiterInnen/Führungskräfte
Bilanz: Maßnahmen
Positive Erfahrungen und Kritikpunkte
Verbesserungsbedarf
4.3.3. Bewertung / Tagesbilanz
Tageseindrücke
Bedeutung regelmäßiger BP-Treffen
Persönlicher Nutzen
Benötigte Unterstützung
Wünsche
Allgemeines zum Projekt
4.4. Ergebnisse der ExpertInneninterviews
5. Zusammenfassung
Literaturverzeichnis
1 Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF)
Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über allgemeine Aspekte von Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) gegeben und worauf BGF allgemein gerichtet ist, anschließend wird darauf eingegangen, welche gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen der Arbeitswelt das Thema Gesundheit immer mehr in den Mittelpunkt der Unternehmensorganisation rücken. Weiters wird auf Ziele und Anliegen von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen eingegangen und unterschiedliche Motive für BGF werden besprochen. In einem ausführlichen Kapitel wird schließlich das konkrete Konzept der BGF beim Konzern X1X2 mit seinen unterschiedlichen Phasen der Implementierung über betriebsinterne Multiplikatoren genauer beschrieben und die die Ergebnisse und Konsequenzen des bereits abgeschlossenen Projekts besprochen.
1.1. Grundlagen und Ausgangspunkte
Die Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz lässt sich in folgende Bereiche unterteilen: (vgl. Naidoo J./ Wills J. 2003, S. 271)
• Erste Hilfe und medizinische Behandlung
• Einstellungsuntersuchungen
• Unfallschutz
• Überwachung von Gesundheitsgefahren
• Überwachung von Infektionsgefahren
• Aufklärung und Beratung zu gesünderen Lebensweisen
• Verfahren zur Schaffung gesünderer Arbeitsbedingungen
• Bereitstellung von Diensten, z.B. Bewegungsprogrammen, Vorsorgeuntersuchungen und Gesundheitsberatungen
Das Konzept der BGF baut auf einem engen Zusammenhang zwischen Gesundheit und Leistungsfähigkeit auf. Ursprünglich wurde das Konzept BGF für Großbetriebe entwickelt, jetzt wird BGF immer mehr auch in Klein- und Mittelbetrieben groß geschrieben.
„Das BGF-Konzept umfasst - gemäß den Richtlinien des Europäischen Netzwerks Betriebliche Gesundheitsförderung – alle gemeinsamen Maßnahmen von ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen und der Gesellschaft insgesamt zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden am Arbeitsplatz“ (Fonds Gesundes Österreich, 2006, S. 4). Dieses Ziel soll durch eine Verknüpfung folgender Ansätze erreicht werden:
• Verbesserung von Arbeitsorganisation und –ablauf sowie der Arbeitsbedingungen im Unternehmen
• aktive Einbindung der MitarbeiterInnen
• Stärkung persönlicher Kompetenzen
Bei einer erfolgreichen BGF erfüllt das Unternehmen nicht nur die gesetzlichen Mindestanforderungen, sondern setzt darüber hinaus zusätzliche innovative Maßnahmen, die darauf abzielen, den Betrieb zu einer „gesunden Organisation“ zu entwickeln. Ein weiteres Ziel ist, es allen MitarbeiterInnen zu ermöglichen, länger gesund zu bleiben (vgl. Fonds Gesundes Österreich, 2006, S. 3 f).
1.2. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Gründe für BGF
Hier soll kurz dargestellt werden, welche allgemeinen wissenschaftlichen Erkenntnisse es im Zusammenhang mit dem Thema Gesundheit und gesundheitspolitische Maßnahmen in der Gesellschaft gibt, und wie weit diese bereits umgesetzt bzw. in den Arbeitsalltag integriert werden.
Wissenschaftliche Forschungen haben ergeben, dass die Lebens- und Arbeitsbedingungen wesentlich zum psychischen und physischen Gesundheitszustand der Menschen beitragen. Folglich geben wissenschaftliche Bereiche, wie zum Beispiel die Gesundheitswissenschaften, Aufschluss über verschiedenste Einflussfaktoren (z.B. Gemeinde, Familie und Arbeit), die zur Entwicklung von Gesundheitsförderungs-, Präventions-, Kurations- und Rehabilitationsmöglichkeiten beitragen, jedoch in der Praxis noch wenig Anwendung finden. Besonders in der Gesundheitspolitik wird hauptsächlich nur technischen Entwicklungen des Kurationsbereiches Aufmerksamkeit geschenkt. Folglich wird der Finanzierung anderer Bereiche weniger Beachtung geschenkt und Budgeteinschränkungen werden vor allem in diesen Bereichen vorgenommen. Ein gutes Beispiel dieses gesellschaftlichen Problems stellt diesbezüglich die Kardiologie dar, welche sich besonders durch Kurationsmaßnahmen im Bereich Therapie und Chirurgie auszeichnet. Die Ausweitung dieser Maßnahmen ging jedoch kaum mit einer Bedarfsermittlung einher. Folglich wurde wenig Rücksicht auf Wirtschaftlichkeit, Effektivität und Zweckmäßigkeit genommen. Ein breites Wissensspektrum in der Kardiologie besteht jedoch in Bezug auf der Entstehung (unter Beachtung der Einflussfaktoren) und dem Verlauf von Herzkrankheiten und bildet somit die Basis für Gesundheitsförderung und Prävention. Jedoch wird dieses Wissen in der Praxis kaum angewandt (vgl. Badura, 2001).
Nach diesem kurzen Überblick über das Konzept der BGF soll nun dargestellt werden, warum in Zusammenhang mit wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen der modernen Arbeitswelt und ihren Herausforderungen und Anforderungen, der BGF immer mehr Bedeutung zukommt.
In den westlichen Industrieländern lässt sich durch das Ansteigen der Lebenserwartung und dem Rückgang der Geburtenrate eine Verschiebung in der Altersstruktur der Gesellschaft feststellen. Diese Entwicklung zeichnet sich ebenfalls in der Belegschaft von Unternehmen ab. Dieser Prozess hatte jedoch bisher noch nicht solche belastenden Auswirkungen, da die Möglichkeit der Frühpensionierung durch Anreize gefördert wurde, was jedoch höhere Finanzierungskosten bedeutete und nicht die erwünschte Wirkung auf den Arbeitsmarkt hatte (z.B.: geringere Arbeitslosigkeit). Eine Studie der OECD zeigte, dass Personen, welche die Möglichkeit der Frühpension wählen, mehr Sozialleistungen in Anspruch nehmen als jene, die länger im Dienstverhältnis bleiben. Folglich würde dies für eine Politik sprechen, welche Gesundheitsförderung und präventive Maßnahmen unterstützt. Alter korreliert neben sozialer Schicht sehr stark mit Krankheitsanfälligkeit, welche unter anderem vom Bildungsstand und dem Berufsstatus der ArbeitnehmerInnen und von deren Teilnahmemöglichkeiten und Arbeitsbedingungen im Unternehmen, der Unternehmenskultur, dem Führungsverhalten der Vorgesetzten, sowie von der betrieblichen Gesundheitspolitik beeinflusst (Badura, 2001, S. 783).
Unsere Arbeitswelt ist geprägt von Hektik, Tempo und Beschleunigung. Zeit wird zu einem kostbaren Gut, das kaum noch jemand frei für sich beanspruchen kann. Immer mehr Aufgaben sollen in immer kürzerer Zeit erledigt werden. Auf Innovationen in den unterschiedlichen Bereichen soll so rasch als möglich reagiert werden. Das hohe Tempo im Alltag vieler ArbeitnehmerInnen behindert oft selbständiges Denken und Handeln wird zu einem Reaktionsmuster, während für proaktives Verhalten kaum noch Raum ist. Die Belastungen, welchen die meisten ArbeitnehmerInnen am Arbeitsplatz täglich ausgesetzt sind, erreichen teilweise ein Ausmaß, das einen vollen Einsatz im Betrieb kaum noch möglich macht (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 2).
Unternehmen wollen immer mehr Gewinne verzeichnen, es wird rationalisiert und eine stetig kleiner werdende Anzahl von ManagerInnen muss immer mehr leisten. Der Druck erhöht sich, mehr Leistung muss erbracht werden, dazu kommt, dass auch der Konkurrenzkampf und Mobbing zunehmen. Gleichzeitig sinkt die Arbeitsplatzsicherheit, all dies führt zu Stress- und Erschöpfungszuständen – auch in Führungsetagen (vgl. Decker/ Decker, 2001, S. 7 f). Situationsanalysen in der Arbeitswelt zeigen, dass der Schutz der Gesundheit am Arbeitsplatz kaum gegeben ist und den Anforderungen der gesetzgebenden Stellen, wie zum Beispiel EU-Richtlinien und Regelungen, wenig entspricht. Dies trifft vor allem auf Klein- und Mittelbetriebe zu, die einer besonderen Begleitung dafür bedürfen (vgl. Badura, 2001, S. 782).
Weiters steigen die Arbeitsbelastungen für die ArbeitnehmerInnen, welche unter anderem durch die Internationalisierung und Zunahme des internationalen Wettbewerbs, sowie durch den stetigen technologischen Wandel entstehen. Besonders durch die Globalisierung und die damit verbundene internationale Orientierung von Unternehmen zwingt diese sich ständigen Optimierungs- und Neustrukturierungsprozessen zu unterwerfen um somit flexibel und innovativ handeln zu können und am internationalen Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Um diese Ziele und Veränderungen zu erreichen, sind die Unternehmen auch auf die Unterstützung ihrer MitarbeiterInnen angewiesen, welche sich einer ansteigenden Komplexität des Tätigkeitsbereiches und der Übernahme größerer Verantwortung gegenübersehen. Um die Ressource Arbeitnehmer-Innen vor gesundheitlichen Risiken zu bewahren, sind vor allem präventive Maßnahmen sowie gezielte Gesundheitsförderung nötig (vgl. Badura, 2001, S. 782f).
Zudem entstehen durch die fortschreitende Internationalisierung und Globalisierung neue Unternehmensbeziehungen (z.B.: Zunahme von Unternehmensfusionen sowie von kleinen, auftragsabhängigen „virtuellen Unternehmen“), neue Unternehmensstrukturen (z.B.: Abbau von Hierarchieebenen) und damit verbunden neue Arbeitsformen, deren gesundheitlichen Auswirkungen auf die ArbeitnehmerInnen noch nicht ausreichend erforscht wurden (vgl. Badura, 2001, S. 783). Aber nicht nur in der modernen Arbeitswelt werden Hektik und Zeitnot immer größer, häufig spiegelt sich diese Schnelllebigkeit auch in privaten Lebensbereichen wider. Auch vor dem politisch-gesellschaftlichen Bereich haben diese Tendenzen nicht Halt gemacht (vgl. Decker/ Decker, 2001, S. 3).
Schon die alten Griechen wussten, dass „ein gutes Leben ‚Körper, Geist und Seele’ zusammenhält und Gesundheit und Beziehung fördert“ (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 4). Damit sich typisch menschliche Eigenschaften, wie Nachdenklichkeit, Kreativität, geistige Entwicklung etc. herausbilden können, ist ein Zustand von Entspannung und Ruhe notwendig. Die Schnelllebigkeit unserer Zeit und die damit verbundene Reflexionslosigkeit (wir haben keine Zeit mehr, über unser Handeln nachzudenken) gefährden unser Wohlbefinden und unsere Gesundheit.
Werden nun diese Entwicklungen betrachtet, wird bald klar, dass ein „gesundes“ Unternehmen ein neu verstandenes Qualitätsmanagement für Leben und Arbeit braucht. Dadurch zeigt sich, dass nicht nur „gesunde“ Zahlen und Bilanzen und ein „gesundes“ Erscheinungsbild zum Erfolg eines Unternehmens einen wesentlichen Beitrag leisten, sondern auch gesunde, vitale und kreative MitarbeiterInnen, ebenso wie ein gesundes, soziales und ökologisches Klima. Auch eine „gesunde“ Führungskultur spielt dabei eine wesentliche Rolle.
1.3. Wechselwirkung: Arbeit und Gesundheit
Da ein großer Teil der Lebenszeit am Arbeitsplatz verbracht wird, ist die Gesundheit stark von der Arbeitswelt abhängig. Die Situation im Unternehmen nimmt so direkten Einfluss auf den Gesundheitszustand der MitarbeiterInnen. Betriebe sind daher auf die Gesundheit ihrer MitarbeiterInnen angewiesen.
Zwei wesentliche Faktoren bestimmen durch ihre Wechselwirkung die Gesundheit der MitarbeiterInnen:
• die bestehende Arbeitsbelastung,
• die vorhandenen gesundheitlichen Ressourcen.
Die BGF setzt an beiden Faktoren an und entwickelt daraus maßgeschneiderte Antworten und Verbesserungsmöglichkeiten (vgl. Fonds Gesundes Österreich, 2006, S. 5).
Es entsteht eine Gleichung, die heißt:
gesundes
leistungsfähiges
Unternehmen
=
Unternehmen
Das Fundament bilden „gesunde“ Zahlen und Fakten, sowie Erfolge am Markt. Durch vitale ausgeglichene, energievolle, motivierte, flexible, kreative und gesunde MitarbeiterInnen entsteht ein gesundes Betriebsklima mit einer positiven Kultur und Führung, das auf der „MindVitness“ der Angestellten aufbaut. Eine ganzheitliche Sicht von Gesundheit ist notwendig, denn nur wenn Körper, Geist und Seele gesund sind, kann wirklich von Gesundheit gesprochen werden.
Da in Zukunft die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens in einem großen Ausmaß von der Leistungskraft, dem Wohlbefinden, der Fitness und der Gesundheit der einzelnen MitarbeiterInnen abhängen wird, kann Gesundheitsentwicklung auch als eine Form von Potenzial-Management gesehen werden. Fehlzeiten sind nicht mehr länger das Problem, sondern die Leistungsfähigkeit und Motivation der MitarbeiterInnen und deren Arbeitsproduktivität. Es geht darum, die verborgenen, ungenutzten Potenziale, Selbstförderungskräfte und Energien von MitarbeiterInnen durch eine gezielte Vitalitäts- und Gesundheitsförderung zu steigern und zu nutzen. Somit lassen sich wichtige wirtschaftliche Interessen von Unternehmen in Bezug auf BGF erkennen, zu den „gesunden“ Zahlen und Fakten, hat sich die Gesundheit der MitarbeiterInnen gesellt.
Heute gilt Gesundheit als Voraussetzung für Produktivität, Leistungsund Entwicklungsfähigkeit. Dabei geht es nicht nur rein um körperliche Gesundheit bzw. die Abwesenheit von Krankheit, sondern vielmehr um eine ganzheitliche Sichtweise. Gesundheit, Vitalität und Engagement werden als gesellschaftlich und wirtschaftlich relevant betrachtet (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 23). Im 21. Jahrhundert sind für Wirtschaft und Gesellschaft nicht mehr vorrangig Rohstoffe und Energieverbrauch bestimmend, sondern vielmehr „der produktive und kreative Umgang mit den geistigen Kräften, mit Wissen und Information“ (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 25). Wir befinden uns also im Übergang von einer Produktionsgesellschaft in eine Wissens- und Informations-gesellschaft. Damit sich Gesellschaft und Wirtschaft in eine positive Richtung entwickeln können, ist eine Verbesserung der psychosozialen und mentalen Vitalität notwendig. Denn durch sie können große Einsparungen erreicht werden und gleichzeitig, die für den gesellschaftlich-ökonomischen Strukturwandel und die Erschließung neuer Märkte notwendigen Ressourcen, freigesetzt werden.
Seit Beginn der Industrialisierung ist das Leben der Menschen unnatürlicher, ‚künstlicher‘ und hektischer geworden. Kurz gesagt: Einige der zivilisatorischen Begleiterscheinungen machen krank. Der materielle Wohlstand hat einen hohen Lebensstandard geschaffen, der aber auch gleichzeitig mit einer Gesundheitsgefährdung einhergeht. Die Annahme, dass allein mit größerem zivilisatorischen Wohlstand und den Fortschritten in der Medizin die bisherige Lebensweise gefördert bzw. erhalten werden kann, erweist sich zunehmend als irreführend. Durch falsche Ernährung, zu wenig Bewegung, Hektik etc. haben sich zudem zahlreiche Zivilisationskrankheiten entwickelt (vgl. Decker/ Decker, 2001, S. 32).
Gesundheitsförderung kann als Personal- und Organisationsentwicklung verstanden werden. Einerseits liegt die Verantwortung für die eigene Gesundheit bei den einzelnen MitarbeiterInnen in Form von Verhaltensprävention, andererseits beim jeweiligen Unternehmen in Form einer Verhältnisprävention. Gesundheit kann demzufolge nicht mehr als reine Privatsache der MitarbeiterInnen gesehen werden. Es ist notwendig, ganzheitliche Programme für eine aktive Gesundheitsförderung zu entwickeln (Decker/Decker, 2001, S. 40 f).
Wie bereits erwähnt, ist in den letzten Jahrzehnten ein starker Anstieg von Zivilisationskrankheiten zu beobachten. Dabei hat sich auch das Krankheitspanorama verändert. Neben einer steigenden Zahl von Muskel- und Skeletterkrankungen haben auch chronische Erkrankungen wie Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen etc. und psycho-mentale Gesundheitsprobleme wie beispielsweise Schlaflosigkeit, innere Anspannung etc. stark zugenommen. Traditionelle Instrumente des Arbeits- und Krankheitsschutzes greifen in Anbetracht der komplexen Gesundheitsprobleme zu kurz. Ein umfassendes und ganzheitliches Verständnis von Gesundheit und BGF wird notwendig (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 44 ff) und begründet gesellschaftliche und wirtschaftliche Maßnahmen im Rahmen von BGF. Im Bereich der BGF ist durch gesellschaftlichen und betrieblichen Strukturwandel ein starker Veränderungs- und Innovationsbedarf notwendig.
Dies resultiert vor allem aus folgenden veränderten Anforderungen:
• Durch ungesunde Lebens- und Ernährungsweisen verschlechtert sich der Gesundheits- und Vitalitätszustand der Menschen, was auch eine betriebliche kompensatorische Gesundheitsentwicklung im Rahmen allgemeiner gesundheitspolitischer Maßnahmen notwendig macht.
• Aufgrund des Übergangs von einer Produktions- in eine Wissensgesellschaft, sind Unternehmen in Zukunft in erhöhtem Ausmaß vom inneren Engagement ihrer MitarbeiterInnen abhängig. Kreativität, geistiges Potential und persönliche Veränderungsbereitschaft werden in diesem Zusammenhang immer wichtiger.
• Verstärkte betriebliche Zusammenarbeit, Teamarbeit und Individualisierung fordern psycho-soziale Stabilität und Fitness (vgl. aktuelle Burn-out-Problematik)
Gesundheit wird zu einem Gestaltungsproblem, das durch erhöhte Krankenstände und Fluktuation sichtbar wird. Da es in Zukunft vermehrt auf die Arbeitsproduktivität ankommt, werden Gesundheit, Vitalität, psycho-sozio-mentale Stabilität, sowie MindVitness zu produktiven Potentialen. Allerdings ist dieses Mehr an Produktivität und geistiger Kompetenz nicht zum Nulltarif zu haben. Es erfordert eine Gesundheits- und Mentalentwicklung, ebenso wie eine bessere Sozialkultur (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 60 f). „Gesundheitsförderung wird Teil der Arbeits- und Organisationsgestaltung und –entwicklung und Grundlage einer neuen Wirtschaftlichkeit“ (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 61).
1.4. Anliegen und Ziele betrieblicher Gesundheitsförderung
„…die Förderung von Gesundheit ist nicht nur effektiver und angenehmer, sondern auch wesentlich billiger als die Heilung von Krankheiten“ (Egger-Subotitsch, Fritsch, Jelenko, Steiner 2007, S. 12).
Betriebliche Gesundheitsförderung betrifft Maßnahmen der ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen gleichermaßen. Allgemein verbinden ArbeitgeberInnen mit dem Konzept Betrieblicher Gesundheitsförderung „die Chance, mit der künftigen Alterung der ArbeitnehmerInnen (demographische Entwicklung, Erhöhung des gesetzlichen Pensionseintrittsalters) wirkungsvoll umgehen zu können“ (ebda, S. 13). Die Anliegen auf Seiten der ArbeitgeberInnen lassen sich also zu folgender Frage zusammen-fassen: Inwieweit sind ihre MitarbeiterInnen im Stande zu arbeiten und wie kann ihre Arbeitsleistung verbessert werden (vgl. ebda, S.13). Basierend auf dieser Fragestellung lassen sich die Anliegen der ArbeitgeberInnen, bezüglich Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung auf folgende Punkte zusammenfassen:
• ArbeitgeberInnen erwarten sich eine gesteigerte Arbeitszufriedenheit und Arbeitsproduktivität ihrer Arbeitnehmer-Innen.
• Weiters besteht ihr Interesse darin, die Anzahl der Krankenstände langfristig zu senken.
• Darüber hinaus besteht ein Anliegen darin, die Produkt- und Dienstleistungsqualität zu steigern.
• Folglich soll auch eine Verbesserung der betrieblichen Kommunikation und Kooperation stattfinden und dies soll zu einer Imageaufwertung des Unternehmens führen (vgl. Egger-Subotitsch, Fritsch, Jelenko, Steiner 2007, S. 13).
Auf Seiten der ArbeitnehmerInnen lassen sich die Anliegen bezüglich betrieblicher Gesundheitsförderung ganz allgemein unter „Schaffung und Verbesserung gesundheitsgerechter bzw. gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen“ zusammenfassen. Dieser allgemein formulierte „Slogan“ beinhaltet folgende konkrete Anliegen der Arbeitnehmer-Innen: (Egger-Subotitsch, Fritsch, Jelenko, Steiner 2007, S. 13)
• weniger Arbeitsbelastung
• verringerte gesundheitliche Beschwerden
• gesteigertes Wohlbefinden
• besseres Betriebsklima
• mehr Arbeitszufriedenheit
• gesünderes Verhalten im Betrieb und Freizeit
• Vergrößerung von Bewältigungskompetenzen
Bei den Anliegen der ArbeitnehmerInnen bezüglich der Betrieblichen Gesundheitsförderung ist anzumerken, dass „dabei präventive Ansätze und deren Verankerung im ArbeitnehmerInnenschutz eine ungleich größere Rolle als auf ArbeitgeberInnenseite spielen“ (ebda, S. 14). Durch die formulierten Anliegen sowohl von ArbeitnehmerInnen als auch von Seite der ArbeitgeberInnen lassen sich nun folgende vier allgemeine Motive der betrieblichen Gesundheitsförderung (Decker/ Decker, 2001, S. 91) ableiten:
•Das humanitäre Motiv:
Dieses Motiv umfasst die Tatsache, dass betriebliche Gesundheitsförderung „aus der Verantwortung von Management und Gewerkschaft für das Wohlergehen und die Gesundheit der Beschäftigten“ hervorgeht.
•Das Verfügbarkeits- und Kostenmotiv:
Bei diesem Motiv handelt es sich neben der Reduktion von Fehlzeiten auch um die Niedrighaltung der Kosten für die Gesundheitsstörungen, die verbesserte Kostenminimierung für die Produktivität und Leistungsqualität der MitarbeiterInnen, da Gesundheit bzw. Krankheit Kostenfaktoren darstellen (vgl. Decker/Decker, 2001, S. 91).
•Das Wettbewerbsmotiv:
Dieses Motiv beinhaltet, dass Marktüberlegenheit nur durch „MindVitness, durch Flexibilität, Kreativität, Engagement und Motivation“ der MitarbeiterInnen erreicht werden kann.
•Erhalt wertvoller Qualifikationen und Fähigkeitspotenziale:
„Mobilität ist teuer, Fachkräfte sind knapp. Denn Vitalität und Gesundheit, aber auch deren Betriebsbindung zu erhalten bzw. zu verbessern ist ein wichtiges Ziel“ (Decker/Decker, 2001, S. 91).
Bei den Zielen der betrieblichen Gesundheitsförderung wird in der Literatur zwischen primären und sekundären Zielen der BGF unterschieden. Die primären Ziele sind eine allgemeine Benennung, wozu betriebliche Gesundheitsförderung eingesetzt wird. Dabei handelt es sich, um die „Verbesserung der seelischen und körperlichen Gesundheit unter ganzheitlicher Perspektive mit dem Schwerpunkt der beruflichen Arbeitswelt“ (Logo Consult, 2003).
Bei den sekundären Zielen sind konkrete Ziele formuliert, die Aufschluss darüber geben, welche Bereiche durch betriebliche Gesundheitsförderung gefördert beziehungsweise verbessert werden können. Konkret handelt es sich dabei um (vgl. Logo Consult, 2003):
• Förderung und Verbesserung der Selbst- und Sozialkompetenz.
• Förderung und Verbesserung der Reflexionsfähigkeit.
• Förderung und Verbesserung der Flexibilität.
• Förderung und Verbesserung der Eigenständigkeit.
• Förderung und Verbesserung der Leistungsbereitschaft.
• Förderung und Verbesserung der Beziehungs-, Kommunikations- und Integrationsfähigkeit sowie der Verantwortlichkeit, Wahrnehmung und Teamfähigkeit.
• Work Life Balance: Rolle, Rollenverständnis und Identität im privaten und beruflichen Umfeld. (Logo Consult, 2003)
1.5 Die vier Grundprinzipien der BGF
(vgl. Fonds Gesundes Österreich, 2006, S. 6)
Ganzheitliches Gesundheitsverständnis
nicht nur individuelle Verhaltensweisen, sondern auch die Rahmenbedingungen müssen ‚gesünder’ gestaltet werden
Partizipation
gemeinsam mit den MitarbeiterInnen etwas für die Unternehmensgesundheit tun
Projektmanagement-Kreislauf
plan- und zielorientiertes Vorgehen, d.h. systematische Vorgehensweise von der Analyse bis zur Auswertung
Beteiligte und Betroffene
dauerhafte Erhöhung der Kompetenzen und Fähigkeiten innerhalb des Betriebes
1.6 Das Konzept Betriebliche Gesundheitsförderung und seine Umsetzung
Im vorangegangenen Teil wurde kurz skizziert, welche Veränderungen und Anforderungen sich in der modernen Arbeitswelt vollziehen, die es notwendig machen, dass Unternehmen ein neues Verständnis der Ressource Arbeitskraft und zum Thema Gesundheit entwickeln, um somit langfristig erfolgreich sein zu können. Weiters wurden die Ziele von ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen, sowie Motive und Ziele der BGF besprochen. In diesem Abschnitt werden nun die Grundvoraussetzungen für die Umsetzung eines BGF-Projektes genauer dargestellt.
• BGF ist eine Führungsaufgabe und nur dann erfolgreich, wenn das Projekt von der Unternehmensführung als wichtige Aufgabe erkannt und als solche behandelt wird. Dieses Projekt erfordert sowohl Engagement als auch einen eigenständigen Beitrag des Betriebes. Dieser kann beispielsweise durch die Bereitstellung von Arbeitszeit und finanziellen Mitteln erfolgen.
• Alle Beteiligten des Unternehmens müssen in das Projekt miteinbezogen werden. So können Ideen, Kenntnisse und Erfahrungen aller MitarbeiterInnen von Anfang an berücksichtigt werden. Dadurch können das Engagement und die Motivation aller MitarbeiterInnen gesteigert werden und maßgeschneiderte Konzepte gemeinsam erarbeitet und getragen werden.
• Innovation statt Reparatur meint, dass es bei der BGF nicht nur um die Verringerung von Krankenstandstagen geht, sondern viel mehr um Innovationen, die eine Neugestaltung von Unternehmensstrukturen und der Führungskultur beinhalten. So finden gesundheitliche Belange auch in Zukunft stärkere Beachtung.
• Eigeninitiative ist gefragt, denn wenn die Initiative nicht vom Unternehmen selbst ausgeht, kann das Projekt kaum erfolgreich umgesetzt werden.
• Eigenes managen des BGF-Projektes stellt sicher, dass Projektziele, Termine und Kosten in Einklang gebracht werden können. Dazu werden wichtige Werkzeuge des Projekt-managements verwendet: Projektplan, Kostenplan, Informations-plan und auch die kontinuierliche Überprüfung der gesteckten Ziele (vgl. Fonds Gesundes Österreich, 2006, S. 6f).
1.7 Vier Schritte auf dem Weg zum gesunden Unternehmen
In der Praxis ist der Weg durch folgenden ‚klassischen’ Managementkreislauf in vier Schritten zu beschreiben - bei der konkreten Umsetzung dieser Schritte ist die Unternehmensgröße von großer Bedeutung. Erfahrungen haben gezeigt, dass hier die entscheidende Zahl von 50 MitarbeiterInnen zu beachten ist, und die jeweiligen Vorgehensweisen darauf abgestimmt werden müssen.
1.7.1 Diagnose
Die Diagnose ist vor Start eines BGF-Projekts sehr wichtig. Sie dient der Problemanalyse und der Bedarfserhebung. Für die dafür notwendige Ist-Analyse stehen mehrere Instrumente zur Verfügung:
Betriebliche Gesundheitskonferenz:
gemeinsames Analysieren der Situation im Betrieb mit möglichst vielen MitarbeiterInnen
Management-Befragung:
Selbsteinschätzungs-Fragebogen zur Standortbestimmung, um zu erfassen, was das Unternehmen bereits in Sachen Gesundheitsförderung tut
Gesundheitsbefragung:
Befragung mittels anonymem, standardisiertem Fragebogen möglichst vieler MitarbeiterInnen aus allen Abteilungen
Krankenstandsauswertung:
Auswertung von Daten zur Arbeitsunfähigkeit
Gesundheitsbericht:
zusammengefasste, wichtigste Ergebnisse der Diagnose-Phase diesen erhalten alle „Betroffenen“
1.7.2 Planung
Im Wesentlichen geht es hier um die Strategieentwicklung und die Ressourcenplanung. Ein wichtiges Instrument ist dabei der Gesundheitszirkel: Die Beschäftigten eines Unternehmens setzen sich in einem Arbeitskreis mit ihren Arbeitsbedingungen auseinander. Ausgangspunkte sind gesundheitliche Belastungen. Sie sprechen über ihre Erfahrungen, analysieren diese Erkenntnisse, entwickeln neue Lösungen und erarbeiten Vorschläge zur Umsetzung dieser Inhalte. Ein so genannter Maßnahmenplan wird erarbeitet.
1.7.3 Umsetzung
In dieser Phase stehen die Maßnahmen und die Qualitätssicherung im Vordergrund. Die Maßnahmen zielen überwiegend auf die Verbesserung der Lebens- und Verhaltensweisen der MitarbeiterInnen ab. Mit den Methoden des Projektmanagements fällt es leichter, das Projekt der Gesundheitsförderung im Betrieb umzusetzen. Damit wird sichergestellt, dass der erarbeitete Maßnahmenplan in einem vorher abgesteckten Zeitrahmen, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln, das bestmögliche Ziel erreicht. Ein typisches Projekt umfasst folgende Aspekte (siehe nächste Seite):
1.7.4 Evaluierung
Bei der Evaluierung sind die Dokumentation, die Auswertung und die Ergebnisanalyse von zentraler Bedeutung. In allen Phasen des Projektes ist eine gute Dokumentation sehr wichtig und sinnvoll. Sie erleichtert die Leitung und die Steuerung des Projektes und dient auch als Grundlage für die Kommunikation der Projektziele und der Arbeitsschritte. Die Kommunikation ist nach innen genauso wichtig wie nach außen. Die Gesundheitsbefragung und der Gesundheitsbericht sind zwei wesentliche Bereiche der Dokumentation. Die Gesundheitsbefragung sollte sowohl vor dem Projekt, als auch einige Zeit nach Ende des Projektes durchgeführt werden. Damit kann festgestellt werden, wie wirksam das Projekt wirklich war.
VERHALTEN
Individuelle Maßnahmen (gesunde Menschen)
VERHÄLTNISSE
Strukturelle Maßnahmen (gesunde Organisation)
Allgemeine
Gesundheitsfaktoren
Kurse und Vorträge
zu Themen wie: Ernährung, Bewegung, Individuelle Seminare, (z.B. Stress-, Konflikt-management) Alkohol, RaucherInnen- Entwöhnung
Rahmenbedingungen:
gesundes Angebot in der Kantine, rauchfreie Zonen am Arbeitsplatz, Ruheräume, Betriebsvereinbarungen zu Alkohol am Arbeitsplatz, Organisation von Veranstaltungen, (kultureller, sozialer und sportlicher Art) betriebliches Fitnesscenter
Arbeitsbezogene
Gesundheitsfaktoren
Personalentwicklungs-maßnahmen:
Führungsverhalten, Kommunikation, Teamfähigkeit, berufliche Qualifikation, Arbeitsmarktfähigkeit, Ergonomie
Arbeitsgestaltung:
Handlungs- u. Entscheidungsspielräume Arbeitsabläufe und Prozesse Teamarbeit Arbeitsplatzgestaltung Erhaltung des Arbeitsplatzes (z.B. für ältere ArbeitnehmerInnen)
Der Gesundheitsbericht sollte zu Beginn und auch am Ende des Projektes erstellt werden. Sein Ziel ist es, zuerst die Ausgangslage zu beschreiben und dann als Zusammenfassung der Effekte und der Auswirkungen des Projektes zu dienen (vgl. Fonds Gesundes Österreich, 2006, S. 9ff).
1.8. Projektspezifische Aspekte betrieblicher Gesundheitsförderung
1.8.1 Informationen
Betriebsinterne Informationen
Die Kommunikation des Projektverlaufes und der Ergebnisse aus dem Projekt ist enorm wichtig. Es sollen aber auch Möglichkeiten der Beteiligung für die Beschäftigten geschaffen werden, sodass eine Partizipationskultur gelebt werden kann. Beides kann mittels spezieller Foren (Gesundheitskonferenzen, Gesundheitszirkel, neue Formen von Besprechungs- und Informationsveranstaltungen) geschehen, die zum Informationsaustausch, zur Diskussion und somit zur Meinungsbildung anregen (vgl. Meggeneder / Pelster/Sochert, 2005, S. 152).
Informationen von außen
(Teilnahme an Unternehmensnetzwerken zur BGF)