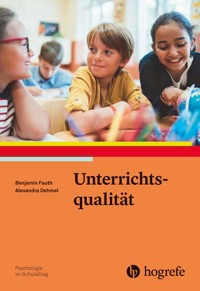
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hogrefe Verlag
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Die Qualität des Unterrichts hat sich in den letzten Jahren als eine zentrale Größe für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern herauskristallisiert. Doch was macht qualitätsvollen Unterricht aus? Was sind Basisdimensionen von Unterrichtsqualität, und wie können sie erfasst und gefördert werden? Die empirische Unterrichtsqualitätsforschung hat hierzu eine Reihe von wichtigen Befunden und nützlichen Modellen hervorgebracht. Allerdings wurden sie im deutschsprachigen Raum bisher kaum für ein breiteres Publikum praxisorientiert aufbereitet. Dieser Band widmet sich dieser Aufgabe und macht Wissen aus der Forschung für die Praxis nutzbar. Er bereichert die pädagogische Diskussion zu gutem Unterricht um neue Perspektiven und Erkenntnisse, die direkt von Lehrkräften und anderen im System Schule tätigen Personen genutzt werden können. Das Buch gibt zahlreiche Hinweise und konkrete Beispiele, insbesondere für die schulische Handlungspraxis und die Lehrkräftebildung, zum Beispiel: Was sind Basisdimensionen qualitätsvollen Unterrichts, und wie können Lehrkräfte sie umsetzen? Was ist datengestützte Unterrichtsentwicklung und wie kann sie genutzt werden, um Unterrichtsqualität zu verbessern? Welche Möglichkeiten gibt es, um in kollegialer Zusammenarbeit die Qualität des Unterrichts weiterzuentwickeln? Wie kann die Schulleitung über Schulentwicklungsmaßnahmen die Unterrichtsqualität fördern? Wie sollte Lehrkräftefortbildung gestaltet sein, um tatsächlich wirksam für die Qualität des Unterrichts zu werden?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Benjamin Fauth
Alexandra Dehmel
Unterrichtsqualität
Psychologie im Schulalltag
Band 8
Unterrichtsqualität
Prof. Dr. Benjamin Fauth, Dr. Alexandra Dehmel
Die Reihe wird herausgegeben von:
Prof. Dr. Caterina Gawrilow, Prof. Dr. Marcus Hasselhorn, Prof. Dr. Ulrich Trautwein, Prof. Dr. Christina Schwenck, Dr. Anke Leuthold-Zürcher
Die Reihe wurde begründet von:
Caterina Gawrilow, Marcus Hasselhorn, Ulrich Trautwein, Christina Schwenck, Stefan Drewes
Prof. Dr. Benjamin Fauth, geb. 1982. 2002–2008 Studium der Psychologie in Freiburg. 2004–2010 Studium der Soziologie und Philosophie in Freiburg. 2009 Wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. 2010–2014 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am IDeA-Forschungszentrum (DIPF und Goethe-Universität Frankfurt). 2013 Promotion. 2014–2019 Juniorprofessor am Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung der Universität Tübingen. 2019 Venia lengendi. Seit 2019 Leiter der Abteilung für Empirische Bildungsforschung am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg in Stuttgart und außerplanmäßiger Professor an der Universität Tübingen. Arbeitsschwerpunkt: Unterrichtsqualitätsforschung, professionelle Kompetenz von Lehrkräften.
Dr. Alexandra Dehmel, geb. 1977. 1997–2002 Studium der Wirtschaftspädagogik in Mannheim und München. 2002–2003 Studium der International-Vergleichenden Erziehungswissenschaft an der University of Oxford. 2003–2010 Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Department Wirtschaftspädagogik der Universität Paderborn. 2010 Promotion. 2010–2016 Expertin an der EU-Agentur CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) in Thessaloniki. 2016–2019 Referentin am Landesinstitut für Schulentwicklung in Stuttgart. Seit 2019 Leitung des Referats Wissenschaftstransfer und Entwicklung von Standards am Institut für Bildungsanalysen Baden-Württemberg in Stuttgart. Arbeitsschwerpunkt: Transfer, Unterrichtsqualität, Lehrkräftebildung.
Alle Rechte, auch für Text- und Data-Mining (TDM), Training für künstliche Intelligenz (KI) und ähnliche Technologien, sind vorbehalten. All rights, including for text and data mining (TDM), Artificial Intelligence (AI) training, and similar technologies, are reserved.
Copyright-Hinweis:
Das E-Book einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar.
Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
Merkelstraße 3
37085 Göttingen
Deutschland
Tel. +49 551 999 50 0
www.hogrefe.de
Umschlagabbildung: © iStock.com / martin-dm
Satz: Mediengestaltung Meike Cichos, Göttingen
Format: EPUB
1. Auflage 2025
© 2025 Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG, Göttingen
(E-Book-ISBN [PDF] 978-3-8409-3196-3; E-Book-ISBN [EPUB] 978-3-8444-3196-4)
ISBN 978-3-8017-3196-0
https://doi.org/10.1026/03196-000
Nutzungsbedingungen:
Durch den Erwerb erhalten Sie ein einfaches und nicht übertragbares Nutzungsrecht, das Sie zum privaten Gebrauch des E-Books und all der dazugehörigen Dateien berechtigt.
Der Inhalt dieses E-Books darf vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Regeln weder inhaltlich noch redaktionell verändert werden. Insbesondere dürfen Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen, digitale Wasserzeichen und andere Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernt werden.
Das E-Book darf anderen Personen nicht – auch nicht auszugsweise – zugänglich gemacht werden, insbesondere sind Weiterleitung, Verleih und Vermietung nicht gestattet.
Das entgeltliche oder unentgeltliche Einstellen des E-Books ins Internet oder in andere Netzwerke, der Weiterverkauf und/oder jede Art der Nutzung zu kommerziellen Zwecken sind nicht zulässig.
Das Anfertigen von Vervielfältigungen, das Ausdrucken oder Speichern auf anderen Wiedergabegeräten ist nur für den persönlichen Gebrauch gestattet. Dritten darf dadurch kein Zugang ermöglicht werden. Davon ausgenommen sind Materialien, die eindeutig als Vervielfältigungsvorlage vorgesehen sind (z. B. Fragebögen, Arbeitsmaterialien).
Die Übernahme des gesamten E-Books in eine eigene Print- und/oder Online-Publikation ist nicht gestattet. Die Inhalte des E-Books dürfen nur zu privaten Zwecken und nur auszugsweise kopiert werden.
Diese Bestimmungen gelten gegebenenfalls auch für zum E-Book gehörende Download-Materialien.
Die Inhalte dürfen nicht zur Entwicklung, zum Training und/oder zur Anreicherung von KI-Systemen, insbesondere von generativen KI-Systemen, verwendet werden. Das Verbot gilt nicht, soweit eine gesetzliche Ausnahme vorliegt.
Zitierfähigkeit: Dieses EPUB beinhaltet umrandete Seitenzahlen (Beispiel: 1) und in einer Seitenliste, die den Seitenzahlen der gedruckten Ausgabe und des E-Books im PDF-Format entsprechen.
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
5Inhaltsverzeichnis
Unterrichtsqualität
1
Einleitung
2
Unterrichtsqualität: Zentrale Begriffe und ein Rahmenmodell
2.1
Warum reden alle über guten Unterricht?
2.2
Zielkriterien: Was soll mit gutem Unterricht erreicht werden?
2.3
Angebot und Nutzung
2.4
Unterrichtliche Sicht- und Tiefenstrukturen
3
Zentrale Konzepte und aktuelle Themen der Unterrichtsqualitätsforschung
3.1
Einleitung: Basisdimensionen der Unterrichtsqualität
3.2
Kognitive Aktivierung
3.2.1
Herausfordernde Aufgaben und aktivierende Unterrichtsgespräche: Die Frage nach dem Wie
3.2.2
Die Bedeutung des Vorwissens für die kognitive Aktivierung: Die Frage nach dem Woher
3.2.3
Fokussierung von Lernzielen: Die Frage nach dem Wohin
3.3
Konstruktive Unterstützung
3.3.1
Unterstützung beim Wissenserwerb (kognitive Unterstützung)
3.3.2
Sozial-emotionale Unterstützung
3.4
Klassenführung
3.4.1
Klassenführung als klassisches Thema der Unterrichtsforschung
3.4.2
Aktuelle Forschung zur Klassenführung
3.5
Adaptiver Unterricht
3.5.1
Mikro- und Makro-Adaptationen
3.5.2
Selbstregulation und formative Assessments
3.5.3
Aktuelle Forschung zum adaptiven Unterricht
3.6
Empirische Befunde und aktuelle Diskussionen in der Unterrichtsforschung
3.6.1
Effekte der Unterrichtsqualität auf die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern
3.6.2
Weiterentwicklungen der drei Basisdimensionen und alternative Modelle
4
Unterrichtsqualität fördern: Konkrete Handlungsoptionen und Umsetzungshinweise
4.1
Förderung der professionellen Kompetenz von Lehrkräften als wichtigste Voraussetzung für qualitätsvollen Unterricht
4.1.1
Lehrkräfteausbildung und Berufseinstiegsphase
4.1.2
Unterrichtsbezogene Lehrkräftefortbildung
4.1.3
Unterrichtsbezogene Trainingsprogramme für Lehrkräfte
4.1.4
Informelles Lernen
4.1.5
Berufliches Wohlbefinden von Lehrkräften, berufliche Selbstregulation und Unterrichtsqualität
4.2
Lernwirksamer Unterricht durch datengestützte Schul- und Unterrichtsentwicklung
4.2.1
Grundlagen datengestützter Schul- und Unterrichtsentwicklung
4.2.2
Unterrichtsbezogenes Feedback zur Unterrichtsentwicklung nutzen
4.2.3
Kooperation an Schulen und kooperative Unterrichtsentwicklung
4.3
Leitungshandeln an Schulen: Wie kann Schulleitung Unterrichtsqualität und Lernen fördern?
4.3.1
Instructional Leadership: Unterrichtsbezogenes Leitungshandeln
4.3.2
Leadership for Learning: Lernzentriertes Leitungshandeln
5
Ausblick
Literatur
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Unterschiedliche Ebenen im Bildungssystem (nach Fauth & Jetter, 2022, S. 8)
Abbildung 2: Vereinfachte Version eines Angebots-Nutzungs-Modells am Beispiel der kognitiven Aktivierung (Abbildung aus: Fauth & Leuders, 2022)
Abbildung 3: Formative Assessments im adaptiven Unterricht
Abbildung 4: Formen der Zusammenarbeit von Lehrkräften nach Gräsel et al. (2006)
Abbildung 5: Lesson Study-Zyklus
Abbildung 6: DATA TEAM®-Verfahren
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Merkmale der Klassenführung nach Kounin (2006)
Tabelle 2: Bewältigungsstrategien
Tabelle 3: Verhältnis- und Verhaltensmanagement als Säulen der Lehrkräftegesundheit
Tabelle 4: Merkmale professioneller Lerngemeinschaften nach Bonsen und Rolff (2006)
Tabelle 5: Prinzipien lernzentrierten Leitungshandelns, Tipps und Beispiele
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
71 Einleitung
Unterrichtsqualität ist wichtig! Dieser Aussage stimmen sicherlich alle zu, die mit Schule und Unterricht zu tun haben. Auch die Bildungsforschung bestätigt, dass die Qualität des Unterrichts entscheidend für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern ist. Doch was macht Unterrichtsqualität aus? Worauf kommt es wirklich an? Wie gelingt es, qualitätsvollen Unterricht zu gestalten und die Unterrichtsqualität weiterzuentwickeln?
Diese Fragen sind alles andere als trivial. Im vorliegenden Band versuchen wir Antworten darauf zu geben und machen Vorschläge, wie man konkret an der Unterrichtsqualität arbeiten kann. Unsere Grundlage sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse, insbesondere aus der Empirischen Bildungsforschung und der Pädagogischen Psychologie. Dort sind in den letzten Jahren rund um das Thema Unterrichtsqualität viele relevante theoretische Konzepte und empirische Befunde entstanden. Diese sind im deutschsprachigen Raum bisher noch kaum für ein breiteres Publikum praxisorientiert aufbereitet worden. Wir diskutieren in Kapitel 2 und 3 zentrale Begriffe, Modelle und aktuelle Forschungsbefunde und stellen basierend darauf in Kapitel 4 konkrete Handlungsoptionen für die Weiterentwicklung von Unterrichtsqualität vor.
Wir diskutieren Fragen wie: Was sind Basisdimensionen qualitätsvollen Unterrichts, und wie können Lehrkräfte sie umsetzen? Was ist datengestützte Unterrichtsentwicklung und wie kann sie genutzt werden, um Unterrichtsqualität zu verbessern? Welche Möglichkeiten gibt es, um in kollegialer Zusammenarbeit die Qualität des Unterrichts weiterzuentwickeln? Wie kann die Schulleitung über Schulentwicklungsmaßnahmen die Unterrichtsqualität fördern? Wie sollten Lehrkräftefortbildungen gestaltet sein, um tatsächlich wirksam für die Qualität des Unterrichts zu werden? Wie kann die Bildungsadministration Schulen bei der Förderung von Unterrichtsqualität unterstützen?
Man sieht: Unterrichtsqualität geht alle an! Der vorliegende Band richtet sich daher nicht nur an (angehende) Lehrkräfte, sondern explizit an alle Kolleginnen und Kollegen, die im Bildungssystem tätig sind. Dazu gehören (angehende) Lehrkräfte, Schulleitungen und schulisches Unterstützungspersonal wie Schulpsychologinnen und Schulpsychologen aber auch Kolleginnen und Kollegen aus der Bildungsadministration inklusive der Schulaufsicht, sowie Lehrende an Hochschulen und 8dem weiteren Unterstützungssystem (z. B. Schulentwicklung und Lehrkräftebildung) bis hin zu Ausbildungsbetrieben und Kooperationspartnern von Schulen. Sie alle können in ihren jeweiligen Handlungskontexten, auf unterschiedlichen Ebenen und Wegen, zur Unterrichtsqualität beitragen. Wir zeigen, wie verschiedene Akteurinnen und Akteure Unterrichtsqualität fördern und weiterentwickeln können. Besonders wichtig dafür ist ein gemeinsames Verständnis von Unterrichtsqualität als Basis für die konstruktive Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteurinnen und Akteure. Die folgenden Fallbeispiele machen deutlich, auf welch vielfältige Weise an der Qualität des Unterrichts gearbeitet werden kann.
Fallbeispiel 1: „Sollen wir Klassenführung zu einem Thema für die Schulentwicklung machen?“
Herr Stiegler ist im Schulleitungsteam einer Gesamtschule. Viele der Kolleginnen und Kollegen an seiner Schule berichten über Herausforderungen bei der Klassenführung und über zunehmende Probleme mit Unterrichtsstörungen durch Schülerinnen und Schüler. Erst letztens sagte ein Kollege frustriert zu Herrn Stiegler: „In vielen Schulstunden ist es mittlerweile gar nicht mehr möglich, sich auf die Unterrichtsinhalte zu konzentrieren und Unterricht zu machen. Ständig stört irgendjemand. Es ist oft laut und unruhig. Ich weiß gar nicht, wie ich so jemals mit dem Lernstoff durchkommen soll – geschweige denn, wie die Kinder bei so viel Störungen überhaupt lernen sollen. Da bleibt vor lauter Disziplinierungsmaßnahmen doch gar keine Zeit mehr zum Lernen! Und mich selbst, mich strengt das echt an. Manche Situationen überfordern mich. Ich merke, dass ich erschöpfter bin als früher und mich viel schneller reizen lasse. Manchmal ist das wie ein Teufelskreis: Ich gehe teilweise schon erschöpft in den Unterricht. Die Störungen kriege ich dann erst recht nicht so in den Griff, wie ich es eigentlich will. Und meinen Unterricht kann ich nicht so wie geplant durchziehen. Das alles führt dazu, dass ich mich immer gestresster fühle. Und dass nicht nur die Qualität meines Unterrichts, sondern auch ich immer mehr leide.“ Im Schulleitungsteam wird intensiv diskutiert: Sollen einzelne, betroffene Lehrkräfte Fortbildungen zum Umgang mit Unterrichtsstörungen und Klassenführung machen? Oder soll das ein Thema für die ganze Schule werden, also zu einem Thema für die Schulentwicklung gemacht werden? Wie „groß“ ist das Problem überhaupt? Das Schulleitungsteam beschließt, das Kollegium und die Schülerinnen und Schüler zu befragen. Dafür nutzen sie ein Befragungsportal, das von ihrem Landesinstitut zur Verfügung gestellt wird. Sie verwenden die dort verfügbaren Fragen zur Klassenführung und erweitern die Befragung um einige selbstformulierte, schulbezogene Fragen. Die Erhebung ergibt, dass die Klassenführung und der Umgang mit Unterrichtsstörungen für die allermeisten Lehrkräfte eine tägliche Herausforderung und belastend sind. Interessanterweise sehen das die Schülerinnen und Schüler ganz ähnlich. Basierend auf diesen Ergebnis9sen entscheidet das Schulleitungsteam gemeinsam mit dem Kollegium, die Klassenführung als Schulentwicklungsthema aufzugreifen. Denn klar ist auch, dass eine gelingende Klassenführung eine wichtige Grundlage für qualitätsvollen Unterricht insgesamt ist – schließlich geht es am Ende darum, dass die zur Verfügung stehende Zeit auch tatsächlich zum Lernen genutzt werden kann. Es wird schnell deutlich, dass das Thema gemeinsam angegangen werden muss: Nicht nur die Lehrkräfte müssen einbezogen werden, sondern auch die an der Schule tätigen Erzieherinnen sowie die Fachkraft für Schulsozialarbeit. Vor allem aber sollen auch die Schülerinnen und Schüler aktiv in den Prozess eingebunden werden. Für die ersten Schritte holt sich die Schule Unterstützung: Sie bezieht unter anderem die Schulaufsicht mit ein und lässt sich von Fachberaterinnen für Schul- und Unterrichtsentwicklung sowie von einem Schulpsychologen unterstützen. Gemeinsam entwickeln sie ein Konzept mit verschiedenen Maßnahmen, die an der Schule umgesetzt werden sollen. Es sieht auch vor, diese Maßnahmen im nächsten Schuljahr zu überprüfen, um darauf basierend notwendige Weiterentwicklungen einzuleiten.
Fallbeispiel 2: „Wie können wir die Lernentwicklung unserer Schülerinnen und Schüler im Blick behalten und zielgerichtet fördern?“
Frau Endres ist Grundschullehrerin und unterrichtet Deutsch in der 3a einer städtischen Grundschule. In ihrer Klasse sind 28 Schülerinnen und Schüler. Die Kinder der 3a kommen aus unterschiedlichen Vierteln und haben ganz unterschiedliche familiäre Hintergründe. Ungefähr ein Drittel spricht Zuhause kein Deutsch. Auch im Leistungsbereich gibt es große Unterschiede. Im Fach Deutsch haben einige Kinder beispielsweise noch Probleme, einzelne Wörter zu entschlüsseln, während andere schon selbstverständlich ganze Bücher lesen. Mit dem Ziel, die Lesekompetenz zu verbessern, wurden in der Schule im letzten Jahr Lernbänder für die Leseförderung eingeführt. Sie sollen es ermöglichen, jedes einzelne Kind seinem Entwicklungsstand entsprechend bestmöglich zu fördern. Durch die Einführung der Lernbänder arbeitet Frau Endres verstärkt mit ihren Kolleginnen zusammen. Das klappt gut, allerdings hat sie manchmal die Befürchtung, den Überblick über die Entwicklungen im Lesen zu verlieren. Denn die Kinder sind in den Lernbändern auf unterschiedliche Gruppen verteilt und lernen in unterschiedlichem Tempo mit unterschiedlichen Lernmaterialien. Frau Endres spricht das bei ihren Kolleginnen an. Sie stellen fest, dass es allen ähnlich geht. Daher wenden sie sich an Frau Özel, die Fachberaterin für das Fach Deutsch ist. Sie betreut ihre und weitere Schulen und unterstützt bei Fragen der Schul- und Unterrichtsentwicklung. Frau Özel berichtet ihnen von einer Lernverlaufsdiagnostik, die helfen kann, die Lernentwicklungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler im Bereich Lesen besser im Blick zu behalten. Sie stellt den Kolleginnen 10das Instrument vor: Über kurze, digitalgestützte Tests werden dabei unterrichtsbegleitend in regelmäßigen Abständen die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis der Kinder erfasst und der Lehrkraft automatisiert zurückgemeldet. Das Ganze dient nicht der Bewertung – also der Benotung – sondern es dient eben genau dazu, die Lernentwicklung kontinuierlich im Blick zu behalten. Die Informationen zum Lernstand des einzelnen Kindes helfen der Lehrkraft zu entscheiden, wie es bestmöglich gefördert werden kann. Sie können Basis für lernförderliches Feedback an die Kinder sein, als Grundlage für konkrete Maßnahmen der konstruktiven Unterstützung dienen und für Elterngespräche präzise Informationen liefern. Kurz: Sie können dabei unterstützen, zentrale Maßnahmen zur Förderung der Unterrichtsqualität umzusetzen. Nach schulinternen Rücksprachen beschließen Frau Endres und ihre Kolleginnen, ab dem kommenden Schuljahr die Lernverlaufsdiagnostik einzusetzen. Frau Özel unterstützt sie dabei. Sie empfiehlt ihnen eine passende Fortbildung und begleitet sie bei der Einführung der Lernverlaufsdiagnostik an ihrer Schule. Außerdem stellt sie Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen anderer Schulen her, die die Lernverlaufsdiagnostik bereits seit Längerem nutzen, sich dazu regelmäßig austauschen und wertvolle Tipps geben können.
Fallbeispiel 3: „Wie legen wir in der Lehrkräftebildung den Fokus auf Unterrichtsqualität?“
Herr May ist als Seminarleiter in der Ausbildung von Lehrkräften für berufliche Schulen tätig. Ihm ist es wichtig, dass angehende Lehrkräfte auf ihr Kerngeschäft, das Unterrichten, bestmöglich vorbereitet werden. Um selbst auf dem Laufenden zu bleiben, beschäftigt Herr May sich regelmäßig mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Bildungsforschung. Er nutzt dazu unter anderem pädagogische Fachzeitschriften und Internetportale, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse für Lehrkräfte und Personen aus der Lehrkräftebildung praxisorientiert aufbereitet werden. Außerdem tauscht Herr May sich regelmäßig mit den Kolleginnen und Kollegen seines Seminars aus. Sie teilen Informationen und überlegen gemeinsam, was für sie relevant ist und wie sie Dinge in der eigenen Praxis umsetzen können. Dieser Transfer ist oft gar nicht so einfach. In letzter Zeit haben sie sich verstärkt mit dem Thema Unterrichtsqualität auseinandergesetzt. Die angehenden Lehrkräfte müssen darauf vorbereitet werden, guten Unterricht zu halten. Darin sind sie sich alle einig. Doch wie gelingt das am besten? Für die Qualität und die Wirksamkeit von Unterricht sind die sogenannten Tiefenstrukturen relevant, das wissen sie aus aktueller Literatur und Fortbildungen. Sie wissen auch, dass auf der Ebene der Tiefenstrukturen drei Basisdimensionen von Unterrichtsqualität diskutiert werden: Kognitive Aktivierung, konstruktive Unterstützung und Klassenführung. Das Konzept ist für sie sehr gut nachvollziehbar 11und sie versprechen sich von der Gestaltung der Basisdimensionen viel für die Entwicklung der Unterrichtsqualität bei ihren Referendarinnen und Referendaren. Gemeinsam überprüfen sie, ob die Ausbildung an ihrem Seminar ausreichend darauf ausgerichtet ist. Mit Blick auf konstruktive Unterstützung überlegen sie beispielsweise: Wie vermitteln wir unseren angehenden Lehrkräften, dass es wichtig ist, den Lernenden Feedback zu geben? Kennen sie die Regeln für lernförderliches Feedback, und haben sie ausreichend Möglichkeiten, gutes Feedback zu beobachten und zu üben? Achten wir als Seminarlehrkräfte bei Unterrichtsbesuchen darauf, ob und wie die angehenden Lehrkräfte ihren Schülerinnen und Schülern Feedback geben? Erhalten sie von uns dazu eine passende Rückmeldung? Den Seminarlehrkräften ist auch klar, dass sie eine Vorbildfunktion haben, was das Feedbackgeben betrifft. Sie müssen in der Ausbildungssituation darauf achten, relevante Aspekte der Basisdimensionen selbst umzusetzen, also die angehenden Lehrkräfte beispielsweise durch effektives Feedback konstruktiv zu unterstützen. Basierend auf ihren Überlegungen und weiteren Recherchen nehmen die Seminarlehrkräfte einige Änderungen ihrer bisherigen Ausbildungspraxis vor. Sie verständigen sich zum Beispiel auf gemeinsame Feedbackregeln, die sie den angehenden Lehrkräften vermitteln und auch selbst berücksichtigen werden. Sie nutzen einen wissenschaftlich fundierten Unterrichtsbeobachtungsbogen. Er kann für Beratung und Feedback im Rahmen der Aus- und Fortbildung sowie der kollegialen Hospitation genutzt werden. Der Bogen enthält unter anderem ein Item zur „Qualität des Feedbacks“. Dort wird aufgelistet, auf was geachtet werden sollte: „Die Rückmeldungen und Kommentare der Lehrkraft helfen den Schülerinnen und Schülern dabei, ihre Fehler zu erkennen und ihr weiteres Vorgehen zu verbessern“, „Es wird erarbeitet, warum eine Antwort oder eine Lösung richtig oder falsch war“, und einiges mehr. Die Kolleginnen und Kollegen setzen den Bogen bei Unterrichtsbeobachtungen ein, denn er zeigt ihnen und den angehenden Lehrkräften, auf was geachtet werden sollte. Gleichzeitig bietet er eine gemeinsame Grundlage für die Besprechung und Reflexion der Unterrichtsbeobachtungen, auf die sich alle beziehen können. Außerdem greifen die Seminarlehrkräfte auf ein Videoportal für Lehrkräfte zurück. Zum Thema Feedback in beruflichen Schulen finden sie dort passende Unterrichtsvideos und Transkripte der Stunden. Sie nutzen die Videos in der Ausbildung, um typische Unterrichtssituationen zu analysieren und Handlungspraktiken und Handlungsalternativen herauszuarbeiten, z. B.: an welchen Stellen hätte die Lehrkraft anders reagieren können? Wie und warum?
Die Fallbeispiele bieten einen ersten Eindruck davon, wie vielschichtig das Thema Unterrichtsqualität ist und wie verschiedene Akteure auf ganz unterschiedlichen Ebenen und Wegen dazu beitragen können, Unterrichtsqualität weiterzuentwickeln.
122 Unterrichtsqualität: Zentrale Begriffe und ein Rahmenmodell
Unterrichtsentwicklung ist Teamarbeit. Wenn sich Kolleginnen und Kollegen zum Thema Unterrichtsqualität austauschen, sollten sie „dieselbe Sprache“ sprechen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir von der Qualität des Unterrichts sprechen? Welche Merkmale sind besonders relevant, wo lohnt es sich genauer hinzuschauen? Was soll mit gutem Unterricht erreicht werden, was sind also die Ziele guten Unterrichts? In diesem einführenden Kapitel wollen wir zentrale Begriffe und definitorische Festlegungen klären. Sie bieten eine Grundlage für die Verständigung innerhalb und zwischen Kollegien bzw. zwischen allen, die im Bildungssystem tätig sind (z. B. Personen aus der Schulaufsicht und der Lehrkräftebildung). Wir schlagen zentrale Zielkriterien des Unterrichts vor, beschreiben mit dem Angebots-Nutzungs-Modell ein Rahmenmodell für zentrale Konstrukte der Unterrichtsforschung und gehen auf den Begriff der „unterrichtlichen Tiefenstrukturen“ ein, der in den letzten Jahren intensiv diskutiert wurde und auch für die Unterrichtsentwicklung hilfreich sein kann.
2.1 Warum reden alle über guten Unterricht?
Verschiedene Ebenen im Bildungssystem – Macht die Qualität des Unterrichts einen Unterschied?
Wenn in den letzten Jahren auf wissenschaftlichen Konferenzen, in politischen Debatten oder pädagogischen Diskussionsrunden über Unterricht gesprochen wurde, dann fehlte nur selten der Hinweis, wie relevant der Unterricht für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern ist. Das war nicht immer so. Noch in den Siebziger- und Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts war zumindest die Bildungsforschung weitaus weniger optimistisch, inwieweit die schulische Lernumgebung die individuelle Entwicklung von Schülerinnen und Schülern beeinflussen kann. In dem 1966 publizierten und seitdem vielfach zitierten „Coleman Report“ (Coleman et al., 1966) kamen die Autoren zu dem Schluss, dass vor allem die individuellen und familiären Hintergründe für den Bildungserfolg entschei13dend seien. Insbesondere in der späteren Rezeption der Studie herrschte lange die Meinung vor, dass die Lernumgebungen (hier vor allem verstanden als Unterschiede zwischen Schulen) kaum einen Einfluss auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern haben.
Seitdem hat sich in der empirischen Bildungsforschung einiges getan. Dies hat zu einer Neubewertung der Rolle geführt, die die Qualität der Lernumwelt für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern spielt. Vor allem die Differenzierung des Bildungssystems in unterschiedliche Ebenen war hier von Bedeutung (Abbildung 1). Viele der Kriterien, die bei Coleman noch im Zentrum der Betrachtung standen, liegen auf der Ebene der Schule (Schulgebäude, Ausstattung der Bücherei, Ausgaben pro Schülerin und Schüler usw.). Neuere empirische Arbeiten zeigen aber, dass Merkmale auf der Ebene des Unterrichts wichtiger für die Kompetenzentwicklung sind als Merkmale, die auf der Schulebene angesiedelt sind. Solche Merkmale von Schulen sind natürlich nicht irrelevant, vor allem nicht für die Kolleginnen und Kollegen, die in besagten Gebäuden arbeiten müssen und für die Schülerinnen und Schüler, die in der Schulbücherei nach neuem Lesestoff suchen. Der Unterricht ist jedoch die eigentliche Lernumgebung, mit der die Lernenden täglich konfrontiert sind. Wie sind die Abläufe im Unterricht strukturiert? Wie ist die Qualität der Aufgaben, mit denen gearbeitet wird? Wie werden die Lernenden unterstützt, wenn Verständnisprobleme auftreten?
Ein Blick auf Abbildung 1 macht diese Befunde unmittelbar plausibel. Hier ist dargestellt, welche unterschiedlichen Ebenen in einem Bildungssystem relevant sind. In dieser Betrachtungsweise stehen die Schülerinnen und Schüler und ihre Entwicklung im Mittelpunkt. Um sie herum lassen sich die Ebene des Unterrichts, die Ebene der Einzelschule und schließlich die systemische Ebene der Bildungsadministration (mit der Schulaufsicht1 und dem weiteren Unterstützungssystem), der Lehrkräftebildung und der Bildungspolitik ansiedeln. Was hier deutlich wird: Die Ebene des Unterrichts ist proximal zum Lernen und zur Entwicklung der Schülerinnen und Schüler – das bedeutet: Sie ist von allen Ebenen „am nächsten dran“ an den Lernenden. Der Unterricht ist eben der Ort, an dem Lernen vor allem stattfindet. Veränderungen in der Qualität des Unterrichts – in dem was Lehrkräfte täglich gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern im Klassenraum tun – schlagen sich viel eher und viel direkter in der Entwicklung der Schülerinnen und Schüler nieder als Unterschiede auf den darüber liegenden Ebenen der Schule oder der Bildungsadministration. Wenn nach der Veröffentlichung von Schulleistungsstudien über Maßnahmen zur Verbesserung der fachlichen Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern diskutiert wird, muss berücksichtigt werden, dass diese Maßnahmen letztlich nur dann bei den Lernenden ankommen, wenn sie auch etwas am Unterricht verändern.
14
Abbildung 1: Unterschiedliche Ebenen im Bildungssystem (nach Fauth & Jetter, 2022, S. 8)
Auf den Unterricht kommt es an!
Die Ergebnisse der viel diskutierten Meta-Studie „Visible Learning“ des australischen Pädagogen und Erziehungswissenschaftlers John Hattie (2009, siehe auch Kapitel 3.1) trugen ebenfalls dazu bei, dass wir heute anders über die Bedeutung von Unterricht denken, als noch vor 30 Jahren. Über das Vorgehen Hatties und die Aussagekraft der einzelnen Effektgrößen ist viel diskutiert worden (Cramer, 2021). Man kann aber festhalten: In der Gewichtung der einzelnen Einflussfaktoren auf den Lernerfolg haben jene Faktoren eine herausgehobene Bedeutung, die sich direkt auf die Qualität des Unterrichts beziehen. Das sind Faktoren wie beispielsweise die Qualität des Feedbacks (siehe Kasten „Individuelle Unterstützung im Lernprozess“, S. 53) oder die Art der Klassenführung im Unterricht (siehe Kapitel 3.4). Insgesamt finden sich bei Hattie deutlich größere Effekte für Merkmale von Lehrkräften und Unterricht als für strukturelle Merkmale auf der Schul15ebene. Für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern ist es weitaus entscheidender, in welche Klasse sie gehen und von welcher Lehrkraft sie unterrichtet werden, als welche Schule sie besuchen – so lässt sich dieser Befund zusammenfassen (vgl. Lotz & Lipowsky, 2015).
Forschungsergebnisse wie diese haben dazu beigetragen, dass sich in der empirischen Unterrichtsforschung in den letzten Jahren eine Sichtweise durchgesetzt hat, die mit der Formel „Auf die Lehrkraft kommt es an!“ (Lipowsky, 2006) auf den Punkt gebracht wird. „Teachers make a difference“, hieß es in der Formulierung von John Hattie (2003). Heute müssten wir wohl ergänzen: Auf die Lehrkraft und ihren Unterricht kommt es an, denn die „Qualität einer Lehrkraft“ (in der englischsprachigen Literatur: Teacher Quality) sollte keineswegs gleichgesetzt werden mit der Qualität des Unterrichts (Teaching Quality; Fauth, 2021). Auch wenn die unterrichtende Lehrkraft am Ende Verantwortung für das Gelingen von Unterricht trägt, ist der Unterricht doch ein interaktives Geschehen, zu dessen Qualität die Schülerinnen und Schüler ebenso viel beitragen wie die Lehrkräfte (siehe Kasten).
„Gute Schülerinnen und Schüler“
In einem interessanten Beitrag hat sich Hilbert Meyer (2019) mit der Frage beschäftigt, was denn den „guten Schüler“ oder die „gute Schülerin“ ausmacht. Ausgangspunkt seiner Überlegung ist die Feststellung, dass in den letzten ca. 20 Jahren sehr viel über „guten Unterricht“ gesprochen und geschrieben wurde (gerade auch von Meyer selbst). Es ist aber viel weniger darüber nachgedacht worden, wie man sich als Lehrkraft eigentlich diejenigen vorstellt und wünscht, für die dieser Unterricht gemacht ist und die von ihm profitieren sollen.
Besonders interessant wird diese Überlegung, wenn man sie wieder auf den Unterricht rückbezieht und sich die Frage stellt, wie der Unterricht dazu beitragen kann, dass sich Schülerinnen und Schüler in diesem Sinne (weiter-)entwickeln. Wie muss Unterricht gestaltet sein, damit sich in ihm und durch ihn „gute Schüler“ und „gute Schülerinnen“ entwickeln können?
Hilbert Meyer gibt übrigens eine interessante „Arbeitsdefinition“ des guten Schülers/der guten Schülerin: „Eine gute Schülerin/ein guter Schüler ist ein Mensch, der sich beim Lernen von Lehrern und Mitschülern helfen lässt.“ (Meyer, 2019, S. 36)
Die Diskussion um den Einfluss, den Schule, Unterricht und Lehrkräfte auf die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern haben, ist nicht nur eine akademische Debatte. Vielmehr hat sie eine enorme Relevanz für die alltägliche Praxis von Lehrkräften. Dies lässt sich exemplarisch an der Forschung zur sogenannten professionellen Kompetenz von Lehrkräften zeigen.
16Professionelle Kompetenz von Lehrkräften als Voraussetzung für Unterrichtsqualität
Für die Gestaltung des Unterrichts und damit auch für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern spielt die professionelle Kompetenz von Lehrkräften eine entscheidende Rolle (Kunter et al., 2011). Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher haben sich intensiv mit der Frage beschäftigt, welche spezifischen Kompetenzen Lehrkräfte entwickeln müssen, um in ihrem Beruf erfolgreich zu sein. „Erfolgreich sein“ heißt hier, den Unterricht qualitätsvoll zu gestalten, den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler zu sichern und dabei als Lehrkraft gesund und motiviert zu bleiben.
Die fachliche Expertise von Lehrkräften ist eine notwendige Grundlage für das professionelle Handeln im Unterricht (vgl. für die folgenden Abschnitte auch Fauth & Jetter, 2022). Diese Expertise bezieht sich jedoch nicht nur auf die jeweils zu unterrichtenden Inhalte (also das fachwissenschaftliche Wissen), sondern auch und vor allem auf das fachdidaktische Wissen (Kunter et al., 2013): Wie sind diese Inhalte jeweils zu unterrichten, um den einzelnen Schülerinnen und Schülern optimale Lerngelegenheiten zu bieten? Zum Beispiel: Welche Aufgaben eignen sich besonders, um bestimmte Sachverhalte verständlich zu machen, welche Verständnisschwierigkeiten treten bei Lernenden an bestimmten Stellen immer wieder auf? In gleicher Weise hat sich auch das pädagogisch-psychologische Wissen in empirischen Untersuchungen immer wieder als bedeutsam für die Unterrichtsgestaltung und den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler gezeigt (Voss, Zachrich, Fauth & Wittwer, 2022). Dazu gehört zum Beispiel Wissen über eine effektive Klassenführung oder über die Unterrichtsgestaltung mit heterogenen Lerngruppen – also im Grunde genau jene Themen, um die es auch in diesem Band geht.
Neben den kognitiven Kompetenzen sind auch eine ganze Reihe nicht-kognitiver Kompetenzen entscheidend dafür, dass Lehrkräfte im Laufe eines Berufslebens erfolgreich sind und sich wohl fühlen. Das betrifft beispielsweise den Umgang mit Stress und den eigenen Ressourcen (berufliche Selbstregulation; siehe Klusmann & Waschke, 2018), aber auch den wichtigen Bereich der beruflichen Motivation. Diese Motivation zeigt sich darin, ob Lehrkräfte grundsätzlich Freude an ihrer pädagogischen Tätigkeit haben („intrinsische Motivation“) und ob sie sich selbst bei ihrer Arbeit als kompetent erleben („Selbstwirksamkeit“; Fauth et al., 2019).
17Selbstwirksamkeitserwartungen
Mit kollektiver Selbstwirksamkeitserwartung bezeichnet man die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund gemeinsamer Kompetenzen einer Gruppe bewältigen zu können.
(Schwarzer & Schmitz, 1999, S. 262)
Die Selbstwirksamkeit von Lehrkräften ist ein für die Unterrichtspraxis besonders wichtiger Teil der beruflichen Motivation. Erfasst werden die Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrkräften beispielsweise über Aussagen wie: „Ich weiß, dass ich es schaffe, selbst den problematischsten Schülern den prüfungsrelevanten Stoff zu vermitteln“ (Jerusalem et al., 2009, S. 74). Beobachtet man den Unterricht mittels Videoanalysen und testet man das Wissen ihrer Schülerinnen und Schüler mit standardisierten Leistungstests, so sieht man, dass jene Lehrkräfte, die solchen Aussagen eher zustimmen, auch tatsächlich erfolgreicher sind. Das betrifft sowohl die von außen eingeschätzte Qualität des Unterrichts als auch den Lernerfolg ihrer Schülerinnen und Schüler. Ein Grund dafür ist natürlich, dass die Selbstwirksamkeitserwartungen von Lehrkräften auf früheren Erfahrungen im Unterricht basieren. Die Selbstwirksamkeit ist dann eine Folge von positiven Erfahrungen, in denen sich Lehrkräfte selbst als wirksam erlebt haben. Aber es gibt eben auch Hinweise auf die umgekehrte Wirkrichtung, dass nämlich positivere Selbstwirksamkeitserwartungen einen Einfluss auf die Art und Weise haben, wie Lehrkräfte unterrichten (Fauth et al., 2019; Holzberger, Philipp & Kunter, 2014). In einer Übersichtsarbeit hat sich gezeigt, dass die kollektiven Selbstwirksamkeitserwartungen der Lehrkräfte an einer Schule hochrelevant für den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern sind. Kollektive Selbstwirksamkeitserwartungen rangieren damit nun an der Spitze des „Hattie-Rankings“ (Hattie, 2023).
Vermutlich decken sich diese Befunde mit dem Erleben der meisten Kolleginnen und Kollegen in der Praxis: Wenn wir daran glauben, dass wir kompetent sind und auch schwierige Herausforderungen im Unterricht meistern können, dann wirkt sich das auf unser Auftreten in der Schule, auf unser ganzes berufliches Handeln aus. Wenn Kolleginnen und Kollegen morgens mit dem Gedanken „Ich schaffe das alles nicht – und bei meinen Schülerinnen und Schülern ist ohnehin Hopfen und Malz verloren“ in die Schule gehen, dann wird sich das vermutlich auch auf ihre Unterrichtsgestaltung auswirken.
In empirischen Studien zeigt sich immer wieder, dass die Merkmale der professionellen Kompetenz von Lehrkräften mit der Qualität des von ihnen gestalteten Unterrichts zusammenhängen (z. B. Kunter et al., 2013). Daher ist die professionelle Kompetenz von Lehrkräften auch ein entscheidender Ansatzpunkt, wenn es darum geht, die Qualität des Unterrichts zu verbessern. Wir können hier festhal18ten: Lehrkräfte und ihr Unterricht machen einen Unterschied, sie sind wichtig für die Entwicklung ihrer Schülerinnen und Schüler und das Wissen darum ist wiederum ein wichtiger Einflussfaktor für ihr unterrichtliches Handeln.
2.2 Zielkriterien: Was soll mit gutem Unterricht erreicht werden?
In diesem Kapitel wurde schon wiederholt darüber gesprochen, dass guter Unterricht auch wirksam sein sollte, z. B. in Bezug auf den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern. Es lohnt sich, hier noch etwas genauer hinzuschauen: Was sollen die Ziele sein, an denen sich die Effektivität von gutem Unterricht messen lassen kann und muss? Bezüglich der Ziele, die zum Beispiel mit Qualitätsentwicklungsprozessen in Schule und Unterricht (siehe Kapitel 4) erreicht werden sollen, hat es in Bildungsforschung und Bildungspolitik in den letzten Jahren eher eine Art diffusen Konsens als wirklich kontroverse Debatten gegeben. Es ist aus unserer Sicht jedoch unumgänglich, dass es zumindest wenige, dafür aber sehr klar benannte Ziele gibt, die Orientierung für gemeinsame Anstrengungen zur Qualitätsverbesserung in Schule und Unterricht bieten können. Wir schlagen daher vor, drei Ziele zu fokussieren (vgl. Fauth & Jetter, 2022; Sliwka & Yee, 2015):
1.
Erwerb fachlicher und überfachlicher Kompetenzen
2.
Persönlichkeitsentwicklung und Wohlbefinden
3.
Chancengerechtigkeit





























