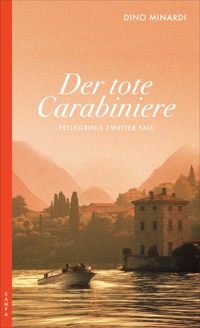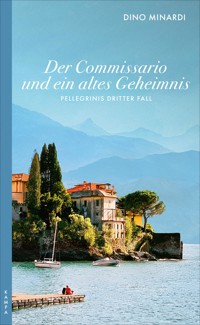13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Pellegrini
- Sprache: Deutsch
Marco Pellegrini hat sich auf unbestimmte Zeit beurlauben lassen. Doch statt Dolce Vita am Comersee heißt es für ihn Fläschchen machen und Windeln wechseln: Sechs Wochen ist die kleine Emma alt und hält Pellegrini im Vaterschaftsurlaub mehr in Trab als sämtliche Verbrecher Comos. Aber so ganz kann Papà Pellegrini das Ermitteln nicht lassen: Als sich in den engen Serpentinen der Auffahrt nach Brunate, unweit des Albergo seiner Eltern, ein Unfall ereignet, springt er seinem neuen Kollegen Commissario Antonio Gruber und Ispettrice Claudia Spagnoli von der Polizia di Stato sofort tatkräftig zur Seite. Der Fahrer ist tot, die Beifahrerin schwer verletzt im Krankenhaus. Im Fahrzeug saßen Hans-Peter und Dagmar Bruchsitter aus Köln. Seit über dreißig Jahren verbrachten sie ihre Urlaube im Albergo Pellegrini. Marta Pellegrini ist überzeugt, dass ihre Stammgäste keinem gewöhnlichen Verkehrsunfall zum Opfer gefallen sind. Nur zu gern hütet sie ihr langersehntes Enkelkind, und für den Commissario endet der Urlaub früher als gedacht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Dino Minardi
Urlaub für den Commissario
Ein Fall für Pellegrini
Roman
Kampa
Samstag, 03. Oktober
Un caffè al banco
Ratlos starrte Marco Pellegrini auf die digitale Anzeige,den Siebträger mit dem frisch gemahlenen Espressopulver noch in der Hand. Den ganzen Morgen hatte die nagelneue Kaffeemaschine in der Bar della Funicolare ihren Dienst getan, Druck, Temperatur, alles war in bester Ordnung gewesen. Jetzt blinkte ihm ein rotes Licht auf dem digitalen Display entgegen, und er hatte keine Ahnung, was es bedeutete.
Pellegrini hakte den Siebträger ein und drückte auf den Knopf, der normalerweise dafür sorgte, dass ein frischer caffè in die Tasse gluckerte. Nichts passierte.
»Technik, die begeistert«, rief Pellegrini laut und verschränkte die Finger ineinander, um sich davon abzuhalten, dem störrischen Gerät einen Schlag zu verpassen. Zum Glück befand sich im Moment außer ihm nur die friedlich schlafende Emma in der Bar. Den caffè hatte Pellegrini für sich selbst machen wollen, es wäre erst der zweite an diesem Morgen.
Er drückte nacheinander alle Knöpfe. Die Digitalanzeige erlosch für ein oder zwei Sekunden vollständig, dann blinkte alles wieder auf, einschließlich dem roten Licht. Seufzend verschränkte Pellegrini die Arme und lehnte sich gegen die Anrichte. Da befand er sich an einem seiner Lieblingsorte, die herbstliche Sonne schien warm durch die bodentiefen Fenster, und aus dem Radio säuselte Jovanottis Mi fido di te. Aber ohne eine Tasse starken schwarzen caffè wollte die übliche Wohlfühlatmosphäre nicht recht aufkommen.
Und zu allem Übel erwachte Emma und fing an zu wimmern. Mit einem Seitenblick auf die Wanduhr über dem Spirituosenregal trat Pellegrini an den Stuhl mit der Babyschale und hob die Kleine hoch. Sie verstummte, doch das würde nicht lange so bleiben. Sicher hatte sie Hunger, wie immer um diese Uhrzeit.
Die Tür zur Bar wurde geöffnet. Ein herbstlicher Wind wehte herein. Die Sonne draußen täuschte, die Tage wurden bereits kühler.
»Buongiorno!«, tönte ein tiefer Bass fröhlich in den Raum. Draußen in der Ferne heulten Polizeisirenen, untermalt von dem herannahenden Geknatter eines Hubschraubers.
Pellegrini versicherte sich, dass Emma fest in seiner rechten Armbeuge lag und schaltete mit der linken den Babymilch-Zubereiter ein. Dann erst wandte er sich mit einem strahlenden Lächeln seinem Gast zu. »Don Amissah, Sie schickt der Himmel.«
Der Pfarrer von Brunate faltete die Hände vor die Brust. »Was ist passiert? Ist es so schlimm um die Menschheit bestellt, dass sich jetzt sogar die Ungläubigen an Gott, den Herrn, wenden?«
»Schlimmer!« Pellegrini lachte. Auch wenn sie in Glaubensfragen nicht einer Meinung waren, verstanden sie sich prächtig. »Die Espressomaschine will ihrer Pflicht nicht nachkommen.«
»Das ist in der Tat kritisch. Ich kann es gerne mit einem Gebet versuchen, aber meiner Erfahrung nach gelangt die göttliche Intervention bei technischen Geräten an ihre Grenzen.«
Ein Signalton piepte unschön.
»Da haben Sie es.« Pellegrini nahm das Milchfläschchen aus der Maschine. »Wenn es wirklich darauf ankommt, ist mit Gott nicht zu rechnen.«
Emma wusste, was nun bevorstand. Sie räkelte sich in seinem Arm und gluckste.
Don Amissah widersprach nicht. Manchmal fragte sich Pellegrini, ob der Pfarrer eigentlich selbst noch glaubte oder angesichts der Entwicklungen auf dieser Welt längst haderte. Der gebürtige Nigerianer gab sich in seinen religiösen Überzeugungen ohnehin eher pragmatisch, stets den Menschen in seiner Gemeinde zugewandt und weniger himmlischen Idealen. Er kritisierte die katholische Kirche offen, vor allem, was deren Missionsbemühungen auf seinem Heimatkontinent oder die Haltung zum Umgang mit afrikanischen Flüchtlingen anging – besser gesagt, ihr lautes Schweigen in diesem Punkt –, und hörte auch nicht damit auf, nachdem er sich vor Kurzem erst einen offiziellen Verweis aus dem Vatikan eingefangen hatte. Dafür hatte er Pellegrinis uneingeschränkte Bewunderung und Solidarität, und dem tat seine agnostische Haltung keinen Abbruch.
Don Amissah setzte sich auf einen Barhocker an den marmornen Tresen und beobachtete interessiert, wie Pellegrini sich gegen die Anrichte lehnte und Emma die Flasche anbot. Das Baby öffnete den Mund, schien sich nicht recht entscheiden zu können, ob es losplärren oder lieber trinken wollte. Vorsichtig stupste Pellegrini ihm mit dem Sauger an die Lippen. Und zu seiner Erleichterung schmatzte Emma ein paarmal und trank schließlich. Das rote Licht auf dem Display der Siebträgermaschine blinkte noch immer.
»Sie ist eine ganz Ruhige, oder? Steht Ihnen übrigens gut«, meinte der Pfarrer.
»Grazie. Und ja, tagsüber ist sie pflegeleicht, aber lassen Sie sich nicht täuschen. Sehen Sie meine Augenringe?«
»Ja, Sie wirken ein wenig müde.«
»Kennen Sie den Film Die Gremlins? Schon älter, von Anfang der Achtziger.«
»Ich bitte Sie, da war ich gerade mal geboren. Meine Eltern hatten keinen Fernseher, und das nächste Kino war kilometerweit weg.« Don Amissah wedelte abwehrend mit der Hand.
»Diese Gremlins sind niedliche Wesen, solange sie nicht nach Mitternacht gefüttert werden. Dann verwandeln sie sich in Monster.«
»Sie meinen, Ihr Baby ist so ein Gremlin?«
»Schauen Sie Emma an, sie ist äußerst niedlich. Nachts habe ich es hingegen mit einem kleinen Dämon zu tun. Sie holt mich alle zwei Stunden aus dem Bett.«
»Da sehen Sie mal, was Mütter leisten. Wie geht es denn Signora Segnieri?«
Pellegrini antwortete zunächst nicht und war sich sicher, dass sein Gegenüber klug genug war, seine eigenen Schlüsse zu ziehen. Dann überwand er sich. Nicht über seine Probleme oder Gefühle zu sprechen, hatte ihn in der Vergangenheit nicht weitergebracht, und er hatte sich geschworen, daraus zu lernen. Wem könnte er sich anvertrauen, wenn nicht diesem zugewandten Pfarrer?
»Schlecht, Don Amissah. Sehr schlecht. Sie ist gut untergebracht und nimmt die Therapieangebote an, aber noch helfen sie nicht. Der zuständige Neurologe sucht nach einem Antidepressivum, das bei ihr anschlägt.« Er stockte. »Sie will mich nicht sehen.« Und ihre Tochter auch nicht.
»Das tut mir leid. Aber das wird sich wieder ändern, da bin ich mir sicher. Geben Sie ihr Zeit.«
»Ich würde Franca mehr als nur Zeit geben, Don Amissah.«
Der Pfarrer nickte lächelnd.
Emma nuckelte die halbe Flasche leer und hatte dann genug. Pellegrini legte ein Tuch über die Schulter, lehnte das Baby dagegen und klopfte ihm sanft auf den Rücken.
Don Amissah schmunzelte. »Ich erinnere mich gut daran, dass ich bei meinen ersten Taufen immer Panik hatte, das Baby fallen zu lassen. Ich stelle mich bis heute manchmal unbeholfen an, diese ganz kleinen Menschen sind nichts für mich. Sie dagegen gehen mit Emma um, als hätten Sie jahrelange Erfahrung.«
»Ich hatte nach der Geburt keine vierundzwanzig Stunden Zeit, mich an diese Rolle zu gewöhnen, und das war gestern vor genau sechs Wochen. Meine Schwester hat mir geholfen, und meine Mutter natürlich auch.«
Und der Gynäkologe, das Pflegepersonal im Krankenhaus, eine Hebamme. An helfenden Händen hatte es wahrlich nicht gemangelt. Manchmal waren es Pellegrini sogar zu viele Hände gewesen. Aber zumindest konnte er sicher sein, dass seine Familie das Baby, gesund und munter, wie es war, bestens versorgte. Er selbst hätte sich lieber um Franca gekümmert – wenn sie es denn zugelassen hätte. Das letzte Schwangerschaftsdrittel war für sie katastrophal verlaufen. Sie entwickelte im siebten Monat Unverträglichkeiten und Übelkeit, was gar nicht einmal so unüblich war, wie sie beide lernen mussten. Zwischendurch nahm sie sogar ab, was dann endlich ihre Ärztin auf den Plan rief. Die letzten zwei Wochen verbrachte sie im Ospedale Sant’Anna, bis Emma per Kaiserschnitt zur Welt kam. Drei Tage lang war Franca danach zwar bei Bewusstsein, jedoch kaum ansprechbar, wollte ihr Kind nicht sehen und stieß das Neugeborene weg, als eine wohlmeinende Krankenschwester versuchte, es ihr auf die Brust zu legen. Danach, als sie auf der Geburtsstation nichts mehr für sie tun konnten, begab Franca sich freiwillig in eine psychosomatische Einrichtung. In den ersten Tagen hatten sie alle noch vergeblich versucht, Franca davon zu überzeugen, das Baby mit in die Klinik zu nehmen. Doch was zunächst noch als Babyblues wegerklärt und auf die Hormonumstellung des Körpers geschoben wurde, stellte sich allzu bald als schwere postpartale Depression heraus. Etwas, das ebenfalls häufiger vorkam, als die Allgemeinheit glaubte, lernte Pellegrini, doch was nutzte das? Eine Besserung war nicht in Sicht. Er, Franca, seine Familie, sie alle mussten Geduld haben, so schwer es ihnen fiel.
Die Siebträgermaschine zischte, und die beiden Männer zuckten zusammen. Dann schoss plötzlich Wasser aus allen Düsen, inklusive der mit dem Siebträger, den Pellegrini zuvor eingehängt hatte. Die Flüssigkeit in der Tasse sah allerdings nicht nach einem guten caffè aus, sondern eher wie schäumendes Spülwasser. Das rote Licht auf dem Display erlosch endlich.
Pellegrini entwand Emma seinen Finger und nahm das Tuch von der Schulter. »Das scheint ein Reinigungsprogramm gewesen zu sein. Vielleicht kann ich Ihnen jetzt Ihren Cappuccino zubereiten, Don Amissah.«
»Versuchen Sie Ihr Glück. Und ein cornetto con albiocca dazu, bitte.«
»Das bekommen Sie auf jeden Fall.«
1
Kurz darauf verabschiedete der Pfarrer sich. Inzwischenhatte sich die Bar della Funicolare wieder gefüllt. Pellegrini bediente sowohl Einheimische, die den Samstag nutzten, um mit der Standseilbahn nach Como zu fahren und einen ausgedehnten Einkaufsbummel durch die engen Gassen zu machen, als auch die wenigen letzten Touristinnen und Touristen der Saison, die einen Tagesausflug nach Brunate unternahmen, um sich den Volta-Leuchtturm anzusehen oder die Aussicht auf die Bucht zu genießen. Den Herbst als Reisezeit für diejenigen zu vermarkten, die es gemütlich mochten und die düstere Atmosphäre von Nebel und nach feuchter Erde duftenden Wäldern schätzten, lockte neuerdings immer mehr Gäste bis weit in den Oktober an den See, sodass die Saison beständig länger wurde.
Pellegrini hatte gut zu tun, wofür er dankbar war, lenkte es ihn doch von seinen Grübeleien ab. Dass er Franca nicht helfen konnte, außer indem er für ihre Tochter da war, machte ihm weit mehr zu schaffen, als er vor Don Amissah zugegeben hatte. Der Pfarrer vermutete es sicher ohnehin, schließlich hatte er auch ständig mit Marta Pellegrini zu tun.
Nach drei Stunden, gerade als der mittägliche Ansturm einsetzte, blinkte das Display der Espressomaschine wieder rot. Stumm verwünschte Pellegrini das Gerät und erklärte der kaffeedurstigen Kundschaft, er könne allenfalls mit dem Wasserkocher einen Instantkaffee zubereiten. Dabei schwenkte er ein Schraubglas mit seit Jahren abgelaufenem Nescafé, das er zu seiner eigenen Überraschung unter dem Spülbecken gefunden hatte. Immerhin nahmen die Gäste es mit Humor und bestellten Crodino, Orangina oder einen frühen Aperol Spritz.
Pellegrini überlegte gerade, ob er wegen der Maschine jemanden aus seiner Familie anrufen sollte, als Marta Pellegrini in die Bar rauschte und erst auf ihren Sohn zuhielt, dann jedoch die Babyschale erblickte und zu Emma abbog. Prüfend beugte sie sich über ihr schlafendes Enkelkind. »Alles in Ordnung, Marco?«
»Nein, nichts ist in Ordnung. Schau dir das an, die Maschine blinkt jetzt schon wieder seit zehn Minuten.«
»Ich meinte, mit dem Baby.« Sie schaute auf das Display. »Das ist das Reinigungsprogramm. Warum lässt du das jetzt laufen, mitten am Tag?« Routiniert ließ sie den Blick über die Anwesenden schweifen, die an den Bistrotischen saßen, sich unterhielten, mit ihren Telefonen herumspielten, vor sich ausgebreitete Wanderkarten studierten – oder auch alles gleichzeitig. Da niemand über die fehlenden Heißgetränke unglücklich wirkte, gab sie sich zunächst zufrieden.
»Ich habe das nicht angestellt, Mamma. Das läuft heute schon zum zweiten Mal automatisch ab.«
»Dann musst du es abstellen, ist doch ganz logisch.«
»Ich? Ich bin Commissario und Teilzeit-Barista, kein Programmierer. Wer hat das denn so eingerichtet?«
Seine Mutter zog eine Schublade auf und nahm ein dickes Taschenbuch mit dem Foto einer raffinierten Latte Art auf dem Cover heraus. »Das ist die Bedienungsanleitung. Da steht es sicher drin.«
Er schüttelte schweigend den Kopf.
Marta Pellegrini stemmte die Fäuste in die Seiten. »Ich habe auch nicht darum gebeten, dass die alte Maschine irreparabel ihren Geist aufgibt. Wenn du hier im Betrieb mit anpackst, kannst du dir nicht nur die Rosinen herauspicken.«
»Wie bitte?«
»Du hast mich schon verstanden.«
Pellegrini hatte Mühe, leise zu sprechen. »Nein, ganz und gar nicht. Was heißt denn hier: im Betrieb mit anpacken? Ich habe mich angeboten, spontan einzuspringen, weil Valentina heute morgen abgesagt hat.« Außerdem war er müde, die kurzen Nächte forderten ihr Tribut.
Marta Pellegrini holte Luft. In dem Moment beendete die Maschine ihre Reinigung. Emma begann zu greinen. Gleichzeitig betrat ein rothaariger Mann mit breiten Schultern die Bar und schaute sich suchend um. Er erblickte Pellegrini und winkte ihm lächelnd zu.
»Sicherlich musst du die Windeln wechseln.« Seine Mutter beugte sich schnüffelnd über die Babyschale.
Pellegrini schüttelte wütend den Kopf. Natürlich wusste sie wieder alles besser. Er hatte Emma gerade erst frisch gewickelt, bevor sie gekommen war.
»Salve, Tonio!«, wandte er sich demonstrativ an den Neuankömmling. »Was führt dich in meine heiligen Hallen? Hoffentlich nichts Dienstliches?«
Commissario Antonio Gruber zuckte unbestimmt mit den Schultern. Pellegrini nickte ihm zu, zog sich eine Kapuzenjacke über und drängte sich an seiner Mutter vorbei.
»Kannst du hier für ein paar Minuten die Stellung halten? Emma braucht nur ein wenig frische Luft.« Er hob das Baby auf, was dieses überrascht verstummen ließ, und fischte eine Mütze aus der Jackentasche.
»Das ist doch viel zu kalt! Zieh ihr wenigstens eine Mütze auf!«
»Liebe Gäste, die Espressomaschine ist jetzt wieder einsatzbereit«, rief Pellegrini im Hinausgehen.
Ein Chor erfreuter Stimmen antwortete ihm, einige standen sofort auf, um etwas zu bestellen. Die Verwünschungen, die seine Mutter hinter seinem Rücken vor sich hin murmelte, würde sie sicherlich beichten müssen. Gruber hielt ihm die Tür auf und schaute neugierig zu, wie Pellegrini Emma gekonnt die Mütze aufsetzte und seine Jacke halb über sie beide schloss.
»Dich schickt der Himmel, sonst wäre da hinter der Theke gleich ein Verbrechen passiert. Komm, lass uns ein paar Meter gehen.«
»Ist das deine Mutter?«
»Wie sie leibt und lebt. Lass dich von ihrer zierlichen Gestalt nicht täuschen. Sie ist Sizilianerin, und es gibt Tage, da legt sie es darauf an, sämtlichen Klischees der süditalienischen Matriarchin zu entsprechen. Und was das Kind anbelangt, weiß sie als Frau, zweifache Mutter und Großmutter natürlich alles besser.« Er tätschelte Emma den Rücken. Die schien jedenfalls der Ansicht zu sein, dass er seine Sache gut genug machte. Zufrieden steckte sie zwei Finger in den Mund und schloss die Augen.
Gruber warf ihm einen amüsierten Seitenblick zu. »Steht dir gut.«
»Das habe ich heute schon mal gehört.«
»Es stimmt ja auch. Schön, mitanzusehen, aber ein bisschen Sorgen macht mir das schon, dass du so in der Vaterrolle aufzugehen scheinst. Am Ende denkst du noch darüber nach, vorläufig nicht zu uns zurückzukommen. Ich könnte es dir nicht verdenken.«
Reumütig grinste Pellegrini. »Du musst mir glauben, dass das so nicht geplant war. Da werben Claudia und ich dich als neuen Kollegen für Como an, und kaum hast du angefangen, machen wir uns aus dem Staub. Glaub mir, an dir liegt es nicht.«
»Das will ich doch hoffen!« Obwohl Gruber kurz auflachte, wirkte er verkrampft und wurde mit einem Schlag wieder ernst. Nachdenklich lehnte er sich auf die Brüstung des Aussichtspunkts, den sie inzwischen erreicht hatten, und schaute hinab auf den See, der, umgeben von grünen Hügeln, unter ihnen lag.
Commissario Antonio Gruber stammte ursprünglich aus Brixen in Südtirol und hatte sich Anfang des Jahres auf die Nachfolge von Ispettore Fabio Cunego beworben. Pellegrinis ehemaligem Mitarbeiter war schon vor einiger Zeit nahegelegt worden, sich eine andere Dienststelle zu suchen, nachdem er mit Ispettrice Claudia Spagnoli ein übles Spiel getrieben hatte. Im Mai nahmen Pellegrini und sie am Kongress der Vereinigung Hominis et Tigris in Bergamo teil und hatten Gruber dort zufällig kennengelernt. Als Pellegrini vor Ort unfreiwillig eine Mordermittlung übernehmen musste, da der zuständige Commissario aus Bergamo zum Kreise der Verdächtigen zählte, rekrutierte er den Kollegen in spe kurzerhand. Die Zusammenarbeit funktionierte so tadellos, dass Grubers Anstellung in Como danach nur noch Formsache war. Statt zu dritt zusammenzuarbeiten, verabschiedete sich Spagnoli aber noch vor Grubers Antritt zu einer Europareise mit ihrer sterbenskranken Mutter und ihrem Bruder Gianluca. Und auch Pellegrini war an Grubers erstem Arbeitstag bereits unverhofft im Vaterschaftsurlaub. Er hatte sich um den Geburtstermin ohnehin freinehmen wollen, aber dann war aus den paar Tagen ein längerer Zeitraum geworden.
Eine Weile standen der Südtiroler und er nun stumm nebeneinander und betrachteten die Aussicht, von der Pellegrini, da war er sich sicher, niemals genug bekommen würde. Der See war unruhig, Wind türmte das Wasser zu schaumigen Wellen auf. Wolken trieben über den Himmel, warfen dunklere Schatten auf die in der Sonne glänzende Oberfläche. Ein Motorboot verließ den Hafen von Como und pflügte auf seinem Weg Richtung Norden eine weiße Schneise durch den See.
»Kennst du das?«, fragte Gruber unvermittelt. »Diese Momente, in denen du dich fragst, ob das, was du machst, irgendeinen Sinn hat? Ob du mit deiner Arbeit überhaupt etwas ausrichten kannst?«
»Natürlich. Aber irgendjemand muss es ja tun. Für die Opfer, für die Gesellschaft, gerade, wenn es um Gewaltverbrechen geht. Mir hilft es dann, mich daran zu erinnern, dass ich die Arbeit ganz gut mache. Hast du einen schwierigen Fall?« Pellegrini wunderte sich ein wenig. Zwar hatte er sich von Questore Ruscon offiziell auf unbestimmte Zeit beurlauben lassen, dennoch hätte er eigentlich erwartet, von einem unnatürlichen Todesfall, gar einem Mord in Como als einer der Ersten zu erfahren.
Gruber wandte der Aussicht den Rücken zu und lehnte sich gegen das Geländer. Als er die Arme verschränkte, wirkten seine Schultern noch massiger. Nicht zum ersten Mal dachte Pellegrini, dass sein Kollege mit dem roten Bürstenhaarschnitt jederzeit einen Job als Türsteher oder Bodyguard bekommen könnte. Dagegen fühlte er, eine Handbreit kleiner, aber aufgrund seines jahrelangen Rudertrainings auch nicht gerade schmal gebaut, sich beinahe zierlich.
»Nein, schwierige Fälle gibt es zum Glück gerade nicht. Es ist eher die Gesamtsituation. Der Questore hat mir heute Morgen unmissverständlich klargemacht, dass wir keine neuen Leute bekommen werden. Ich bin noch keine zwei Monate hier und habe schon vierunddreißig Überstunden. Und das ist ja eher wenig, das weiß ich selbst.«
»Daher dachtest du, du schaust mal bei mir rein und fragst, ob ich etwas Zeit habe.«
Gruber lachte laut auf. »Die hast du nicht, die Zeichen sind eindeutig. Die Frauen deiner Familie haben dich fest im Griff.« Er klang schon weniger angespannt. »Ach was, ich will dich nicht mit meinen Zweifeln und Nöten belästigen. Tatsächlich bin ich vorhin in der Nähe gewesen und dachte, ich schaue mal in der Bar vorbei, von der du erzählt hast. Ich hatte gar nicht damit gerechnet, dich hier zu treffen, schon gar nicht hinterm Tresen.«
»Das kommt hin und wieder vor, wenn es einen personellen Engpass gibt. Die Bar ist sieben Tage die Woche siebzehn Stunden geöffnet, an den Wochenenden noch eine Stunde länger. Es gibt nur zwei Vollzeitangestellte, die übrigen Schichten werden über Teilzeit, Aushilfen und Familie abgedeckt. Rechne dir selbst aus, wie gut das passt. Personalprobleme kennen wir in letzter Zeit auch.«
»Ich glaube, Ruscon hofft immer noch darauf, dass du recht schnell zurückkommst.«
»Auf mich sollte der Questore nicht zählen.« Pellegrini stockte, dachte wieder an Franca. »Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Das weiß niemand. Vater zu werden, habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber solange Emma mich braucht, bin ich da.« Sanft streichelte er dem schlafenden Kind über den Rücken. Das mit der Jacke war nicht optimal, er hätte besser ein Tragetuch mitgenommen. Er lernte eben noch.
»Aber vielleicht habe ich eine gute Nachricht für dich«, sagte Pellegrini in das einträchtige Schweigen. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass Claudia sehr bald in den Dienst zurückkehrt. Sie ist zumindest schon wieder in Como.«
»Ja, das weiß ich«, sagte Gruber zu seiner Überraschung. »Sie hat sich auch bei mir gemeldet und gefragt, ob ich ein Problem damit hätte, wenn sie sogar möglichst zeitnah wieder anfängt. Der Tod ihrer Mutter liegt jetzt drei Monate zurück. Mir scheint, ihr fällt die Decke auf den Kopf.«
»Ich konnte mir ohnehin nicht gut vorstellen, dass sie noch weitere Wochen oder Monate durch die Weltgeschichte tingeln würde. Das Geld war ja nicht das Problem, wenn ich sie richtig verstanden habe. Aber sie ist einfach nicht der Typ dafür.« Er fragte sich, wann er selbst die Arbeit vermissen würde. Noch hielt Emma ihn auf Trab; die für ihn unbekannten Herausforderungen, die Sorge um Franca waren für den Moment genug. Aber was die Zukunft auch für ihn bereithielt, ewig konnte es so nicht weitergehen. Und der kurze Zusammenstoß mit seiner Mutter vorhin hatte ihm wieder einmal gezeigt, dass es für ihn nach wie vor nicht infrage kam, dauerhaft im Familienbetrieb mitzuarbeiten.
»Was hat dich nach Brunate geführt, Tonio?«, fragte er, um das Thema zu wechseln. »Du meintest vorhin, du wärst in der Nähe gewesen.«
»Das, richtig. Ein Großeinsatz, leider mit unerfreulichem Ende. Auf der Fahrt hier rauf ist in einer der Serpentinen ein Auto verunglückt. Der Fahrer hat nicht überlebt, die Beifahrerin wurde schwer verletzt ins Hospital eingeliefert.«
»Oddio, ich habe heute Morgen einen Hubschrauber gehört. Also schon wieder ein Verkehrsunglück. Das wird immer schlimmer. Gerade hier, die schmalen Straßen, die zahllosen und viel zu großen Autos, das passt schon lange nicht mehr zusammen. Und warum macht das nicht jemand von der Polstrada?«
»Ich habe heute Dienst, ich war verfügbar. Das ist es, was ich vorhin meinte, die Personaldecke ist hauchdünn. Du warst früher bei der Verkehrspolizei, richtig?«
Pellegrini nickte. »Stimmt. Ich habe so einiges gesehen und erlebt. Was weißt du schon über den Unfallhergang?«
»Laut einer Anwohnerin ist ein Motorrad aus Richtung Brunate gekommen und hat das Auto in der Steilkurve geschnitten. Für die Zeugin sah es so aus, als hätte der Autofahrer versucht, auszuweichen. Der Wagen fuhr zur Seite und wurde über die Leitplanke die Böschung runtergeschleudert. Der sah ziemlich übel aus. Ob die Beifahrerin überlebt, steht noch in den Sternen. Aber weil du vorhin von ›viel zu groß‹ gesprochen hast: Das war eine G-Klasse. Die braucht die gesamte Straßenbreite, da wäre nicht viel mit Ausweichen gewesen.«
»Lass mich raten. Der Motorradfahrer war ganz in Schwarz gehüllt und auf einer Maschine unterwegs, die meiner Meinung nach nicht in den Straßenverkehr gehört, sondern nur auf eine Rennbahn.«
»Ganz in Schwarz, das stimmt, sogar das Helmvisier war verspiegelt. Daher könnte es auch eine Frau gewesen sein, oder?« Gruber lachte auf. »Wenn ich mich recht entsinne, fährt Claudia ebenfalls gern auf zwei Rädern.«
»Ja, ist möglich, aber unwahrscheinlich, wenn es einer von denen war, die ich vor Augen habe. Ich würde auch darauf wetten, dass er eher jünger ist, zwischen zwanzig und dreißig, allerhöchstens vierzig. Aber was heißt denn ›könnte‹? Heißt das, ihr wisst es nicht?«
»Nein, die Person ist flüchtig. Und die Anwohnerin hat sie samt Motorrad ungefähr so beschrieben, wie du gerade: ›eine schwarze Gestalt auf einem sportlichen und sehr lauten Motorrad‹, so ihre Worte.«
»Flüchtig? Dem Fahrer ist nichts passiert?«
»Scheint so. Die Zeugin meinte, das Motorrad wäre ein paar Schlangenlinien gefahren, aber dann war es fort. Offen gestanden bin ich nicht sicher, wie zuverlässig diese Augenzeugin ist. Das muss alles ziemlich schnell gegangen sein. Die Dame stand zufällig am Fenster und hat Blumen gegossen, als es passiert ist. Wir haben natürlich in der Nachbarschaft herumgefragt, ob noch jemand etwas gesehen hat.«
»Die wenigsten sind am Samstagvormittag zu Hause«, meinte Pellegrini. »Und wenn doch, arbeiten sie im Garten oder entrümpeln den Keller, was weiß ich.« Sein Vater Amerigo Pellegrini hatte mal erzählt, in seiner ehemaligen Heimatstadt Köln sei es früher üblich gewesen, samstagmorgens sein Auto zu waschen. Auch er sei einmal im Monat am Wochenende mit seinem Ford Fiesta in die Waschstraße gefahren, wo er sich in eine lange Schlange habe einreihen müssen. Wenn Pellegrini das richtig verstanden hatte, war sein Vater dort immer denselben Leuten begegnet, daher vermutete er, dass im Mittelpunkt des Rituals eher der soziale Austausch stand und nicht das saubere Auto.
»So ist es. Es gibt zwei Videoaufnahmen, die wir uns ansehen müssen. Aber auch da bin ich skeptisch, ob die uns weiterbringen. Die Überwachungskameras waren auf die Hauseinfahrten gerichtet, nicht auf die Straße.« Gruber stieß sich vom Geländer ab und klatschte in die Hände. »Wie du siehst, verpasst du nichts. Alles ziemlich übel, aber eher Routine. Es wird schwierig, den Motorradfahrer zu finden. Anschließend festzustellen, ob er eine Schuld, gar die Hauptschuld an dem Unfall trägt oder nicht, ist weniger herausfordernd. Selbst wenn er als Verursacher vor Gericht landet, ist sein Anteil am Geschehen für die KFZ-Versicherungen interessanter als für mich.«
»Ich verstehe schon. Und den Fahrer macht es nicht mehr lebendig. Hoffen wir, dass die Frau überlebt.«
»Sie liegt zurzeit im künstlichen Koma. Der Oberarzt auf der Intensivstation hat mir versprochen, dass er sich meldet, sobald sich etwas ändert. Und es wird selbstverständlich eine Obduktion des Toten geben, aber die hat Zeit bis Montag.«
Pellegrini brummte zustimmend. Er hatte schon wieder vergessen, dass Samstag war. Dank Emma spielten die Wochentage für ihn kaum noch eine Rolle. Er lud seinen Kollegen ein, noch mit zurück in die Bar zu kommen. Mit etwas Glück hatte die Espressomaschine ihren Dienst wieder aufgenommen. Doch Gruber verwies auf die Zeit und verabschiedete sich mit einem bedauernden Lächeln.
2
Als Pellegrini nach einer halben Stunde zurückkehrte,war es in der Bar ruhiger geworden. Seine Mutter war allein, abgesehen von zwei Stammgästen. Die beiden Rentner saßen mit einigen Rubbellosen und je einer Weißweinschorle an der Theke und unterhielten sich angeregt, während sie die Spielfelder mit Münzen freikratzten.
»Marco, da bist du ja! Du ahnst nicht, was passiert ist!«, rief Marta Pellegrini ihm entgegen.
»Vermutlich nicht. Dimmi!« Es musste etwas Dramatisches sein, denn ausnahmsweise kontrollierte sie nicht, ob Emma von der frischen Luft möglicherweise Schaden genommen hatte.
»Nicole Bruchsitter hat mich gerade angerufen. Erinnerst du dich an sie? Also vermutlich heißt sie gar nicht mehr Bruchsitter, da sie verheiratet ist, aber das ist gerade mal egal.«
»Die Bruchsitters aus Köln. Ich weiß noch, wer die sind«, meinte Pellegrini ruhig. Er brachte die friedlich schlummernde Emma wieder in der Babyschale unter. »Ein Ehepaar mit zwei Töchtern. Sie gehörten nach der Wiedereröffnung zu unseren ersten Gästen.«
»Genau! Nicole war eine junge Signorina von elf oder zwölf Jahren.« Sie hielt die Hand auf Höhe ihres Oberschenkels. »Ihre Schwester Caroline war sieben und so klein. Und beide mit langen blonden Zöpfen.«
»Daran erinnere ich mich nicht mehr.« Dagegen hatte er die fünfzehnjährige Nicole lebhaft vor Augen. Mit ihr hatte er, kaum ein Jahr älter, seine ersten Erfahrungen gesammelt. Sergio, der Pizzabäcker des Albergo, der ihm unter dem Siegel der Verschwiegenheit Kondome besorgt hatte, verpfiff ihn am Ende doch bei seinen Eltern. Noch besser als das entsetzlich ziellose Herumgefummel zweier Teenager und die Strafpredigt Amerigo Pellegrinis war ihm die heimliche Anerkennung seiner Mutter im Gedächtnis geblieben. Die hatte ihn dafür gelobt, an Verhütung gedacht zu haben, ganz im Gegensatz zu seinem Vater, als er das erste Mal mit ihr … und so weiter. Das waren Informationen, die ein Sechzehnjähriger über seine Eltern unter keinen Umständen erfahren möchte und die er ganz sicher niemals vergessen würde.
»Ihre Eltern sind verunglückt!«, riss die fassungslose Stimme seiner Mutter ihn aus seinen Erinnerungen. »Hier! Hans-Peter ist tot! Dagmar liegt im Ospedale Sant’Anna.« Sie brach ab und griff unbewusst nach dem kleinen Kettenanhänger, einem goldenen Kreuz, das sie um den Hals trug.
Pellegrini richtete sich auf und starrte sie an. Ihm kam ein ganz schrecklicher Gedanke. »Hier? Wo?«
»Praktisch vor dem Albergo, auf der Auffahrt nach Brunate! Sie wollten heute anreisen. Es heißt, Hans-Peter wäre mit dem Auto von der Straße abgekommen. Madonna mia.«
Wortlos nickte Pellegrini. Und während er Grubers Bericht zuvor distanziert und nüchtern hatte zuhören können, stiegen nun Bilder vor seinem inneren Auge auf, Unfälle, die er in all den Jahren gesehen hatte – ganz vorneweg der seines besten Freundes Luca Camerone, der ebenfalls eine Böschung hinabgestürzt war. Das war zwar am Luganer See gewesen, aber das machte keinen Unterschied. Die Straßen waren dort nicht anders, schmal und oft genug in schlechtem Zustand, die Hänge steil. Saniert wurden sie am ehesten dort, wo eine Etappe des Giro d’Italia an einem Ort vorbeiführte, oder wie gerade jetzt im Herbst vor der Lombardeirundfahrt. Und selbst das hatte den Radsportprofi Renco Evenepol vor wenigen Jahren bei Nesso nicht vor einem spektakulären Sturz von einer der zahllosen Brücken bewahrt.
»Stammgäste, die seit dreißig Jahren herkommen, und dann so was.« Sie murmelte etwas, rief vermutlich weitere Heilige an. »Ich erinnere mich gut daran, wie wir im letzten Jahr auf der Poolterrasse mit einem Glas Wein zusammengesessen haben. Sie haben sich so sehr auf den Ruhestand gefreut. Marco, jetzt sag doch was. Wie konnte das passieren?«
»Deswegen war der Kollege vorhin hier. Sie wissen noch nicht, warum Hans-Peter von der Fahrbahn abgekommen ist. Es scheint, dass da ein Motorradfahrer beteiligt war, aber der ist flüchtig.«
Jahrelang war Pellegrini beim Geruch von gegrilltem Fleisch übel geworden, da er ihn daran erinnerte, wie Lucas Lieferwagen in Flammen aufgegangen war. Eigentlich hatte sich das gelegt, doch jetzt wurde ihm beim Gedanken an ein Barbecue wieder mulmig. Wie gut, dass Herbst war und die Grillsaison beinahe vorbei.
»Madonnuzza!« Marta Pellegrini schlug rasch ein Kreuzzeichen. »Einer dieser Raser auf einem Motorrad. Jetzt wundere ich mich gar nicht mehr. Hans-Peter ist so ein umsichtiger Fahrer, dem wäre das niemals passiert! Erst im letzten Urlaub hat er mir erzählt, dass er vom ADAC eine Plakette bekommen hat, für fünfzig Jahre unfallfreies Fahren. Und die Bruchsitters kennen die Straßen hier in- und auswendig.«
»Aber auch sie fahren immer größere Autos. Tonio sprach von einer G-Klasse. Mal ehrlich, für den wäre ein Lkw-Führerschein angebracht.«
»Nicht Hans-Peter, nein, der ist immer gut gefahren.«
Pellegrini sagte nichts mehr. Seine Mutter konnte das wohl kaum beurteilen. Sie konnte höchstens mitbekommen haben, wie der deutsche Gast auf den Hotelparkplatz eingebogen war. Aber solche Diskussionen führten zu nichts.
»Ob ich Dagmar besuchen sollte?«, grübelte Marta Pellegrini laut. »Was wird denn aus den Töchtern? Die Familie war immer so angenehm, alle vier. Und was machen sie mit dem Betrieb? Hans-Peter hat doch noch gearbeitet. Ob er viele Angestellte hat? Ich weiß es gar nicht.«
Und es ging sie auch eigentlich nichts an, fand Pellegrini. Er begab sich hinter die Theke und stellte erleichtert fest, dass einem weiteren caffè nichts im Wege stand. »Die beiden Töchter sind so erwachsen wie ich. Das ist alles nicht einfach, aber sie werden zurechtkommen.«
»Ja, das stimmt natürlich. In meinem Kopf sehe ich sie immer noch als Kinder vor mir.«
»Dagmar Bruchsitter liegt auf der Intensivstation und ist derzeit nicht ansprechbar. Sollte sich daran etwas ändern und ich davon erfahren, gebe ich dir sofort Bescheid. Allerdings hat Tonio anderes zu tun.«
»Va bene. Ich muss zurück ins Hotel. Was wird denn Amerigo sagen? Er mochte Hans-Peter sehr, der war auch ein begeisterter Hobbykoch. Er war der einzige Gast, dem Amerigo sogar ein paar seiner Küchentricks verraten hatte.« Sie sprach leiser vor sich hin und hatte die Tür bereits geöffnet, als ihr noch etwas einfiel. »Marco!«
»Ja?«
»War Don Amissah heute Morgen eigentlich hier? Ich habe ihn getroffen, da war er auf dem Weg runter nach Como.«
Pellegrini wurde misstrauisch. »Ja, er war da.«
»Habt ihr über Emmas Taufe gesprochen?«
»Das schon wieder«, murmelte er.
»Was meinst du?«, rief seine Mutter und schloss noch einmal die Tür.
Die beiden Rentner an der Theke hoben neugierig die Köpfe und versuchten gleichzeitig, sich uninteressiert zu geben.
»Nichts«, erklärte er lauter. »Nein, haben wir nicht.« Bei sich dachte er, dass es gar kein Wunder war, wenn in der Nachbarschaft immer alle alles wussten, so wie Marta Pellegrini private Angelegenheiten herumposaunte. Er kannte die beiden alten Männer nur vom Sehen, war aber sicher, dass sein Nonno Carlo mit ihnen Boccia spielte, sie also genau wussten, um wen es hier ging. Jetzt taten sie so, als widmeten sie sich immer noch ihren Rubbellosen, aber das hieß ja nicht, dass sie nicht weiterhin zuhörten. Also musste Pellegrini sich hüten, seine Mutter in allzu scharfen Worten in die Schranken zu weisen.
Sie machte kehrt, stützte sich auf den Marmortresen und beugte sich vertraulich näher, ohne sich vom mörderischen Blick ihres Sohnes aus der Ruhe bringen zu lassen. »Marco, das muss doch geklärt werden!«