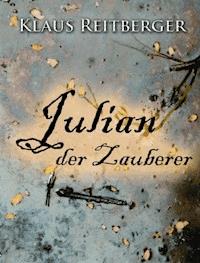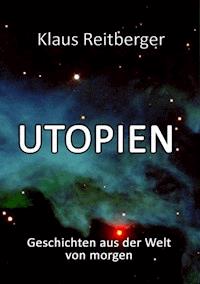
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Niemand kann uns sagen, wie die Zukunft aussieht. Denn die Welt ist im Wandel und dieser Wandel ist unberechenbar. Jeder Tag kann eine neue Entdeckung mit sich bringen, welche die Welt, wie wir sie kennen, von Grund auf zu verändern vermag. Doch man darf raten, darf mit fragendem Auge in die Zukunft schauen und versuchen zu erkennen, wie es dort wohl sein mag. In diesem Buch wagt der Autor einen riskanten Blick in die Welt von morgen. Was er dort sieht, schildert er in kurzen Erzählungen, hautnah am Leben der Menschen künftiger Zeiten. Begleiten Sie ihn auf eine weite Reise durch Raum und Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 427
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Imprint:
Utopien: Geschichten aus der Welt von morgenKlaus Reitbergerwww.klausreitberger.wordpress.com
published at epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Copyright 2011 Klaus ReitbergerISBN 978-3-8442-0969-3 Titelseite: Orionnebel – Sloan Digital Sky Survey (SDSS) Collaboration,http://www.sdss.org
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Prolog.
Utopie I: Das Ende der Arbeit
Utopie II:Das Ende der Realität
Utopie III: Das Ende der Familie.
Utopie IV: Das Ende der Gefangenschaft
Utopie V: Das Ende der Natur
Utopie VI: Das Ende der Religion.
Utopie VII: Das Ende des Todes.
Utopie VIII: Das Ende der Menschheit
Utopie IX: Das Ende der Einsamkeit
Utopie X:Das Ende.
Epilog.
Nachwort
Widmung
Für die Schönheit der Sterne
Und die Schiffe von morgen
Für die Stimmen im Wind
Und die Lieder im Regen
Vorwort
Die Utopie ist eine ungeheure Kraft, aber niemand sieht sie. Sie ist geschichtlich, weil sie geschichtsbildend ist.Jean Ziegler
Wissen Sie, was kommen wird? Was wird sein in hundert Jahren, was in tausend oder mehr? Können wir überhaupt eine Vorstellung haben von all den Veränderungen, die uns erwarten? Wenn jemand aus der Zukunft zu uns käme und uns von ihr erzählte, würden wir ihm glauben?
Hätte man denn jemandem geglaubt, der im Jahre 1869 auf den Marktplätzen Europas verkündet hätte, die Menschen stünden nur hundert Jahre später auf dem Mond? Fast alle hätten dieses Hirngespinst verworfen, hätten seinen Verkünder als verrückt bezeichnet. Wohl auch Sie. Wohl auch ich.
Noch nie veränderte sich das Leben so schnell wie heute. Alles ist im Fluss. Alles ist im Wandel. Eine neue Erfindung veraltet binnen weniger Jahre. Doch nicht nur unsere Umwelt, sondern auch die Menschen selbst sind diesem Wandel unterworfen. Es verändern sich unsere Gewohnheiten. Es verändert sich unser Umgang miteinander. Es verändert sich unser Glaube. Es verändert sich unsere Moral. Nichts bleibt. Alles fließt.
Doch wohin fließen wir? Lohnt es sich denn, diese Frage zu stellen? Soll man überhaupt darüber nachdenken? Ich denke, dass es sich immer lohnt Fragen zu stellen, so fern und unerreichbar die Antwort auch ist. Man muss seine Gedanken kreisen lassen über das unbekannte Land von morgen. Zuerst wird man nicht viel sehen, doch dann kann man vielleicht die eine oder andere Kontur erkennen. Daraus konstruiert sich eine Zukunft. Daraus erwächst eine Utopie.
Das Wort Utopie stammt aus dem Griechischen. Es bedeutet in wörtlicher Übersetzung „kein Ort“ und von keinen Orten möchte ich berichten. Ich erzähle Geschichten aus Welten, die nirgendwo sind und niemals irgendwo waren. Ob sie sein könnten, das ist die Frage, die ich mich dem Leser zu stellen getraue.
Utopie heißt auch Wunschtraum, Hirngespinst und Schwärmerei. Es trifft nicht zu, dass ich mir alle Träume wünsche, die ich in diesem Buch skizziere. Vor manchen graut es mir. Ein Hirngespinst kann auch ein Albtraum sein. Manch Schwärmerei führt zum Verhängnis.
Doch bei all dem ist es schön zu träumen.
Ich habe nicht den Anspruch objektiv zu sein. Meine Geschichten sind zutiefst subjektiv. Es sind meine Utopien, meine Gedanken, meine Landschaften, die ich sehe, wenn ich vom Berg der Gegenwart hinab über die weiten Ebenen der Zukunft blicke. Ich sehe sie mit meinen Augen. Andere mögen Anderes sehen.
Der Unterschied zwischen Prognose und Utopie besteht darin, dass erstere einen Anspruch auf Gültigkeit erhebt, während sich die andere damit begnügt ein Traum zu sein. Doch auch Träume verändern die Welt. Träume beherrschen vielleicht sogar die Welt.
Ich arbeite weder mit Kristallkugeln noch Taschenrechnern, bin kein Prophet und auch kein Wissenschaftler. Ich bin Geschichtenerzähler und mein Werkzeug ist die Fantasie. Die Geschichten, die ich erzähle, handeln von jenen Dingen, die vielleicht sein werden, die vielleicht einst möglich sind. Die Zukunft ist das schönste aller Rätsel. Kein Geheimnis ist so unlösbar wie sie. Kein stiller Teich ist tiefer.
Vieles was ich schreibe, mag dem Leser bizarr erscheinen, mag schockieren und vielleicht sogar erschrecken. Ich schreibe nur das, was ich sehen kann, wenn ich am wandernden Zaun der Gegenwart stehe und auf die verbotene Seite blicke. Diese Dinge sehe ich. Von diesen Dingen schreibe ich.
Oft werde ich zu euphorisch sein, manches Mal zu pessimistisch, zu speziell, zu allgemein, zu fordernd, faselnd, zu polemisch, hin und wieder gar (man möge es mir verzeihen) politisch – doch was heißt nicht politisch sein denn anderes, als zu eben jenen Fragen schweigen, die uns von allen am meisten betreffen? Und wenn ich dazu schweige, dann kann ich auch gleich still bleiben.
In den Geschichten, die dieses Buch enthält, betrachte ich zehn verschiedene Utopien, zehn verschiedene Veränderungen, Wendungen, bahnbrechende Umschwünge, die allesamt das Potential haben, die Welt, wie wir sie heute kennen, von Grund auf umzugestalten zu etwas Neuem.
Einer Sache bin ich mir fast sicher: Die wahre Zukunft wird keiner dieser zehn Utopien entsprechen. Viel wahrscheinlicher ist, dass sie eine Mischung aus allen oder mehreren meiner Träume in abgeschwächter Form sein wird, dass einiges noch hinzu kommt, an das ich gar nicht gedacht habe, was ich mir nicht einmal vorstellen konnte. Einiges von dem, was ich sehe, mag auch nur ein Irrlicht sein.
In meinen Geschichten wird eine Veränderung immer recht isoliert betrachtet. Die eine Utopie spielt in der anderen keine Rolle. Erst dies macht es möglich darüber zu schreiben. Die wahre Welt ist natürlich viel komplexer, komplexer noch als alle Welten, die je von einem Erzähler geschaffen wurden. So muss man also selektieren, muss unter vielen Träumen, die alle zusammen geträumt werden, die einzelnen Glieder heraus trennen und für sich alleine betrachten. Nur so erkennt man alle Folgen, alle Konsequenzen und Implikationen, die ein solcher Traum, eine solche Utopie mit sich bringt. Da jede einzelne meiner Utopien an sich schon sehr facettenreich ist, betrachte ich sie stets in vier kurzen Geschichten, aus vier unterschiedlichen Blickwinkeln heraus.
Wann genau meine Geschichten sich ereignen, lasse ich offen. Mag es in vierzig Jahren soweit sein, in vierhundert oder noch viel später - ich weiß es selber nicht. Wenn ich in die Zukunft blicke, dann scheint es mir, dass manche Dinge kommen werden. Wann und in welcher Abfolge vermag ich nicht zu sagen. Da alles irgendwann enden muss, ist eine jede meiner Utopien auch die Geschichte eines Endes. Daher rühren auch die Namen, welche ich den einzelnen Kapiteln dieses Buches gebe. Wenn es eines gibt, worüber ich mir im Klaren bin, eines, das ich mich wirklich ohne Zweifel zu sagen getraue, dann ist es, dass auch die Menschen eines Tages vergehen werden, eines Tages nicht mehr sind. Denn eine jede Geschichte hat ein Ende.
Es gibt heute viele Menschen, meist sehr jung an Jahren, die davon ausgehen, dass ihr Leben sich in einem mehr oder weniger konstanten Umfeld abspielen wird. Sie glauben, dass die Dinge bleiben werden, wie sie sind, dass die Erde gemächlich ihre Runden dreht und auf ihr gemächlich der Mensch sein Leben lebt. Was soll schon groß passieren? Welche Innovation hat schon die Macht von Grund auf etwas zu verändern? Wer so denkt, der kennt den Menschen schlecht. Der Mensch versteht nicht viel von Stillstand. Der Mensch strebt, solange er lebt. Man kann nie wissen, ob eben in dieser Sekunde irgendwo auf dieser Erde ein verhängnisvoller Gedanke gedacht wird, welcher in seinen Konsequenzen, seien diese gut oder nicht, alles, was wir kennen, von Grund auf verändern wird. Vielleicht gestern. Vielleicht morgen. Irgendein Geistesblitz, eine Begegnung, eine Beobachtung, eine Erfindung, auch der Zufall, all dies kann die Kraft haben alle – auch uns – zu verändern.
Eben dies möchte ich mit meinen Utopien zeigen. Nichts ist selbstverständlich. Jeder Stein wird irgendwann vom Wasser weggespült. Niemals werden die Würfel gefallen sein, denn liegen sie auch tausend Jahre still, kann stets ein frischer Wind aufkommen und sie erneut ins Rollen bringen. In vierzig Geschichten möchte ich durch die Zukunft führen. Zehn Träume werde ich träumen. Durch zehn Hirngespinste werde ich wandern. Bizarres, Schönes und Schreckliches gibt es dort zu sehen. Kommen Sie mit auf eine Reise ohne Wiederkehr an einen Ort, den es nicht gibt. Bereisen wir die Utopie. Besuchen wir die Zukunft.
Prolog
Es geschah auf dem dritten Planeten eines mittelgroßen Sternes am Rande der Milchstraße. Vor vielen tausend Jahren sträubte sich dort ein sonderbares Wesen die Dinge als selbstverständlich hinzunehmen und begann sich Fragen zu stellen. Woher kommt es, dass auf die Nacht immer wieder der Tag folgt? Hat die Welt Grenzen? Was ist das Kleinste vom Kleinen und das Größte vom Größten? Warum muss man sterben? Und: Kann man dies nicht verhindern?
Der erste, der von diesen Rätseln heimgesucht wurde, hatte es nicht leicht. Seine Artgenossen drängten ihn die seltsamen Gedanken ruhen zu lassen und ihnen bei der Jagd zur Hand zu gehen. Nichts Gutes würde von solch neuen Ideen kommen. Doch jener erste – nennen wir ihn Rätselfreund – ließ sich nicht aufhalten. Niemand kann die Zukunft aufhalten.
In seinem kurzen Leben gelang es Rätselfreund einige Fragen zu beantworten. Der Preis dafür war Einsamkeit, doch die nahm er in Kauf, kannte er doch weit süßere Früchte als jene der Geselligkeit. Es war weniger das Nachdenken, das ihn auf die Lösung mancher Rätsel brachte. Vielmehr war es das Hinsehen. Rätselfreund wollte wissen, ob die Welt wirklich nur, wie seine Artgenossen behaupteten, bis zu den fernen Bergen am Horizont reichte. Also ging er hin und sah nach. Er bestieg die felsigen Höhen, erreichte einen Gipfel und blickte plötzlich über ein weites grünes Land, dessen Grenzen nicht erkennbar waren.
In vielen langen Nächten betrachtete Rätselfreund die Sterne. Er fragte sich, was wohl das weiße Band sei, welches hinter den Sternen zu liegen scheint und quer über den Himmel verläuft. Diese Frage konnte er nicht beantworten. Wohl aber erkannte er, dass es unter den Sternen einige gab, die sich nicht mit den anderen bewegten sondern auf sonderbaren Wegen wandelten. Rätselfreund stellte schließlich fest, dass jene Wandelsterne sich in eben jener Bahn aufhalten, die auch von Sonne und Mond durchlaufen wird. Obwohl er es noch nicht verstand, hatte Rätselfreund damit als erster die Ebene seines Sonnensystems im Sternenmeer erkannt.
Auch das Feuer beschäftigte ihn, war es doch das kostbarste Gut seiner Welt. Man findet es in Stürmen, wenn der Himmel seine Speere auf die Erde wirft. Holz hält es am Leben. Rätselfreund war vom Feuer fasziniert. Er nährte es mit allen Dingen, welche die Natur ihm darbot und versuchte herauszufinden, welche Stoffe brennbar sind und welche nicht. Eines Tages, als er über einer großen Flamme die Funken fliegen sah, da dämmerte ihm plötzlich eine wundersame Erkenntnis. Schon einmal hatte er solche Funken gesehen. Nicht im Feuer sondern an Steinen. Bald hatte Rätselfreund entdeckt, wie man mit Feuersteinen tun kann, wozu sonst nur Blitze in der Lage sind. Er konnte Feuer machen. Es war dies seine größte Entdeckung. Allen Mahnungen seiner Artgenossen zum Trotz, entstand somit aus seinen sonderbaren Gedanken doch noch etwas Gutes, etwas Nützliches, etwas, das das Leben, wie man es kannte, zu verändern vermochte.
Rätselfreund eilte um seinen Brüdern und Schwestern vom Geheimnis des Feuers zu erzählen, doch leider brach er sich auf dem Weg den Knöchel und verhungerte kläglich. Die Tiere verzehrten seinen Körper. Sämtliche Erkenntnisse, die er im Laufe seines Lebens gewonnen hatte, gingen mit Rätselfreunds Tod verloren. Er hatte es nicht vermocht seine Gedanken weiterzugeben. Nichts davon blieb.
Doch andere kamen. Viele von Rätselfreunds Artgenossen, welche ihn nie gekannt hatten, stellten sich dieselben Fragen. Auch sie fanden Antworten. Vor ihrem Tod gaben sie ihre Erkenntnisse weiter. Oft gingen diese wieder verloren, andere veränderten sich mit den Jahren ihrer Überlieferung. Dann jedoch erfanden jene sonderbaren Wesen etwas Wunderbares, etwas, womit Gedanken die Zeit überdauern konnten – die Schrift. Erst durch die Schrift wurde es möglich, dass Gleichgesinnte oft viele Jahre später auf Gedanken aufbauen konnten, die lange zuvor zum ersten Mal formuliert wurden. Man musste nicht mehr immer wieder von vorne anfangen und lernte auf den Schultern der Vergangenheit zu stehen. Aus vereinzelten Funken war ein Feuer geworden. Man sah sich um, blickte in die Welt hinaus und fand Antworten. Und diese Antworten veränderten die Welt stärker, als man es je für möglich gehalten hätte.
Die Zeit schritt voran und erreichte das Heute. Viele Fragen sind inzwischen beantwortet. Einige der größten und ältesten Rätsel sind gelöst. Der Mensch – so nennt sich jenes sonderbare Wesen am dritten Planeten eines entlegenen Sternes am Rande der Milchstraße – konnte in nur wenigen Jahrtausenden durch die räumliche und zeitliche Zusammenarbeit vieler großer Geister Erstaunliches hervorbringen und sich umfangreiches Wissen aneignen. Er hat erkannt, dass er auf einem 12740 km dicken Gesteinsbrocken lebt, welcher einmal jährlich einen durch Kernfusion geheizten Gasball umkreist. Dieser Gasball – die Sonne – umkreist alle 250 Millionen Jahre die Milchstraße, eine einhundert tausend Lichtjahre dicke Scheibe aus hundert Milliarden Sternen, aus interstellarem Gas und gewaltigen Staubwolken. Dies ist nur eine Galaxie, wie es ihrer viele gibt – unvorstellbar viele. Der Mensch hat erkannt, dass das Universum in seiner Gesamtheit etwa vierzehn Milliarden Jahre alt ist und sich stetig weiter ausdehnt. Er weiß inzwischen, was das Kleinste vom Kleinen ist. Mit modernen Maschinen blickt er in die Welt von Atomen und Molekülen, von Protonen und Elektronen, von Leptonen und Quarks. Es gelang dem Menschen sogar das Leben zu verstehen. Er weiß um das dynamische, ständig konkurrierende Wechselspiel der Gene. Alles, was ein Mensch ist, die Struktur seines Körpers, liegt gespeichert in der Doppelhelix seiner DNA, die in jeder seiner Zellen steckt. Der Mensch kennt auch den Prozess der Evolution, die alles Leben und letztlich auch ihn selbst hervorgebracht hat, ganz ohne Götter und fremde Kräfte. Auch sein eigenes Denken hat er immer besser verstehen gelernt.
Der Mensch weiß viel. Doch alles weiß er nicht. Es gibt noch immer viele Rätsel, die bisher noch ungelöst sind, viele offene Fragen. Wird er sie je lösen können? Wenn ja, dann werden die Antworten sicherlich alles verändern, sowie alte Antworten bereits alles verändert haben.
Kann man den Tod besiegen? Ist der Mensch allein im All? Wird er je in der Lage sein zu anderen Sternen zu reisen? Kann eine künstliche Intelligenz in der Lage sein zu empfinden wie der Mensch? Rätselfreunde haben viel zu tun.
Der Mensch steht heute vor einer Vielzahl von Problemen und Fragen. Auch ob er weiterhin in der Lage sein wird Antworten zu finden, oder ob er zuvor zu Grunde geht, ist eine dieser Fragen. Mutig und ängstlich, fordernd und scheu blickt das sonderbare Wesen Mensch in eine ungewisse Zukunft. Niemand weiß, was sein wird, doch alle arbeiten daran. Hastig folgt man dem Pfad durch das Hügelland der Zukunft. Was wird den Wanderer hinter der nächsten Biegung erwarten? Der Mensch ist durch die Vergangenheit gezogen und hat das Heute erreicht. Nun blickt er in die Zukunft, in welcher alles endlich ist.
Utopie I: Das Ende der Arbeit
Arbeit, die ewige Last, ohne die alle übrigen Lasten unerträglich würden.Klaus Mann
So ist verflucht der Ackerboden deinetwegen. Unter Mühsal wirst du von ihm essen alle Tage deines Lebens. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Ackerboden;Genesis
I
Adam lebt um zu leben. Alles was er braucht und je brauchen wird, ist ihm schon in die Wiege gelegt worden. Wie viele ist er dazu auserkoren nichts zu tun – sein ganzes Leben lang. Er ist frei. Die Welt steht ihm offen. Er kann gehen, wohin er will und sich die Zeit vertreiben, womit er möchte. Doch er braucht nichts zu tun – denn alles wird für ihn getan.
Wenn Adam am Morgen erwacht, dann hat er nur wenige Gründe aufzustehen. Trotzdem tut er es. Er murmelt seinen Frühstückswunsch und schon nach wenigen Minuten stehen Orangensaft, frisches warmes Weißbrot und ein 3-Minuten-Ei für ihn bereit. In der Dusche hat Adam das Bedürfnis nach Musik. Er wünscht sich ein Lied und schon bald kann man in allen Zimmern seiner Wohnung die Beatles hören. Manche Texte alter Lieder haben längst ihren Sinn verloren. Manche nicht.
Adam ist Herr seiner Räumlichkeiten. Seine Sprache ist voller Zaubersprüche. Fast jede Speise kann er sich wünschen und bald darauf wird sie serviert. Bei manchen dauert es freilich länger, da die Zutaten nicht in den Wänden lagernd sind. Aber inzwischen sind die Einheiten in den Zubringerkanälen glücklicherweise so schnell geworden, dass man den Unterschied kaum noch merkt. Doch Adams Macht reicht weit über seine Ernährung hinaus. Alle Lieder kann er sich wünschen, fast alle Filme, die je gedreht worden sind. Möchte er einen bestimmten Duft in seiner Nase haben, so ist das Zimmer bald davon erfüllt. Er muss es nur sagen.
Während er sein Frühstück einnimmt, erscheinen an einer Wand die Neuigkeiten der Stunde. Viel Neues ist aber nicht dabei. Auf der anderen Seite der Welt hat es gerade einen Unfall gegeben. Zwei Vehikel sind miteinander kollidiert. Kein Wunder, denn die Fahrzeuge werden dort noch von Menschen gesteuert. Es gibt auch Gutes zu berichten. In Adams Heimatstadt geht eine neue Einheitenfabrik in Betrieb. Sie wird gewährleisten, dass es künftig keinen Engpass bei der Wartung und dem Austausch alter Einheiten mehr gibt. Bis auf einen im Grunde überflüssigen Kontrolleur, der alle paar Wochen einmal durch die Fabrikshallen geht, gibt es dort sonst keine einzige menschliche Arbeitskraft. Zum Schluss erscheinen noch ein paar allgemeine Fakten. Die Bevölkerungszahlen sinken weiter. Der Wohlstand und die Selbstmordrate steigen gemächlich an.
Nach seinem Morgenmahl geht Adam nochmals ins Bad und betrachtet sich im Spiegel. Was er sieht, gefällt ihm nicht. Er setzt sich in einen Stuhl und lässt sich an der Wand zeigen, wie er mit verschiedenen alternativen Haarstilen aussehen würde. Nachdem er eine Wahl getroffen hat, wird sein Kopf von einer Einheit erfasst und sanft mit der gewünschten Haartracht versehen. Das Ergebnis ist sehr zufriedenstellend.
Adam kleidet sich an und verlässt seine Wohnung. Rasch bringt ihn der Fahrstuhl nach unten. Im Erdgeschoss riecht es heute nach Vanille. Irgendeine klassische Melodie liegt in der Luft. Draußen vor der Tür singen Vögel. Es sind sogar echte. Man kann sie in den Bäumen sehen, wo sie geschäftig ihre Nester bauen. Der Himmel ist blau und es ist Frühling. Ohne Hast wandert Adam durch die menschenleeren Straßen. Sein Ziel ist der Stadtpark. Ein Wort würde genügen und eine Transporteinheit brächte ihn in wenigen Sekunden dorthin. Doch wozu die Eile? Entlang seines Weges flitzen einige Fahrzeuge an Adam vorbei. Obwohl er mitten auf der Straße geht, wird er von keinem erfasst. Es fällt sehr schwer sich vorzustellen, wie die Welt war, als Fahrzeuge noch von Menschen gesteuert wurden. Musste man damals nicht ständig Angst haben?
Adams Gedanken kreisen und versuchen sich die Vergangenheit vorzustellen. Es muss eine Zeit gewesen sein, in der es viel gab, wovor man sich fürchten konnte. Vor zwei Jahren hat sein Badezimmer ihm eines Morgens gesagt, dass sich Adams Blinddarm binnen Stunden entzünden würde. Eine Operationseinheit kam und löste das Problem rasch. Allein die Vorstellung, ein menschlicher Arzt würde an ihm herum schnipseln, jagt Adam schon kalte Schauer über den Rücken. Den Einheiten kann er vertrauen. Den Menschen nicht.
Nach einem kurzen Spaziergang erreicht Adam den Park. Dort sieht er zum ersten Mal an diesem Tag andere Menschen. Viele kommen hierher und beginnen den Tag inmitten der von vielen Einheiten gepflegten Grünflächen. Man füttert Tauben und Eichhörnchen und erfreut sich an den Farben der vielen Blüten.
Adam ist fast jeden Tag hier. Früher war das anders. Noch vor zehn Jahren sah sein Leben viel unruhiger aus. Er hatte damals das Bedürfnis alles auszuprobieren. Sämtliche Extremsportarten hat er gekostet. Er ist gereist von einem Ort zum andern, hat dies und das versucht. Ihm schien es damals, als sei er auf der Suche nach etwas, als müsse er etwas finden, dem er sein Leben widmen konnte. Doch er fand nichts. Jede selbstauferlegte Aufgabe verlor mit der Zeit ihren Reiz. Überall sah es gleich aus. Schließlich beruhigte sich Adams Leben und er lernte den stillen Müßiggang zu genießen. Nicht alle können das.
Die warme Vormittagssonne steht schon hoch, als er Helena erblickt. Sie sitzt auf einer Bank unter einer Linde und hat wie immer ein Buch in Händen, ein echtes physisches Buch aus Papier und Karton. Es gibt nur mehr wenige, die es vorzogen heute noch auf diese Art und Weise zu lesen, da es doch so viel schnellere und effizientere Wege gab. Doch Helena ist immer eine von wenigen gewesen, egal ob es sich um Bücher handelt oder um etwas Anderes. Erst als er sich bis auf zwei Schritte genähert hat, wird sie auf Adam aufmerksam und begrüßt ihn freundlich. Man kennt sich gut, hat sogar eine Zeit lang gemeinsam gelebt, bis unterschiedliche Interessen die beiden Leben wieder auseinander trieben. Helena scheint froh zu sein ihr Buch kurz weglegen zu können. Sie lädt Adam ein sich neben sie zu setzen.
Ohne zu reden verharrt man eine halbe Minute. Man genießt die bloße Nähe und ist dankbar dafür, dass einstige Vertrautheit und tiefe Kenntnis des anderen das Äußern von Höflichkeitsfloskeln unnötig machen. Man versteht sich. Trotzdem rechnet Adam nicht mit dem, was Helena ihm nun anvertrauen wird.
„Was liest du denn gerade?“, fragt er.
Lesen ist Helenas Leidenschaft. Sie liebt Geschichten. Während Adam in seiner Jugend gereist und körperlich an seine Grenzen gegangen ist, hat sie pausenlos gelesen. Auch jetzt noch. Sie liest ihr Leben lang. Dies ist auch ein Grund gewesen, warum eine Beziehung zwischen ihnen auf Dauer nicht halten konnte. Helena schien oft fern zu sein und durch ihre Bücher mehr in anderen Welten zu leben, als in dieser. Adam hat sich für Literatur nie besonders interessiert. Hin und wieder gönnt er sich einen guten, spannenden Film aus dem Action- oder Horrorgenre. Doch lesen ist ihm zu anstrengend.
„Ich lese ein Buch von Charles Dickens. Es heißt David Copperfield. Das wird dir nichts sagen.“
„Nein, nicht wirklich. Und wie ist es?“
„Üppig. Man sieht wie voll und reich ein Leben sein kann, trotz vielen Elends. Und man sieht, wie leer unser Leben im Gegensatz dazu ist.“
Sie blickt ihm tief in die Augen und Adam erkennt, dass es weder Sarkasmus noch Humor ist, der ihre Worte formt, sondern tiefer, wahrer Kummer. Er will sie aufheitern, doch er weiß nicht wie.
„Ach, komm. Alles scheint anders, als es ist. Ich wette, hättest du damals gelebt, du hättest dir nichts sehnlicher gewünscht als in der Welt von heute zu leben.“
Sie antwortet nicht, sondern sieht ihn nur stumm und traurig an. Während er sprach, hat ihr Adam seine Hand auf das Knie gelegt. Nun legt sie ihre Hand auf die seine. Ihr Gesicht ist ganz nah und er spürt, wie ihr Blick zwischen seinen beiden Augen unruhig hin und her wechselt. Zittert ihre Hand? So hat Adam sie noch nie erlebt. Ist es die Sehnsucht nach dem, was zwischen ihnen war, welche sie plötzlich so unruhig macht?
„Du weißt“, sagt er „solltest du mich brauchen, ich bin für dich da. Du kannst jederzeit vorbeikommen.“
Immer noch schweigt sie.
„Wollen wir gemeinsam ein Eis essen gehen?“
Immer noch schweigend gibt sie seine Hand wieder frei, wendet sich ab und greift nach ihrem Buch.
„Nun sag mir doch, was los ist, Helena.“
Endlich spricht sie. Ein trauriges Lächeln ziert ihr Gesicht.
„Danke. Kein Eis. Ich muss diese Geschichte noch zu Ende lesen, weißt du? Es die letzte, die ich lesen werde.“
„Wieso? Steigst du dann auf Filme um?“ Adam hat gesprochen, noch bevor er gedacht hat. Nun erst dämmert ihm, was sie sagen möchte.
„Dein letzten Buch?“
„Ja. Meine Entscheidung steht fest. Versuch also nicht mich umzustimmen. Morgen Abend gehe ich zur Grünbaumgasse“
Adam erhebt sich und blickt in die Ferne. Plötzlich packt ihn der Ekel. Er weiß, dass es heutzutage viele gibt, die am Leben scheitern und in die Grünbaumgasse gehen, doch von Helena hätte er dies nie gedacht. Wie kann sie, die einst so lebensfroh gewesen ist, nun einfach aufgeben? Die Grünbaumgasse – wenn es ein Tabuwort in der heutigen Gesellschaft gibt, dann dieses. Ein jeder kennt es, doch niemand spricht davon. Ein jeder weiß, dass es ein Problem mit der Selbstmordrate gibt, doch es schickt sich nicht darüber zu reden. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, wurde vor Jahren ein spezieller Ort eingerichtet, wohin man gehen kann, wenn man diese seltsame, doch nicht mehr seltene Entscheidung getroffen hat – die Grünbaumgasse.
Ob es Ekel ist oder Angst, Adam hält es plötzlich nicht mehr neben Helena aus. In schnellen Schritten und ohne sich umzudrehen sucht er das Weite. Er hört sie rufen, dass es ihr leid tue. Doch er will sie nicht rufen hören. Er will gar nichts mehr hören. Vielleicht ist es nicht sosehr der Ekel, der ihn forttreibt, sondern vielmehr die Angst, sie könnte ihn auf ähnliche Gedanken bringen. Er will sie nicht fragen, warum sie es tut. Was, wenn er selbst keine Argumente mehr findet? Was, wenn ihre Antworten auch zu seinen Antworten werden? Nein. Am anderen Ende des Parks lässt Adam sich von einer Einheit ein Eis reichen und versucht diese furchtbare Begegnung so schnell wie möglich zu vergessen.
Doch es gelingt nicht. Immer wieder kehren seine Gedanken zu Helena zurück, die ihn mit großen, traurigen Augen anstarrt. Was, wenn sie recht hat? Immer schon ist sie die Klügere gewesen. Aber warum sich umbringen? Leben sie nicht beide im Paradies? Alles ist da. Man muss es sich nur wünschen. Natürlich ist es nicht leicht, damit fertig zu werden, dass man nur lebt um zu leben, dass es kaum Aufgaben, kaum wirkliche Lebensinhalte mehr gibt. Doch warum kann man sich denn nicht einfach zurück lehnen und genießen?
An diesem Nachmittag versucht Adam eben dies zu tun. Nach einem guten Mahl lässt er sich in seiner Wohnung auf das Sofa fallen, wünscht sich einen guten alten Film und versucht zu genießen. Doch sie lässt ihn nicht. Immer wieder blicken ihn Helenas Augen an. Ihre Worte hallen noch immer in seinen Ohren. Sie sprach von morgen Abend. Noch lebt sie, noch atmet sie, doch bald schon nicht mehr. Ein furchtbarer Gedanke.
Der Film zieht unbemerkt an Adams Augen vorbei. Es gelingt ihm nicht, ihn wirklich wahrzunehmen. Anstatt an Helena denkt er nun an sein eigenes Leben, denkt daran, dass niemand ihn vermissen würde, wenn dieser Tag auch sein letzter wäre. Was hat er denn erreicht? Nichts. Es gibt nichts zu erreichen. Es gibt nichts mehr, wofür man kämpfen könnte.
Adam weiß, dass solche Gedanken Gift sind. Als der Abend kommt, lässt er sich wie manches Mal eine Schlaftablette reichen und versinkt schon bald in traumloser Stille. Die letzten Gedanken des Tages gelten seinem Leben. Keine Bürden. Keine Lasten. Keine Arbeit. Alle Wünsche gehen in Erfüllung. Adam ist im Paradies. Es geht ihm besser, als allen Menschen, die jemals zuvor gelebt haben. Es ist das Paradies. Doch wieso wird man dort nicht froh?
II
Mit langsamen Schritten durchquert Samantha Chatman die großen, grauen Produktionshallen. Was sie sieht, gefällt ihr. Arbeit wird verrichtet. Waren werden geschaffen. Alles funktioniert – ein jedes Teil, ein jedes Glied, eine jede Einheit. Im Grunde ist die ganze Fabrik in ihren riesigen Ausmaßen nichts anderes als eine einzige große Einheit, in welcher alles seinen Zweck erfüllt, alles Förderliche maximiert, alles Störende minimiert wird. Funktion. Effizienz. Schön.
Nur eine Sache ist hier überflüssig und diese Sache ist sie selbst. Es gibt keinen Grund für Samantha hier zu sein. Dennoch ist sie hier. Es gefällt ihr dabei zuzusehen, wie alles seine Wege geht. Ohne menschliches Zutun, wie in einem großen Uhrwerk werden ständig neue Einheiten erzeugt. Und dies geschieht in einer großen Vielfalt von Formen und Funktionen. Die Fabrik ist frei von Makeln. Keine Menschen, keine Arbeiter, kein Schweiß. Keine Emotionen, keine Müdigkeit, keine Fehler. Keine Ärgernisse, keine Pausen, keine Probleme.
In der Vergangenheit war es anders. Samantha weiß das. Wie alle hat sie die Geschichte der Welt im Kopf und wie manche kann sie damit auch etwas anfangen. Sie hat die Bilder gesehen. Sie weiß, wie es gewesen ist. Damals musste der Mensch arbeiten oder sterben. Fabrikshallen voll schmutziger Menschen. Emotionen. Fehler. Ineffizienz. Das ist vorbei.
Es ist noch Zeit. Samantha muss erst um zehn Uhr bei der Konferenz sein. Tief in Gedanken lehnt sie sich an ein metallenes Geländer und sieht zu, wie unter ihr ein Dutzend kleiner Einheiten in eifriger Geschäftigkeit an einer großen Kraneinheit arbeitet. In Windeseile werden die Teile aneinandergefügt.
Während sie zusieht, denkt Samantha an die Geschichte der letzten Jahrhunderte und lächelt dabei. Sie glaubt alles durchschaut zu haben und zu verstehen. Wenn es ein globales Problem gab, das die Menschheit zu Beginn des neuen Jahrtausends geißelte, so war dies die Arbeitslosigkeit. Sie zerrüttete und zerstörte die Gesellschaft, sowohl in erster, wie auch dritter Welt. Doch obwohl das zunehmende Schwinden von entlohnter Beschäftigung damals in aller Munde war, gab es nur wenige, die sich der wahren Tragweite dessen bewusst waren. Immerzu sprachen Obrigkeiten aller Welt von der Schaffung neuer Arbeitsplätze, ja gar vom Mythos der Vollbeschäftigung. Indes standen immer mehr Menschen ohne Arbeit da. Ihre Zahlen stiegen ständig und diese Entwicklung war nicht aufzuhalten. Es fehlt an Einsicht, wenn man glaubte, dass der Fortschritt ebenso viele Berufe, Tätigkeiten, Arbeitsdomänen schafft, wie er zu tilgen vermag. Täglich gab es weniger zu tun für den Menschen. Doch wollte man das nicht? Ja, man wollte es so. Und es war auch gut so.
Samantha ist mit der Zukunft sehr zufrieden. Ist es denn nicht seit Urzeiten ein menschliches Bestreben, sich das Leben leichter zu machen? Was heißt dies anderes, als Mittel und Wege zu finden, um mit weniger und immer weniger Eigenarbeit, weniger Schweiß, seine Bedürfnisse zu stillen? Das war seit jeher das Ziel. Musste das Wort Arbeitslosigkeit zwingend von negativer Bedeutung sein? Nein, ganz und gar nicht. Es ist doch letztlich das, was der Mensch sich wünscht.
Doch welches sind nun die Mittel und Wege, die man ersann um sich den Schweiß zu ersparen? Lange ist es her seit jenes Affenwesen, das einst zum Menschen werden würde, einen Stein, einen Knochen, einen Ast mit seinen behaarten Fingern ergriff und somit das Werkzeug erfand. Große Erleichterungen im täglichen Leben hat die Menschheit seither erfahren. Arbeit, einst härtester Natur, wurde zum Drücken eines Knopfes. Viel hat sich getan und dieser Stein, den einst der Affe hob, dieser Stein konnte bald schon für sich selbst denken und beinahe selbstständig seine Arbeit tun. Stets wendiger, geschickter, wissender wurden des Menschen Vorrichtungen, des Menschen Maschinen, welche der Erleichterung des Lebens dienten. Ihr Anwendungsbereich wuchs und wuchs und erstreckte sich bald in alle Bereiche der Gesellschaft. Allmählich wurde sich der Mensch der Tatsache bewusst, dass die Industrielle Revolution erst der Anfang gewesen ist. Die wirkliche Wende stand erst noch bevor. Es dämmerte das Zeitalter der Einheiten.
Für Samantha liegt diese Wende bereits weit in der Vergangenheit. Sie hat sich sehr schnell ereignet. Leider nicht immer friedlich, denn die sozialen Umwälzungen waren groß. Aber schließlich hat sich die neue Gesellschaftsstruktur fast überall durchgesetzt. Kein Schweiß mehr. Es ist schwer geworden, die Menschen der Vergangenheit zu verstehen. Besonders Marx. Es gibt keine Arbeiter und Bauern mehr. Kein Mensch pflügt mehr Felder. Doch auch sonst tut er nicht viel. Er ist frei.
Samantha stellt sich im Geiste all die heute oft archaisch klingenden Tätigkeiten vor, mit denen ihre Vorfahren einst ihr tägliches Brot verdienten. Das Errichten von Gebäuden, das Stehen an Fließbändern, Feldarbeit, das Sortieren von Büchern, Transport, das Verkaufen von Waren in Geschäften und Supermärkten, die es gab, bevor die Zubringerrohre in Betrieb gingen – all das und noch viel mehr ist längst vorbei. Der Mensch kann endlich ruhen. Die Einheiten haben ihn abgelöst. Zuerst ergänzten sie ihn, dann ersetzten sie ihn. Und sie machen ihre Sache tausendmal besser als er in all seinen Fehlern. Wer würde sich heute noch getrauen, sich bei Krankheit von einem menschlichen Arzt operieren zu lassen? Maschinenhände sind tausendmal sicherer. Wer würde sich schon zumuten, etwas zu essen, das von Menschenhand zubereitet ist? Kocheinheiten sind weitaus besser und sicherer.
Erst spät hat man erkannt, dass diese Entwicklung kommen musste. Dabei war es doch so einfach vorherzusehen. Die Menschen am Anfang des Jahrtausends hätten sich nur eine Frage stellen sollen. Welche Tätigkeit, welcher Beruf, welche Arbeit kann denn nicht genauso gut oder gar besser von Maschinen und künstlichen Intelligenzen verrichtet werden? Etwa das Steuern von Fahrzeugen? Heutzutage werden in weiten Teilen der Welt sämtliche Automobile, Flugzeuge und andere Fortbewegungsmittel von Einheiten gesteuert. Die Fortbewegungsmittel sind daher selbst nichts anderes als Einheiten. Seit ihrer Einführung gibt es kaum Unfälle. Maschinen sind weit bessere Fahrer, weit bessere Köche und Hirnchirurgen. Maschinen können Menschen pflegen, können Straßen bauen und Lager verwalten. Nur wenig bleibt für den Menschen zu tun. Nur wenige Menschen tun noch etwas.
Samantha ist eine davon. Immer noch lehnt sie an der Brüstung und beobachtet den Fortschritt an der nun fast fertigen Kraneinheit. Sie ist fast sechzig, am Höhepunkt ihres Lebens. Und sie ist mit sich zufrieden. Sie und andere haben die Entwicklung, den Fortschritt, haben die Evolution vorangetrieben. Samantha hat dazu beigetragen, dass die menschliche Arbeitskraft fast restlos von der Erde verschwunden ist. Einheiten fällen Bäume, fertigen Möbel, ernten Getreide, backen Brote, scheren Schafe, nähen Kleider, bauen Chips, bauen andere Einheiten, bauen alles. Sie transportieren, produzieren, unterrichten, verwalten, kommunizieren. Und vor allem funktionieren sie. Weit besser als der Mensch es tut.
Es wird Zeit für sie zu gehen, denn Samantha darf bei der Konferenz nicht fehlen. Sie geht durch Türen und Korridore. In einer perfekten Welt gäbe es hier keine Türen mehr. Dies ist kein Ort für Menschen und man könnte den verfügbaren Platz noch effizienter nützen, wenn man auf den Luxus von menschlichen Arealen in Fabriken völlig verzichtet. Bald hat Samantha die Produktionshalle IV verlassen und tritt hinaus in eine neblige Nacht. Schon vor einer Minute hat sie ein mentales Signal ausgesandt. Eine Transporteinheit wartet bereits auf sie. Samantha lässt sich auf einen weichen Sitz fallen und wünscht sich schottische Volksmusik und einen Kaffee. Beides geht rasch in Erfüllung, während ihr Fortbewegungsmittel durch die Landschaft fegt.
Hinter den transparenten Wänden der Transporteinheit sieht Samantha das riesige Areal der Fabrik vorbei gleiten. Dann folgen Wälder und schließlich die künstlichen Grünflächen der Stadt. Der Nebel verschlingt alles, das weiter als zehn Meter entfernt liegt. Die Straßenlaternen sind machtlos dagegen. Samanthas Gedanken kreisen wieder. Als Kind hat sie einst eine Schwäche für die klassische Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts gehabt. Am besten gefiel ihr stets Isaac Asimov mit seinen seltsamen Utopien. Schon damals hat er die wachsende Bedeutung der Einheiten erahnt und doch verkannt. Da ist eine Begebenheit in seinen Geschichten, die Samantha nie verstanden hat. Warum mussten seine Robots – wie er sie nannte – menschliche Gestalt haben? Dies ist doch völlig unnötig. Niemand würde heute eine Einheit konstruieren, die dem Menschen ähnelt. Zum einen ist dieser Körper völlig unpraktisch, wenn es verschiedenster Fertigkeiten bedarf, zum anderen ist der Gedanke dieser äußerlichen Angleichung von Mensch und Maschine irgendwie beunruhigend. Es gibt keine Robots, nur Einheiten, Einheiten von millionenfacher Form und Gestalt, wovon keine dem Menschen gleich sieht. Ein anderer Mythos des späten zwanzigsten und vor allem des einundzwanzigsten Jahrhunderts hat Samantha immer amüsiert: die Dämonisierung der Maschine. Es gibt genug Werke in Film und Schrift, in denen sich die künstliche Intelligenz der Einheiten gegen ihren Schöpfer wendet. Heute klingt dies lächerlich. Allein der Gedanke, dass eine Einheit etwas anderes tun sollte, als das, wozu sie konstruiert wurde, scheint absurd. Und doch... Ein Satz Asimovs geht ihr nicht aus dem Kopf: „Es gab immer schon Geister in den Maschinen.“ Es stimmt. Manche Dinge bleiben ungeklärt.
Es dauert nicht lange und das Vehikel bleibt stehen. Die Stadt ist zwar groß geworden, doch mit fünfzig Metern in der Sekunde ist fast jedes Ziel schnell erreicht. Samantha steigt aus, betritt eine Glaspyramide und durchquert einige Korridore. Türen schieben sich auf und sie betritt einen kleinen Saal. An einem kreisrunden Tisch haben sich bereits einige Personen eingefunden. Man erhebt sich als Zeichen der Höflichkeit. Man nickt freundlich. Samantha setzt sich hinzu.
Nicht jeder ist körperlich anwesend, obwohl die 3D-Projektionen fast den Anschein erwecken. Bald sind alle eingetroffen. Hier sitzen sie, die letzten Menschen, die noch gebraucht werden. Die Entscheidungsträger. Die Führer. Sie haben die Kontrolle. Sie sind nur zufällig die, die sie sind. Am Ende eines langen Selektionsprozesses waren eben nur diese übrig geblieben. Die Elite. IQ-Titanen ohnegleichen. Nicht, dass ihre Tätigkeiten besonders anspruchsvoll sind, doch die Besten sind eben besser als andere. Niemand wird mehr aus Ambition wichtig. Ambitionen sind überflüssig. Samantha spricht als erste.
Meistens sind Konferenzen dieser Art recht ereignislos. Auch diesmal ist es so. Man berichtet von neuen Techniken, die die Maschinen noch intelligenter und somit den Menschen noch unnützer machen. Immer gibt es weniger Fälle, in denen ein menschliches Eingreifen nötig wäre. Einheiten bauen, warten und reparieren sich gegenseitig. Wenn jemand den Stecker zieht, so stecken sie ihn selbst wieder ein. Ein jedes Problem kann von ihnen erkannt, analysiert und gelöst werden. Manche Einheiten sind auch gute Wissenschaftler, die selbst nach Mitteln und Wegen suchen, um die Prozesse der künstlichen Intelligenz zu verfeinern. Natürlich wird der menschliche Geist noch für lange Zeit nicht nachgebaut werden können, doch dies ist nicht erforderlich. In vieler Hinsicht übertreffen die Chips der Einheiten ohnehin schon lange das menschliche Gehirn. In anderen Dingen, wie zum Beispiel auf der Ebene der Emotionen, ist es nur gut, dass die Einheiten dem Menschen eben nicht nachkommen. Nur emotionslose Einheiten sind fehlerlose Einheiten.
Hans Grahm, ein alter Freund Samanthas, hat an diesem Abend einiges zu berichten. Neue Verbesserungen der neuronalen Schnittstelle bahnen sich an. Ein anderer Kopf der Konferenz berichtet von Fortschritten in der Raumfahrt. Eine unbemannte Sonde ist auf dem Jupitermond Io gelandet. Die Technologie ist hoch genug entwickelt um auch einen Menschen dorthin zu schicken, doch niemand greift diesen Gedanken auf. Man hat schon längst kein Interesse mehr am bemannten Raumflug. Der Mensch hat sich mit der Erde zufrieden gegeben. Die einst recht dicht bevölkerten Kolonien auf dem Mars sind wieder leer geworden. Nur Einheiten sind noch dort und fördern Rohstoffe. Einst träumten die Menschen davon, das Sonnensystem zu kolonialisieren, doch man hat dieses Vorhaben rasch aufgegeben. Durch das Ende der Arbeit ist die Erde zu einem seltenen Paradies geworden. Niemand sucht mehr die Ferne.
Und doch ist nicht alles perfekt, wie Christian Vidocq eben berichtet. Samantha hört ihm nur halb zu. Sie hat die vielen Berichte über die steigenden Selbstmordraten satt und hegt eine tiefe Verachtung gegenüber all jenen, die diesen Weg beschreiten. Wo liegen die Gründe für die Mutlosigkeit vieler? Geht die Entwicklung zu schnell voran? Für Samantha geht sie nicht schnell genug. Irgendwo in Asien gibt es immer noch Orte, wo alte, dumme Maschinen von Menschen gesteuert wurden. In den Anden verstecken sich Rebellen, die einen alternativen Lebensstil praktizieren. Dies sind die wahren Probleme. Jene, die für die Zukunft nicht reif sind, sollen ruhig aus dieser Welt scheiden.
Samantha äußert ihre Meinung nicht laut, da sie weiß, dass sie damit auf Widerstand stoßen wird. Nach einigen fruchtlosen Diskussionen endet die Konferenz und man vertagt sich. Aber wozu? Im Grunde sind auch diese Zusammenkünfte fast schon zwecklos geworden. Der Ball rollt bereits und er wird immer weiter rollen. Man muss ihn nicht mehr anstoßen. Das Uhrwerk ist fertig und tickt unentwegt. Es muss nicht gewartet und neu aufgezogen werden. Auch das geht von selbst. Samantha ahnt es. Bald werden auch diese Konferenzen ihr Ende finden und die letzten arbeitenden Menschen werden sich zurückziehen. Eines Tages wird man den Maschinen alles übergeben, denn sie machen ihre Sache gut. Die Aufgaben sind klar definiert: dem Menschen ein möglichst schönes Leben schaffen und seine Wünsche erfüllen. Was will man mehr?
Als Samantha etwas später wieder in einer Transporteinheit sitzt, lässt sie das Fahrzeug auf dem Heimweg bei der Grünbaumgasse vorbeifahren. Etwa zwanzig Menschen sieht sie dort stehen. Einer nach dem anderen verschwindet. In Unverständnis schüttelt Samantha den Kopf. Gerne hätte sie sich einen der Unglücklichen in den Wagen geholt und ihn ausgefragt, warum er hier ist, doch irgendetwas lässt sie vor diesem Schritt zurückschrecken. Rasch weist sie dem Vehikel an, sie nach Hause zu bringen.
III
Li ist verzweifelt. Er sitzt bei sich zu Hause und starrt eine Wand an. Schon wieder ist ein Tag vergangen, doch morgen wird er ihn vergessen haben. Es sind ja doch alle Tage gleich und das Führen von Tagebüchern verlor schon lange jeden Sinn. Man kann nicht einfach so durchs Leben gehen ohne dafür zu kämpfen, dass man leben kann. Man braucht etwas zu tun. Viele Menschen malen, viele dichten heutzutage. Doch es sind zu viele. Da es sonst nichts mehr gibt, wollen sie nun alle Poeten sein, wollen alle die Muse küssen. Das Ergebnis ist, dass die Kunst verkommt, da es zu viele Künstler gibt. Menschen, die in früheren Zeiten nie Feder oder Pinsel in die Hand genommen hätten, tun dies nun. Manche schaffen wahrlich Wunderbares, doch in der Sturmflut von neuen Werken, größtenteils Belangloses, sind diese Funkelsteine nicht zu sehen. Welch Unsinn doch jeden Tag geschrieben wird. Schon längst ist die Lust zu lesen Li vergangen, zumindest die Lust neue Bücher zu lesen. Gern verliert er sich in der Geschichte und den alten Werken, doch irgendwann kommt stets der Zeitpunkt, an dem er ein Buch weglegen muss, da er es nicht mehr erträgt weiter zu lesen. Er wünscht sich nichts sehnlicher als in die Vergangenheit zu reisen. Viel reicher und froher erscheint ihm doch das Gestern im Gegensatz zum Heute.
Sein Lampenschirm fragt ihn, was er zum Abendessen wünscht. Li ist ratlos. Vorschläge fordert er. Diese kommen. Schließlich wählt er Butterbrote. Schmeckt ja doch alles gleich. Bald darauf steht das Essen auf dem Tisch. Unwillig blickt Li auf die Brote herab. Wenn er sagen könnte, er habe sie sich verdient, dann wäre dies schon etwas Neues, dann hätte er vielleicht sogar Appetit. Doch verdient hat Li nichts. Weder die Butterbrote, noch seine Wohnung, noch das Recht am Leben zu bleiben. Er hat überhaupt nichts verdient. Niemand hier hat etwas verdient.
„Dennoch haben wir alles und leiden darunter“, murmelt Li halblaut vor sich hin.
Er lässt die Brote stehen und tritt an die leere Wand, welche er schon seit Stunden fast ununterbrochen anstarrt. Er bittet um die Bilder seiner Ahnen und sie erscheinen vor ihm. Da sind sie, die Alten. Doch es gibt auch Aufnahmen aus ihrer Jugend. Die ältesten Bilder sind sogar noch zweidimensional. Nicht viele haben zweidimensionale Bilder ihrer Vorfahren. Ihre Namen stehen darunter. Daneben Geburts- und Sterbejahr. Auch der Beruf ist dort zu lesen. Li überfliegt die altbekannten Daten mit den Augen. Jonathan Henzel - Maurer. Dieser ist im letzten Krieg aufgewachsen. Krieg muss eine seltsame Sache gewesen sein. Und Maurer ist er gewesen. Maurer. Jakob weiß nicht, was das ist, doch es klingt beeindruckend. Maurer. Das klingt nach Kraft, nach selbst erarbeitetem Brot im Schweiße seines Angesichts. Es muss schön gewesen sein ein Maurer zu sein. Und ungesund. Nur 64 Jahre alt ist Jonathan geworden. Miranda Fried – Chirurgin. Diese war Lis Ururgroßmutter, wenn er nicht irrt. Eine Chirurgin. Das ist schwer vorstellbar für Li. Menschen, die trotz all ihrer Fehleranfälligkeit an anderen Menschen herumbasteln. Auch Fahrzeuge wurden damals von Menschen gelenkt. Li findet es immer wieder erstaunlich, dass andere tatsächlich so viel Vertrauen hatten, sich in ein Fahrzeug zu setzen, das von Menschenhand gesteuert wurde. Es muss Unfälle gegeben haben, damals. Viele Unfälle. Miranda Fried starb bei einem Flugzeugabsturz. Wurden Flugzeuge damals etwa auch von Menschen gesteuert? Wohl ja. Sonst hätte es kaum Unfälle gegeben. Welch Wahnsinn! Mutige Vergangenheit.
Ein anderer Vorfahre: Herbert Fried. Ein Lehrer. Was das war, weiß Li. Er hat es einst gelernt. Nicht von einem Lehrer, versteht sich, denn die gibt es ja schon lange nicht mehr. Die letzten zweiundvierzig Jahre seines Lebens hat dieser Lehrer in Rente gelebt. Etwa so wie Li sein ganzes Leben lebt. Doch Herbert hat sich dies verdient. Li nicht. Noch einer. Theodor (Ted) Grün - sein Großvater, ein Techniker. Dieser hat schon die Anfänge der Langeweile gesehen. Auf den älteren Bildern, auf denen er ergraut ist, sieht er stets so traurig aus. Nicht so auf den jüngeren. Seltsam war die Kleidung des vergangenen Jahrhunderts. Bis auf diese ähnelt Li seinem Großvater sehr. Nur die Augen sind anders und besonders deren Ausdruck. Li hat nie so fröhlich in die Welt geblickt.
Wie sagte seine Freundin Mia heute Mittag? „Es geht uns besser als allen anderen Menschen, die es je gegeben hat.“
„Geht es uns wirklich besser?“, denkt Li.
Man lebt länger. Man ist gesünder, man hungert nicht, man friert nicht. Niemand quält einen. Kein Krieg. Man ist frei. Es muss den Menschen wirklich besser gehen. Doch warum scheinen die Gesichter auf den alten Fotos dann immer so froh, so glücklich zu sein? Was hatten sie Grund zu lachen, zu lächeln, zu schmunzeln, zu grinsen, zu strahlen, wo es ihnen doch so viel schlechter ging, als ihm, Li Grün, hier und heute?
Die Butterbrote verschwinden wieder. Genug von den Geistern. Manchmal sieht Li die Alten gern – wie sie lebten, wer sie waren. Wer ist er? Einer von vielen ohne Besonderheiten. Sein Lampenschirm fragt, ob er etwas zu trinken wünscht. Er bestellt ein hochprozentiges Getränk und leert das Glas in einem Zug. Seine Kehle brennt. Das leere Glas verschwindet wieder.
Li würde gerne Menschen sehen. Er spielt mit dem Gedanken außer Haus und in die Nachtviertel zu gehen, wo viele Leute tanzend in den Straßen lachen. Doch ihr Lachen ist hohl. Wie sein eigenes, wenn er lachen würde. Hohl und nicht von Dauer. Öd und grau. Er will sich ins Vergnügen stürzen, doch der Sprung gelingt ihm nicht. Zu oft schon hat er sich auf diese Art vergnügt. So oft, dass es längst kein Vergnügen mehr ist. Denn wenn auch das Vergnügen zur Routine wird, dann ist Vergnügen kein Vergnügen mehr. Alles ist Routine. Nichts geschieht. Nichts verändert sich. Man wartet einfach nur, dass man altert und stirbt. Doch wieso warten?
Li verlässt seine Wohnung. Stundenlang wandelt er durch die nächtlichen Straßen der Stadt – aber nicht planlos. Er hat ein Ziel, dem er sich stetig nähert. Zum ersten Mal seit langer Zeit, hat er ein Ziel. Natürlich könnte er sich von einer Transporteinheit hinbringen lassen, doch das wäre falsch. Nicht zu diesem Ziel. Man muss dorthin einfach zu Fuß gehen, auf eigenen Beinen. Li hat schon lange geahnt, dass er diesen Pfad, den er heute beschreitet, einst wählen würde. Nun ist es soweit. Es ist gut, dass es Nacht ist. Man muss bei Dunkelheit dorthin. Es ist falsch bei Tageslicht an jenen Ort zu gehen. Nichts spricht dagegen es am Tage zu tun, doch es ist falsch. Ein Instinkt sagt nein. Man stirbt in der Nacht.
Li weiß, wo die Stelle ist. Sie wird nicht beworben wie die Bars und die Tanzlokale. Für sie gibt es keine Lichter und Leuchtzeichen. Man spricht und schreibt nicht gerne davon, doch jeder weiß, wo der Ort sich befindet. Er braucht keine Wegweiser. Grünbaumgasse 37. Nicht das Haus, sondern die unbenannte Nische daneben. Ein jeder kennt diese Adresse. Das ist nicht verwunderlich, denn es gibt sie schon seit vielen Jahren und fast alle Menschen erwägen die Möglichkeit früher oder später einmal dort hinzugehen. Grünbaumgasse 37. Diese Worte klingen magisch in den Ohren der Stadt, die Li seine Heimat nennt. Grünbaumgasse 37. Man muss dies flüstern, darf es nicht laut sagen. Man ehrt die Bedeutung dieser Stelle. Es ist egal, wer Grünbaum war, oder ob dort einst ein grüner Baum gestanden hat. Dies interessiert niemanden. Dies weiß kaum jemand mehr. Es gibt viele alte Straßennamen, doch nichts gleicht jenem Ort. Grünbaumgasse 37. Li ist auf den Weg dorthin.
Er biegt gerade in eine neue Straße ein – noch mehrere Häuserblöcke von seinem Ziel entfernt – als er Schritte hinter sich hört. Im ersten Augenblick der Wahrnehmung kommt ihm der Gedanke, dass jemand kommt, um ihn zu hindern, um ihn zu halten; um ihn zu retten, wie sie sagen. Doch ein weiterer Gedanke verscheucht dieses Hirngespinst. Es ist ihnen egal. Sie sind sowieso machtlos. Wer auch immer da hinter ihm naht, es droht wohl keine Gefahr. Li blickt nicht zurück. Die Schritte kommen näher, verlangsamen sich dann und bleiben auf konstanter Entfernung hinter ihm. Dies bleibt so drei Minuten lang. Dann erklingt eine unbekannte Stimme.
„Sie sind auf dem Weg zur Grünbaumgasse?“ Es ist zwecklos es zu leugnen. Und geschmacklos. Warum jetzt noch lügen?
„Ja“, sagt Li, den Blick immer noch starr nach vorne gerichtet.
„Dann haben wir denselben Weg.“ Sein Verfolger holt ihn mit schnellen Schritten ein. Man bleibt stehen und betrachtet sich. Li ist vierunddreißig, glattrasiert und blond. Die Haare trägt er kurz, nur bis zu den Schultern. Sein Gegenüber sieht jünger aus, doch das ist schwer zu sagen. Es scheint indianischer Abstammung zu sein und hat ein Gesicht feiner Züge. Keine Angst ist in seinen Augen. Man geht weiter.
„Endgültige Entscheidung?“, fragt der Hinzugetretene.
„Ja. Endgültig.“
„Lange gezögert, oder schnell entschieden?“
„Ich wusste schon lange, dass es dazu kommt. Es war nur eine Frage der Zeit. Bei Ihnen?“
„Spontan. Ganz spontan. Gestern dachte ich noch an Übermorgen. Heute wurde mir klar, dass ich dieses Übermorgen nicht brauche.“
Sie schweigen. Ein Tier in der Seitengasse. Offene Fenster. Irgendwo Musik.
„Ich hoffe, wir müssen nicht zu lange warten“, sagt der Indianer.
„Stimmt es denn, was man sich erzählt?“
„Dass man dort jetzt Schlange steht? Oh ja. Ich bin oft daran vorbeigegangen. So ganz zufällig. Es sind viele geworden. Mehr jede Nacht.“
„Wir leisten unsern Beitrag.“
„Ja.“
Eine Zeitlang schweigen sie beide. Li stellt sich im Geiste eine Schlange von Menschen vor – alle mit demselben Gedanken, mit demselben Ziel. Keiner hat mehr Hoffnungen und Perspektiven.
„Traurig irgendwie, dass es so viele sind.“, sagt er.
„Traurig? Ich weiß nicht. Es geschieht einfach. Ich finde es gut, die Wahl zu haben.“
„Diese Wahl hatten sie alle. Immer schon.“
„Ja. Doch heute macht es Sinn. Mehr Sinn denn je.“
„Sinn?“ Li hat nie viel über den Sinn seiner Handlungen nachgedacht. Er hat die Dinge einfach nur getan.
„Ja, Sinn“, bestätigt der Indianer. „Nennen Sie doch zum Beispiel Ihre Gründe dorthin zu gehen.“
„Nennen Sie mir doch Gründe nicht dorthin zu gehen.“
„Eben. Es ist... Es ist…“
„Ich weiß, was Sie meinen.“
„Wir sind gleich da.“
Grünbaumgasse 37. Schon von Weitem sieht man sie, die vielen Menschen, die dort Schlange stehen. Einer nach dem anderen dringt langsam vor, hinein in die dunkle Seitengasse. Keiner kommt wieder.
„Da sind wir also“, stellt Lis Begleiter fest.
„Da sind wir.“
Schweigen. Füße auf hartem Grund. Atmen. Ungeduld. Schweigen. Man blinzelt und geht einen Schritt weiter.
„Wie heißen Sie eigentlich?“
„Li Grün.“
„Elijah Richardson. Freut mich.“
Ein Handschlag. Ein Lächeln. Man versteht sich. Schweigen. Man blinzelt und geht einen Schritt weiter.
„Sagen Sie, Li, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben, aber es gibt da so einen Satz von einem dieser Philosophen des 19. oder 20. Jahrhunderts - ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls sagte der: Wer ein Warum zu leben hat, der erträgt fast jedes Wie.“
„Aha.“ Li hat sich nie viel mit Philosophie beschäftigt. Elijah fährt fort.
„Unser Wie ist wunderbar. Wir haben alles, was wir brauchen und viel mehr. Wir können essen, soviel wir wollen, haben Zeit, haben alles, was man sich nur wünschen kann. Alles ist frei. Für nichts muss man etwas geben, nur nehmen und haben. Das Wie des modernen Menschen ist das Wie des Paradieses dieser alten Kinderschreck-Geschichten. Noch nie war das Wie so wunderbar.“
„So wunderbar?“ Die Welt scheint Li alles andere als wunderbar. Sonst wäre er wohl kaum hier.
„Ich spreche nur vom Wie. Denn leider, leider ging irgendwo am Weg zu diesem wunderbaren Wie das Warum verloren. Man hat es fallen und liegen lassen. Im Staub.“
„Im Schlamm“
„Im Abgrund.“
„Und?“
„Wer ein Warum zu leben hat, der erträgt fast jedes Wie. Wer kein Warum zu leben hat, dem ist auch jedes Wie ein Graus, sei es noch so wundervoll.“