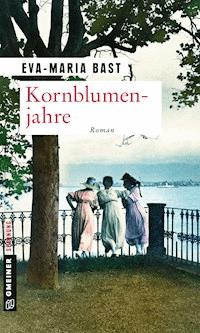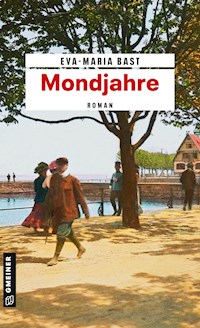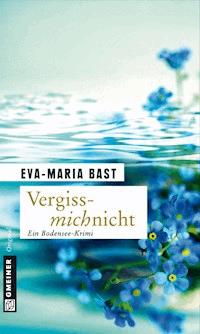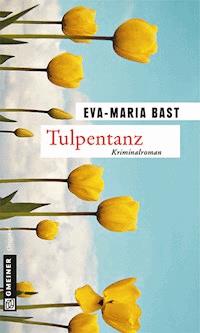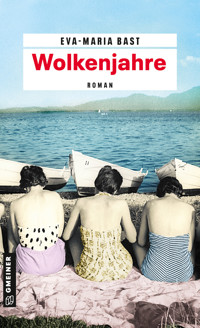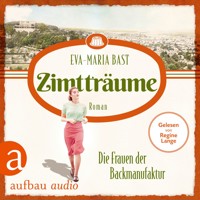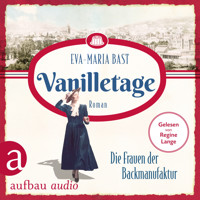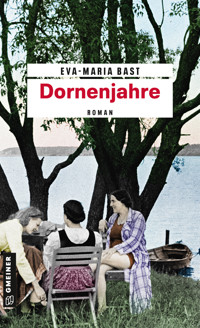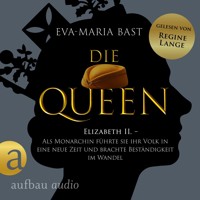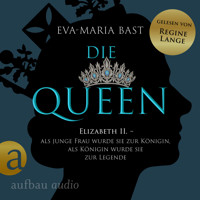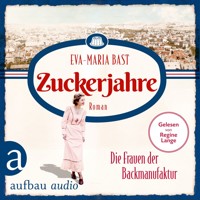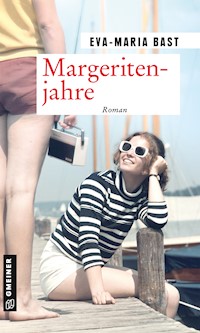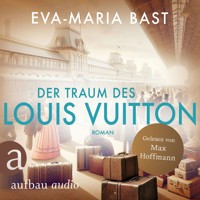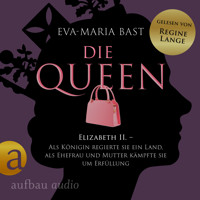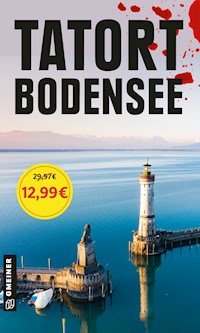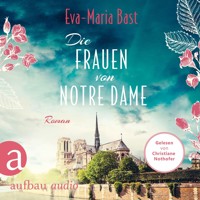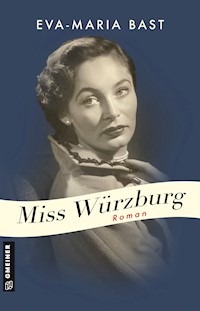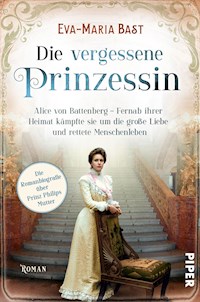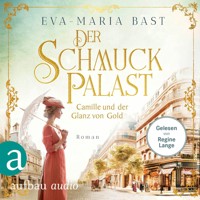14,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Frauen der Backmanufaktur - Die ersten zwei Bände in einem E-Book Bundle!
Vanilletage -
Träume aus Zucker
Bielefeld, 1892. Die junge Josephine und ihr Mann Carl haben große Pläne: Sie wollen ein Mittel herstellen, das das Backen revolutionieren wird. Es fehlt nur noch die richtige Mischung. Während Josephine in der gemeinsamen Apotheke bereits an der Werbung arbeitet, experimentiert Carl weiter – und dann ist es geschafft: Ihr Backpulver wirft große Gewinne ab, Josephine und Carl können schon bald expandieren. Doch ihr Erfolg ruft immer mehr Neider auf den Plan, und Josephine und Carl müssen um die Zukunft ihres jungen Unternehmens fürchten – und um ihre Liebe ...
Zuckerjahre -
Träume aus Zartbitter.
Bielefeld, 1914: Das Unternehmen der Familie Meister floriert, die Entwicklung des Backpulvers war ein riesiger Erfolg. Julius, der Sohn des Firmengründers, hat in Chemie promoviert und will die Firma übernehmen, doch zuvor heiratet er Lotte, seine große Liebe. Kurz darauf bricht der Erste Weltkrieg aus – Julius wird eingezogen, während Lotte das gemeinsame Kind erwartet. Sie ist voller Sorge, als eine schreckliche Nachricht sie erreicht. Und auf einmal muss sie ihre Ideen einbringen, um das Unternehmen zu retten …
Die mitreißende Saga um die Erfolgsgeschichte einer deutschen Backdynastie – packend und berührend erzählt von Bestsellerautorin Eva-Maria Bast.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 841
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über das Buch
Vanilletage - Träume aus Zucker
Bielefeld, 1892. Die junge Josephine und ihr Mann Carl haben große Pläne: Sie wollen ein Mittel herstellen, das das Backen revolutionieren wird. Es fehlt nur noch die richtige Mischung. Während Josephine in der gemeinsamen Apotheke bereits an der Werbung arbeitet, experimentiert Carl weiter – und dann ist es geschafft: Ihr Backpulver wirft große Gewinne ab, Josephine und Carl können schon bald expandieren. Doch ihr Erfolg ruft immer mehr Neider auf den Plan, und Josephine und Carl müssen um die Zukunft ihres jungen Unternehmens fürchten – und um ihre Liebe ...
Zuckerjahre - Träume aus Zartbitter.
Bielefeld, 1914: Das Unternehmen der Familie Meister floriert, die Entwicklung des Backpulvers war ein riesiger Erfolg. Julius, der Sohn des Firmengründers, hat in Chemie promoviert und will die Firma übernehmen, doch zuvor heiratet er Lotte, seine große Liebe. Kurz darauf bricht der Erste Weltkrieg aus – Julius wird eingezogen, während Lotte das gemeinsame Kind erwartet. Sie ist voller Sorge, als eine schreckliche Nachricht sie erreicht. Und auf einmal muss sie ihre Ideen einbringen, um das Unternehmen zu retten …
Die mitreißende Saga um die Erfolgsgeschichte einer deutschen Backdynastie – packend und berührend erzählt von Bestsellerautorin Eva-Maria Bast.
Über Eva-Maria Bast
Eva-Maria Bast ist Journalistin und Autorin mehrerer Sachbücher, Krimis und zeitgeschichtlicher Romane. Für ihre journalistische Arbeit wurde sie mehrfach ausgezeichnet. Als eine Hälfte des Autorenduos Charlotte Jacobi schrieb sie u. a. den Spiegel-Bestseller »Die Douglas-Schwestern«. Die Autorin lebt am Bodensee.
Im Aufbau Taschenbuch sind bisher ihre Saga über die Frauen der Backmanufaktur »Vanilletage«, »Zuckerjahre« und »Zimtträume« erschienen, der Roman »Die Frauen von Notre Dame« sowie der erste Band der Saga um die Familie Cartier »Der Schmuckpalast – Antoinette und das Funkeln der Edelsteine«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Eva-Maria Bast
Vanilletage & Zuckerjahre - Die Frauen der Backmanufaktur
Die Frauen der Backmanufaktur - Die ersten zwei Bände in einem E-Book Bundle!
Orientierungsmarken
Cover
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Copyright-Seite
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Newsletter
Vanilletage – Die Frauen der Backmanufaktur
Prolog — Hamburg, November 1876
Teil 1 — 1889–1893
1. Kapitel: Berlin, Oktober 1889
2. Kapitel: Berlin, Oktober 1889
3. Kapitel: Berlin, Oktober 1889
4. Kapitel: Berlin, Oktober 1889
5. Kapitel: Berlin, Oktober 1889
6. Kapitel: Berlin und Bielefeld, Februar bis April 1890
7. Kapitel: Bielefeld, Mai 1890
8. Kapitel: Bielefeld, Dezember 1892
9. Kapitel: Berlin und Obernkirchen, Januar 1893
10. Kapitel : Obernkirchen, Januar 1893
11. Kapitel: Bielefeld, Februar 1893
12. Kapitel: Bielefeld, Februar 1893
13. Kapitel: Bielefeld, Februar 1893
14. Kapitel: Bielefeld, Februar 1893
15. Kapitel : Berlin, März 1893
16. Kapitel: Berlin, März 1893
17. Kapitel: Berlin, März 1893
18. Kapitel: Berlin, März 1893
19. Kapitel: Berlin, März 1893
20. Kapitel: Bielefeld, März 1893
21. Kapitel: Bielefeld, März 1893
22. Kapitel: Bielefeld, Juli 1893
23. Kapitel: Berlin, August 1893
24. Kapitel: Bielefeld, August 1893
25. Kapitel: Berlin, August 1893
Teil 2 — 1894–1895
26. Kapitel: Bielefeld, März 1894
27. Kapitel : Bielefeld, März 1894
28. Kapitel: Bielefeld, Juli 1894
29. Kapitel: Bielefeld, Juli 1894
30. Kapitel: Bielefeld, Juli 1894
31. Kapitel : Bielefeld, Juli 1895
32. Kapitel: Bielefeld, Juli 1895
33. Kapitel : Bielefeld, Juli 1895
34. Kapitel: Bielefeld, Juli 1895
35. Kapitel: Berlin, Juli 1895
36. Kapitel: Bielefeld und Berlin, Juli 1895
Teil 3 — 1906
37. Kapitel: Bielefeld, Januar 1906
38. Kapitel: Bielefeld, Januar 1906
39. Kapitel: Bielefeld, Januar 1906
40. Kapitel : Bielefeld, Februar 1906
41. Kapitel: Bielefeld, Februar 1906
42. Kapitel : Bielefeld, Februar 1906
43. Kapitel : Bielefeld, Februar 1906
44. Kapitel: Bielefeld, Februar 1906
45. Kapitel: Berlin, März 1906
46. Kapitel : Neapel, Juli 1906
47. Kapitel: Bielefeld, Juli 1906
48. Kapitel: Bielefeld, August 1906
Epilog — Bielefeld, 1911
Danksagung und Nachwort
Zuckerjahre – Die Frauen der Backmanufaktur
Teil 1 — 1914
1. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
2. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
3. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
4. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
5. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
6. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
7. Kapitel: Bielefeld, Mai 1914
8. Kapitel: Bielefeld, Juni 1914
9. Kapitel: Bielefeld, Juni 1914
10. Kapitel: Berlin, Juni 1914
11. Kapitel: Berlin, Juni 1914
12. Kapitel: Bielefeld, Juli 1914
13. Kapitel: Wien, Juli 1914
14. Kapitel: Baden, Juli 1914
15. Kapitel: Baden, Juli 1914
16. Kapitel: Bielefeld, Juli 1914
17. Kapitel: London, Juli 1914
18. Kapitel: Bielefeld, August 1914
19. Kapitel: Bielefeld, August 1914
20. Kapitel: Bielefeld, August 1914
21. Kapitel: Bielefeld, August 1914
22. Kapitel: Bielefeld, Herbst 1914
Teil 2 — 1916
23. Kapitel: Bielefeld, Januar 1916
24. Kapitel: Bielefeld, Januar 1916
25. Kapitel: Bielefeld, Januar 1916
26. Kapitel: Bielefeld, Januar 1916
27. Kapitel: Verdun, März 1916
28. Kapitel: Bielefeld, März 1916
29. Kapitel: Bielefeld, März 1916
30. Kapitel: Bielefeld, März 1916
31. Kapitel: Bielefeld, März 1916
32. Kapitel: Verdun, April 1916
33. Kapitel: Verdun, April 1916
34. Kapitel: Bielefeld, Mai 1916
35. Kapitel: Verdun, Mai 1916
36. Kapitel: Bielefeld, Mai 1916
37. Kapitel: Bielefeld, Sommer 1916
38. Kapitel: Bielefeld, September 1916
Teil 3 — 1919
39. Kapitel: Bielefeld, Januar 1919
40. Kapitel: Bielefeld, Januar 1919
41. Kapitel: Bielefeld, Januar 1919
42. Kapitel: Bielefeld, Februar 1919
43. Kapitel: Bielefeld, Februar 1919
44. Kapitel: Bielefeld, Juni 1919
45. Kapitel: Bielefeld, August 1919
46. Kapitel: Bielefeld, August 1919
47. Kapitel: Sylt, August 1919
48. Kapitel: Bielefeld, August 1919
49. Kapitel: Oestrich-Winkel im Rheingau, August 1919
50. Kapitel: Bielefeld, September 1919
51. Kapitel: Bielefeld, September 1919
52. Kapitel: Bielefeld, September 1919
53. Kapitel: Bielefeld, September 1919
54. Kapitel: Bielefeld, September 1919
55. Kapitel: Bielefeld, September 1919
Epilog — Bielefeld, Weihnachten 1919
Spuren der Realität
Danksagung und Nachwort
Impressum
Eva-Maria Bast
Vanilletage – Die Frauen der Backmanufaktur
Roman
Prolog
Hamburg, November 1876
Und jetzt schau her, Carl, gleich geht es los«, verkündete Louis Meister und wies den Vorarbeiter an, die beiden Dampfmaschinen im Kesselhaus anzuheizen. Während der Mann die Kohle in den Brennraum schaufelte, bewegten sich die Zeiger an der Druckanzeige kontinuierlich nach oben. Louis deutete auf das Uhrwerk. »Siehst du, nun hat der Zeiger den roten Strich erreicht, und wir haben damit genug Druck, um die Maschine in Gang zu setzen.«
Carl nickte und verfolgte gebannt, wie sich die Kolben auf und ab bewegten und die Maschine fauchend Dampf ausstieß.
»Das ist unglaublich«, flüsterte der Junge fasziniert.
»Gleich wirst du noch mehr staunen«, prophezeite sein Onkel. »Komm mit.«
Er ging seinem Neffen voran durch das Kesselhaus und blieb vor den grauen Granitwalzen stehen. Mit großen Augen beobachtete Carl, wie ein Arbeiter einen Sack voller Mandeln einfüllte.
»Und nun zieh mal an dem Hebel«, sagte Louis und deutete auf den Metallgriff, der seitlich der Walzen angebracht war.
Carl tat, wie ihm geheißen, griff nach dem Hebel und bewegte ihn nach rechts. Dabei sah er, wie ein großer Riemen auf das Zahnrad übersprang und sich nach der Dampfmaschine nun auch die Mühlsteine langsam in Bewegung setzten.
Carl strahlte. »Das macht Spaß.«
Sein Onkel nickte.
»Ich nehme dich in die Lehre, wenn du mit der Schule fertig bist«, bot er Carl an. »Ich hätte dich gern bei mir, klug, wissbegierig und ehrgeizig, wie du bist.«
Carl freute sich über das Kompliment. Zumal es aus dem Munde seines Onkels kam. Wie wohl die ganze Familie, bewunderte auch er Louis Meister aus ganzem Herzen. Er war erst fünfundzwanzig Jahre alt gewesen, als er sich 1870 selbstständig gemacht, in Altona eine Konditorei eröffnet und sie schnell zu der größten der Stadt gemacht hatte. Jede Menge Leckereien hatte es dort gegeben, und Carl, selbst Bäckerssohn, hatte gestaunt, was sich aus Zucker, Mehl und Eiern alles zaubern ließ. Denn sein Vater buk immer nur Brot für die Arbeiter, die in den Kohlegruben, Steinbrüchen und in den Glasmanufakturen ihr Tagwerk verrichteten. Als der Onkel sich eines Tages auf herrliche Zuckerwaren aus Mandeln spezialisiert hatte, war Carl hingerissen gewesen. Marzipan hieß die wunderbare Süßigkeit. Schon als Achtjähriger hatte er dabei zugesehen, wie der Onkel die Mandeln an einem Stein fein rieb, sie dann in einem Topf, über dem Feuer röstete und nach und nach den Zucker zugab. Herrlich hatte das geduftet! Bei seinem nächsten Besuch in der väterlichen Mühle hatte Louis Meister bunte Früchte und Tiere aus Marzipan mitgebracht, die er mit Anilinfarben selbst eingefärbt hatte. Carl hatte gespannt gelauscht, als sein Onkel erzählte, dass die Leute sogar aus Hamburg kämen, um in seinem Laden zu kaufen. So erfolgreich, hatte er gedacht, wollte er auch mal sein. Eines Tages würde er ein großer Fabrikant werden, wie sein Onkel einer war.
Jetzt steckte Louis mitten in den Vorbereitungen für die feierliche Eröffnung seiner Dampf-Marzipan-Fabrikation, die in drei Wochen stattfinden sollte. Dass er sich trotzdem Zeit für seinen Neffen nahm und ihm sogar die neue Maschine bereits vorführte, bevor diese irgendjemand anderes außerhalb der Fabrik bestaunen konnte, rührte Carl zutiefst. Und weil der Onkel nun sagte, er wolle ihn zu sich nehmen, platzte Carl beinahe vor Stolz. Doch er würde Louis enttäuschen müssen. So wie er seinen Vater enttäuschen musste. Nach seinem Schulabschluss am Gymnasium hätte er eigentlich Bäcker werden sollen wie sein Vater. Doch er würde weder in dessen Fußstapfen noch in die seines Onkels treten. Sein Entschluss stand fest: Er musste eine Apothekerausbildung machen. Das war er seinen Geschwistern schuldig. Seinen toten Geschwistern. Denn er war überzeugt, sie würden noch leben, wenn nicht … Dann wäre das Glück noch in ihrem Leben, die Mutter nicht gramgebeugt und der Vater nicht so, als könne er nie wieder lachen.
An den Tod der kleinen Lina hatte Carl keine Erinnerung. Er war erst drei gewesen, als sie starb. Aber dass seine Schwester Maria nicht einmal ihren ersten Geburtstag erleben durfte, hatte ihn hart getroffen. Immerhin neun Jahre alt war er damals gewesen. Und nun war auch noch Georg tot, der seinen vierzehn Jahre älteren Bruder vergöttert hatte – und umgekehrt. Sobald er laufen konnte, war Georg Carl überallhin gefolgt, hatte ihm ständig seine kleinen Ärmchen entgegengestreckt und wollte auf den Arm genommen werden. Puppenhaft tauchte das kleine Gesicht vor Carls innerem Auge auf. Wie Georg, dahingerafft von der Schwindsucht in dem kleinen Sarg gelegen hatte. Der Schmerz drohte ihm den Atem zu rauben, hastig schnappte er nach Luft, verschluckte sich, hustete und brach dann in Tränen aus. Sein Onkel, der neben ihm stand, zog ihn an sich. »Schon gut«, murmelte er. »Schon gut.«
Carl fühlte sich geborgen in seinen Armen. Ein wenig war es, als ob sein Vater ihn umarmen würde. Für einen Moment gab er sich der Illusion hin, es sei wirklich der Vater, der ihn hielt. Carl konnte sich nicht erinnern, wann er das das letzte Mal getan hatte. Immer waren Schutzbedürftigere da gewesen, er, der große und vernünftige Sohn, brauchte keine Fürsorge, sondern sollte mithelfen, sich um seine kleineren Geschwister zu kümmern. Er hatte Verantwortung. Und aus dieser Verantwortung heraus stand sein Entschluss fest. Apotheker wollte er werden, um Medizin herzustellen, die Leben retten und auch die Schwindsucht besiegen konnte, gegen die es noch kein Heilmittel gab. Apotheker. Nicht Bäckermeister. Nur wusste das noch keiner.
• • • •
Drei Wochen später war Carl wieder bei seinem Onkel in Altona. Als Ältester musste er die Familie bei der offiziellen Eröffnung der Dampf-Marzipan-Fabrication vertreten. Seine Eltern waren noch zu sehr in Trauer, außerdem musste der Vater sich um die Bäckerei und die Mutter um die Kinder kümmern. Zwar hatten sie dank der guten Herkunft seiner Mutter Bertha – einer Rechtsanwaltstochter – durchaus Personal, aber seine Mutter überließ die Kleinsten nicht gerne anderen. Was Carl gut verstehen konnte.
Also fuhr er allein zur großen Eröffnung von Onkel Louis’ Fabrik in Ottensen, deren Bau dank des hervorragend florierenden Geschäftes seines Onkels möglich gewesen war.
»Ich möchte dich jemandem vorstellen«, sagte Louis und deutete auf einen großgewachsenen Herren. »Das ist dein Onkel Louis Dohme aus Amerika. Er hat nicht nur denselben Vornamen wie ich, sondern sieht mir auch ziemlich ähnlich. Wir haben starke Gene«, erklärte der Onkel grinsend, und Carl musste ihm im Stillen recht geben. Beide Männer glichen einander – und damit auch seinem Vater – sehr.
»Guten Tag, Carl«, sagte der Amerikaner und schüttelte ihm die Hand. »Möchtest du mir ein bisschen Gesellschaft leisten? Ich kenne hier nämlich keinen.«
»Ich auch nicht«, gestand Carl.
»Na, dann passen wir ja gut zusammen«, sagte Louis Dohme erfreut und nahm Carl beim Arm. »Ich würde vorschlagen, wir gehen schon mal in Richtung des Marzipanbuffets, bevor sich nachher alle darauf stürzen«, schlug er vor, und der Junge nickte begeistert. Das riesige Buffet hatte er schon vorhin aus der Ferne erspäht, doch als sie sich jetzt näherten, blieb Carl die Spucke weg. »Das ist ja wunderschön«, flüsterte er andächtig. Zwar hatte er Onkel Louis’ bunte Marzipantiere und -blumen schon verschiedentlich zu Gesicht bekommen und sich auch von deren köstlichem Geschmack überzeugen können, aber das hier war etwas vollkommen anderes. Eine ganze Landschaft aus Marzipan. Eigentlich viel zu schade zum Essen.
»Ja«, sagte der Amerikaner. »Mein Namensvetter ist ein echter Zauberkünstler.«
Dann sah er Carl fragend an. »Dein Onkel hat mir erzählt, dass er große Stücke auf dich hält. Er sieht in dir wohl fast so etwas wie einen Sohn und hätte dich gern als Nachfolger. Dann kannst du auch solche Welten schaffen.«
Er wies auf das Marzipanbuffet.
»Das will ich nicht«, gestand Carl leise. »Das darf ich nicht. Ich traue mich nur nicht, es dem Onkel zu sagen.«
Louis Dohme sah ihn aufmerksam an. »Was willst du dann, Carl?«
»Nun«, erwiderte der leise, »ich würde schon gern. Ich habe immer davon geträumt, einmal die Bäckerei von Vater zu übernehmen und dort die feinsten Torten und Kuchen zu backen. Es tut mir leid, dass es dort fast nur Brot gibt. Vater könnte so viel mehr.«
Es klang leidenschaftlich.
»Also ist es doch dein Traum«, stellte Louis fest. »Aber du sagst, du darfst nicht. Warum?«
»Ich möchte – ich muss Apotheker werden«, stieß der Junge hervor.
Louis sah ihn überrascht an. »Das ist eine gute Wahl«, sagte er. »Ich bin ebenfalls Apotheker. Aber warum musst du …«
Doch Carl unterbrach ihn überrascht. »Du bist auch Apotheker?«, rief er. »Das ist ja großartig! Du musst mir alles erzählen.«
Louis nickte. »Das will ich gerne«, versprach er. »Aber zuerst möchte ich von dir wissen, warum du glaubst, dass du Apotheker werden musst.«
Carl schlug die Augen nieder. »Drei meiner kleinen Geschwister sind gestorben«, sagte er. »Vielleicht wäre das nicht passiert, wenn sie die richtigen Medikamente gehabt hätten. Ich möchte nicht nur Medikamente verkaufen, ich möchte sie auch entwickeln und herstellen.«
Louis Dohmes Miene war ernst geworden. »Ich kann dich sehr gut verstehen«, sagte er. »Ich bin selbst der Älteste von sieben Geschwistern. Man fühlt sich immer verantwortlich.«
Carl nickte, froh, endlich mit jemandem über seine Träume und auch seine Sorgen sprechen zu können.
»Erzählst du mir nun deine Geschichte?«, bat er.
»Sehr gern«, begann Louis. »Mein Vater war Steinhauer in Obernkirchen, da, wo du auch herkommst.«
»Aber wie bist du nach Amerika gekommen?«, fragte Carl staunend.
»Man könnte sagen, mein Vater hat aus der Not eine Tugend gemacht«, erwiderte Louis achselzuckend. »Er hatte einen eigenen Steinbruch, aber irgendwann war der vollständig abgebaut. Da ist er mit uns nach Baltimore in Amerika ausgewandert, dort waren mit seinen Steinen einige Gebäude, darunter eine Kirche, errichtet worden. Ich war fünfzehn Jahre alt, als wir in Bremen an Bord gegangen sind. So alt wie du jetzt. Meine Welt war vollkommen durcheinander. Und nun schau, was aus mir geworden ist.«
»Ich bin vierzehn«, korrigierte Carl, freute sich aber darüber, dass er ihn für älter gehalten hatte.
Louis Dohme nickte. »Du wirkst älter. Ist wohl das Schicksal von uns Erstgeborenen.«
»Und in Amerika hast du dann deine Ausbildung als Apotheker gemacht?«, fragte Carl.
»Ja«, fuhr Louis Dohme fort. »Nach meiner Gehilfenprüfung war ich auf der pharmazeutischen Hochschule in Baltimore. Anschließend habe ich eine Weile als Apotheker gearbeitet. Aber nur sehr kurz.«
»Warum?«, fragte Carl, der vollkommen vergessen hatte, dass er sich gerade auf der Eröffnungsfeier der Fabrik seines Onkels befand. Auch Louis Dohme schien nichts so wichtig zu finden, wie seinem Neffen nun die Geschichte zu erzählen, und er fuhr fort: »Ich hatte das Glück, einen sehr wohlmeinenden Lehrer zu haben, Alpheus Phineas Sharp. Er hat mir zunächst eine Beteiligung angeboten, und seit 1860 produzieren wir als Sharp&Dohme Arzneimittel. Und wir sind damit sehr erfolgreich.« Ernst sah er seinen Neffen an. »Ich biete dir das gleiche an wie dein anderer Onkel Louis«, sagte er. »Komm mit mir nach Amerika. Ich bringe dir alles bei, was du wissen musst.«
Teil 1
1889–1893
1. Kapitel
Berlin, Oktober 1889
Josephine Meister legte den Kopf in den Nacken und genoss die Sonnenstrahlen auf ihrem Gesicht. Nach den vielen Regentagen tat es gut, endlich wieder ein wenig Wärme zu verspüren. Ohnehin liebte sie den goldenen Herbst mit seinen leuchtenden Farben – und ja, sie mochte selbst die Regentage, wenn sie es sich zu Hause mit einer Tasse Tee gemütlich machen konnte.
Sie warf einen zärtlichen Blick in den Kinderwagen, in dem der kleine Julius friedlich schlummerte. Die Händchen lagen, zu Fäusten geballt, rechts und links neben seinem rosigen Gesicht, der winzige Mund machte im Schlaf leichte Nuckelbewegungen. Josephine hatte das Gefühl, ihr Herz müsse überquellen vor lauter Liebe zu diesem Menschlein.
Plötzlich schreckte sie auf. Lautes Klingeln riss sie aus ihren Gedanken. »Passen Sie doch auf«, fluchte eine Männerstimme, und Josephine trat erschrocken einen Schritt zur Seite. Ohne es zu bemerken, war sie mit ihrem Kinderwagen mitten auf der Spur der Pferdebahn zum Stehen gekommen. Hastig schob sie den kleinen Wagen zur Seite, nickte dem Fahrer entschuldigend zu und sah der Pferdebahn seufzend nach. So sehr sie Veränderungen auch liebte: Dass die Pferdebahn nun vermutlich bald nicht mehr durch Berlin fahren würde, erfüllte sie mit großer Wehmut. Eine Fahrt mit der Pferdebahn zählte zu ihren schönsten Kindheitserinnerungen. Einmal in der Woche hatte ihre Tante Berthe sie ausgeführt. Dann waren sie Pferdebahn gefahren, und in der Konditorei des ersten Wiener Cafés in der Kaisergalerie hatte es immer eine heiße Schokolade und ein Stück Kuchen gegeben.
Doch diese Zeiten schienen endgültig vorbei zu sein. Josephine war erwachsen und lebte inzwischen im benachbarten Charlottenburg, Tante Berthe war nach Amerika ausgewandert, die Geschäfte in der Kaisergalerie wechselten immer wieder, und wenn sie ihrem Mann Glauben schenken durfte, dann waren eben auch die Tage der Pferdebahn gezählt. Und so ungern sie es sich eingestand: Es war zu befürchten, dass Carl recht hatte mit seiner Prognose. Schon vor acht Jahren hatte ein Mann namens Werner Siemens in Groß-Lichterfelde die erste elektrische Straßenbahnlinie der Welt eröffnet, seitdem hatte die »Elektrische« die Pferdebahn schon auf zahlreichen Strecken ersetzt. Und seit drei Jahren fuhr am Ku’damm obendrein die Dampfstraßenbahn.
Nachdenklich lenkte Josephine ihre Schritte in Richtung Sophie-Charlotten-Straße. Vor eineinhalb Jahren, kurz nach ihrer Hochzeit, war sie mit Carl in die elegante Neubauwohnung gezogen. Seit einiger Zeit galt es als todschick, hier in Charlottenburg zu leben, das inzwischen von vielen Berlinern gerne zur Sommerfrische besucht wurde. Zu Josephines Leidwesen ging dafür allerdings der ländliche Charme des Städtchens verloren, und immer mehr Häuser wurden gebaut. Andererseits fand sie den Wandel ausgesprochen aufregend und war ihrer Mutter dankbar, dass sie ihnen die großzügige Wohnung in der Beletage zur Hochzeit geschenkt hatte. Carl war ebenso dankbar, aber auch peinlich berührt gewesen. Denn anders als Josephine kam er keineswegs aus einem reichen Elternhaus, und wenn er auch glücklich darüber war, dass ihre Mutter in ihre Liebesheirat, die alles andere als standesgemäß war, eingewilligt hatte, so schämte er sich seiner Schwiegermutter gegenüber doch für seine Herkunft als Bäckerssohn. Da konnte Josephine noch so oft sagen, dass es ihrer Mutter darauf ankam, dass ihre Tochter glücklich war.
Ein Mann habe für seine Familie Sorge zu tragen, erwiderte Carl dann. Es könne nicht angehen, dass sie wieder und wieder Unterstützung von ihrer verwitweten Mutter erhielten.
»Ich werde dir ein Leben bieten, das mindestens dem entspricht, das du von zu Hause gewohnt bist, Liebling«, hatte er ihr versprochen und jeden Widerspruch im Keim erstickt. Und er meinte es durchaus ernst mit seinem Versprechen. »Du wirst schon sehen, Phinchen«, sagte er ein ums andere Mal. »Bis zu meinem dreißigsten Geburtstag bin ich ein gemachter Mann. Meine Onkel sind schließlich auch sehr erfolgreich.«
Josephine ahnte, dass die Tatsache, dass Carls Familie nicht nur seinen Vater, den einfachen Bäckermeister, sondern auch sehr erfolgreiche Unternehmer hervorgebracht hatte, ihn ein wenig unter Druck setzte – als hätte er die Verpflichtung, ebenso erfolgreich zu sein. Sie allerdings fand das Vorbild der Onkel eher beunruhigend. Schließlich war der eine, ein Seidenfabrikant, nicht gerade freundlich zu seinen Arbeitern, und ein weiterer, der Marzipan-Fabrikant Louis Meister war vor fünf Jahren mit nur neununddreißig gestorben. Er sei schwer krank gewesen, hatte Carl ihr erzählt, und dass ihn der Tod des Onkels, der in ihm immer einen Sohn gesehen habe, sehr getroffen habe. Doch Josephine wurde den Gedanken nicht los, dass Louis Meister einfach zu viel gearbeitet hatte. Und dass er letztendlich daran gestorben war. Da Carl es damals abgelehnt hatte, in die Firma seines Onkels einzutreten, hatte dieser Carls jüngeren Bruder Franz zu sich geholt, und der hatte nun von Louis Meisters Witwe Prokura erhalten. Josephine wusste, dass Carl sich für seinen Bruder sehr freute, hatte aber das Gefühl, dass es ihren Mann umtrieb, dass der Jüngere schon mehr erreicht hatte als er selbst. Doch Carl hatte eben Apotheker werden wollen und seinen Weg zielstrebig verfolgt: Nach seiner Lehre war er auf Wanderschaft gegangen, zum Glück, denn sonst hätten sie sich nie kennengelernt. Seine Wanderjahre hatten ihn auch nach Berlin geführt. Der junge Apotheker hatte bei ihrer Mutter Charlotte ein günstiges Zimmer genommen, und Josephine hatte sich sofort in ihn verliebt. Nach seiner Promotion in Botanik – er hatte noch ein Studium an die Apothekerlehre angehängt – hatten sie geheiratet und sich hier niedergelassen, wo sich Carl, getrieben von Ehrgeiz, gleich an einem Unternehmen beteiligte, das die Einrichtungen für Apotheken und chemische Firmen vertrieb. Aber insgemein träumte er davon, eine Apotheke sein Eigen zu nennen, denn die könne zur Goldgrube werden. Und zwar dann, wenn es in ebenjener Apotheke etwas zu kaufen gab, was man sonst nirgendwo erwerben konnte. Eine Erfindung, nach der die Leute buchstäblich verrückt waren.
»Weißt du, Phinchen«, sagte er stets, »die Praline ist auch in einer Apotheke erfunden worden und heute ein Verkaufsschlager. Den brauchen wir auch.«
Nur um was für einen Verkaufsschlager es sich handeln könnte, darüber war sich Carl noch nicht im Klaren. »Es muss irgendetwas sein, das das Leben schöner macht. Wie die Praline. Und wenn es das Leben nicht schöner macht, dann sollte es das Leben doch zumindest leichter machen.«
2. Kapitel
Berlin, Oktober 1889
Inzwischen war Josephine vor dem prachtvollen Belle-Epoque-Haus angekommen, das sie bewohnten. Sie zog den Schlüssel aus ihrer Handtasche und öffnete die Haustür. Es kostete sie einige Anstrengung, den Kinderwagen über die beiden steinernen Eingangsstufen ins Innere zu wuchten. Ihn in den ersten Stock zu tragen, brauchte sie gar nicht erst versuchen. Zum Glück pflegte sie ein ausgesprochen freundliches Verhältnis mit den Nachbarn, die den kleinen Julius allesamt vergötterten und sich deshalb nicht im Mindesten an dem Kinderwagen störten, der nun immer neben der Haustür stand. Trotzdem dachte Josephine voller Sehnsucht an die Paternoster, die der letzte Schrei waren und in einem Kontorhaus nach dem anderen Einzug hielten. Bis es so weit war, sich diesen Luxus auch in Privatwohnhäusern zu leisten, würde es wohl noch eine ganze Weile dauern, wenn es überhaupt jemals so weit kommen würde, fürchtete Josephine, während sie, ihr kleines, warmes Bündel im Arm, die Treppen nach oben stieg.
»Da sind wir wieder!«, rief sie kurz darauf, als sie die Wohnungstür aufschloss.
»Wir sind im Wohnzimmer!«, hörte sie die Stimme ihres Gatten. Überrascht runzelte sie die Stirn. Carl war meist entweder in seinem Arbeitszimmer anzutreffen, wo er über seinen Büchern brütete, oder in der Küche beim Experimentieren. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie ihren Mann das letzte Mal im Wohnzimmer gesehen hatte – und schon gar nicht mit Besuch.
Eilig ging sie, den kleinen Julius auf dem Arm, zur Wohnzimmertür. Ihr Mann erhob sich bei ihrem Anblick, ebenso der Gast, der ihr strahlend entgegenblickte.
Er war groß, schlank, hatte dunkles, gewelltes Haar und sah Carl erstaunlich ähnlich.
»Guten Tag?«, sagte Josephine fragend.
»Liebling!« Carl eilte ihr entgegen, küsste sie überschwänglich auf den Mund und nahm dann den kleinen Julius auf den Arm. »Wir haben Besuch.«
»Das sehe ich«, erwiderte sie und lächelte den Fremden an. Der machte einen Schritt auf sie zu und küsste ihre Hand. »Angenehm«, sagte er. »Ich bin Louis Dohme. Carls Onkel.«
»Natürlich!«, rief Josephine erfreut. »Der Onkel aus Amerika. Carl hat mir schon so viel von dir erzählt.«
Sie wusste, dass Louis ihren Gatten seinerzeit eingeladen hatte, zu ihm nach Amerika zu kommen. Carl hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als der Einladung zu folgen, am Ende aber aus Rücksicht auf seine Mutter abgelehnt. »Sie hätte mich niemals darum gebeten, nicht zu gehen«, hatte er Josephine berichtet. »Aber als ich davon anfing, ist sie richtig in sich zusammengefallen. Sie hatte ja schon drei Kinder verloren.«
Diese Rücksichtnahme hatte Josephine zutiefst gerührt.
Nun sah sie ihren Mann vorwurfsvoll an. »Warum hast du denn nicht erzählt, dass Louis uns besucht? Ich hätte doch etwas vorbereitet.«
»Weil ich es selbst nicht wusste«, erklärte Carl und klopfte seinem Onkel lachend auf die Schulter. »Das ist typisch für meinen lieben Louis. Immer für eine Überraschung gut. So war er schon immer.«
Der andere erwiderte das Lachen. »So ist das Leben doch viel spannender«, fand er. »Du hättest mal das Gesicht deines Mannes sehen sollen, als ich plötzlich vor ihm stand.«
»Das kann ich mir vorstellen«, sagte Josephine und schmunzelte, der Verwandte aus Amerika war ihr sogleich sympathisch. Zumal Louis seine Aufmerksamkeit inzwischen dem kleinen Julius zugewandt hatte und ihm ganz sacht über die rosige Wange strich.
»Er ist bezaubernd«, flüsterte er.
»Ja, das ist er«, bestätigte Josephine. »Er ist unser ganz großes Glück.«
»Eines Tages werde ich selbst Vater sein«, sagte Louis sehnsüchtig. »Darauf freue ich mich schon heute.«
Josephine sah den Onkel ihres Mannes zweifelnd an. Dem Aussehen nach war er sicherlich schon über fünfzig, und sie fragte sich, ob sein Wunsch noch in Erfüllung gehen würde. Doch sie sagte nichts.
»Darf ich euch denn wenigstens jetzt etwas anbieten?«, fragte sie stattdessen.
»Gleich, Liebling«, sagte Carl mit einem Funkeln in den Augen. »Zuallererst muss ich dir etwas zeigen. Louis hat mir nämlich etwas aus Amerika mitgebracht. Im Grunde ist es das, wonach ich immer gesucht habe. Ärgerlich ist nur, dass ich es nicht selbst erfunden habe. Immerhin: Hier in Deutschland kennt es kaum einer, und ich werde die Zusammensetzung herausfinden.«
»Nun sag doch endlich, um was es geht?«, unterbrach Josephine lachend seinen Redeschwall. Ihr Mann war ein widersprüchlicher Charakter. Die meisten kannten nur den ernsthaften, sehr strebsamen, manchmal etwas brummigen Carl Meister. Sie aber wusste, dass er auch voller Elan und Leidenschaft sein konnte, und sie liebte ihn dafür, wie sehr er sich für seine Arbeit begeisterte und mit welchem Engagement er seinen Traum verfolgte, eine bahnbrechende Erfindung zu machen. Sie war überzeugt, dass ihrem Mann eines Tages der große Durchbruch gelingen würde. Und sie war erleichtert, dass es nun nicht mehr unbedingt Arzneimittel sein mussten. Sie hatte das Gefühl, je länger der Tod seiner Geschwister zurücklag, desto freier werde er von diesem Zwang und desto offener könne er für alles sein, was das Leben ihm schenkte.
»Setz dich«, sagte er nun und zog den Stuhl zurück. Erst jetzt bemerkte Josephine die schöne und schwere Glasflasche auf dem Esstisch. Sie war geöffnet, ein wenig weißes Pulver lag verstreut darum herum.
»Was ist das?«, fragte sie neugierig.
»Das«, sagte Carl feierlich, »ist Backtriebmittel.«
»Backtriebmittel«, wiederholte Josephine nüchtern.
»Ja!«, rief Carl. »Dass ich darauf nicht eher gekommen bin! Ich kenne es von meinem Vater. Er hat es in seiner Bäckerei benutzt.«
»Und was macht man damit?«
»Mit Backtriebmittel«, erklärte Carl feierlich, »wird das Gebäck doppelt so groß. Und schön leicht und locker. Der Brotteig braucht etwas, um aufgelockert zu werden, sonst ist es nur ein harter Klumpen. Dazu kann man zwar Hefe oder Sauerteig nehmen, aber das ist furchtbar umständlich. Im Grunde geht es darum, dass beim Backen Gase entstehen. Und das funktioniert mit Backtriebmittel viel einfacher.« Er hob den Finger und zitierte scherzhaft: »Mit Backtriebmittel schmeckt der Kuchen wie vom Bäcker.«
»Das klingt toll«, sagte Josephine vorsichtig. »Aber was ist so aufregend daran, wenn es das Backtriebmittel doch schon gibt?«
Carl beugte sich vor und sah seiner Frau in die Augen. »Backtriebmittel gibt es bisher nur in Bäckereien oder sehr teuer in den Kolonialwarenläden«, erklärte er. »Die meisten Menschen kennen es nicht.«
»Und das heißt?«
»Mensch, Phinchen, du bist doch sonst auch nicht so schwer von Begriff«, rief Carl. »Ich werde selbst ein Backtriebmittel herstellen. Und das werden wir dann in unserer Apotheke verkaufen. Wir werden die Ersten sein, bei denen man Backtriebmittel für zu Hause günstig bekommt. Und zwar in einer Variante, die einfach anzuwenden ist.«
Josephine nickte. »Das könnte funktionieren.« Dann sah sie den Onkel ihres Mannes fragend an. »Und seit wann gibt es dieses wundersame Backtriebmittel?«
Louis, der sich während Carls Erläuterungen im Hintergrund gehalten und nach dem Händchen des kleinen Julius gegriffen hatte, zuckte die Achseln. »In England ist man schon Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Idee gekommen, in den Teig Substanzen zu geben, die Kohlendioxyd bilden. Und auch in Deutschland gab es einen Mann, der sich intensiv mit dem Backtriebmittel befasst hat. Ihr habt vielleicht schon einmal von ihm gehört. Sein Name ist Justus von Liebig.«
Josephine zuckte nur die Achseln, doch Carl nickte.
»Ein ziemlich bekannter Wissenschaftler.«
»Aber wenn sich so ein bekannter deutscher Wissenschaftler schon damit auseinandergesetzt hat – wird es dann keinen Ärger geben, wenn du das nun verfolgst?«
Carl schüttelte ungeduldig den Kopf. »Bei seinem Mittel gab es Probleme mit der Haltbarkeit, und daher eignet es sich nicht«, sagte er.
»Sein Schüler ist allerdings schon erfolgreich damit, aber in Amerika«, wusste Louis Dohme. »Er heißt Eben Norton Horsford, und nach seiner Rückkehr in die Staaten stellte er ein Backtriebmittel aus Natron und Weinsäure her.« Louis grinste. »Und inzwischen ist er Millionär.«
»Na, siehst du!« Carl warf Josephine einen triumphierenden Blick zu.
»Dann werde ich uns jetzt wohl mal Kaffee kochen«, sagte sie und lächelte Carls Onkel an. »Und wenn du das nächste Mal kommst, dann wird Carl sein Backtriebmittel schon erfunden haben, und ich werde dir ganz mühelos einen Kuchen zaubern können.«
»Das ist es!« Carl hieb mit der flachen Hand begeistert, aber so heftig auf den Tisch, dass das Pulver durch die Luft schwirrte und der kleine Julius erschrocken sein Gesicht verzog.
»Mensch, Phinchen, du bist genial.«
»Warum?«, fragte sie lachend. »Was habe ich denn so Geniales gemacht?«
»Na, das ist die Geschichte, die wir den Leuten erzählen müssen, damit sie es kaufen«, rief er. »Diese Situation kennt doch jede Hausfrau, zumindest dann, wenn sie keine Dienstboten hat.«
Josephine musste lächeln. In dem großbürgerlichen Haushalt, in dem sie aufgewachsen waren, hatten sie ganze Heerscharen von Dienstboten beschäftigt, und sie war wie selbstverständlich davon ausgegangen, dass sie auch als Carls Frau über Dienstboten verfügen würde. Doch da hatte ihr Gatte nicht mitgemacht. »Ich habe sowieso schon ein schlechtes Gewissen, dass wir uns von meiner Schwiegermutter aushalten lassen«, hatte er gesagt. »Sie stellt uns doch schon die Wohnung. Und nun soll sie auch noch das Personal übernehmen? Ich würde mir schändlich vorkommen.«
»Aber …«, hatte Josephine erwidert, »aber wer soll denn sonst den Haushalt übernehmen? Ich kann doch gar nicht kochen.«
»Phinchen«, hatte er zärtlich gesagt, ihr über die Wange gestreichelt und sie mit diesem liebevollen Blick angesehen, dem sie so schlecht widerstehen konnte. »Phinchen, ich weiß, dass ich dir viel abverlange. Und ich verspreche dir, wenn ich selbst für uns sorgen kann – und das wird nicht mehr allzu lange dauern –, kannst du so viele Dienstboten bekommen, wie du nur möchtest. Aber bis dahin … könntest du es vielleicht versuchen, mit dem Haushalt?«
Josephine hatte seinem treuherzigen Blick nicht widerstehen können. Und sie musste sich eingestehen, dass sie sich auf die Herausforderung freute. Es gefiel ihr, dass ihr Mann so stolz und so ehrgeizig war. Außerdem wollte sie ihn auf dem Weg, den er gewählt hatte, und den sie gut fand, so gut sie nur konnte, unterstützen.
Schließlich hatten sie sich auf einen Kompromiss geeinigt. Josephines Mutter war besorgt um das Wohl ihrer Tochter, wenn diese nun all die Aufgaben im Haushalt übernehmen müsse, und sie hatte gedroht, ihre Zustimmung zur Hochzeit zu verweigern, und das, obwohl Josephine bereits in anderen Umständen war. In der Folge hatten sie ein Mädchen eingestellt, das reinemachte und sich um die Wäsche kümmerte, und Josephine hatte in der Küche die Herrschaft übernommen – und große Freude daran gefunden, ihren Mann zu versorgen. Für den Anfang hatte sie mit der Köchin ihrer Mutter, Frau Rentlein, in deren Küche sie als Kind so manche Leckerei verspeist und so manche heiße Schokolade getrunken hatte, die heimliche Verabredung getroffen, dass diese immer etwas zu essen bereithalten und rasch vorbeibringen würde, sollte es einmal schiefgehen. Josephine wollte sich vor ihrem Carl nicht blamieren. Aber es ging nie schief. Und inzwischen hatte sie sich an ihre neue Rolle gewöhnt und viel Selbstsicherheit gewonnen.
»Dann gehe ich jetzt mal Kaffee kochen«, verkündete sie nun und entschwand nach nebenan in die Küche.
Auch wenn Carl sein Backtriebmittel noch nicht erfunden hatte, konnte Josephine eine gute Gastgeberin sein. Erst gestern hatte ihr Frau Rentlein, als Josephine mit dem kleinen Julius ihrem Elternhaus einen Besuch abgestattet hatte, eine Dose mit dem herrlichen Buttergebäck zugesteckt, das sie nun zusammen mit dem frisch aufgebrühten Kaffee servierte.
»Warum bist du denn eigentlich hier?«, fragte sie Louis, als sie wenig später beim Kaffee saßen. »Du bist doch sicher nicht nur gekommen, um deinem Neffen eine Flasche Backtriebmittel zu bringen?«
»Nein, das bin ich in der Tat nicht«, bestätigte er lachend. »Ich war schon so lange nicht mehr in meiner alten Heimat – da hatte ich Sehnsucht. Außerdem wird mein bester Freund, der hier in Berlin lebt, in Kürze fünfzig Jahre alt, und wenn er auch nur im kleinen Kreis feiert, wollte ich doch dabei sein.«
»Heinrich Braunbarth wird schon ein halbes Jahrhundert alt?«, fragte Carl erstaunt. »Unglaublich, wie schnell die Zeit vergeht. Bitte richte ihm meine herzlichsten Glückwünsche aus.«
»Das werde ich«, versprach Louis. »Dass ich gerade jetzt in Berlin bin, hat aber noch einen anderen Grund«, gestand er dann. »Ich hatte gelesen, dass der russische Zar kommen wird. Und da dachte ich, vielleicht habe ich ja Glück und bekomme ihn zu Gesicht.«
Lachend schüttelte Carl den Kopf. »Mein Onkel hat schon von jeher eine mir unerklärliche Faszination für die Romanows«, sagte er.
»Ich kann ihn da gut verstehen«, sprang Josephine ihm bei. »Ich finde es ebenfalls sehr aufregend, dass der Zar nach Berlin kommen wird. Im Hause meiner Mutter herrscht deshalb auch große Aufregung. Sie hat angewiesen, dass wir an dem Tag flaggen, denn der Festzug kommt durch die Straße, in der sie jetzt lebt.«
»Tatsächlich?«, rief Louis mit leuchtenden Augen aus. »Ob es möglich wäre, dass ich …«
»Aber natürlich«, antwortete Josephine auf die unausgesprochene Frage. »Du gehörst doch zur Familie.«
»Danke.« Louis wirkte beinahe gerührt.
»Allerdings weiß man immer noch nicht, wann er denn nun genau kommt. Aber auf jeden Fall in Begleitung seiner Frau, wenn ich es richtig weiß. Ich werde dich sofort informieren, wenn ich Näheres erfahre.«
Dann fiel ihr Blick wieder auf die Glasflasche mit dem Backtriebmittel, das immer noch auf dem Tisch stand. Rumford yeast powder, las sie. »Was bedeutet denn yeast?«
»Hefe«, übersetzte Louis.
»Aber es ist doch gar keine Hefe?«, fragte Josephine.
»Das stimmt«, bestätigte Carl. »Es dürfte Kaliumhydrogencarbonat oder Natriumhydrogencarbonat sein. Aber es hat eben eine ähnliche Wirkung. Durch Wärme entwickelt sich Gas, und dieses sorgt dafür, dass das Gebäck aufgeht, genau wie bei Hefe, und die kennen und verstehen die Leute. Deshalb haben sie es vermutlich so genannt.«
Josephine nickte. Das leuchtete ihr ein. »Und dieser Rumford hat also eine Fabrik für dieses yeast powder?«, fragte sie interessiert.
»In der Tat«, bestätigte Louis und biss genussvoll in einen von Frau Rentleins Keksen. »Eine ziemlich große und erfolgreiche sogar. Er selber heißt aber nicht Rumford, sondern es handelt sich um jenen Eben Norton Horsford, der das Backtriebmittel auch erfunden hat und der inzwischen Millionär ist. Er hat einen Partner namens George Francis Wilson«, lüftete er grinsend das Geheimnis des Namens.
»Ach so!«, rief Josephine. »Jetzt verstehe ich das alles.«
»Er produziert allerdings vor allem für Bäckereien«, ließ sich Carl vernehmen. »Nicht für die Hausfrau, so wie ich das vorhabe.«
»In Amerika waren es aber nicht die Bäckereien, sondern der Sezessionskrieg, der der Fabrik zum Durchbruch verholfen hat«, fuhr Louis fort.
»Ein Krieg verhilft einer Backzutat zu einem Durchbruch?«, fragte Josephine erstaunt. »Warum denn das?«
»Damit ist es wesentlich leichter«, mischte sich nun Carl ins Gespräch, »Backwaren industriell herzustellen braucht weniger Leute. Und die Kapazitäten der Bäcker wurden im Krieg woanders gebraucht als an den Backöfen …«
3. Kapitel
Berlin, Oktober 1889
Und du bist sicher, dass du uns nicht begleiten möchtest?«, fragte Josephine ihren Mann, als sie am Mittag des 12. Oktober ihre Tasche packte. Am kommenden Morgen war es endlich so weit: Der Zar würde in Berlin eintreffen, und da die Straßen abgesperrt wären, hatte Josephine beschlossen, schon am Vortag zu ihrer Mutter in die Wilhelmstraße zu fahren. Gleich würde die Kutsche kommen und sie und den kleinen Julius abholen. Dann würden sie Louis in seinem Domizil einsammeln. Im Gegensatz zu ihrem Mann besaß Louis’ Familie offenbar viel Geld, zumindest übernachtete er in einer gerade frischgebauten Villa im angesagten Viertel Lichterfelde. Hier genoss seine Familie die Wochenenden in dem großen parkartig angelegten Garten, wenn sie in Deutschland weilte.
»Ich bin ganz sicher«, versicherte Carl und küsste seine Frau zum Abschied. »Zum einen muss ich dringend die Bücher meiner Firma durchsehen, zum anderen will ich die Gelegenheit nutzen, ein wenig zu experimentieren. Ich habe mir nun alle Materialien besorgt, die ich benötige, um Backtriebmittel herzustellen.«
»Aber bis du den ersten Kuchen damit backst, wartest du auf mich, ja?«, bat sie ihn.
»Sagst du das nun aus Sorge um deine Küche?«, neckte er sie.
»Wenn schon, dann aus Sorge um dich«, stellte sie richtig. »Aber das ist es nicht mal.«
»Was ist es dann?«
Liebevoll sah sie ihn an. »Du bist ein großartiger Mann, Carl«, sagte sie. »Ich glaube an dich und an deine Ideen. Und ich glaube, dass du Erfolg haben wirst. Deshalb ist die Sache mit dem ersten Kuchen ein großer Moment. Und den würde ich gern mit dir teilen.«
Er zog sie in seine Arme, um sie zu küssen. »Was habe ich doch für ein Glück mit dir«, sagte er. »Ich glaube, nicht viele Ehemänner haben derart verständnisvolle Ehefrauen, die auch noch freiwillig auf so viel Komfort verzichten.«
»Komfort ist mir nicht wichtig«, versicherte sie und hob Julius aus seiner Wiege. Während Carl seinen Sohn küsste, wiederholte sie ihre Frage: »Möchtest du nicht doch mitkommen? Es ist sicherlich das einzige Mal in deinem Leben, dass du Gelegenheit hast, den Zaren aus nächster Nähe zu sehen.«
Doch Carl blieb bei seiner Meinung. »Das würde mich nur interessieren, wenn der Zar Kuchen essen würde«, erklärte er grinsend. »Gebacken mit meinem Backtriebmittel.«
• • • •
Josephines Elternhaus erhob sich als prachtvoller Bau direkt an der Wilhelmstraße. Wie jedes Mal verspürte Josephine ein leichtes Herzklopfen, als sie die vertrauten Steinstufen emporstieg. Sosehr sie Carl und ihr Leben an seiner Seite auch liebte: Nach Hause zu kommen – und als Zuhause bezeichnete sie das Haus ihrer Mutter immer noch – war und blieb einfach wunderbar. Umsorgt zu sein. Sich um nichts kümmern zu müssen. Hier hätte sie sich nie Gedanken machen müssen, wie sie den Kinderwagen nach oben bekäme, die Diener hätten sich nur zu gern darum gekümmert. Einen Kinderwagen hatte sie heute zwar nicht dabei, aber Nanette, ihr altes Kindermädchen, durch deren brünette Haare sich immer mehr graue Strähnen zogen, kam ihr schon in der Eingangshalle entgegengeeilt.
»Da ist er ja, unser Prinz!«, rief sie, nachdem sie Josephine und Louis begrüßt hatte. »Darf ich?«
Sehnsuchtsvoll streckte sie die Arme nach dem Kleinen aus, und Josephine legte ihn in die erfahrenen Hände der Amme. Sie wusste, wie traurig Nanette über ihren Auszug gewesen war – und vor allem über die Tatsache, dass Josephine und Carl nach der Hochzeit nicht in der Berliner Villa wohnen geblieben waren. Zu gern hätte sie sich um den kleinen Julius gekümmert. Zumal Josephines jüngerer Bruder Fritz nun auch schon fast erwachsen war und Nanette nicht mehr gebraucht wurde. Josephine wusste, dass ihre Mutter ihre treue Angestellte niemals entlassen würde, aber sie wusste ebenso gut, dass Nanette sich bei dem Gedanken, Almosen zu bekommen, furchtbar fühlte. Wer weiß, wenn Carl mit seiner neuen Idee erfolgreich wäre, könnten sie vielleicht Nanette zu sich holen, dachte Josephine, während sie Louis voraus weiter in den Salon eilte, wo sie ihre Mutter vorzufinden hoffte. Sie pflegte die späte Vormittagsstunde dort meistens mit einem Buch oder einer Stickerei zu verbringen oder ihre Korrespondenz zu erledigen.
Tatsächlich saß Charlotte Behn mit einem Buch am Fenster. Sie trug ein zartgrünes Nachmittagskleid, das am Kragen mit Spitzen besetzt war und das ihr, wie Josephine fand, ausnehmend gut stand. Charlotte bemerkte sie nicht sofort, als sie eintraten, und wie so oft dachte Josephine auch jetzt wieder, wie wunderschön ihre Mutter war. Mit ihren gut vierzig Jahren hatte Charlotte Behn nichts von ihrer mädchenhaften Grazie eingebüßt, das blonde Haar trug sie stets aufgesteckt, die Locken, die sich aus der Frisur lösten und ihr Gesicht umspielten, ließen sie verträumt wirken.
Mit einem Blick auf Louis bemerkte Josephine, dass dieser von ihrer Mutter ebenso hingerissen war wie die meisten Menschen, ein Gefühl, das sich bei jenen, die Charlotte Behn besser kennenlernten, noch zu verstärken pflegte. Charlotte war nicht nur eine Schönheit, sondern hatte auch ein zwar stilles, aber dennoch sehr einnehmendes Wesen und eine ausgesprochen warmherzige Ausstrahlung. Josephine hatte oft den Eindruck, dass ihre Mutter, obgleich sie furchtbar unter dem Tod ihres Mannes gelitten hatte, ganz und gar in sich selbst ruhte.
»Mama?«, machte Josephine nun auf sich aufmerksam, und Charlotte schrak leicht zusammen, um sich dann rasch zu erheben und ihr entgegenzueilen.
»Liebes!«, rief sie, während sie ihre Tochter rechts und links auf die Wange küsste. »Da bist du ja schon. Ich habe über dieser spannenden Lektüre vollkommen die Zeit vergessen.«
Mit einem Blick auf den Buchrücken sah Josephine, dass ihre Mutter das Werk des Vorlesers der Deutschen Kaiserin Augusta, Jules Laforgue, las, Berlin. Der Hof und die Stadt 1887.
Charlotte Behn richtete ihren Blick auf ihren Gast.
»Willkommen, werter Herr Dohme«, begrüßte sie ihn. »Ich muss gestehen, dass ich ob Ihres Besuchs ein wenig aufgeregt bin.«
»Oh«, machte Louis hilflos, und Josephine musste ein Schmunzeln unterdrücken. Wie die meisten Männer, die ihre Mutter zum ersten Mal sahen, schien sich Louis Hals über Kopf in sie verliebt zu haben. Und wie bei den meisten Begegnungen hatte Charlotte keine Ahnung von ihrer Wirkung auf ihr Gegenüber. Einen neuen Mann gab es nicht in ihrer Welt, aber Charlotte hatte ein großes Interesse für Menschen, und das zeigte sie auch.
»Wir hatten nämlich noch nie Besuch aus Amerika«, plauderte sie jetzt weiter und nahm Louis beim Arm, um ihn zu dem zierlichen Tisch zu führen, auf dem Tee und Gebäck bereitstanden. »Diese Tage sind also doppelt aufregend für uns. Ein Amerikaner im Haus, und draußen fährt der russische Zar vorbei. Darf ich Ihnen etwas anbieten?«
»Gern«, sagte Louis und wirkte überfordert, da fragte Charlotte ihre Tochter: »Wo hast du denn eigentlich meinen süßen Enkel gelassen?« Gleich darauf wandte sie sich wieder an Louis. »Können Sie das glauben, dass ich schon Großmutter bin?«
»Sie … eh … Sie sehen wirklich nicht aus wie eine Großmutter«, erwiderte der arme Louis verlegen, während Josephine ihm zu Hilfe eilte und hastig ergänzte: »Nanette hat ihn mir schon in der Eingangshalle abgenommen.«
»Unsere gute Nanette«, sagte Charlotte liebevoll. »Wir haben wirklich Glück mit unserem Personal.«
Nachdem sie wenig später ihren Tee ausgetrunken hatten, stellte Charlotte ihre Tasse ab.
»Ich werde Agathe nun bitten, unserem Gast sein Zimmer zu zeigen.«
»Das ist sehr freundlich, vielen Dank«, erwiderte Louis und erhob sich höflich.
»Wir sehen uns dann um sieben Uhr zum Abendessen im Speisesaal«, ergänzte Josephine. »Ich zeige ihn dir gleich mal, damit du dich nachher nicht verläufst.«
4. Kapitel
Berlin, Oktober 1889
Das heißt es also, Blut und Wasser zu schwitzen, dachte Carl, während er fassungslos eine Seite nach der anderen prüfte und verzweifelt feststellen musste, dass das, was anfangs nur leicht bedrohlich ausgesehen hatte, sich zu einer ausgemachten Katastrophe auszuwachsen schien. Dass Josephine die Nacht mit dem Kleinen bei ihrer Mutter verbrachte, war ihm, sosehr er seine Frau auch liebte und so gern er sie um sich hatte, sehr recht gewesen, denn er wusste, dass er nicht länger die Augen vor dem Problem verschließen konnte. Er musste sich der unangenehmen Tatsache stellen, dass es schlecht um seine Firma stand. Und er hatte keine andere Wahl, als sich endlich, endlich, mit den Büchern zu beschäftigen. Die offenbarten ihm nun aber eine Wahrheit, die schlimmer war als seine Befürchtungen. Das kleine Unternehmen, an dem er beteiligt war und das Apotheken und Laboratorien ausstattete, war schlicht nicht mehr zu retten.
Carl stöhnte auf und vergrub die Hände in den Haaren. Seine Gedanken rasten, suchten verzweifelt einen Ausweg – und fanden keinen. Das Ende der Hoffnung traf ihn wie eine Keule. Und dann sah er ihr Gesicht vor sich, ihr leuchtendes Gesicht, die grünen, seelenvollen Augen unter dem kastanienbraunen Haar, das, wenn die Sonne darauf fiel, rötlich leuchtete. Wie sie voller Vertrauen zu ihm aufblickte. Sie hatte ihr Leben in seine Hände gegeben. Und er musste sie nun so bitter enttäuschen. Die Scham kroch in ihm empor, ergriff von ihm Besitz, lähmte ihn. Wie würde sie reagieren, wenn er ihr sagte, dass es keine Hoffnung mehr gab? Dass sie einen Versager geheiratet hatte?
Mit einem wütenden Aufschrei fegte er die Papiere vom Tisch, Bogen für Bogen segelte dem Boden entgegen. Carl starrte die verstreuten Papiere an. Dann fiel sein Blick wieder auf die Glasflasche und ihren Erfolg versprechenden Inhalt.
Nachdenklich nahm er sie, ruhiger nun, in die Hand. Ob hierin die Zukunft läge? Er spürte, dass sich ganz leise und zaghaft der Hauch von Hoffnung und Zuversicht in ihm auszubreiten begann. Er war ein Versager, das stand ganz außer Frage. Aber das musste Josephine ja nicht wissen. Wenn es ihm gelänge, die Mischung herauszufinden und im großen Stil an den Mann – oder an die Frau – zu bringen, dann hätte die Tatsache, dass er seine Firma aufgeben musste, einen ganz anderen Charakter. Dann würde er das tun, weil er etwas anderes entdeckt hatte, etwas, das noch erfolgsversprechender war. Dann stünde er vielleicht nicht da wie ein Versager.
Carl Meister hatte seinen Vater immer geliebt, den rechtschaffenen und ein wenig einfachen Brotbäcker aus Obernkirchen. Aber er gestand sich in diesem Moment ein, dass er sich auch immer ein wenig für ihn geschämt hatte, selbst wenn er sich für diesen Umstand wiederum sich selbst gegenüber schämte. Denn im Gegensatz zu seinen beiden Brüdern, dem stolzen Marzipanhersteller und dem erfolgreichen Seidentuchfabrikanten, hatte es der Bäckermeister nie weit gebracht, und dass sie ein einigermaßen komfortables Leben führen konnten, war nur dem Erbe der Mutter zu verdanken gewesen. Wieder und wieder hatte Carl gedacht, dass er es einmal weiter bringen würde als der Vater. Und dass er auf keinen Fall vom Geld seiner Frau leben wollte.
Dass er sich dann ausgerechnet in die Tochter einer reichen Frau verliebt hatte – und sie sich in ihn – war zwar schön, setzte ihn aber auch unter einen gewissen Druck, es noch weiterzubringen. Während seine Gedanken auf die Reise gegangen waren, hatte er die ganze Zeit über die kleine Flasche angestarrt. Nun stand er kurz entschlossen auf, brachte sie in die Küche und stellte sie auf den Tisch. Dann ging er nach nebenan in die Abstellkammer, in der sich in einer Holzkiste seine kleine Laborausstattung mit einem Mörser, einer Feinwaage und diversen Chemikalien sowie Reagenzgläsern befand.
Mit einem Mal verspürte Carl ein heftiges Herzklopfen. Er schluckte, rieb sich kurz und heftig die Hände, dann nahm er seine Werkzeuge und baute sie fein säuberlich auf dem Küchentisch auf.
Er gab etwas von dem Yeastpulver in ein Reagenzglas und löste es in ein wenig Wasser auf, um zunächst den Säuregrad zu bestimmen. Vorsichtig träufelte er etwas Indikatorlösung in das Reagenzglas und begann jetzt tropfenweise, Natronlauge zuzugeben. Sobald sich die Lösung verfärbte, konnte er den Säuregehalt bestimmen. Auf diese Art würde es ihm hoffentlich gelingen, die Zusammensetzung des Pulvers zu entschlüsseln. Mit vor Konzentration gerunzelter Stirn übertrug er den ermittelten Wert in seine Kladde. Als nächstes wollte er prüfen, ob es sich um Natriumhydrogencarbonat oder um Kaliumhydrogencarbonat handelte. Dazu füllte er etwas von dem weißen Yeastpulver in den Mörser und rieb es mit Hilfe des Pistills noch feiner. Zufrieden stellte er den Mörser zunächst zur Seite und verband die Gaskartusche mit dem Bunsenbrenner. Sobald dieser gezündet hatte, nahm er eine Spatelspitze des feinen Pulvers und hielt es in die Flamme, die sich daraufhin schlagartig gelb verfärbte.
»Na also«, entfuhr es Carl. Voller Genugtuung unterstrich er das Wort Natriumhydrogencarbonat in seiner Kladde. Da sich die Flamme gelb verfärbt hatte, konnte er ausschließen, dass es sich um Kaliumhydrogencarbonat handelte, denn in diesem Fall wäre sie lila geworden. Nun hatte er eine ungefähre Ahnung, wie die Mischung in dem Fläschchen vor ihm zusammengesetzt war, und er machte sich daran, zwei der Bestandteile – Natriumhydrogencarbonat und Weinsäure – zu vermengen. Er war ein wenig nervös, als er die Mischung in das Reagenzglas gab. Dann tropfte er Indikatorlösung hinein und schüttete Natronlauge dazu. Die Mischung in dem Glasfläschchen verfärbte sich sofort rotblau. Verärgert runzelte er die Stirn. Das bedeutete, dass der Säuregrad noch nicht stimmte, sonst hätte die Mischung erst viel später ihre Farbe geändert. Geduld, ermahnte er sich, du musst geduldig sein. Irgendwann wird es stimmen. Er probierte eine Zusammensetzung nach der anderen, doch er fand die richtige Mischung einfach nicht.
Verzweifelt gab er schließlich auf, kämpfte die aufsteigende Wut nieder, vergrub den Kopf in den Händen und schlief, völlig erschöpft, beinahe sofort ein.
• • • •
»Hast du gut geschlafen, Liebes?«, begrüßte Charlotte Behn Josephine am nächsten Morgen im Frühstückszimmer.
»Himmlisch«, seufzte ihre Tochter. »Ich habe zum ersten Mal seit Julius’ Geburt durchgeschlafen.«
»Eine Amme hat eben doch ihre Vorteile«, bemerkte ihre Mutter schmunzelnd und strich sich eine blonde Strähne hinter das Ohr, an dem heute ein hellblauer, tropfenförmiger Topas funkelte.
Nachdem Josephine den Kleinen am späten Abend noch einmal gestillt hatte, hatte Nanette sich nur zu gern bereit erklärt, Julius in der Nacht das Fläschchen zu geben, und Josephine hatte nur sehr kurz gezögert und dann zugestimmt. Wenn es jemanden gab, dem sie ihren kleinen Sohn anvertrauen konnte, dann war es Nanette.
»Ja, eine Amme hat ihre Vorteile, wie so vieles andere in diesem Haus auch«, seufzte Josephine erneut. »So sehr ich meinen kleinen Goldschatz liebe – ich komme zu Hause gar nicht mehr dazu, zu zeichnen, und das habe ich doch früher so gerne getan.
Ihre Mutter sah sie prüfend an. »Bereust du es, dich für ein einfacheres Leben entschieden zu haben?«, fragte sie und legte besorgt ihre Hand auf die ihrer Tochter. »Du kannst jederzeit zurückkehren, das weißt du hoffentlich.«
Josephine schüttelte lächelnd den Kopf. »Nein, Mutter, ich bereue es nicht«, erwiderte sie. »Ich muss zwar gestehen, dass es hier komfortabler ist und ich das auch durchaus genieße, aber ganz so einfach ist unser Leben auch nicht, die meisten Menschen verfügen in unserem Alter nicht über so eine große Wohnung wie wir.«
»Wenn sie aus unseren Kreisen stammen, schon«, korrigierte ihre Mutter. »Aber ich verstehe dich. Du tust das für deinen Mann, und es nötigt mir Respekt ab, dass er selbst für seine Familie sorgen möchte. Außerdem finde ich es schön, dass du das aus Liebe zu ihm respektierst.«
»Und ich finde es schön, dass du dieser nicht standesgemäßen Hochzeit zugestimmt hast«, entgegnete Josephine. »Mir ist bewusst, dass das alles andere als selbstverständlich ist.«
»Weißt du«, sagte Charlotte und rührte nachdenklich in ihrer Tasse, »dein Vater und ich waren sehr glücklich miteinander. Bei uns hat beides gestimmt: Wir waren standesgemäß, aber wir waren auch verliebt, in all den Jahren bis zu seinem Tod. Aber wie viele unglückliche Freundinnen habe ich im Lauf der Jahre getröstet, weil sie einen Mann heiraten mussten, der standesgemäß war, sie aber einen anderen liebten. Das wollte ich dir unbedingt ersparen.«
In diesem Moment öffnete sich die Tür, und Louis kam in Begleitung von Josephines Bruder Fritz herein. Wie schon am Vorabend beim gemeinsamen Abendessen waren sie in ein angeregtes Gespräch vertieft.
»Guten Morgen, die Damen«, strahlte Fritz, der seiner Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten war, und ließ sich auf seinen Stuhl fallen, während Louis offenbar nicht so recht wusste, wie er sich verhalten sollte und etwas verloren herumstand. Josephine hatte den Eindruck, dass ihre Mutter den sonst so selbstbewussten Fabrikanten offenbar nachhaltig verunsichert hatte.
»Fritz«, rügte ihn seine Mutter liebevoll. »Möchtest du Herrn Dohme nicht einen Stuhl anbieten, bevor du dich selbst setzt?«
»Pardon.« Der Zwanzigjährige sprang wieder auf, grinste seinen Besucher an und sagte mit einer leichten Verbeugung: »Bitte sehr, werter Herr Dohme. Nehmen Sie doch Platz.«
Louis musste lachen, was ihn von seiner Verlegenheit befreite.
»Danke sehr«, sagte er und setzte sich.
Auch Fritz nahm wieder Platz und griff hungrig nach einem Brötchen, während Agathe herbeikam, um dem Gast Kaffee einzuschenken.
»Wir sollten uns beeilen«, sagte Fritz kauend. »Gleich geht es los. Habt ihr schon einmal hinausgesehen?«
Josephine schüttelte den Kopf.
»Draußen herrscht das reinste Chaos«, berichtete ihr Bruder und schluckte sein Brötchenstück herunter. »Tausende Schaulustige drängen sich hinter den Absperrungen.«
»Und wir müssen einfach nur aus dem Fenster sehen«, rief Josephine begeistert aus.
Fritz bedachte seine Schwester mit einem spitzbübischen Blick, während Louis etwas gestelzt sagte: »Ich möchte nochmals meinen Dank dafür zum Ausdruck bringen, dass ich diesem bedeutenden Ereignis in Ihrem Hause beiwohnen darf.«
»Aber ich bitte Sie«, ließ Charlotte sich vernehmen. »Das ist doch selbstverständlich.«
Kurz darauf hatten sie das Frühstück beendet und an den großzügigen Fenstern in der im Hochparterre gelegenen Bibliothek Position bezogen. Josephines Mutter gestattete dem Personal, die Arbeit für die Zeit des Ehrenmarschs ruhen zu lassen, um ebenfalls Zeugen dieses historischen Ereignisses werden zu können. Einzig Nanette hatte abgewinkt. »Was interessiert mich der Zar, wenn ich doch diesen kleinen entzückenden Jungen habe?«, hatte sie gesagt und Julius auf sein Näschen geküsst. »Lassen Sie mich nur nach ihm sehen, dann können Sie sich auf den Zaren konzentrieren.« Josephine hatte nur zu gern zugestimmt. Sosehr sie ihren Kleinen liebte – es war auch einmal angenehm, tun und lassen zu können, was sie wollte.
»Es geht los«, verkündete ihre Mutter in diesem Moment und drückte Josephines Hand.
Von der Straße her ertönten Fanfaren, und die Menge, die sich hinter den Absperrungen drängte, brach in lauten Jubel aus.
»Da kommen sie.« Aufgeregt deutete Josephine auf die erste der drei Kutschen, die zwischen unzähligen Kürassieren und Ulanen durch das Spalier aus Truppen und Zuschauern fuhren.
»Sie wollen zur russischen Botschaft. Dort empfängt der Botschafter den Zaren und den Kaiser zu einem feierlichen Frühstück«, ließ sich Fritz Behn vernehmen.
»Und das Wetter ist auch hervorragend«, freute sich seine Mutter, als sei das allein ihr Verdienst. »Berlin zeigt sich seinem hohen Besuch heute wahrlich von der allerbesten Seite und im allerschönsten Kleide.«
»Wer sitzt denn nun in welcher Kutsche?«, wollte Josephine wissen.
Darüber konnte Louis aufklären, der im Vorfeld alles über den Zarenbesuch gelesen hatte, was er in die Finger bekommen konnte. »Der Kaiser fährt mit dem Zaren im vorderen Wagen«, erklärte er. Und dann hatten sie das Glück, dass das Gefährt unmittelbar vor ihrem Fenster zum Stehen kam. Dass die Bibliothek im Hochparterre lag, bedeutete, dass sie über die Köpfe der Schaulustigen einen guten Blick in die Kutsche hatten.
»Der Zar ist zum Greifen nah. Das hätte ich mir nicht träumen lassen«, flüsterte Louis ergriffen.
»Er hat sich seit dem letzten Mal kaum verändert«, murmelte Charlotte. »Man sieht ihm gar nicht an, was er alles durchgemacht hat.«
»Sie haben den Zaren schon einmal gesehen?«, fragte Louis beeindruckt.
»Ja«, bestätigte sie. »Ich hatte bei seinem letzten Berlinbesuch im November 1887 das Vergnügen.
»Und was ist ihm Schreckliches geschehen?«, fragte Josephine, die sich bisher nie sonderlich für den Zaren interessiert hatte. Nun musterte sie den mächtigen Mann, der neben dem Kaiser saß, verstohlen.
»Vor zwei Jahren ist er nur knapp einem Attentat entkommen«, wusste Louis. »Und letztes Jahr gab es bei der Rückkehr von einer Reise in den Kaukasus einen schweren Eisenbahnunfall.«
»Aber ihm ist nichts passiert?«
»Wie man es nimmt«, fuhr Louis fort. »Seine Familie war mit im Zug, als dieser einen steilen Abhang hinunterstürzte. Das Dach des Speisewagens, in dem sich die Familie aufhielt, wäre beinahe eingestürzt. Der Zar hat es mit seinen Schultern angehoben, bis sich alle in Sicherheit gebracht hatten.«
»Du lieber Himmel«, flüsterte Josephine ergriffen. »Er hat ihnen das Leben gerettet.«
Louis nickte. »Ja, er ist ein Held. Man sagt aber, dass die schwere Last womöglich Folgeschäden verursacht hat, die man nicht absehen kann. Er ist seither nicht mehr ganz so vital, wie man es von ihm kennt.«
Nachdenklich sah Josephine Louis von der Seite an. »Warum weißt du eigentlich so viel über den Zaren?«, fragte sie. »Woher kommt deine Faszination?«
Louis lächelte. »Ich kann es nicht mal so genau sagen«, erklärte er. »Vielleicht, weil meine Großmutter mir früher immer russische Märchen vorgelesen hat? Ich habe schon als kleiner Junge von russischen Wintern und schneeweißen Palästen mit eigenartig geformten Dächern geträumt.«
»Aber du warst noch nie in Russland?«
»Nein«, sagte er. »Leider nicht.«
In diesem Moment kam Bewegung in die Szenerie vor dem Fenster, mit einem Ruck fuhren die Kutschen ein Stück weiter nach vorne. Josephine konnte sehen, dass Prinz Albrecht und der junge Großfürst Georg im mittleren Wagen Platz genommen hatten. In der letzten Kutsche saßen der Reichskanzler Fürst von Bismarck, sein Sohn Graf Herbert von Bismarck-Schönhausen und der russische Botschafter am Berliner Hof.
»Schade, dass es schon vorbei ist«, seufzte Louis, als die Kutschen aus ihrem Blickfeld verschwunden waren. »Aber wie wunderbar, dass ich es erleben durfte. Nochmals meinen herzlichen Dank.«
»Es war uns wirklich eine Freude«, betonte Charlotte. »Bitte besuchen Sie uns noch einmal, bevor Sie die Stadt verlassen.« Schelmisch fügte sie hinzu: »Und bringen Sie meine Tochter und meinen Enkelsohn mit.«
5. Kapitel
Berlin, Oktober 1889
Nachdem Louis sich verabschiedet hatte, hatte Josephine den Tag noch in ihrem Elternhaus verbracht, so dass sie erst zum Abendessen heimkehrte – einen großen Topf bei sich, den Frau Rentlein ihr mitgegeben hatte. Dann müsse die Gnädige Frau sich nach ihrer Heimkehr nicht noch an den Herd stellen, hatte die Köchin argumentiert. »Nur aufwärmen müssen Sie’s noch.«
Bei einem Blick in den Topf hatte Josephine erfreut festgestellt, dass Frau Rentlein Königsberger Klopse für sie vorbereitet hatte. Ihr Leibgericht, das zuzubereiten sie mangels Kochkünsten allerdings noch nicht in der Lage war.
Als sie die Wohnungstür aufschloss, verriet ihr der Geruch aus der Küche, dass es in der Tat ausgesprochen praktisch war, bereits ein fertiges Gericht im Korb zu haben. Es stank in der ganzen Wohnung entsetzlich angebrannt.