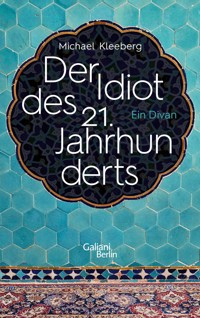9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DVA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein zeitgenössisches Sittenbild und ein deutsches Jahrhundertpanorama
Ein Mann, seine Frau(en), seine Kinder, seine Familie, seine Arbeit, seine Freunde. Seine Stadt. Seine Zeit. Karlmann Renn ist ein moderner Jedermann zwischen Lächerlichkeit und Triumph, und sein Alltag, der Weltalltag unserer Epoche.
Der Roman erzählt von der Liebe und Sorge eines Vaters, von Selbstbehauptung im Beruf, von der Konfrontation mit Kindheit und Familie, den Abgründen der Freundschaft, den Verlockungen des Ausbruchs und vom Einbruch des Todes. es ist die Geschichte des mühevollen Reifeprozesses und der Bewährungsproben Karlmann Renns, der sein Leben ohne die Tröstungen der Religion, der Kunst und der Philosophie meistern muss.
Michael Kleeberg gestaltet seine Welt mit vielfältigen Stimmen, Klängen und Rhythmen, durch die multiplen Perspektiven seines Erzählens. Komik und Tragik, Lakonie und Zärtlichkeit – die sprachschöpferische Lust dieses Romans ist so groß wie seine Präzision unerbittlich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 667
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Michael Kleeberg
VATERJAHRE
Roman
Deutsche Verlags-Anstalt
Meinem Vater
Der Pelide sprach mit Recht:Leben wie der ärmste KnechtIn der Oberwelt ist besser,Als am stygischen GewässerSchattenführer sein, ein Heros,Den besungen selbst Homeros.
HEINRICH HEINE
Well, you know, I was a human being before I became a businessman.
GEORGE SOROS
Ich rede zu dir nach Jahren des Schweigens,Mein Sohn. Es gibt kein Verona.Ich habe den Ziegelstaub in den Fingern zerrieben. Das ist’s, was bleibtVon der großen Liebe zu unseren Heimatstädten.
Welcher Kern des Lebens
Des Apfels, den das Flammenmesser durchschnitt, wird dann überdauern?
Mein Sohn, glaube mir, keiner.
Nichts, nur die Mühe des männlichen Alters,
Die Schicksalsfurche auf seiner Hand.
Nur die Mühe,
Sonst nichts.
CZESŁAW MIŁOSZ
Kapitel 1 PRIVATLEBEN
Scheiße, wo hast du all die Schönheit hergenommen, du Lutschbonbon – du Liebesapfel! Lichterlohe Lulu! – Lukullische Louie im Fuchs- und Luchspelz! – Du gurrende, turtelnde Blue-Note – du süßeste Sure meines Qur’ans – du lütte Huri, schlummernd auf meinem Lustlager als Soulfood im Elysium, du – du – …
Hilflos zuckend schlägt das Zungenblatt gegen Zähne und Zahndamm: Charly Renn fehlen die Worte.
Leihen wir ihm also, während er verzweifelt‚ von wegen hier: ›Herz voll, Mund über!‹, dumm und stumm das Wunder bewundert, die Seelenruhestörerin, die da schläft, wo sie nicht liegen sollte – in seinem Ehebett –, die befreite und bewegliche Zunge, die dem wehrloswortlos Liebenden gerade abgeht, denn nichts ist so wichtig, wie einen Ausdruck für seine Eindrücke zu finden, will man nicht unter Überdruck explodieren. So viel wissen wir als der voraus- und zurückblickende Janus dieser Geschichte, ihr dialektisches Doppelgesicht.
Der Honigfluss ihres Haars, den der perlmuttschimmernde Ammonit ihrer Ohrmuschel teilt; o diese harmonische Helix, diese marzipanmürbe Sichel, diese zungenspitzengroße Fossa triangularis! Oder das Samtkissen ihres Lobulus, so einzigartig und unverwechselbar wie ihr Fingerabdruck.
Um sie ist alle Welt zu kurz gekommen!
Kaum dass du es wagst, dich zu setzen zwischen den sanft geschwungenen Kopf- und Fußteilen aus weißem Schleiflack, die das Kleinod einfassen wie ein Schmuckkästchen aus Alabaster. Nur die Hälfte des schlafenden Gesichts ist dem Anblick preisgegeben, ein Ohr, ein geschlossenes Lid, eine Augenbraue sowie Nase und Lippen. Ihr Atem, unhörbar wie der einer Katze, strömt durch das zarte Ventil der Nüstern, die sich millimeterweise blähen und verengen im Unterwasserrhythmus einer Koralle oder Seeanemone.
Lautlos gleiten Wolken über den Spiegel des Einbauschranks und das schwarze Aquarium des B&O-Bildschirms. Aus der offenstehenden Badezimmertür schwebt der südseeische Duft eines Duschgels.
Weil sie das Leben hat, muss alles sterben. Du (in einer Weile), die beiden Thujen, die schon braun sind und die man von hier oben im letzten Tageslicht durch die Fenster, die die Giebelform nachzeichnen, am Jägerzaun sehen kann, der den kleinen, gepflegten, den weiblich grünen Daumen verratenden Garten hin zu Frau Gebhardt begrenzt, die seit zwei Wochen im künstlichen Koma liegt, weshalb ihr Mann auch den Rasen nicht gemäht hat.
Weil sie die Kraft hat, ist die Welt kein Hort. Und genau deshalb wirst du dich jetzt als alter (42) Inkubus an sie schmiegen und Liebe gegen Jugend tauschen. Weil sie die Jugend hat, wird alles alt. Doch gegen Schönheit und Jugend hilft nur – ebenso wie gegen unbestreitbare Überlegenheit, das hast du gelernt – die weiße Fahne der Liebe. Sie weht nun über deinem Dach. Nebenan in Hübners Vorgarten stattdessen die rot-weiß-blaue von Schleswig-Holstein. 45-Grad-Satteldächer und rote Backsteinverklinkerungen. Das ist Bauvorschrift. Ansonsten konnten die Doppelhaushälften frei gestaltet werden hier am Eilberg.
Das mattschwarze Gehäuse des Weckers auf dem Nachttisch absorbiert einen letzten Lichtstrahl des Spätsommerabends. Die abgestreifte Nomos-Glashütte daneben, mit der du dich vor zwei Jahren zum Vierzigsten beschenkt hast, schimmert metallisch wie deine Seele, der du dich einen Moment lang entledigt hättest, um ihr mahnendes Ticken nicht zu spüren.
Weil sie vollkommen ist, ist die Welt ein Scherben.
Der Mohn des Schlafs auf dem Lid, diesem Schmetterling, der sich auf ihrem Auge niederlässt und, die Flügel breitend, die Welt ausblendet mit seiner feinst geschuppten und geäderten Traumhaut. Eine einzige Träne, perfekt geformte Perle, wie aus Silikon, ist im Bogen der Wimper hängen geblieben, eine kleine Trophäe, aufgespießt auf der Lanze des Schlafs und im Zeugenstand festgehalten.
Weil sie der Himmel ist, gibt’s keinen dort. Ja, nickt Charly, ich bin zweiundvierzig Jahre alt, und sie ist die einzige Religion, die ich habe, die einzige Ideologie, an die ich glaube.
Er horcht. Unten im Haus rumort es. Kann er es wagen? Er legt die Hand auf den Haaransatz an der Schläfe, seine Lippen berühren den blonden Wangenflaum, aber nicht die Haut. Nicht schwerer lasten auf ihr als eine Schneeflocke, das ist die Kunst. Sie seufzt im Schlaf. Wohlig? Wer das wüsste.
Das alte Leid der Liebenden: Nicht unter die Haut der Geliebten gelangen zu können (nur zwischen ihre Schleimhäute), nicht mit ihren Gehirnströmen, Synapsenschaltungen, mit ihren Erinnerungen und Gefühlen vernetzt zu sein, sie nicht von innen nach außen liebkosen zu können, sie nicht in sich zu haben als unverlierbaren Schatz (so wie man früher Götter essen konnte oder wie in der angeblich mystischen Verschmelzung der Seelen und Kräfte zwischen Mörder und Opfer beim Stierkampf).
Will er die Augen offen lassen, um jedes Detail ihres Gesichts mit ihnen zu inhalieren wie einen Duft, so als stehe ein Abschied bevor, er habe nur noch diesen einen Blick frei und die Seele verlange nach dem Brandzeichen unvergänglicher Bilder? Oder soll er sie schließen und die Medulla oblongata via Trigeminus direkt mit den Empfindungen der Lippen beglücken?
Was ist intensiver? Was währt länger?
Er öffnet den Krawattenknoten und wirft die Seidenkrawatte über das Bett auf eine Stuhllehne, bereit, die Schlafende mit all seinen Tentakeln zu umfangen wie die träumende Perlentaucherin, in achtarmiger Sehnsucht sich mit den Saugnäpfen seiner Sterblichkeit an sie zu heften, da wird die Tür aufgerissen, und Charly schreckt aus seinem Liebestraum hoch.
Liegt sie doch wieder hier? Und du dabei! Bist du so lieb, Charly, und trägst Luisa hinüber in ihr Bett?
Die simultane Trias aus Missbilligung, Nachsicht und Pragmatismus ist, sofern nicht Heikes norddeutsche Trikolore, die aller Mütterlichkeit, die zuzeiten mit beiläufiger Selbstverständlichkeit von den Kindern auf den Ehemann übergreift, der dieses Gefühl, von einer höheren Instanz an seine lässlichen Sünden und Schwächen gemahnt und zugleich durch einen familiären Aufsichtsrat von ihnen entlastet zu werden, durchaus genießt.
Eine Ahnung von dieser manchmal schnippischen, manchmal warmherzigen Souveränität, dieser sachlichen Kompetenz und unerschütterlichen Gewissheit musst du schon damals im Zimmer des Krankenhauses gehabt haben, als du ihr zum ersten Mal gegenüberstandest und, obwohl nun weiß Gott mit den Herzrhythmusstörungen des Alten genug anderes in deinem Kopf vorging, dir gesagt hast, während ihr euch unterhieltet – oder die Vision hattest: Das ist die Mutter meiner Kinder.
Du hast gar nicht aufgeblickt, als sie in der Tür stand, aber da sie die Treppe lautlos heraufgekommen ist, muss sie Laufschuhe und Socken unten im Windfang ausgezogen haben, aber noch immer die schwarze Stretchhose und das Tanktop tragen. Einmal pro Tag läuft sie, wenn morgens keine Zeit ist, dann abends, mit pendelndem, dunklem Pferdeschwanz und Kopfhörer über den Ohren – und einmal die Woche fährt sie ins Frauengym nach Ahrensburg.
Charly bewundert die heroische Disziplin, mit der Heike nach zwei Geburten wie alle diese fast Vierzigjährigen ihres Kreises die Figur ihrer Mädchenjahre, ihrer Studienzeit bewahrt in einem täglichen, wortlos geführten, unkommentierten Kampf gegen die Zeit, der sie so anrührend wie begehrenswert macht. Mütter, Herrinnen des Überblicks, kompetente Managerinnen der Familie, noch immer oder wieder Berufstätige, Akademikerinnen, gelassene und souverän fordernde und gebende Erotikerinnen – so erscheinen sie uns, so wollen wir sie, ihrer eigenen Inszenierung glaubend, wahrnehmen, wenn sie in ihren Vans oder schwarzen Kombis mit getönten Scheiben vorfahren, in Jeans und Chucks, die erste Generation von Frauen, die auf zwanzig Schritt wie die Schwestern ihrer halbwüchsigen Töchter aussehen und, stehst du dann vor ihnen, sie verblassen lassen werden mit ihrer dringlicheren Präsenz. Nutzend ihre Zeit und eingedenk ihrer Endlichkeit, wie es irgendwo heißt.
Was ruft sie jetzt auf halbem Weg die Treppe hinunter? Dass du Luisa, wenn sie beim Transport in ihr eigenes Bett aufwacht, vorlesen sollst. Und bevor du dich noch lautlos von ihr zu lösen vermagst, öffnet sich zuerst ein glasiges Kaninchenauge des Kindes, noch stehst du nicht, da öffnet sich das zweite, und bevor du an der Tür bist, platzt die Seifenblasenvagheit des Blicks, er fokussiert sich, und schon spricht sie: Papa, bleib da! Und du sitzt in der Falle.
Die Liebe deines Lebens, und ist sie wach, ist sie dir lästig. Das schönste je erblickte Gesicht, und doch ist seine Kontemplation nicht abendfüllend.
Was willst du nur lieber? Was ist dir nur wichtiger?
Lieber willst du jetzt das schlafende Gesicht küssen und zufrieden abhaken und dich mit einem Glas Wein vor den Fernseher setzen und entspannen, das heißt den Fluss kappen, der ständig alles mit allem verbindet, das sicher in der Ablage des Lebens verstaute Geschehene mit dem unbekannten Bevorstehenden, und der verhindert, dass der Augenblick je schön werden könnte, indem er verweilt. Nimm dir ein Beispiel an deinem kleinen Bruder. Der schläft. Der lässt uns wenigstens abends in Ruhe. Nichts mehr hören von dem Hund und von Leben und Tod und nicht mehr sich einlassen müssen auf ein Gespräch.
Aber warum? Weil Liebe und Interesse nicht miteinander verbunden sind, denn die Liebe steckt ausschließlich im Liebenden und nährt sich, im Gegensatz zum Interesse, nicht in erster Linie vom Austausch mit dem Geliebten. Deshalb ist es auch kein Widerspruch, dass Charly Renn zugleich denken kann, er würde, um ihr Leben zu retten, ohne zu zögern das seine für diese Sechsjährige opfern, und es als eine Plage, eine Zumutung empfinden, ihr jetzt eine weitere (halbe) Stunde ebendieses Lebens zu widmen.
Sein ausweichender Blick gleitet über ihren Körper. Der Blick der Liebe ist immer auch ein ängstlich prüfender Blick. Natürlich liebt ein Vater seine Tochter, würde sie auch als bärtiges Monstrum oder als geistig behindertes Wesen irgendwie lieben – heißt es nicht, dass in Familien, die ein mongoloides Kind neben anderen haben, dieses das am innigsten geliebte sei? Doch dieser Vater hier zweifelt daran, dass Anmut und Verstand die Liebe nicht stärker befeuern sollten als Hässlichkeit und Dummheit. Und so gingen schon seine frühen Gedanken, bald nach dem ersten erschrocken-bezauberten Blick, mit dem er die Finger und Zehen des noch an der Nabelschnur hängenden schleimig-roten Aliens nachzählte und das Gesicht auf Normalität hin prüfte, bang der Frage nach, ob die genetische Ausstattung seiner Tochter seinen Ansprüchen genügte, und wenn nicht, woran und an wem es liegen konnte.
Etwas, worüber Charly sich nicht zu sprechen traut, nicht einmal und schon gar nicht mit Heike, weil er weiß, auf welch schlüpfriges Terrain er sich damit begibt, woran er aber im Grunde seiner Seele fest glaubt, das ist, dass sich ›Rasse‹ – nicht im Sinne der Nazis, sondern so wie man von einem Pferd oder einem alten Jaguar oder einem Ferrari im Gegensatz zu einem Opel oder Nissan sagt, sie haben Rasse – sichtbar an der Oberfläche des menschlichen Körpers abzeichnet und dass bestimmte ästhetische Schwachpunkte, niedrige Stirn, kleine Champignon-Ohren, klobige Fesseln, fliehendes Kinn oder hässlich geformte Nägel, eindeutige Hinweise darauf sind, dass mit dem entsprechenden Menschen auch sonst nicht viel los sein kann und er nicht reüssieren wird im Leben. Und mit dem danach suchenden Blick mustert er seit ihrer Geburt immer wieder in unregelmäßigen Abständen selbstvergessen seine Tochter – und schämt sich, wenn er sich dabei ertappt, doppelt: weil der Blick, aus dem er plötzlich aufwacht, lieblos ist, ein Blick kalten, besorgten Interesses, und weil ihm bewusst ist, dass die Kriterien, die er anlegt, um den Körper seines Kindes zu beurteilen, dieselben sind, die er sein ganzes Erwachsenenleben lang gegenüber Frauen angelegt hat, um zu entscheiden, ob sie ihn sexuell interessieren und erregen oder nicht.
Er forscht unter dem Kindchenschema nach der Regelmäßigkeit der sich entwickelnden Gesichtszüge: Verspricht das Näschen charaktervoll zu werden oder droht es rudimentär zu bleiben? Ist der Lippenschwung ausgeprägt? Sind die Brauen schön geformt und sitzen sie als die beiden Drahtzieher des Gesichtstheaters im richtigen geometrischen Verhältnis zu den Marionetten (Augen, Mund und Nase) unter ihnen und dem Rahmen der Bühne (den die Ohren bilden)? Sind die Wimpern lang und gebogen? Hat sie – Gott behüte – gar Schlupflider wie Meret? Deutet die Bildung des Unterkiefers (von vorne, im Dreiviertelporträt, im Profil) auf Durchsetzungsfähigkeit oder Mitläufertum? Ist das Haar voll und kräftig, duftig und leuchtend und womöglich naturgewellt? Ist die Zeichnung der Ohren, des einzigen Merkmals, das sich von Anfang an nicht mehr verändert, rein, wie von Matisse mit einem einzigen schwungvollen Strich auf den Skizzenblock der Evolution geworfen, oder sind sie verwachsen, knorpelig, knollenartig, verhunzt, irgendwie zurückgeblieben und voller Ecken, Wülste und überflüssiger Hautlappen? Ist die Körperhaltung königlich oder bäuerlich, wächst da eine Herrin heran oder eine Knechtsseele? Wie sieht der Nabel aus? Wie ein Kelch oder wie eine Geschwulst? Was wird aus diesen Beinen werden? Zwängt sie mit siebzehn einen fetten Arsch in zu enge Jeans, quillt Orangenhaut aus den Shorts und schaben schlaffe, kalbfleischige Schenkel beim Gehen aneinander? Verjüngt sich die Wade zur Fessel hin, die ganz schmal sein muss, um dann in einen Fuß überzugehen, der gewölbt ist wie eine römische Brücke? Und die Finger, hören sie irgendwann auf zu wachsen, bleiben kurz und dick und dienen nur zum Kartoffelschälen, oder werden sie schlank, sehnig, erotisch und beweglich wie die Hände von Musikerinnen oder Hände, die –?
Und würdest du sie wirklich weniger lieben, hielte sie deinen Ansprüchen nicht stand? Also enttäuscht wäre ich schon. Würdest du sie dafür verantwortlich machen, würdest du ihr die Schwächen ihrer äußeren Erscheinung vorwerfen wie einen Tort, den sie dir bewusst angetan hätte? Irgendwie schon. Hilft ja nichts, es zu leugnen.
Denn eigentlich ist ja alles gut bis perfekt und sie verspricht eine Schönheit zu werden mit diesen Augen und Grübchen und dem Talent zum Fratzenschneiden, das nur bei schönen Frauen erotisch ist. Bloß ein paar Details sind es, die dir das unangenehme Gefühl einimpfen, hier habe die Vermischung der Gene versagt, hier habe es irgendwo sozusagen nicht mehr ganz gereicht, sei die genetische Ejakulation nicht mächtig genug gewesen, bis nach ganz unten und außen, bis in die letzten Kapillaren der Extremitäten zu schießen.
Ihre Fingernägel sind breiter als lang. Das ist ganz hässlich und ein schlechtes Zeichen. Außerdem kaut sie sie ab. Es gibt nichts Widerwärtigeres als eine Frau mit abgekauten Nägeln, deren Daumen mit der Zeit zu Klauen verkrüppeln. Und hol’s der Teufel, aus so jemandem wird auch nichts! Und ihre Füße. Sie hat Plattfüße und knubblige Zehen, man sieht den Unterschied zu den anderen Mädchen mit ihren dünnen Fohlenfesseln und Tänzerinnenfüßen jetzt schon, wenn sie im Sommer barfuß im Garten spielen. Da liegt der ganze Unterschied zwischen denen, die später die glücklichen, begehrten sein werden, und denen, die dumm in der Ecke stehen und von niemandem geliebt werden. Vollblutpferde und Ackergäule. Warum musste es ausgerechnet dafür nicht reichen? Nirgendwo sonst zeigt sich die natürliche Rasse so wie an Händen und Füßen! Und Charly hat nicht solche Hände und Füße! Selbst Heike nicht, nicht in dem Maße. Wo kommt es dann bitte her?
Versucht er sich zusammenzureißen und diese von ihm selbst nur unter Vorbehalt ernst genommenen Gedanken zu verscheuchen, hört er erneut die Frage: Was willst du? Eine Tochter, auf die du scharf bist, wenn sie sechzehn ist? Oder vierzehn oder dreizehn? Eine Tochter als Wichsvorlage? Du wirst es sowieso nicht dürfen. Gewiss, antwortet er sich dann, aber auf einer theoretischen Ebene ist es schade, denn wer sonst sollte das Recht dazu haben?
Ähnliche Sorgen um die genetische Ausstattung oder die Schönheit von Max macht er sich nicht. Der kann karottenrote Haare und abstehende Ohren und Sommersprossen haben, das würde Charly nicht stören. Auch wie die Nägel wachsen oder ob er Anzeichen von Debilität zeigt, ist Charly gleichgültig. Max ist ein Junge. Ein dreijähriger Junge. Charly liebt ihn, natürlich, aber es steckt zu viel von ihm selbst in dem Knaben, als dass nicht ein Schatten von Peinlichkeit auf die Zuneigung fiele. Wo er bei seiner Tochter den Eindruck hat, gewisse Einzelheiten seiner Gesichtsbildung wären wie Gaben an sie übergegangen, von dem Bildhauer ihrer Züge als Inspiration benutzt und kreativ in Lösungen umgesetzt worden, die, ohne die eigene Handschrift zu verleugnen, bestimmte Bögen, bestimmte Volumina erhielten und übertrugen, oder von dem Komponisten ihres Gesichts als von der Grundtonart ausgehende und mit harmonischen Veränderungen spielende Variationen in Musik gesetzt worden, da kann er bei Max, der im Übrigen kein karottenrotes Haar hat, sondern flaumig dunkelblondes, und auch keine abstehenden Ohren, nur eine Art von Karikatur seiner selbst erkennen. Manches fehlt, manches erscheint wie eine schwache Kopie, Fremdes entstellt das Spiegelbild, und Charly kann nicht anders, als beim Anblick des Knaben sich selbst als das Original zu setzen, von dem die Abweichungen nicht etwas Eigenes ergeben, sondern einen merkwürdig verfälschten Klon. Es ist, als habe der Bildhauer hier die bereits in den feuchten Lehm vorgeprägten Züge mutwillig umkneten wollen, um auf der Basis von etwas Fertigem etwas Eigenes zu formen, aber diese Absicht auf halbem Wege aufgegeben, sodass sein Sohn Charly zuweilen aus gewissen Perspektiven und einschließlich mancher Gesten und Kopfbewegungen erscheint wie eine gnomenhafte, spöttische Nachbildung seiner selbst, in anderen aber vollkommen fremd auf ihn wirkt, so als habe er überhaupt nichts mit ihm zu tun.
Er kann den Kleinen nicht mit derselben blind verliebten, bezauberten Innigkeit umarmen und küssen wie seine Tochter. Dafür spielt er mit ihm Fußball im Garten und hat ihm im Mai zu seinem Geburtstag, als Bayern die Champions League gewann, ein Lizarazu-Trikot gekauft. Seitdem protestiert er, wenn man ihn ruft, er heiße nicht Max, sondern ›Bischente‹. Die einzige Angst, die er hat, was seinen Sohn betrifft, ist die, er könne ein Mitläufer, ein Mäuschen und ein Dulder werden und unfähig, sich mit dem Mundwerk Respekt, Freunde, Bewunderer zu verschaffen oder verprellte Spielkameraden wieder auf seine Seite zu quatschen.
Man muss alle Kinder gleich lieb haben, aber man tut es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass es Charly als ein größeres Wunder erscheint, ein weibliches Wesen gezeugt zu haben, als seien dazu ganz andere Fähigkeiten vonnöten als bei der Selbstreproduktion in einem weiteren Y-Chromosom. Von Anfang an hat er seine Tochter angesehen wie ein besonders feines Uhrwerk, dessen Mechanik zu bewundern und zu hüten (aber nicht zu betatschen) der Uhrmacher ihn auserkoren hätte, wogegen ein Junge so primitiv, schmuddelig, geheimnislos und verlässlich ist wie ein Mopedmotor. (Hoffentlich, denn was wäre schlimmer als ein komplizierter, komplexbeladener Junge. Lieber einen anständigen Flegel, der die offenen Türen des Lebens einrennt.) Charly sieht es mit Genugtuung, dass der kleine Max seine große Schwester abgöttisch liebt und bewundert (noch) und für ein höheres Wesen hält, und beobachtet fasziniert, wie das Mädchen die Macht, die es über ihn hat, ab und zu so mutwillig wie perfide ausübt, indem es den Bruder ignoriert, zu Tränen treibt, um ihn dann zärtlich trösten zu können wie eine Puppe oder ein Stofftier. Verliebt sieht er, mit welch beiläufig-herrischen Gesten Luisa ihn auf Botendienste schickt, die er, ganz treuer Paladin, beflissen erledigt, und hütet sich, nicht ohne verborgenen Stolz, darüber nachzusinnen, von wem sie solche Attitüden geerbt oder abgeschaut hat.
Der Abstand zwischen den beiden ist größer als der zwischen ihm und Erika, aber manche Situationen, die er beobachtet, versetzen Charly schlagartig in eine hell ausgeleuchtete Asservatenkammer der Erinnerung, von deren Existenz im Spukhaus des Gedächtnisses er gar nichts ahnte: Als er vor vielleicht einem Jahr auf der verkehrsberuhigten Straße Luisas Versuchen mit dem Fahrrad zusah, hinter der Max auf seinem Dreirad eifrig herstrampelte, lobte er sie verliebt, nur um dann aus den Augenwinkeln zu sehen, wie die Hautwülste unter den Brauen des Jungen dicker wurden, sich in ihrer Mitte eine senkrechte Kummerfalte auftat, und noch bevor der Kleine in Tränen ausbrechen konnte (was er schließlich nicht tat), sog etwas an diesem Anblick Charly in den Körper dieses Zweijährigen hinein, und er befand sich auf der schmalen Erinnerungsstraße, die in Friedrichshafen auf das Mietshaus zuführte, in dem sie lebten. Er sah, wie der Ford seines Vaters, der offenbar länger weg gewesen war, hupend an ihnen vorüberfuhr, wie er vor dem Haus parkte, wie ihr Vater ausstieg und wie Erika mit ihrem Roller über die Schlaglöcher flog, als Erste bei ihm war und wie er sie hochhob und schwenkte und wieder absetzte und dann, schon auf dem Weg ins Haus, ihm, der jetzt auch angekommen war und außer Atem seinen Roller auf die nicht asphaltierte Straße fallen ließ, zuwinkte und wie ihm, als sein Vater sich nach dem Winken abwandte, plötzlich klar wurde (und die Gänsehaut jener Erkenntnis stellt wieder, fünfunddreißig Jahre später, die Härchen auf seinem Arm auf): ›Der große Mann hat mich nicht so lieb.‹ Es war eine Erkenntnis, seither tausendmal vergessen, wieder erinnert, wieder vergessen, aber eingeprägt wie mit dem Brenneisen.
In seinen Armen, der Kopf mit dem dunkelblonden Haar, dessen geschwungene Strähnen ihr so wirkungsvoll über die Augen hängen, als hätte ein Hairstylist aus Hollywood die Aufgabe gehabt, eine schlafzerzauste Garbo in Szene zu setzen (und es ist der Schwung des Haars über die Stirn, der, seiner Zeit und dem Kindergesicht weit voraus, eine Ahnung davon vermittelt, wie verführerisch sie als Halbwüchsige aussehen wird), in schwindelerregendem, unerschütterlichem Vertrauen an seine Schulter geschmiegt (dies wird das Schwerste sein – das schwinden zu sehen), stellt sie auf dem Weg über den gefliesten Flur hinüber zum anderen Giebel, dem vorderen des Hauses, der die beiden Kinderzimmer beherbergt, denn auch sofort und punktgenau dieselbe Frage wie vor dem ersten Einschlafen:
Papa, muss Bella wirklich sterben?
Egal was er darauf antworten wird, die nächste wird lauten: Papa, was ist Sterben? Und so weiter. Es ist nicht so, dass er sich fortsehnt, weil einem Erwachsenen die Konversation mit einem Kind auf die Dauer durch ihre Eintönigkeit und Primitivität langweilen würde und er ›wichtigere Dinge‹ zu bedenken hat, sondern ganz im Gegenteil: weil es die wohltätigen und schonenden Abbreviaturen und Ellipsen nicht beherrscht, mit denen wir im Allgemeinen Gespräche in einem psychisch erträglichen Rahmen halten. Mit einem Kind zu reden ist wie mit einem Heiligen oder Schwachsinnigen zu konversieren. Es geht immer ums Ganze, und es geht immer nur um ja ja und nein nein, und was darüber ist, das ist von Übel.
Papa, muss Bella wirklich sterben?, fragt sie in seinen Armen, bevor er sie in ihr Bett legt und sie zudeckt. Sie greift vorsorglich nach seinem Handgelenk.
Ich fürchte, ja.
Aber doch nicht jetzt. Irgendwann, wenn sie ganz alt ist.
Du, sie ist sehr krank. Und da ist das Leben irgendwann nicht mehr schön.
Papa, was ist eigentlich Sterben?
Weißt du, wenn man alt ist –
Aber Bella ist doch gar nicht alt, erst sechs, wie ich –
Oder wenn man krank ist, dann kommt irgendwann der Moment, wo man stirbt.
Aber man kann doch nicht einfach so sterben, nur weil man krank ist. Ich bin doch auch manchmal krank. Kann ich da auch einfach so sterben?
Charly zieht die Brauen zusammen vor lauter Konzentration darauf, welche beruhigenden Lügen er ihr erzählen soll. Ihr müder, aber sich zum Wachsein, zum Verstehen zwingender Blick zehrt an ihm. Er kann ihr nicht sagen, was die einzige Wahrheit ist, die er kennt: Das Leben ist eine elende und ungerechte Schweinerei, und es kann jeden erwischen, zu jedem Zeitpunkt und nie wenn man es erwartet, und Sinn macht es nie. Und er kann ihr auch nicht sagen: Du hast Grund, Angst zu haben. Ich habe sie auch.
Wenn er auf die Frage antworten sollte: Was hat sich unumkehrbar verändert seit den Geburten, seit der ersten Geburt, dann wäre die Antwort: Angst ist in dein Leben getreten.
Eine gänzlich andere Angst als alle Ängste, berechtigt oder ungerechtfertigt, begründet oder hypochondrisch, die alle ihn selbst, sein Leben, seinen Körper, seine Gegenwart und Zukunft betreffen. Und es ist verrückterweise eine Angst, die aus der Schönheit kommt, aus dem Glück, als entfalte sich vor deinen Augen eine Rosenblüte, aus deren Herz sich plötzlich ein widerlicher Wurm erhebt, der alles von innen her auffrisst und die rosige Seide der Blätter im Nu in schwarzen Kot verwandelt. Es ist eine Angst, die sich nicht aus dem Beängstigenden speist, nicht aus Zeitungsmeldungen und Bildern von Mord, Tod, Katastrophen und Krieg – nicht in erster Linie. Sie keimt im Gegenteil aus den Kristallen der Perfektion. Es ist, als wäre durch die Geburt der Kinder ein schützender Schleier von deinen Augen genommen, sodass du die permanente Bedrohtheit des Lebens jetzt ständig sehen musst.
Es kann der Anblick Luisas auf der Schaukel sein, wie sie mit wehendem Haar der Nachmittagssonne entgegenfliegt, das Licht- und Schattengeflocke auf der hellen Haut ihres Gesichts, ihre Arme, ihre kleinen Hände, die die Nylonschnüre umklammern – also der Anblick vollkommenen Lebensglücks –, und vor dieses Bild schieben sich plötzlich andere wie Wolken vor die Sonne und lassen allen Glanz verblassen. Da du sie sofort bekämpfst und wegzuschieben versuchst, diese Schlaglichter von Schmerz, Leid und Tod, zugefügt von Autos, von Männern, vom Irrsinn der Welt, bleiben es Schemen. Doch klärt sich dein Blick dann wieder auf den gegenwärtigen Moment, hat das Glück einen schwarzen Rahmen bekommen, ohne den du es fast nie mehr haben kannst.
Aber es braucht den Anblick von Luisa und Max überhaupt nicht: Alles, was schön ist und anrührend und sterblich, verweist auf die Sterblichkeit seiner Kinder. Der Blick eines Tiers, die warmen Augen seines Hundes etwa, mit Feuchtigkeit und braunen, den schwarzen Kern umwabernden Pigmenten gefüllte Beeren, aus denen er, den Kopf im Nacken, arglos und konzentriert zu dir aufblickt. Oder die heftig flügelschlagende Meise in der Hecke, ein gelbschwarzes panisches Geflatter, die versucht, die Elster von ihrem Nest fernzuhalten. Oder der erste frische Trieb, der lindgrün, dünn, nackt und kühn aus dem verholzten, im letzten Herbst gestutzten Zweig des Kirschlorbeers emporwächst und seine samtigen Blätter entrollt. Der leuchtende Stäubchendunst der Pollen in der von den Baumkronen gefilterten Mittagssonne oben auf dem Eilberg. Ein grüner Pukiroller, der an einem von Grünspan bedeckten Jägerzaun lehnt wie ein wartendes Taxi.
Vielleicht ist es gar keine Angst. Vielleicht beginnt einfach, wenn man Kinder hat, die Vergänglichkeit sichtbar zu werden, und der feine Sand des Lebens rieselt aus der Schale deiner Hände, die doch fest verschränkt sind und hermetisch geschlossen scheinen.
Aber wenn es das Bewusstsein der Vergänglichkeit ist, dann nicht das der eigenen. Die Angst vor dem eigenen Tod, selbst dem ›vor der Zeit‹, der eintritt, bevor man erreicht und erlebt hat, was man erreichen und erleben wollte, ist geringer geworden, seit die Nachfolge geregelt scheint. Kaum zu glauben, aber es ist ein versöhnlicher Gedanke geworden, dir eine Welt ohne dich vorzustellen, solange es nur eine Welt mit deinen Kindern ist. Auch ist es nicht die Sterblichkeit der Kinder an sich, die dir Angst macht. Solange sie dich nur überleben. Danach ist es gewissermaßen ihr Problem. Was natürlich doch nur bedeutet, dass du Angst vor dem grauenerregenden schwarzen Loch hast, in das DU fielest wie hinab in die Hölle, stieße ihnen etwas zu.
Charly erinnert sich noch gut an das Drama um die entführte und ermordete Tochter eines NDR-Jazzredakteurs und an dessen ungeheuerliche Geste: dem gefassten Mörder zu verzeihen. Das hast du nie vergessen. So viele Berichte in der Zeitung über entführte und vergewaltigte und ermordete oder sonstwie gestorbene Kinder, aber dann dieser eine Fall von Verzeihen.
Nicht nur ist Charly das vollkommen unverständlich, es reicht im Gegenteil schon ein harmloses Bild wie das des verlassenen Rollers am Gartenzaun, um ein Splattermovie vor deinem inneren Auge in Szene zu setzen über einen Monte-Christo-Rachefeldzug, an dessen Ende der wimmernde Mörder deiner Kinder schon halb verstümmelt in seinem Blut vor dir kniet, bestürzt auf seine abgehackten Gliedmaßen starrt, seine hervorquellenden bläulich-rosigen Gedärme in den Leib zurückzustopfen sucht und dich um den Gnadenschuss bittet, aber du siehst genüsslich und verzweifelt zu, wie er langsam verblutet, seine Schmerzen können dir nie genügen, also trittst du nochmal und nochmal auf ihn ein, trittst gegen seinen Körper, trittst gegen seinen Schädel und weißt doch: Es hilft alles nichts, es bringt sie dir nicht zurück, und schwer atmend und wütend auf dich selbst kommst du wieder zu dir, zwingst dich angeekelt aus deiner Fantasie, einen schlechten Geschmack im Mund, kopfschüttelnd, sentimental, läufst zu den Kindern, überschüttest sie mit Zärtlichkeiten, kaufst ihnen Geschenke, als würdest du in ihrer Schuld stehen und hättest sie ungerecht behandelt und mit deinen Visionen geschändet.
Um genau so viel bist du angreifbarer geworden, wie du deine Oberfläche durch die Kinder vergrößert und erweitert hast. Und war es ihm früher möglich, sich als ungebundener Partisan unbemerkt durch die Stellungen des Schicksals zu schleichen, kommt es ihm nun so vor, als müsse er einen ganzen familiären Planwagentreck unbewaffnet durchs feindliche Indianerland des Lebens führen, Klapperschlangenbiss und Grizzlyangriffsrisiko noch nicht einmal miteingerechnet.
Vielleicht ist also genaugenommen die Sorge in sein Leben getreten. Und zwar nicht nur in Form des grauen Weibs, das sich durchs Schlüsselloch ins Haus schleicht, sondern als eine das ganze Leben, die ganze Existenz umfassende Aufgabe.
Nein, du kannst nicht einfach so sterben, keine Angst, versucht er sie zu beruhigen. Du nicht. Und Bella, wenn sie stirbt, dann heißt das, sie schläft ein. Wenn man stirbt, schläft man ein und wacht in einer anderen Welt wieder auf.
Im Himmel?
Ja, im Himmel.
Beim lieben Gott?
Genau, beim lieben Gott.
Kommen auch Hunde in den Himmel?
Jeder, der sehr geliebt wird, kommt in den Himmel. Bella natürlich auch.
Aber wenn du sagst, man schläft ein, dann muss man ja auch wieder aufwachen.
Ja, aber nicht hier. Hier auf der Erde ist man dann tot. Aufwachen tut man anderswo.
Aber wenn ich einschlafe, kann es dann sein, dass ich im Himmel wieder aufwache? Ich bin ja auch sechs.
Nein, du nicht.
Aber warum ich nicht, wenn Bella so einschläft?
Weil du weder alt noch krank bist.
Und du, Papa? Du bist doch schon alt. Ich will nicht, dass du stirbst.
Nein, ich auch nicht. Ich bin noch nicht so alt für einen Menschen, und krank bin ich auch nicht.
Er sieht seine Tochter nachdenklich an. Natürlich will sie nicht, dass er stirbt, und sie weiß auch nicht, was Sterben ist. Aber etwas in ihr sagt ihr, dass er der Nächste ist, dass es irgendwie natürlich wäre, wenn er vor ihr, lange vor ihr stirbt. Es ist ein Instinkt weit unterhalb einer Ahnung, vielleicht eine Manifestation des eigenen Lebenswillens, und etwas in ihm, das er sich nicht recht erklären kann, ist froh darüber, ist stolz darauf.
Der Prozess unserer sukzessiven Ablösung von der Erde, der mit dem Tag einsetzt, an dem uns ein Kind geboren wird, und der meist unbewusst abläuft, uns aber, werden wir irgendwann darauf aufmerksam, zu Protest und Gegenwehr veranlasst, die im Extremfall bis zum Konkurrieren mit den eigenen Kindern, zu Neid und Hass auf sie führen kann, zeigt sich am deutlichsten daran, wie uns unsere Erinnerungen langsam durchsichtiger und vager werden und abhandenkommen zugunsten von Erinnerungen an unsere Kinder, in denen wir nur mehr am Rande stehen als Zeugen und Zuschauer. Es ist, als wirke das vampirische Leben der Kinder seit ihrer Geburt auf unser Leben wie die Viren, die Blutkörperchen zerstören: Es zersetzt die Erinnerung, und vielen kommt es irgendwann so vor, als habe unser Leben, das ja immer nur in Erinnerungen bewahrt wird und von ihnen seinen Sinn erfährt, genau zu der Zeit aufgehört, als wir Vater oder Mutter wurden, denn nichts davon findet sich seit dieser Zeit in unserem Gedächtnis wieder.
Vielleicht ist das ein Trick der Evolution, gegen den das kapitalistische System, das davon lebt, dass wir uns für wichtig halten, versucht, den Zeitpunkt, da wir von Erinnerungsproduzenten zu Verwaltern fremder Erinnerungen werden, so weit wie möglich, am besten lebenslang hinauszuzögern.
Aber es ist wahr, dass dein Leben seit dem Frühjahr 1995 keine individuellen Erinnerungen mehr schafft. Es ist vollgestopft mit Gegenwart, die nach Gebrauch entweicht wie Rauch aus einem Dampfschiff. Die Arbeit hinterlässt keine Erinnerungen, ebenso wenig die Abende mit Freunden (so unterhaltsam sie sind), ebenso wenig die Golfurlaube mit Kai (dito), ebenso wenig die Radtouren (trotz der Landschaft). Alles das füllt die Tage aus vom Morgen bis zum Abend, aber dann ist es fort und vergangen.
Die letzte Erinnerung, die nur dir gehört, ist die an die Motorradtour über die Alpen im Sommer ’94. Schon auf den Bildern vom Einzug in das Haus trägst du die Lütte auf dem Arm, und du erinnerst dich, wie du die Kettlerschaukel einbetoniert hast, damals noch mit Körbchen und Kindersicherung, du erinnerst dich daran, wie Luisa in Argentario nach vier abgebrochenen Versuchen und schon halb weinerlich unter den Anfeuerungsrufen eines Dutzends italienischer Stenze, die vor Ambre Solaire glänzten und Goldkettchen oder welche mit Raubtierzähnen oder anderen Penisvarianten um den Hals trugen, sich schließlich überwand und mit einem Froschhüpfer vom Felsen hinab in das türkisklare Wasser sprang, und an ihr Strahlen beim Auftauchen und daran, wie friedvoll es war, unter der Palme auf der Hotelterrasse neben ihr zu liegen und Siesta zu halten, während Heike Max im Buggy durch den Schatten fuhr und stillte. Du erinnerst dich, als wär es gestern passiert, an das entsetzliche Knirschen und den markerschütternden Schrei, der in ein Dauerheulen überging, das dich völlig lähmte, als Lulu, auf dem Gepäckträger sitzend, während du nur einmal hin- und herfuhrst in der verkehrsberuhigten Straße, das Bein in die Speichen bekam, wie du das Rad gestoppt, dich umgeblickt, etwas Weißes gesehen hast und dachtest: Der Knochen! Der Knochen liegt frei! Und dich dann hinsetzen musstest, weil der Kreislauf kippte, und nach Heike brülltest, die den Gartenschlauch fallen ließ, die Gartenschuhe im Rennen von sich warf, sich hinkniete, den Knöchel aus den Speichen befreite (was du gesehen hattest, war nur die blutleere aufgescheuerte Haut, bevor die Blutung einsetzte, nicht der Knochen), und an die rasende, unter Apnoe (so kam es dir vor) absolvierte Fahrt in die Notaufnahme des Krankenhauses, und ihre Tränen und ihr Gejammer und ihre Schmerzen, als sie beim Röntgen das Bein drehen musste, und wie nett die Ärztin mit ihr war und ihr sogar etwas schenkte, und an die ungeheure Erleichterung darüber, dass der Knöchel nur verstaucht war, nicht gebrochen, und wie ihre Angst und ihr Schmerz dann auf der Rückfahrt in einen Veteranenstolz übergingen, und wie sie den anderen Kindern den Verband zeigte und sagte, sie wolle später auch Röntgenärztin werden, und wie sie sich in den Tagen und Wochen danach die Episode mit genüsslichem Grauen wieder und wieder erzählen ließ, als müsse sie sie hören, um glauben zu können, dass sie ihr selbst passiert war.
Schrecksekunden mit den Kindern, Reisen mit den Kindern, die Augen der Kinder unter dem Weihnachtsbaum, so leuchtend wie die Christbaumkugeln im Licht der Wachskerzen, die Hand des kleinen Bruders in der Hand der großen Schwester, Erinnerungen an Harmonie und Unschuld, und vielleicht ist es auch einfach so, dass diese Erinnerungen schöner sind, reiner als die eigenen, ein ganz durchsichtiges, mundgeblasenes Glas ohne Einschlüsse, Blasen und blinde Flecke.
Es gibt Erinnerungsbilder, scharf wie Fotos, obwohl es selbst produzierte Kombinationen aus mehreren Erinnerungen verschiedener Zeiten sind, die sich im Laufe der Zeit als Synthesen bestimmter Entwicklungen übereinandergelegt und zusammengeschoben haben. So zum Beispiel der Gedächtnis-Schnappschuss des absoluten Glücks auf Luisas Gesicht aus der Zeit, als sie vielleicht ein halbes Jahr alt war. Jener Gesichtsausdruck erschien nur momentweise, aber jedes Mal, wenn er ihm geschenkt wurde, überlief ihn angesichts ihrer Wonne eine Gänsehaut. Und in der Erinnerung an ihre frühen Tage ist genau dieser Anblick da: Sie schließt die Augen, grinst mondgesichtig, mit aufgeblasenen Backen und leicht schäumendem Mündchen, als produziere sie vor lauter Freude ihren eigenen Champagner: »Bfff!«
Selbst in den intensivsten Erinnerungen bist du nur noch ein Beobachter, kein Akteur mehr. Im Moment der Geburt, während der Presswehen, standest du hinter Heikes Kopf und sahst aus dieser Perspektive Chefarzt und Oberarzt, wie sie, links und rechts postiert, ziemlich roh auf den geschwollenen Bauch drückten, wirklich so, als solle eine riesige Wurst aus ihrer zu engen Pelle gequetscht werden, sahst die Hebamme, deren Hände zwischen Heikes Beinen verschwanden und zogen, als sei sie ein Tierarzt, der einer Kuh das Kälbchen aus dem Bauch holt. Und dann, in einem Schwall gelblich-brauner Flüssigkeit, rutschte es plötzlich ans Licht wie ein aus dem Netz geschütteter Fisch an Deck, fing, auf dem Bauch liegend, sofort zu schreien an, der Chefarzt saugte mit einem Röhrchen Flüssigkeit ab, Luisa wurde abgewischt und der Mutter angelegt. Durch die Verformung im Geburtskanal hatte sie einen King-Kong-Kopf und die dunkelrote Farbe eines gehäuteten Kaninchens, die der Chefarzt beim Diktat als »rosig« und »perfekt« bezeichnete. Heike war plötzlich überall im Gesicht, an den Schultern und auf der Brust sommersprossig vor Anstrengung und glitt binnen Sekunden von der Tortur in die Seligkeit, als sie Luisa auf sich spürte – an all das erinnerst du dich. Aber völlig weggelöscht ist, dass der Chefarzt dich dann nach vorn gerufen, dir irgendein Utensil in die Hand gedrückt haben muss, mit dem du die Nabelschnur durchtrennt hast. Das ist ja nun mehr als Symbolik, das muss ja auch spürbar gewesen sein und sichtbar, der einzig aktive Moment, den du in diesen langen Stunden hattest – aber nichts, vollkommener Blackout.
Doch auch seitdem er (genau wie Heike) sich wieder verstärkt um ein eigenes Leben bemüht und sie wieder viele Dinge ohne die Kinder tun und erleben, bleiben die Erinnerungen daran fahl und sind nur die anämischen, degenerierten Kinder ihrer Vorfahren aus der Zeit, als er noch der Mittelpunkt seiner Existenz war.
Aber es ist ja nicht sicher, dass sie stirbt, setzt das Kind neu an.
Doch, Luischen, ich fürchte, es ist sicher, dass sie sterben muss.
Aber warum?
Weil die Krankheit, die sie hat, sie nicht leben lässt. Weißt du, sie hat Schmerzen. Wenn sie fiept, dann heißt das, es tut ihr weh. Und das wollen wir doch nicht, dass unsere Bella Schmerzen hat?
Nein!
Und deshalb lassen wir sie morgen Abend, wenn sie dann immer noch Schmerzen hat, von Dr. Bielefeldt einschläfern.
Was heißt das?
Er gibt ihr eine Spritze, und dann schläft sie ganz ruhig ein. Aber vorher verabschieden wir uns von ihr. Und dann nehmen wir sie in den Arm, damit sie weiß, dass wir bei ihr sind.
Aber eine Spritze tut doch weh!
Nein, die tut ihr nicht weh. Das verspreche ich dir.
Aber vielleicht ist sie ja morgen wieder gesund.
Vielleicht. Aber ich glaube es nicht.
Und wenn ich für sie bete?
Das wird nichts schaden. Aber ich glaube nicht, dass es sie davor bewahren wird zu sterben.
Aber das ist doch ungerecht!
Ja.
Und wer macht das, dass sie sterben muss? Der liebe Gott?
Charly sagt nichts.
Dann ist das ein Scheißgott, kein lieber Gott!, bricht es aus ihr heraus.
Luisa, Scheiße sagt man nicht. Außerdem kannst du nicht zum lieben Gott beten und dann solche Sachen über ihn sagen.
Noch keine Woche geht Luisa jetzt zur Schule, ist sie, wie sie stolz sagt, ›ein Schulkind‹ (ihre große Schultüte wird in der Erinnerung überblendet von deiner, die so viel riesiger gewesen zu sein schien und so viel schöner mit ihrem blau-silbern leuchtenden Stanniolüberzug und den Glitzerbildchen darauf, wogegen die Kinder heute bereits am ersten Schultag Reklame laufen), und schon hat die makellose Unschuldshaut, die sie bis zu diesem Tag umhüllte und sie die ersten sechseinhalb Jahre ihres Lebens im Paradies gehalten hat, erste hässliche Risse und Schmisse bekommen. Die Keime von Vulgarität und Gemeinheit dringen ebenso ein wie Hass, Neid, Ungerechtigkeit, Kampf – du ahnst es noch nicht, Kind, aber dein erster Schultag war the first day of the rest of your life.
Das Göttliche, das Ehrfurchtgebietende, das Anbetungswürdige, die Unversehrtheit der Seele – von nun an wird das alles jeden Tag weniger werden, und irgendwann bist du ein Mensch, und wie fremd und ernüchtert und sehnsuchtskrank werden wir einander dann aus zunehmender Distanz anblicken.
Am zweiten Tag brachte sie das Wort ›Scheiße‹ nach Hause. Das hat sie nicht aus der Schule, sagte Heike, das hat sie von dir.
Ich will aber trotzdem nicht, dass Bella stirbt!, sagt Luisa heftig, wie um den Kraftausdruck durch die Vehemenz ihres Willens zu rechtfertigen.
Sie beginnt zu weinen. Er weiß nicht, was er sagen soll. Er nimmt sie in den Arm. Er findet, er bräuchte selber Trost. Ein wenig spendet ihm ihre warme Lebendigkeit.
Müssen wir alle sterben? Sie hat sich wieder losgemacht. Das Thema ist zu ernst.
Irgendwann einmal, wenn wir alt und lebenssatt sind. Aber du erst in hundert Jahren.
Und was ist das für eine Krankheit, die Bella hat?
Die heißt Krebs.
Ist das ansteckend?
Nein, ist es nicht.
Und wenn doch? Dann kriegen wir sie auch.
Nein, da musst du keine Angst haben. Krankheiten übertragen sich nicht vom Tier auf den Menschen, und es ist sowieso keine ansteckende Krankheit.
Und wenn ich Bella streichele?
Nein, im Gegenteil. Mit jeder Zärtlichkeit tust du ihr was Gutes. Sie weiß ja nicht, was sie hat, die Ärmste.
Weiß Bella, dass sie vielleicht sterben muss?
Nein. Sie spürt nur, dass es ihr schlecht geht. Tiere sind, wenn sie sterben müssen, immer ganz gottergeben. Sie legen sich irgendwo hin oder verstecken sich und warten, dass es vorübergeht.
Weil sie nicht wissen, dass sie sterben.
Ja, vielleicht.
Aber warum müssen wir es denn wissen?
Weil wir Menschen sind, mein Herz. Wir können mehr fühlen als ein Tier, aber dafür müssen wir auch mehr wissen.
Luisa runzelt die Stirn. Das ist schwer zu verstehen für sie.
Charly wünscht sich Heike an seine Seite. Am liebsten würde er nach ihr rufen. Was mache ich hier? Philosophischen Stuss reden! »Weil wir Menschen sind, mein Herz.« So ’n Scheißdreck! Was soll sie denn damit anfangen? Heike würde sie nur in den Arm zu nehmen brauchen, und sie schliefe auf der Stelle ein. Das sind seine schönsten Momente: zusehen, wie natürlich Heike mit den Kindern umgeht. Und dabeisitzen.
Es ist überhaupt kein Gleichnis oder sowas, sondern pure Realität: Bei der Geburt und davor und danach ist jeder Mann, mag er auch mit Brief und Siegel der Erzeuger sein, ein Joseph und steht mit großen Augen zwischen Ochs und Esel. Charly weiß nicht mehr, wann ihm diese Erkenntnis gekommen war, irgendwann in der Rückschau oder zu Weihnachten, jedenfalls nicht im Kreißsaal.
Heike war eine vorbildliche Schwangere. Sie arbeitete bis in den achten Monat, hatte keine Migräne, musste sich nicht übergeben und war noch erstaunlich lange bereit, mit ihm zu schlafen. Oxytocine und Vernunft ließen sie nach der ersten Ultraschalluntersuchung von einer Stunde auf die andere das Rauchen einstellen. Nie mehr fing sie wieder damit an. Trauerte dem auch nicht nach. Sie war nicht mehr alleine ab diesem Moment, und Charly, der sich so monogam, so bereit zu gemeinsamer Brutpflege fühlte wie eine Meise, ein Schwan, ein Fuchs oder eine Präriewühlmaus, musste feststellen, dass er trotz aller Unterstützung seiner Hormonrezeptoren vor allem seinen guten Willen brauchte, wogegen seine Frau sukzessive und ganz ohne Mystik eine andere wurde und einen anderen Bund eingegangen war.
Als er sie, das seit Tagen bereitstehende Köfferchen in der Hand, ins Krankenhaus brachte und sie beide noch scherzend und mit einem Gefühl wie Lampenfieber sich die kommenden Stunden ausmalten, nicht ahnend, dass es zwanzig werden würden, da hätte ihm seine Josephsrolle schon deutlich werden können, die eines Helfers und Gut-Zureders und mehr oder minder hilflos bei den Atemübungen Assistierenden. Denn alles das, was danach folgte, das völlig Neue, ganz und gar Fremde und Beängstigende – die Atemstöße und die zunehmenden Schmerzen, zunächst erträglich, dann plötzlich so unerwartet peinvoll, dass die nächste Wehe mit Furcht erwartet wurde, dann wie ein langsames Eintauchen in eine Flucht immer engerer, luft- und lebenabschnürender konzentrischer Kreise oder Eisenbänder und die Erwartung, vom jeweils nächsten zermalmt zu werden, und das atemlose Erstaunen, noch einen Ring weiter und tiefer gekommen zu sein, und die Sicherheit, den nächsten nicht mehr zu ertragen, ihr Stöhnen, dann ihr ausatmender Schrei, dann die sich lösenden Tränen, das Pressen bis zur Verformung ihres Kopfes, ihres Halses, ihrer Schultern, und schließlich, jenseits des Endes aller Kräfte und erst nachdem die herbeigerufene Hebamme den Chefarzt unsanft zur Seite gedrückt, um mit ihren Händen den rot geäderten riesigen Bauch zu kneten wie ein Bildhauer den Ton, bis sie das Kind darin mit dem Kopf voraus in den Geburtskanal bugsiert hatte, das letzte nervenzerreißende Crescendo von Schmerzen und Wehen und Schreien (als er nicht mehr daran glaubte, nur noch seine Frau gerettet haben wollte), und so plötzlich wie zuvor die Entwicklung endlos gewesen war, die fischartig flutschende Erlösung in Blut und Gewebe –, alles das gehörte nur ihr, Leid und Erlösung ausschließlich ihr (und ein wenig der Hebamme).
Was Joseph tun konnte, wozu er nötig war, das war die Bereitschaft zu sozialer Monogamie. Er wurde gebraucht (wenn auch nicht um den Preis des Lebens) von dem Doppelwesen, das da geboren war, er stand ihm am nächsten und weinte, als die Hebamme das Neugeborene auf Heikes schweißnassen Bauch legte. Er wagte nur, ihre nasse Stirn zu küssen, Ehrfurcht, Scheu, Ekel, Vorsicht ließen gar nichts anderes zu. Das, wie sollte man es nennen, das selig-müde, Fältchen und Krähenfüße spinnende Lächeln, das weniger eine Aktivität ihrer Gesichtsmuskeln zu sein schien als vielmehr etwas von außen über sie gebreitetes oder aufgeprägtes, dieses Lächeln war etwas ganz Neues und Niegesehenes, und keine Verschmelzung, kein Orgasmus hatte je etwas Ähnliches hervorrufen können.
Maler der Spätgotik und der Renaissance haben es in ihren Mutter-und-Kind-Gemälden dargestellt, dieses Lächeln: Es zeigt sich weniger am Bogen der geschlossenen Lippen – die nur ganz leise angerührt scheinen, so wie ein zarter Windhauch ein Blatt am Baum nicht flattern, sondern nur beben lässt – als an den Augen. Die Lider sind noch schwer, als erholten sie sich langsam von einer Last, die lange auf ihnen gelegen hat, und der Blick, der, ganz exklusiv und alles andere ausschließend und ausblendend, das Kind erfasst, nicht so sehr ansieht als vielmehr birgt, der Blick, in dem sich Staunen, Bangigkeit und zärtliche Zuneigung die Waage halten, scheint über die festgehaltene Sekunde hinaus in eine Art von Ewigkeit zu gehen, in ein Vergangenheit und Zukunft umfassendes Präsens, und ist daher Freude so gut wie Trauer, die beide in dieser Dimension ununterscheidbar werden.
Es liegt aber noch etwas anderes in den Gesten der Mutter (wie in ihren Blicken, die immer auf das Kind gerichtet sind, das seinerseits diesen Blick nur selten erwidert), etwas Ausgrenzendes, eine Art exklusiver Besitzanspruch; nicht nur bergen die Arme der Mutter den Säugling, sie verbergen ihn auch vor dem Vater.
In irgendeinem Museum hat Charly einmal ein Gemälde gesehen, etwas Italienisches aus dem fünfzehnten Jahrhundert, eine Szene auf der Flucht nach Ägypten, Mutter und Kind auf dem Esel, Joseph daneben. Der Esel hat den Kopf gesenkt und macht sich ans Grasen, die Gruppe will rasten. Joseph steht vom Betrachter aus gesehen rechts von ihm, den Kopf gesenkt, die Gerte schlaff in der Hand, offenkundig erschöpft und müde. Marias Beine hängen an der rechten Flanke des Tiers hinab, sie ist im Begriff abzusteigen, hat das Jesuskind dafür mit beiden Händen umfasst und hält es ein wenig von sich ab. Ihr Kopf aber ist zu ihrem Mann gewendet, sie mustert ihn vor dem Absteigen kurz über die linke Schulter. Ja, sie mustert ihn, es ist kein abschätziger Blick, aber ein flüchtig einschätzender, ein Blick des Nutzdenkens: Kann er noch? Ist er uns noch eine Hilfe? Kann er noch etwas für uns tun? Haben wir ihn überbeansprucht, überschätzt? Macht er schlapp und lässt uns im Stich?
Damals bei der Geburt wurde Charly Zeuge einer Verwandlung – die kein großes Aufhebens von sich machte, das war nicht Heikes Stil, aber eine Verwandlung war es. Ein verwandelter Blick, verwandelte Gesten (ihre Armhaltung, die Neigung ihres Kopfes und der veränderte Lichteinfall darauf, wenn sie das Baby an ihrer Brust barg und es resolut »andockte«, wie die Hebamme das nannte, damit es zu saugen begann), aber er, der Mann, Karlmann, der heilige Joseph, er hatte sich nicht verwandelt, ihm war nichts verkündigt worden. Er war der Hüter des Paares, das nicht über Oxytocin-Rezeptoren, sondern durch eine Nabelschnur aus Fleisch und Blut miteinander verbunden gewesen war, und wenn er in den Tagen nach der Geburt (die von Max ging viel schneller und unkomplizierter) die innige, wie aus einem einzigen Stück Olivenholz geschnitzte Umarmung von Mutter und Säugling betrachtete, erfüllte ihn der Gedanke, Joseph und dafür verantwortlich zu sein, die kostbare Fracht nach Ägypten und wieder zurück zu geleiten, den Esel am Strick hinter sich herzuziehen, Wegelagerer mit dem Stock zu vertreiben und für Essen und Unterkunft zu sorgen, mit einem Behagen, das er nie zuvor verspürt hatte, weil ihm nie zuvor aufgegangen war, wie reizvoll es sein kann, im Film des eigenen Lebens eine Nebenrolle zu spielen.
Luisa versucht es noch einmal anders.
Und wie ist es im Himmel?
Das wissen nur die, die dort sind. Und die können es uns nicht sagen.
Meinst du, dass man alle seine Freunde wiedertrifft im Himmel?
Ich kann es dir nicht versprechen, aber ich glaube, im Himmel passiert all das, was du dir am allermeisten wünschst.
Kriegt man dann da auch sein Lieblingsessen?
Was würdest du dir denn wünschen?
Fischstäbchen mit Pommes und Ketchup!
Ich bin sicher, es gibt himmlische Fischstäbchen.
Sie denkt nach. Dann schüttelt sie den Kopf.
Nein, das geht nicht, Papa.
Warum nicht?
Weil die Fische, die sterben, im Himmel ja auch wieder aufwachen. Dann können sie doch nicht nochmal zu Fischstäbchen gemacht werden.
Ja, wahrscheinlich hast du da recht. Wahrscheinlich gibt es dort auch ganz andere Sachen zu essen.
Papa, meinst du, dass Bella merkt, dass sie nicht mehr so gut riecht?
Ja, das glaube ich bestimmt.
Woher kommt das?
Das ist die Krankheit. Aber genau kann ich es dir nicht sagen.
Aber du hast dich nicht bei ihr angesteckt?
Nein, ganz sicher nicht. (Vor allem nicht an einem am Anus durchbrechenden Tumor!)
Ich will nicht, dass sie stirbt!
Ich weiß, aber vielleicht können wir ja –
Ich will keinen anderen Hund, ich will meine Bella!
Ich wollte doch gar nichts sagen von einem anderen Hund …
Aber genau das hat er natürlich gewollt. Der Hund, der (noch bevor es eine Bella gab) zu dem kostbaren Bild dazugehört, das nur als ein vollständiges Charlys Glück verbürgt. Du weißt es noch und siehst es vor dir, während du das weinende Kind an deine Brust drückst:
Als Heike aus der Tür des Sprechzimmers ihrer Frauenärztin trat und Charly die aufgeschlagene Geo in den Schoß legte und sie ansah und binnen einer Sekunde an allem – der Körperhaltung, den Augen mit den Lachfältchen, dem zu einem kaum sichtbaren Lächeln an den Winkeln hochgezogenen Mund – das Wunder ablas, da war das erste Bild, das sich vor ihm aufbaute, dreidimensional und in leuchtenden Farben, noch bevor er stand und sie in die Arme nahm, das einer Kindheit, die sich diametral von seiner eigenen unterschied, so wie er sie weniger bewusst erinnerte denn vielmehr als Gefühl in sich spürte.
Und das war bei Lichte betrachtet so merkwürdig wie unlogisch.
Und dennoch war es etwas, das in ihrer Lebensplanung nie zur Diskussion stand. Es war das Bild einer Kindheit mit einem schwanzwedelnden Golden Retriever in einem grünen Garten mit einem Einfamilienhaus wie aus der Margarinereklame, das Bild einer vollkommen idyllischen Kindheit an einem einzigen Ort, ohne Umzüge, ohne Einsamkeit, ohne Entwurzelung, ohne Ängste und Verluste und den Zwang, sich immer wieder neu durchzusetzen, ohne Sehnsucht und Neid und Schmerz.
Eine Kindheit, die ein genaues Gegenteil deiner eigenen sein muss.
Eine Kindheit also ohne jenen ersten, unerwarteten Abschied aus Friedrichshafen, mit dem alles begann. Aus Friedrichshafen mit seinen drei Kirchtürmen – oder besser vier, denn die Schlosskirche besitzt deren zwei. Zwei perfekte, symmetrische, barocke Zwiebeltürme, er sah sie aus dem Grün herausragen bei jedem Spaziergang die Uferpromenade entlang. Die Schlosskirche hatte etwas von einer Adelsherrin, einer Stiftsdame, alterslos, von ebenmäßigen Zügen und ruhiger Würde, die zurückgezogen vom Trubel der Stadt in ihrem Park lebte, über dessen Mauern sie herübersah, die Distanz genießend, die ihre Majestät gebot und die ihr gewährt wurde. Als Kind hat er die Kirche neben Erika, zwischen den Eltern ein einziges Mal betreten, zur Weihnachtsandacht in einer eisigen Winternacht. Sie war kalt, kerzenleuchtend und von karger Heiligkeit. Die Nikolauskirche im Innenstadtbogen mit ihrem Stufengiebel dagegen liebte er, wie man eine rosige und vergnügte dicke Marktfrau liebt, die einem mitten im Winter heiße, gezuckerte Backäpfel schenkt. Dem Kindern vertrautesten Heiligen gewidmet, strahlte sie Güte und Herzenswärme aus, sie erinnerte ihn an die Kirchen auf den Adventskalendern, und vielleicht bildete er sich tatsächlich ein, man könne in der Vorweihnachtszeit ihre Portale, Türchen, Fenster und Luken aufklappen und bekäme flötende Engel, Lichterkränze, eine Eule im Dachstuhl und eine im Heiligenschein des Kindes schimmernde Krippe mit Ochs und Esel zu sehen. Dagegen erfüllten ihn Bangigkeit, Angst vor dem Tod und seinem düsteren Engel und eine gewisse Abscheu angesichts der Canisius-Kirche zwischen den Bahngleisen und dem Maybachwerk ganz in der Nähe des alten Schulhauses, in das er jeden Morgen eintrat. Mit ihren schwärzlich-ochsenblutroten Backsteinmauern, die in seiner Erinnerung viel rußiger und düsterer sind, als sie heute auf Fotos wirken, ließ sie ihn an ein Fabrikgebäude denken, einen Verschiebebahnhof, irgendein lärmendes, stampfendes Mahlwerk der Seelen, in dem kein lieber Gott wohnen konnte, eher sein rußiger, schwarzer Widerpart, der in seinen Albträumen eine so beherrschende Rolle spielte. Dennoch war auch die St. Petrus Canisius-Kirche vollwertiger Teil dieser Trias, des Dreiecks der Kirchtürme, deren Silhouetten für ihn so etwas darstellten wie christliche Eschen Yggdrasil, die Säulen, auf denen das Himmelsgewölbe sicher ruhte mit seinen wer weiß wie vielen Sternlein, seinen Schutzengeln und den verstorbenen Großvätern, die wohlwollend herabsahen.
Und dann zogen sie fort aus dieser Stadt, in der er Jürgen Rieger, der die ganze Klasse terrorisierte und es auch bei ihm versuchte, auf dem Nachhauseweg in den Entwässerungsgraben geboxt hatte, wodurch das Leben plötzlich freie Bahn in alle Zukunft versprach. Fort aus der Stadt, deren Seegeruch er, wenn er möchte, in seine Nase zaubern kann, den brackigen und würzigen Geruch an der Treppe hinab zum Wasser auf dem Weg zum Hafenbahnhof und dort den metallischen Geruch der Waage in der großen Halle, auf deren silbriges, profiliertes, leicht schwankendes Fußblech er stieg, und er erinnert sich an das Gefühl des kleinen, pastellfarbenen (grün oder rosa oder beige, immer wechselnd), rechteckigen Wiegekärtchens in seiner Hand, das aus dickem, hartem, unverbiegbarem Karton bestand und mit einem Klingeln in die von so vielen Händen glattpolierte Mulde auf Höhe seines Halses fiel und auf dem in Schreibmaschinentype sein Gewicht gedruckt war: 17,2 Kilo.
Eine Kindheit also ohne das albtraumhafte Erwachen in einen Dachauer Novemberschultag mit Dauerregen, wenn ihr die Räder aus dem Fahrradkeller hochtrugt um 7 Uhr in der Dunkelheit und dann im grünen Cape über den Hof und auf die Straße und mit zusammengebissenen (nassen) Zähnen die fünf Kilometer bis zur Schule, die nassen, zusammengekniffenen Augen auf das Katzenauge am Hinterrad Erikas geheftet, und die Nässe und der feuchte, muffige Geruch der Pullover (die genau dann getrocknet waren, wenn ihr wieder raus in den Regen musstet), und der Lehrer, Herr Hornbichl, redete in seinem breiten, so unsäglich fremden Dialekt, und was für ein Kampf, täglich geführt, Woche um Woche, Monat um Monat, anerkannt zu werden dort, respektiert zu werden, nicht mehr schikaniert zu werden als der ewige »Neue«.
Erst als er sein Talent auf dem Fußballplatz entdeckte und Rechtsaußen in der Knaben-B-Mannschaft des TSV 1865 wurde und auf der rechten Außenbahn, den Ball am Fuß, allem entfloh in die Freiheit eines halbhoch fast von der Eckfahne auf den Elfer hingezirkelten Passes, den Ecki einmal volley verwandelte, begannen sie ihn, den Zugereisten, zu akzeptieren, und Eckis Augen leuchteten, wenn er auf den Hof herunterkam, und kaum war es so weit, zogen sie wieder fort.
Eine Kindheit also ohne das Skalpell des Geldes, das schneidend leise die Kinder in ›wir‹ und ›sie‹ trennte mit unsichtbarer, aber präziser Schärfe und alles Minderwertige auslöste wie den Knochen vom Fleisch. Plötzlich war der Fußballverein zu weit entfernt von der Siedlung mit den Einfamilienhäusern, und die Eltern fürchteten um unsere Glieder und Sehnen angesichts der Metzgerburschen und Hauptschüler (und Jugos) dort, und ›wir‹ gingen ohnehin alle in den Tennisclub von Hemmingen-Westerfeld. Auch die Eltern (um Bekannte zu finden). Und diesmal waren es nicht seine sportlichen Talente, sondern das sich in Rhetorik findende Ego, das ihm Respekt und den Klassensprecherposten eintrug. Am altehrwürdigen KWR begegnete er auch zum ersten Male Adligen (auf Augenhöhe, versteht sich), und die Eva-Marias und Ursulas in ihren rosa Kaschmirtwinsets waren gern gesehene Gäste, wenn sie zum gemeinsamen Üben für Klassenarbeiten ins Haus kamen. (Und das erotische Klickern des Perlenarmbands am Handgelenk einer dieser Ursulas, wenn es beim Vokabel-Aufschreiben die Tischplatte berührte. Sounds like money. So viel Englisch konnte er.) Kaum war es zu einer lieben Nachmittagsgewohnheit geworden, sich ›unterm Schwanz‹ zu treffen, da zogen wir ›zurück‹ nach Hamburg.
Eine Kindheit also ohne den Schock, die unglaubliche Ungerechtigkeit, mitten in den Pubertätslieben und -freundschaften wieder aus der neuentdeckten und angeeigneten Heimatstadt herausgerissen zu werden (die letzten Nachmittage, an denen unkontrollierte Tränen der Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit und Wut ins Kopfkissen flossen), nur wegen der Jobcapricen des Alten, der sich einen Dreck um seine Kinder scherte (»wir haben immer darauf geachtet, dass ihr an die besten Schulen kommt«), und Tage darauf der zweite Schock: die Erkenntnis, die wie Kohlensäure durch die Blutbahn prickelte, in eine Weltstadt geraten zu sein, gemessen an der Hamburg zu piefigster Provinz verzwergte, dein Hamburg.
Natürlich war es die Fremde, aber auch die Überwältigung, Tag für Alltag in dieser Fremde zu leben, nicht nur auf Besuch dort zu sein. Unvergessen, nie zu vergessen der Tunnelblick in irgendeine unzerstörte Straßenschlucht, in das gewaltige, summende, brummende, nach Metall und Abfall und überhitztem Trafo duftende Zeitkontinuum einer europäischen Metropole mit Backsteinfassaden und regenglänzenden grünen Kupferdächern und polierten goldenen Kronen und schmiedeeisern umzäunten Brunnen. Wie jede in Jahrhunderten gewachsene Weltstadt war Amsterdam von einer souveränen Selbstgenügsamkeit, von pulsierender Gelassenheit.
Von der großen, möblierten Wohnung im Nieuw Zuid nahe der Beethovenstraat aus wurden die konzentrischen Kreise der Stadt, ihre Jahresringe, zu Fuß, mit dem Rad, mit der Strippenkaart in der Tram erkundet. Kalte, neblige Januarmorgen in den Cafés des Pijp, sonnige Oktobernachmittage auf den Wiesen im Vondelpark und die Stunde nach der Schule, wenn die Clique, anstatt nach Hause zu fahren, sich auf der Terrasse des American am Leidseplein traf und man sich für den Abend im The Movies im Jordaan verabredete.
Hier kamen sie beide den Eltern abhanden, es hätte gar nicht die bedrückte, verlogene Stimmung zu Hause gebraucht, die sich ab und zu in nervösen Ausbrüchen entlud. Das bürgerliche Trauerspiel der scheiternden Ehe (die dann doch hielt, dank des Herzanfalls und der Rückkehr) war verstaubtes neunzehntes Jahrhundert verglichen mit den grenzenlosen Verheißungen, die sich ihnen boten, die Amsterdam der jugendlichen Seele öffnete, als klappten die Wände unserer Wohnung plötzlich auf wie die Seiten eines Pappkartons und offenbarten die sonnenbeschienene, dunstglasige Weite einer ganz unbekannten zusätzlichen Dimension. In die man nur hineinzuwandern brauchte. Sie hieß Jugend, Freiheit, hieß ›Mein Leben‹.
Natürlich bewahrte Amsterdam auch deswegen einen besonderen Zauber, weil sie die Stadt nur oberflächlich kennenlernten und sich für den niederländischen Teil an ihr, Geschichte, Politik, Gesellschaft, überhaupt nicht interessierten. Die Clique aus der deutschen Schule, die sich auf dem Leidseplein traf, nicht nur bekam sie keinen Kontakt zu den Einheimischen (die allerdings auch nicht sonderlich interessiert waren und ihr Land zu schützen versuchten, indem sie Sprache als Zitadelle benutzten und jedem Ausländer, vor allem den Deutschen, in dessen Sprache antworteten, auch wenn sie sie schlechter beherrschten als dieser die ihre), sie wollte auch gar keinen, lernte Niederländisch nur oberflächlich und genoss die exterritoriale Illusion, das Gefühl von ›Internationalität‹.
Und während Charly mit seinen Freunden, Söhnen und Töchtern deutscher Diplomaten, Auslandskorrespondenten und Geschäftsführer niederländischer Firmenfilialen, die Stadt durchstreifte, rauchte, küsste, tanzte, diskutierte, sich ver- und entliebte, alles samt Schulpensum in nie gekannter Leichtigkeit, da verlor er seine Schwester, die bislang immer, trotz des Altersunterschieds, wie ein Zwilling zu ihm gehört hatte.
Er bekam zunächst gar nicht mit, dass Erika begann, ihre eigenen Wege zu gehen. Sie wurde in diesem Amsterdamer Jahr noch viel mehr als er zu einer Erwachsenen, die in immer längeren Abwesenheiten – dabei all ihre Pflichten in der Schule und zu Hause perfekt erfüllend – ihre Autonomie gewann und fortan nie mehr als Tochter, nur noch auf Augenhöhe, mit Respekt und einer gewissen ehrfürchtig-erstaunten Distanz behandelt wurde.