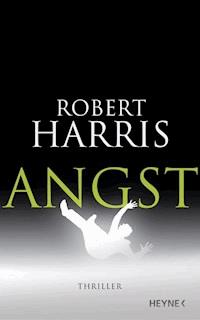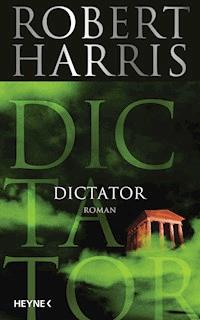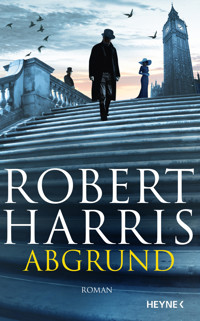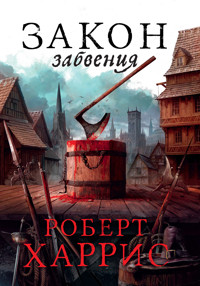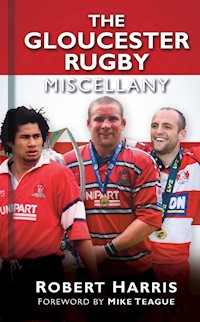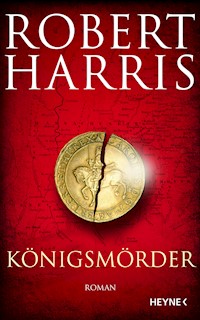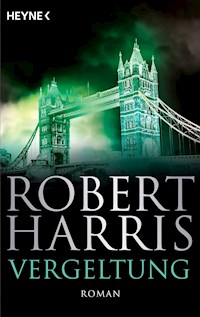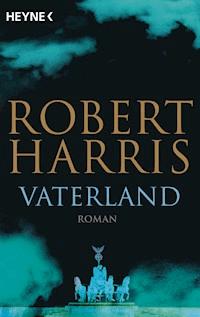
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Hitler hat den Krieg gewonnen - Nazideutschland beherrscht ganz Europa. Das ist das Horrorszenario in Robert Harris' frivolem Politthriller.
«Harris versteht, gut und spannend zu schreiben. Es kommt alles vor: Verbrechen, Verschwörungen, Vertuschung, Irreführung, Gewalt und Liebe. Harris kann den Historiker nicht verleugnen - so würzt er seine Geschichte mit historischen Dokumenten.»
DIE ZEIT
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 598
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Hitler hat den Krieg gewonnen. Großdeutschland, das vom Rhein bis zum Ural reicht, dominiert Europa. Auch noch 1964 zermürben allerdings ständige Partisanenkämpfe im Osten das Reich, weshalb wenigstens der Kalte Krieg mit den USA beigelegt werden soll. Mit großem Pomp wird der 75. Geburtstag des Führers geplant, zu dem man auch den amerikanischen Präsidenten Joseph Kennedy erwartet. Da kommt der brutale Mord an einem hohen Parteibonzen kurz vor den Feierlichkeiten höchst ungelegen. Die Ermittlungen werden offiziell schnell eingestellt. Kripoermittler Xaver March will aber nicht locker lassen und gerät mit seinen Entdeckungen an eine Wahrheit, die alle Vorstellung sprengt. Als nunmehr Mitwisser sind seine Tage gezählt.
Mit Vaterland hat Robert Harris einen modernen Klassiker im Genre der Alternativwelten geschrieben, der verstörend zeitlos und aktuell ist.
»Ein Schriftsteller, der Spannung beherrscht wie Alfred Hitchcock.« Nelson Mandela
Der Autor
Robert Harris wurde 1957 in Nottingham geboren und studierte in Cambridge. Seine Romane Vaterland, Enigma, Aurora, Pompeji, Imperium, Ghost, Titan, Angst, Intrige, Dictator, Konklave, München, Der zweite Schlaf und Vergeltung wurden allesamt internationale Bestseller. Seine Zusammenarbeit mit Roman Polański bei der Verfilmung von Ghost (Der Ghostwriter) brachte ihm den französischen »César« und den »Europäischen Filmpreis« für das beste Drehbuch ein. Die Verfilmung von Intrige – wiederum unter der Regie Polańskis – erhielt auf den Filmfestspielen in Venedig 2019 den großen Preis der Jury, den Silbernen Löwen. Robert Harris lebt mit seiner Familie in Berkshire. Zuletzt erschien im Heyne-Verlag sein historischer Roman Königsmörder.
ROBERT HARRIS
VATERLAND
ROMAN
Aus dem Englischen von
Hanswilhelm Haefs
Durchgesehene und verbesserte Neuausgabe
Mit einem Nachwort vom Autor
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Für Gill
Danksagung
Ich danke den Bibliothekaren der Wiener Library in London für ihre langjährige Hilfe.
Ebenso danke ich David Rosenthal und – besonders – Robyn Sisman, ohne die dieses Buch nie begonnen, geschweige beendet worden wäre.
R.H.
Die hundert Millionen selbstbewusster deutscher Herrenmenschen sollten aufs brutalste in Europa eingesetzt und in ihrer Macht gesichert werden durch ein Monopol technischer Zivilisation und die Sklavenarbeit einer abnehmenden eingeborenen Bevölkerung von vernachlässigten, kranken, illiteraten Kretins, damit sie die Muße gewönnen, über unendliche Autobahnen dahinzubrausen, die Kraft-durch-Freude-Hotels, die Parteihauptquartiere, das Militärmuseum und das Planetarium zu bewundern, die ihnen ihr Führer in Linz (seinem neuen Hitleropolis) erbauen wollte, durch die örtlichen Kunstgalerien zu traben und bei Sahneteilchen endlosen Wiederholungen der Lustigen Witwe zuzuhören. Das sollte das Deutsche Jahrtausend sein, aus dem nicht einmal die Einbildungskraft mehr Fluchtmittel haben würde.
HUGH TREVOR-ROPER
Der Geist Adolf Hitlers
Wenn einer sagt: Passen Sie auf, Sie kriegen jetzt zwanzig Jahre Partisanen-Krieg! Diese Aussicht erfreut mich … Deutschland wird in einem Zustand der ewigen Wachsamkeit bleiben.
ADOLF HITLER
29. August 1942
TEIL I
DIENSTAG, 14. APRIL 1964
Ich schwöre Dir, Adolf Hitler,
als Führer und Kanzler des Deutschen Reiches
Treue und Tapferkeit.
Ich gelobe Dir und den von Dir bestimmten Vorgesetzten
Gehorsam bis in den Tod,
so wahr mir Gott helfe.
Der Eid des SS-Mannes
1
Dicke Wolken hatten die ganze Nacht über Berlin gedräut, und jetzt schleppten sie sich in das hinein, was als Morgen galt. An den westlichen Stadträndern trieben Regenfahnen wie Rauch über die Oberfläche der Havelseen.
Himmel und Wasser verschmolzen zu einer grauen Schicht, die nur von der dunklen Linie des gegenüberliegenden Ufers unterbrochen wurde. Da bewegte sich nichts. Kein Licht war zu sehen.
Xaver March, Mordermittler der Berliner Kriminalpolizei, stieg aus seinem Volkswagen und hielt das Gesicht in den Regen. Er mochte diesen besonderen Regen. Er kannte seinen Geschmack und seinen Geruch. Es war baltischer Regen, aus dem Norden, kalt und von der See gewürzt, scharf vom Salz. Für einen Augenblick fühlte er sich wie vor zwanzig Jahren, im Kommandoturm eines U-Bootes, das aus Wilhelmshaven hinausglitt, mit gelöschten Lichtern, hinein in die Dunkelheit.
Er sah auf die Uhr. Es war kurz nach sieben.
Am Straßenrand vor ihm standen drei andere Wagen. Die Insassen von zweien schliefen auf dem Fahrersitz. Der dritte war ein Streifenwagen der Ordnungspolizei – der Orpo, wie jeder sie nannte. Er war leer. Durch das offene Fenster drang in der feuchten Luft das Funkgerätknistern scharf herüber, unterbrochen von heruntergerasselten Redefetzen. Das Drehlicht auf dem Dach leuchtete den Wald neben der Straße an: blau/schwarz, blau/schwarz, blau/schwarz.
March suchte nach den Orpo-Leuten und sah sie sich am See unter einem tropfenden Birkenbaum schützen. Im Schlamm zu ihren Füßen schimmerte etwas fahl. Auf einem Baumstamm nahebei saß ein junger Mann in einem schwarzen Trainingsanzug mit den SS-Zeichen auf der Brusttasche. Er war vorwärtsgekrümmt, die Ellbogen auf den Knien, die Hände seitwärts gegen den Kopf gepresst – ein Bild des Elends.
March nahm einen letzten Zug aus seiner Zigarette und schnippte sie weg. Sie zischte und erstarb auf der nassen Straße.
Als er näher kam, hob einer der Polizisten den Arm.
»Heil Hitler!«
March beachtete ihn nicht und rutschte das schlammige Ufer hinab, um sich die Leiche anzusehen.
Es war der Körper eines alten Mannes – kalt, fett, haarlos und erschreckend weiß. Aus der Entfernung hätte es eine Alabasterstatue sein können, die man mit Schlamm beworfen hatte. Mit Dreck beschmiert, lag die Leiche auf dem Rücken, halb aus dem Wasser, die Arme abgespreizt, das Gesicht zurückgeworfen. Ein Auge war fest zugedrückt, das andere schielte bösartig in den schmutzigen Himmel.
Ohne den Blick von der Leiche zu wenden, redete er den Orpo-Mann an, der ihn gegrüßt hatte. »Ihr Name, Unterwachtmeister?« March sprach mit sanfter Stimme.
»Ratka, Herr Sturmbannführer.«
Sturmbannführer war der SS-Titel, der dem Wehrmachtsrang eines Majors entsprach, und Ratka schien – obwohl hundemüde und nass bis auf die Knochen – eifrig bedacht, Ehrerbietung zu zeigen. March kannte diesen Typen, ohne auch nur hinzusehen: drei Gesuche um Versetzung zur Kripo, alle abgelehnt; eine pflichtbewusste Frau, die dem Führer eine Fußballmannschaft Kinder geschenkt hatte; ein Monatseinkommen von 200 Reichsmark. Ein Leben, in Hoffnung gelebt.
»Gut, Ratka«, sagte March, wieder mit sanfter Stimme. »Wann hat man ihn entdeckt?«
»Vor einer guten Stunde. Wir waren auf Patrouille in Nikolassee und hatten gerade Schichtende. Wir haben den Anruf entgegengenommen, Dringlichkeitsstufe eins. Fünf Minuten später waren wir hier.«
»Wer hat ihn gefunden?«
Ratka wies mit dem Daumen über die Schulter.
Der junge Mann in dem Trainingsanzug stand auf. Er konnte kaum älter als achtzehn sein. Das Haar war so kurz geschoren, dass die rosa Kopfhaut durch das spärliche hellbraune Haar schimmerte. March bemerkte, wie er vermied, auf die Leiche zu blicken.
»Ihr Name?«
»SS-Schütze Hermann Jost.« Er sprach mit sächsischem Akzent – nervös, unsicher, gefallsüchtig. »Von der Sepp-Dietrich-Akademie in Schlachtensee.« March kannte sie: eine Monstrosität aus Beton und Asphalt, die in den Fünfzigerjahren am Südufer der Havel errichtet worden war. »Ich laufe hier fast jeden Morgen. Es war noch dunkel.« Hilflos fügte er hinzu: »Zuerst hab ich gedacht, dass es ein Schwan ist.«
Ratka schniefte schmählich. Ein SS-Kadett, den ein toter alter Mann einschüchterte! Kein Wunder, dass sich der Krieg im Ural ewig weiterschleppte.
»Haben Sie sonst jemand gesehen, Jost?« March sprach in einem freundlichen Ton, wie ein Onkel.
»Nein. Es gibt eine Fernsprechzelle an dem Rastplatz etwa einen halben Kilometer zurück. Ich hab angerufen und bin dann hergekommen und hab gewartet, bis die Polizei da war. Auf der Straße war keine Menschenseele.«
March blickte wieder auf die Leiche. Sie war sehr dick. Bestimmt über zwei Zentner.
»Wir sollten ihn aus dem Wasser holen.« Er wandte sich der Straße zu. »Zeit, unsere Dornröschen zu wecken.«
Ratka, der im strömenden Regen von einem Bein aufs andere trat, grinste.
Es regnete jetzt stärker, und das Kladower Ufer war praktisch verschwunden. Wasser prasselte auf die Baumkronen und trommelte auf die Wagendächer. Der schwere Regengeruch nach Verfall lag in der Luft: fette Erde und verrottende Vegetation. Marchs Haare waren an die Kopfhaut geklatscht, Wasser rann ihm den Hals hinab. Er nahm es nicht wahr. Für March enthielt jeder Fall, wie routinemäßig auch immer, wenigstens zu Anfang das Versprechen auf Abenteuer.
Er war zweiundvierzig Jahre alt – schlank, mit grauem Haar und kühlen, grauen Augen, die zum jetzigen Himmel passten. Im Krieg hatte das Propagandaministerium einen Spitznamen für die U-Boot-Männer erfunden – die »grauen Wölfe« –, und das wäre in einer Hinsicht ein guter Name für March gewesen: Er war ein akribischer Fährtensucher. Aber vom Wesen her war er kein Wolf und rannte nicht mit dem Rudel. Er verließ sich mehr aufs Hirn als auf Muskeln, weshalb ihn seine Kollegen stattdessen auch »Fuchs« nannten.
U-Boot-Wetter!
Er riss die Tür des weißen Škodas auf und wurde von einem Schwall heißer Luft der Autoheizung getroffen.
»Morgen, Speidel!« Er schüttelte die knochige Schulter des Polizeifotografen. »Zeit, nass zu werden.« Speidel fuhr zusammen und wurde wach. Er warf March einen wütenden Blick zu.
Als sich March nun dem anderen Škoda näherte, kurbelte jemand das Fahrerfenster herunter. »Schon gut, March. Schon gut.« Die Stimme von SS-Arzt Dr. August Eisler, Rechtsmediziner der Kripo, war ein Quietschen an beleidigter Würde. »Heben Sie sich Ihren Kasernenhumor für die auf, die Sinn dafür haben.«
Sie sammelten sich am Wasserrand, alle außer Eisler, der abseits stand und sich unter einem alten, schwarzen Regenschirm schützte, unter den er niemand sonst bat. Speidel schraubte ein Blitzlicht auf seine Kamera und setzte den rechten Fuß sorgsam auf einen Lehmklumpen. Als ihm eine Welle über den Schuh schwappte, fluchte er.
»Scheiße!«
Der Blitz flammte auf und fror die Szene einen Augenblick lang ein: die weißen Gesichter, die silbrigen Regenfäden, die Dunkelheit der Bäume. Ein Schwan schoss irgendwo aus dem nahen Schilf, um sich anzusehen, was da vor sich ging, und zog einige Meter entfernt seine Kreise.
»Er bewacht sein Nest«, sagte der junge SS-Mann.
»Ich brauch hier noch eine.« March zeigte. »Und eine hier.«
Speidel fluchte wieder und zerrte seinen triefenden Fuß aus dem Schlamm. Die Kamera blitzte noch zweimal.
March beugte sich nieder und ergriff die Leiche unter den Achseln. Das Fleisch war hart, wie kaltes Gummi, und glitschig.
»Helft mir.«
Die Orpo-Leute nahmen jeder einen Arm. Vor Anstrengung grunzend, hievten sie die Leiche gemeinsam aus dem Wasser und zerrten sie über das schlammige Ufer auf die durchtränkte Wiese. Als March sich aufrichtete, fing er den Ausdruck auf Josts Gesicht ein.
Der alte Mann trug eine blaue Badehose, die ihm bis auf die Knie hinabgerutscht war. In dem eisigen Wasser waren die Genitalien zu einem winzigen Klümpchen weißer Eier in einem Nest schwarzer Schamhaare zusammengeschrumpelt.
Der linke Fuß fehlte.
Das musste wohl so sein, dachte March. Das war einer der Tage, an denen nichts einfach war. Ein Abenteuer allerdings.
»Herr Doktor. Ihre Meinung bitte.«
Mit einem gereizten Seufzer trat Eisler geziert vor und zog sich den Handschuh von der einen Hand. Das Bein der Leiche endete unterhalb der Wade. Während Eisler immer noch den Schirm hielt, beugte er sich steif vor und ließ die Finger um den Stumpf gleiten.
»Eine Schiffsschraube?«, fragte March. Er hatte Leichen gesehen, die man aus belebten Wasserwegen gezogen hatte – dem Tegeler See und der Spree in Berlin, der Alster in Hamburg – und die alle ausgesehen hatten, als wären Metzger über sie hergefallen.
»Nein.« Eisler zog die Hand zurück. »Eine alte Amputation. Übrigens ausgezeichnet gemacht.« Er presste mit der Faust hart auf die Brust. Schlammiges Wasser schoss aus dem Mund und blubberte aus den Nasenlöchern. »Rigor mortis ziemlich fortgeschritten. Zwölf Stunden tot. Vielleicht weniger.« Er zog den Handschuh wieder an.
Irgendwo hinter ihnen ratterte ein Dieselmotor durch die Bäume.
»Der Rettungswagen«, sagte Ratka. »Die lassen sich Zeit.«
March winkte Speidel zu sich. »Machen Sie noch eine Aufnahme.«
Er blickte auf die Leiche hinab und zündete sich eine Zigarette an. Dann hockte er sich hin und starrte in das offene Auge. So verharrte er eine Weile. Wieder blitzte die Kamera. Der Schwan bäumte sich, schlug mit den Schwingen und machte sich dann zur Nahrungssuche in die Seemitte auf.
2
Das Kripohauptquartier lag auf der anderen Seite Berlins, eine Fünfundzwanzig-Minuten-Fahrt von der Havel aus. March brauchte eine Aussage von Jost und bot ihm an, ihn an seiner Kaserne abzusetzen, damit er sich umziehen könne, aber Jost lehnte ab. Er wolle seine Aussage lieber so schnell wie möglich erledigen. Nachdem die Leiche im Rettungswagen verstaut und zum Leichenschauhaus unterwegs war, machten sie sich also in Marchs kleinem, viertürigem Volkswagen auf den Weg durch den Stoßverkehr.
Es war einer jener trostlosen Berliner Morgen, wo die berühmte Berliner Luft nicht erfrischend, sondern nur scharf war und die Feuchtigkeit wie mit tausend Eisnadeln in Gesicht und Hände stach. Auf der Potsdamer Chaussee zwang das Spritzwasser der vorüberrauschenden Wagen die wenigen Fußgänger an die Hauswände. Und während March sie durch die regenbespritzte Windschutzscheibe beobachtete, stellte er sich eine Stadt voller Blinder vor, die sich ihren Weg zur Arbeit ertasteten.
Es war alles so normal. Später sollte ihn das am meisten berühren. Es war wie bei einem Unfall. Zuvor war alles ganz gewöhnlich; dann der eine Augenblick; und danach hatte sich die Welt für immer verändert. Es gab nämlich nichts Routinemäßigeres als eine aus der Havel gefischte Leiche. Das geschah zweimal im Monat – verkommenes Volk und gescheiterte Geschäftsleute, leichtsinnige Kinder und liebeskranke Jugendliche; Unfälle und Selbstmorde und Morde; die Verzweifelten, die Törichten, die Traurigen.
Das Telefon hatte um Viertel nach sechs in seiner Wohnung in der Ansbacher Straße geläutet. Das Klingeln hatte ihn nicht wecken brauchen. Er hatte mit offenen Augen im Halbdunkel gelegen und auf den Regen gelauscht. Seit ein paar Monaten schlief er schlecht.
»March? Wir haben hier ’ne Meldung über ’ne Leiche in der Havel reinbekommen.« Es war Krause, der Kripobeamte vom Nachtdienst. »Seinse ein guter Junge, fahrnse hin und sehnse nach.«
Er sei nicht interessiert, hatte March geantwortet.
»Ob Sie interessiert sind oder nicht, spielt keine Rolle.«
»Ich bin nicht interessiert, weil ich keinen Dienst habe«, sagte March. »Ich hatte letzte Woche Dienst, und die Woche davor.« Und auch die Woche davor, hätte er hinzufügen können. »Heute ist mein freier Tag. Sehn Sie noch mal in Ihre Liste.«
Danach hatte es eine Pause am anderen Ende gegeben, dann hatte Krause sich wieder gemeldet und sich widerwillig entschuldigt. »Sie haben Schwein gehabt, March. Ich hab doch tatsächlich in den Dienstplan von letzter Woche geguckt. Sie können weiterschlafen. Oder …« Er hatte gegluckst. »Oder was immer Sie sonst tun.«
Eine Windbö hatte Regen gegen das Fenster gepeitscht und die Scheibe klirren lassen.
Es gab ein Standardverfahren, wenn eine Leiche entdeckt wurde. Ein Rechtsmediziner, ein Polizeifotograf und ein Ermittler hatten sich umgehend zum Tatort zu begeben. Die Ermittler arbeiteten nach einem Dienstplan, den das Kripohauptquartier am Werderschen Markt führte.
»Wer ist heute eigentlich dran?«
»Max Jäger.«
Jäger. March teilte das Büro mit Jäger. Er hatte auf den Wecker gesehen und an das kleine Haus in Pankow gedacht, in dem Max mit seiner Frau und den vier Töchtern wohnte. Unter der Woche war das Frühstück so ziemlich die einzige Zeit, wo er sie sah. March andererseits war geschieden und lebte allein. Er hatte sich vorgenommen, den Nachmittag mit seinem Sohn zu verbringen. Aber vor ihm erstreckten sich die langen Morgenstunden, eine Leere. So wie er sich fühlte, wäre irgendeine Routinearbeit zur Ablenkung ganz recht.
»Na schön, lassen Sie ihn in Frieden«, hatte er gesagt. »Bin ja sowieso wach. Ich übernehme den Fall.«
Das war vor fast zwei Stunden gewesen. March sah im Rückspiegel nach seinem Mitfahrer. Jost schwieg, seit sie die Havel verlassen hatten. Er saß steif auf dem Rücksitz und starrte auf die vorbeigleitenden grauen Gebäude.
Am Brandenburger Tor signalisierte ihnen ein motorisierter Polizist mit einer Flagge anzuhalten.
In der Mitte vom Pariser Platz schwenkte eine SA-Kapelle in braunen, triefnassen Uniformen stampfend durch die Pfützen. Durch die geschlossenen Wagenfenster kam das gedämpfte Dröhnen von Trommeln und Trompeten eines alten Parteimarschs. Einige Dutzend Leute hatten sich gaffend vor der Akademie der Künste versammelt und zogen die Schultern gegen den Regen ein.
Es war unmöglich, zu dieser Jahreszeit durch Berlin zu fahren, ohne solchen Übungen zu begegnen. In sechs Tagen hatte Adolf Hitler Geburtstag, Führergeburtstag, ein staatlicher Feiertag, und jede Kapelle im Reich würde an den Paraden teilnehmen. Die Scheibenwischer schlugen den Takt wie ein Metronom.
March beobachtete die Menge und murmelte: »Hier sehen wir den endgültigen Beweis, dass das deutsche Volk tatsächlich verrückt ist, wenn’s um Marschmusik geht.«
Er drehte sich zu Jost um, der dünn lächelte.
Ein Beckentusch beendete das Stück. Ein feuchter Applaus prasselte. Der Kapellmeister wandte sich um und verneigte sich. Hinter ihm hatten die SA-Leute bereits begonnen, halb gehend, halb rennend zu ihrem Bus zurückzukehren. Der Polizist auf dem Streifenkrad wartete, bis der Platz leer war, dann stieß er kurz in die Trillerpfeife. Mit weißbehandschuhter Hand winkte er sie durch das Tor.
Vor ihnen gähnte Unter den Linden. Die Straße hatte ihre Lindenbäume 1936 verloren – niedergemacht in einem Akt von amtlichem Vandalismus zur Zeit der Olympischen Spiele in Berlin. An ihrer Stelle hatte Joseph Goebbels, der Gauleiter der Stadt, eine Allee aus zehn Meter hohen Steinsäulen errichten lassen, auf denen jeweils ein Parteiadler mit ausgebreiteten Schwingen hockte. Von den Krummschnäbeln und Flügelspitzen tropfte der Regen in Strippen. Es war, als führe man durch einen indianischen Begräbnisgrund.
March bremste vor den Ampeln an der Kreuzung Friedrichstraße ab und bog dann rechts ein. Zwei Minuten später hielten sie auf dem Platz gegenüber dem Kripobau am Werderschen Markt.
Es war ein hässliches Gebäude – ein mächtiges, rußverschmutztes Ungetüm aus dem Wilhelminischen Zeitalter, sechs Stockwerke hoch, an der Südseite des Marktes. March war seit zehn Jahren fast sieben Tage die Woche hergekommen. Wie seine Frau damals oft beklagt hatte, war es ihm vertrauter als seine Wohnung. Im Innern gab jenseits der SS-Posten und der knarzenden Drehtür ein Anschlagbrett den gegenwärtigen Stand der Terrorismuswarnung bekannt. Vier Farbcodes in aufsteigender Reihung nach der Dringlichkeit: grün, blau, schwarz und rot. Heute war die Warnung wie immer rot.
In der Eingangshalle wurden sie vom Doppelposten in der Glaskabine überprüft. March zeigte seinen Ausweis und unterzeichnete für Jost.
Am Markt ging es geschäftiger zu als üblich. Die Arbeit verdreifachte sich in der Woche vor dem Führergeburtstag immer. Mit Aktenstapeln beladene Sekretärinnen klapperten auf hohen Absätzen über den Marmorboden. Die Luft roch schwer nach nassen Mänteln und Bohnerwachs. Gruppen von Offizieren in Orpo-Grün und Kripo-Schwarz standen beisammen und unterhielten sich flüsternd über ihre Fälle. Über ihnen sahen von den entgegengesetzten Enden der Halle mit Girlanden geschmückte Büsten vom Führer und von Reinhard Heydrich, dem Chef des Reichssicherheitshauptamtes, einander mit leeren Augen starr an. March zog das Metallgitter am Aufzug zurück und geleitete Jost hinein.
Die Sicherheitskräfte, über die Heydrich gebot, waren in drei Gruppen gegliedert. Am unteren Ende der Hackordnung war die Orpo, die gewöhnlichen Bullen. Sie lasen Betrunkene auf, patrouillierten die Autobahnen, stellten die Strafzettel wegen überhöhter Geschwindigkeit aus, nahmen die Verhaftungen vor, bekämpften Brände, kontrollierten die Eisenbahnen und die Flughäfen, nahmen die Notrufe entgegen und fischten die Leichen aus den Seen.
An der Spitze stand die Sipo, die Sicherheitspolizei. Die Sipo umfasste sowohl die Gestapo, also die Geheime Staatspolizei, als auch den SD, den parteieigenen Sicherheitsdienst. Ihr Hauptquartier lag in einem trostlosen Komplex um die Prinz-Albrecht-Straße, einen Kilometer südwestlich vom Markt. Sie befasste sich mit Terrorismus, Umsturzgefahr, Gegenspionage und »Verbrechen gegen den Staat«. Sie hatte ihre Ohren in jeder Fabrik und jeder Schule, in jedem Krankenhaus und jeder Kirche; in jeder Stadt, in jedem Dorf, in jeder Straße. Eine Leiche in einem See würde die Sipo lediglich dann beschäftigen, wenn es sich um einen Terroristen oder einen Verräter handelte.
Und irgendwo zwischen den beiden und in beide übergehend war die Kripo – Amt V des Reichssicherheitshauptamtes. Zuständig für Verbrechensbekämpfung, untersuchte es alle offenkundigen Verbrechen, vom Einbruch über Bankraub, Tätlichkeiten, Vergewaltigung und Mischehen bis hinauf zum Mord. Eine Leiche im See – wer sie war und wie sie dahin kam –, das war Kriposache.
Der Aufzug hielt im zweiten Stock. Der Gang war wie ein Aquarium beleuchtet. Das schwache Neonlicht prallte vom grünen Linoleum und von den grün lackierten Wänden wider. Der gleiche Geruch nach Wachs wie in der Eingangshalle, hier aber noch gewürzt mit den Desinfektionsmitteln der Toiletten und abgestandenem Zigarettenrauch. Zwanzig Milchglastüren säumten den Korridor, einige halb offen. Das waren die Büros der Ermittler. Aus einem klang das Klappern eines einsamen Fingers, der auf eine Schreibmaschine einhackte; in einem anderen klingelte ein unbeantwortetes Telefon.
»Das Nervenzentrum des unermüdlichen Kampfes gegen die verbrecherischen Feinde des Nationalsozialismus«, sagte March und zitierte damit eine Schlagzeile, die kürzlich im Parteiblatt Völkischer Beobachter gestanden hatte. Er hielt inne, aber weil Jost nur verständnislos glotzte, erklärte er: »Ein Witz.«
»Bitte?«
»Vergessen Sie’s.«
Er stieß die Tür zu seinem Büro auf und knipste das Licht an. Der Raum war wenig mehr als ein düsteres Kabuff, eine Zelle, deren einsames Fenster sich auf einen Hof verrußter Ziegel öffnete. An einer Wand Regale: zerlesene ledergebundene Bände mit Vorschriften und Anweisungen, ein Handbuch der forensischen Medizin, ein Wörterbuch, ein Atlas, ein Straßenführer von Berlin, Fernsprechbücher, Kästen mit aufgeklebten Etiketten – »Braune«, »Hundt«, »Stark«, »Zadek« –, jeder Kasten ein bürokratischer Grabstein, der an irgendein lange vergessenes Opfer erinnerte. Eine andere Wand nahmen vier Aktenschränke ein. Auf einem stand oben eine Beamtenpalme, die eine mittelalterliche Sekretärin auf dem Höhepunkt ihrer unausgesprochenen und unerwiderten Leidenschaft für Xaver March zwei Jahre zuvor dort hingestellt hatte. Jetzt war die Zimmerpflanze tot. Das war die ganze Ausstattung, abgesehen von zwei Holzschreibtischen, die unter dem Fenster aneinandergeschoben waren. Der eine war von March, der andere von Max Jäger.
March hängte seinen Überzieher an einen der Haken neben der Tür. Er zog es vor, keine Uniform zu tragen, wenn vermeidbar, und am heutigen Morgen hatte er den Regensturm über der Havel als Entschuldigung dafür genommen, graue Hosen und einen dicken, blauen Pullover anzuziehen. Er schob Jost den Stuhl von Jäger hin. »Setzen Sie sich. Kaffee?«
»Gern.«
Der Automat stand im Gang. »Wir haben Fotos reinbekommen. Das glaubste nich. Sieh dir das ma’ an.« Über den Korridor konnte March die Stimme von Fiebes von der V B 3, der Abteilung für Sittlichkeitsverbrechen, hören, wie er mit seinem letzten Erfolg angab. »Hat ihr Dienstmädchen geschossen. Sieh ma’, kann man jedes Haar sehn. Das Mädel sollte Profi wern.«
Worum es da wohl gehen mochte? March schlug gegen die Seite des Kaffeeautomaten, worauf der einen Plastikbecher auswarf. Die Frau eines Offiziers, vermutete er, und ein polnischer Arbeiter, den man aus dem Generalgouvernement zur Gartenarbeit rangekarrt hatte. Meistens war es ein Pole; ein träumerischer, seelenvoller Pole, der an dem Herzen der Frau zupfte, deren Mann fort an der Front war. Es klang so, als ob sie von einem eifersüchtigen Mädchen aus dem BDM, dem Bund Deutscher Mädel, in flagranti fotografiert worden wären, das begierig darauf war, den Behörden zu gefallen. Hier lag ein Sexualverbrechen vor, wie es 1935 das Blutschutzgesetz festgeschrieben hatte.
Er gab dem Automaten einen weiteren Stoß.
Das würde ein Verfahren vor dem Volksgerichtshof geben. Der Stürmer würde darüber saftig geil als Warnung für andere berichten. Zwei Jahre Ravensbrück für die Frau. Degradierung und Ungnade für den Ehemann. Fünfundzwanzig Jahre für den Polen, wenn er Glück hatte; wenn nicht, der Tod.
»Scheiße!« Eine männliche Stimme murmelte etwas, und Fiebes, ein wieselartiger Kommissar Mitte fünfzig, dessen Frau vor zehn Jahren mit einem SS-Skilehrer durchgebrannt war, stieß ein kurzes Meckern aus. March kehrte mit je einem Becher schwarzen Kaffees in den Händen in sein Büro zurück und schmiss die Tür hinter sich so laut zu, wie er das mit dem Fuß nur konnte.
Reichskriminalpolizeiamt
Werderscher Markt 5/6
Berlin C2
ZEUGENAUSSAGE
Mein Name ist Hermann Friedrich Jost. Ich wurde am 23.2.45 in Dresden geboren. Ich bin Kadett an der Sepp-Dietrich-Akademie in Berlin. Um 5.30 Uhr heute Morgen unternahm ich meinen regelmäßigen Trainingslauf. Ich ziehe es vor, allein zu laufen. Mein normaler Weg führt mich nach Westen durch den Grunewald zur Havel, nach Norden am Seeufer entlang zum Lindwerder Restaurant, dann südlich zur Kaserne in Schlachtensee. 300 Meter nördlich der Schwanenwerder Chaussee sah ich etwas im Wasser am Rand des Sees liegen. Es war die Leiche eines Mannes. Ich rannte zu der Fernsprechzelle, die etwa einen halben Kilometer entfernt am Rand des Uferweges steht, und unterrichtete die Polizei. Ich kehrte zu der Leiche zurück und wartete auf die Ankunft der Behörden. Während der ganzen Zeit regnete es stark, ich habe niemand gesehen.
Ich gebe die Erklärung aus eigenem, freiem Willen in der Anwesenheit von Kripoermittler Xaver March ab.
SS-Schütze H. F. Jost
08.24/14.4.64
March lehnte sich zurück und studierte den jungen Mann, während der seine Aussage unterschrieb. In seinem Gesicht gab es keine harten Züge. Es war so rosa und weich wie das eines Säuglings, mit einem kräftigen Ausbruch von Akne um den Mund und einem blonden Bartflaum auf der Oberlippe. March bezweifelte, dass er sich rasierte.
»Warum laufen Sie allein?«
Jost reichte ihm die Aussage. »Das gibt mir die Möglichkeit, meinen Gedanken nachzuhängen. Es tut gut, einmal am Tag allein zu sein. Man ist in der Kaserne nicht oft allein.«
»Seit wann sind Sie Kadett?«
»Seit drei Monaten.«
»Gefällt es Ihnen?«
»Gefallen!« Jost wandte das Gesicht dem Fenster zu. »Ich hatte gerade mit meinem Studium an der Universität Göttingen angefangen, als meine Mobilmachung kam. Ich will mal so sagen, das war nicht der glücklichste Tag in meinem Leben.«
»Was haben Sie studiert?«
»Literatur.«
»Deutsche?«
»Gibt es denn andere?« Jost zeigte wieder sein dünnes Lächeln. »Ich hoffe, dass ich an die Universität zurückkann, wenn ich meine drei Jahre abgedient habe. Ich will Lehrer werden; Schriftsteller. Kein Soldat.«
March überflog die Aussage. »Wenn Sie so gegen das Militär sind, was machen Sie dann in der SS?« Er konnte die Antwort erraten.
»Mein Vater. Er war Gründungsmitglied der Leibstandarte Adolf Hitler. Sie wissen, wie das ist: Ich bin sein einziger Sohn; es war sein glühendster Wunsch.«
»Sie müssen das hassen.«
Jost zuckte die Achseln. »Ich überlebe. Und man hat mir gesagt – natürlich inoffiziell –, dass ich nicht an die Front muss. Sie brauchen in der Offiziersschule in Bad Tölz einen Assistenten, um einen Lehrgang über die Degeneration der amerikanischen Literatur zu halten. Das klingt mehr nach meinem Gebiet: Degeneration …« Er wagte ein weiteres Lächeln. »Vielleicht werde ich auf dem Gebiet noch ein Experte.«
March lachte und blickte wieder auf die Aussage. Etwas stimmte da nicht, und jetzt sah er es. »Werden Sie sicher.« Er legte die Aussage zur Seite und stand auf. »Ich wünsche Ihnen Glück beim Lehren.«
»Darf ich gehen?«
»Selbstverständlich.«
Mit einem Ausdruck der Erleichterung stand Jost auf. March griff nach der Türklinke.
»Noch was.« Er drehte sich um und starrte dem SS-Kadetten in die Augen. »Warum lügen Sie mich an?«
Josts Kopf fuhr zurück. »Was …?«
»Sie haben gesagt, Sie hätten die Kaserne um fünf Uhr dreißig verlassen. Sie haben die Polizei um fünf nach sechs angerufen. Schwanenwerder ist drei Kilometer von der Kaserne entfernt. Sie sind fit: Sie laufen jeden Tag. Sie bummeln nicht herum: Es gießt in Strömen. Wenn Sie also nicht plötzlich zu hinken angefangen haben, müssen Sie lange vor sechs am See angekommen sein. Damit sind – wie viele? – zwanzig Minuten von fünfunddreißig in Ihrer Aussage nicht erklärt. Was haben Sie da gemacht, Jost?«
Der junge Mann sah wie erschlagen aus. »Vielleicht hab ich die Kaserne später verlassen. Oder vielleicht hab ich erst ein paar Runden auf der Laufbahn gedreht …«
»Vielleicht, vielleicht …« March schüttelte traurig den Kopf. »Das sind Tatsachen, die überprüft werden können, und ich warne Sie: Es wird hart für Sie, wenn ich die Wahrheit herausfinden und Ihnen vorlegen muss. Sind Sie homosexuell?«
»Herr Sturmbannführer! Um Gottes willen …«
March legte die Hände auf Josts Schultern. »Das ist mir egal. Vielleicht laufen Sie jeden Morgen allein, um irgendeinen Burschen für zwanzig Minuten im Grunewald zu treffen. Das ist Ihre Angelegenheit. Darum geht es hier nicht. Alles, was mich interessiert, ist die Leiche. Haben Sie irgendwas gesehen? Was haben Sie wirklich gemacht?«
Jost schüttelte den Kopf. »Nichts, ich schwöre es.« Tränen stiegen ihm in die weiten, blassen Augen.
»Na schön.« March ließ ihn los. »Warten Sie unten. Ich werde veranlassen, dass man Sie nach Schlachtensee zurückbringt.« Er öffnete die Tür. »Denken Sie daran, was ich gesagt hab: Lieber sagen Sie mir jetzt die Wahrheit, als dass ich sie später allein herausfinde.«
Jost zögerte, und für einen Augenblick glaubte March, er würde etwas sagen, aber dann ging er den Korridor hinab und war fort.
March rief in die Kellergarage durch und orderte einen Wagen. Er legte auf und starrte durch das schmierige Fenster auf die gegenüberliegende Mauer. Die schwarzen Ziegel glitzerten unter dem Regenfilm, der aus den oberen Stockwerken herabstürzte. War er mit dem Jungen zu hart umgegangen? Wahrscheinlich. Aber manchmal konnte man die Wahrheit nur überlisten, konnte sie nur in einem unbewachten Augenblick durch einen Überraschungsangriff fangen. Hatte Jost gelogen? Bestimmt. Aber wenn er homosexuell war, dann konnte er es sich kaum leisten, nicht zu lügen: Jeder, der einer »widernatürlichen Unzucht« für schuldig befunden wurde, wanderte prompt ins Arbeitslager. SS-Leute, die man wegen Homosexualität verhaftete, wurden zu Strafbataillonen an der Ostfront abkommandiert; wenige kehrten zurück.
March hatte im letzten Jahr Dutzende solcher jungen Männer wie Jost gesehen. Und jeden Tag gab es mehr davon. Sie lehnten sich gegen ihre Eltern auf. Sie stellten den Staat infrage. Sie hörten amerikanische Radiosender. Sie brachten ihre grob gedruckten Kopien verbotener Bücher in Umlauf – Günter Grass und Graham Greene, George Orwell und J.D. Salinger. Vor allem aber protestierten sie gegen den Krieg – den anscheinend endlosen Kampf gegen die von den USA unterstützten sowjetischen Freischärler, der nun bereits seit zwanzig Jahren östlich des Urals vor sich hin mahlte.
Plötzlich schämte er sich, wie er Jost behandelt hatte, und erwog, hinunterzulaufen und sich bei ihm zu entschuldigen. Aber dann entschied er, wie immer, dass seine Pflicht dem Toten gegenüber zuerst komme. Seine Buße für die Grobheit des Morgens würde sein, der Leiche im See ihren Namen zu geben.
Der Dienstraum der Berliner Kriminalpolizei nahm den größten Teil der dritten Etage am Werderschen Markt ein. March nahm zwei Stufen zugleich hinauf. Vor dem Eingang verlangte ein Posten mit Maschinenpistole seinen Ausweis. Die Tür öffnete sich unter dem dumpfen Schlagen elektrischer Riegel.
Eine erleuchtete Karte Berlins nahm die halbe Rückwand ein. Eine Sternengalaxie, im Halbdunkel orange, kennzeichnete die 122 Polizeireviere der Hauptstadt. Zu ihrer Linken war eine zweite Karte, größer noch, die das ganze Reich darstellte. Rote Lichter kennzeichneten die Städte, die groß genug für eigene Kriminalabteilungen waren. Die Mitte Europas glühte blutig rot. Weiter nach Osten wurden die Lichter immer spärlicher, bis es jenseits Moskaus nur noch einige wenige einzelne Funken waren, die wie Lagerfeuer im Dunkeln blinkten. Ein Planetarium des Verbrechens.
Krause, der Beamte vom Dienst für den Gau Berlin, saß auf dem Podest unter den Schautafeln. Er telefonierte, als March herankam, und hob die Hand zum Gruß. Vor ihm saßen in gestärkten weißen Hemden ein Dutzend Frauen in gläsernen Abteilungen mit Kopfhörern und Mikrofonen. Was sie sich alles anhören mussten! Der Feldwebel einer Panzerdivision kommt von seiner Dienstzeit aus dem Osten zurück. Nach dem Essen nimmt er seine Pistole heraus und erschießt nacheinander seine Frau und die drei Kinder. Dann verspritzt er sein Gehirn über die Zimmerdecke. Eine hysterische Nachbarin ruft die Bullen. Die Nachrichten kamen hier herein – wurden überprüft, gewertet, entschlackt –, ehe sie nach unten in jenen Korridor mit dem rissigen grünen Linoleum und dem abgestandenen Zigarettenrauch weitergegeben wurden.
Hinter dem Beamten vom Dienst nahm eine uniformierte Sekretärin mit saurem Gesicht Eintragungen auf der Tafel der Nachtzwischenfälle vor. Es gab vier Spalten: Verbrechen (ernst), Verbrechen (gewaltsam), Zwischenfälle, Unfälle. Jede Kategorie war weiter geviertelt: Zeit der Meldung, Informant, Einzelheiten, veranlasste Maßnahme. Das durchschnittliche Chaos einer Nacht in der größten Stadt der Welt mit ihren zehn Millionen Einwohnern wurde hier auf wenigen Quadratmetern weißen Plastiks in Hieroglyphen verwandelt.
Es hatte seit zehn Uhr am Vorabend achtzehn Tote gegeben. Der schlimmste Zwischenfall – 1H 2D 4K – war ein Autozusammenstoß, bei dem drei Erwachsene und vier Kinder in Pankow kurz nach elf starben. Keine Maßnahme veranlasst; das konnte der Orpo überlassen bleiben. Eine Familie verbrannte bei einem Hausbrand in Kreuzberg, eine Messerstecherei vor einer Kneipe im Wedding, eine Frau in Spandau zu Tode geprügelt. Die Notiz über Marchs unterbrochenen Morgen war die letzte der Liste: 06:07[O] (das bedeutete, die Nachricht war von der Orpo gekommen) 1H Havel/March. Die Sekretärin trat zurück und sicherte ihren Füller mit einem scharfen Klicken.
Krause hatte sein Telefonat beendet und blickte abwehrbereit auf. »Ich hab mich schon entschuldigt, March.«
»Schon gut. Ich will die Vermisstenliste. Raum Berlin. Sagen wir, der letzten achtundvierzig Stunden.«
»Kein Problem.« Krause sah erleichtert aus und drehte sich in seinem Sitz zu der sauergesichtigen Frau um. »Du hast den Ermittler gehört, Helga. Überprüf mal, was in der letzten Stunde reingekommen ist.« Er drehte sich wieder zurück und sah March an, vor Schlafmangel ganz rotäugig. »Ich hab immerhin ’ne Stunde gewartet. Aber jeder Ärger in der Gegend – Sie wissen ja, wie das ist.«
March blickte auf die Berlinkarte. Das meiste war ein graues Spinnennetz aus Straßen. Aber auf der Linken gab es zwei Farbkleckse: das Grün des Grunewalds und, daran entlanglaufend, das blaue Band der Havel. In den See hinein krümmte sich wie ein Fötus eine Insel, mit dem Ufer durch eine Nabelschnurchaussee verbunden.
Schwanenwerder.
»Hat Goebbels da immer noch sein Haus?«
Krause nickte. »Und die übrigen.«
Da waren die elegantesten Adressen Berlins, praktisch ein Regierungsviertel. Ein paar Dutzend große Häuser, von der Straße abgeschirmt. Ein Wachposten am Eingang der Chaussee. Ein guter Ort fürs Privatleben, für Sicherheit, für Waldspaziergänge und für private Anlegestellen; ein schlechter Ort, eine Leiche zu entdecken. Die Leiche war weniger als dreihundert Meter entfernt angetrieben worden.
»Die örtliche Orpo nennt es den Fasanenstrich«, sagte Krause.
March lächelte. Goldfasanen war Gossensprache für Parteibonzen.
»Nicht gut, ’ne Schweinerei zu lange vor der Türschwelle liegen zu lassen.«
Helga war zurückgekommen. »Personen, die seit Sonntagmorgen als vermisst gemeldet wurden«, verkündete sie. »Und die bislang nicht aufgespürt wurden.«
Sie gab Krause eine lange Rolle ausgedruckter Namen, der überflog sie und reichte sie dann an March weiter. »Das langt, Sie für eine Weile beschäftigt zu halten.« Er wirkte amüsiert. »Sie sollten das Ihrem dicken Freund Jäger geben. Der hätte sich schließlich um die ganze Sache kümmern sollen, oder?«
»Danke. Aber ich will wenigstens damit anfangen.«
Krause schüttelte den Kopf. »Sie machen doppelt so viel Stunden wie die anderen. Sie werden nicht befördert. Sie kriegen ein beschissenes Gehalt. Sind Sie verrückt, oder was?«
March hatte die Liste vermisster Personen zu einer Röhre zusammengerollt. Er lehnte sich vor und klopfte Krause damit leicht gegen die Brust. »Sie vergessen sich, Genosse«, sagte er. »Arbeit macht frei.« Das Motto der Arbeitslager.
Er drehte sich um und ging durch die Reihen der Telefonistinnen zurück. Hinter sich konnte er Krause zu Helga sagen hören: »Siehst du, was ich meine? Was für ’n Scheißwitz sollte das jetzt wieder sein?«
March kam in sein Büro zurück, als Max Jäger gerade seinen Mantel aufhängte. »Xavi!« Er breitete die Arme aus. »Ich hab ’ne Nachricht aus dem Dienstraum bekommen. Wie kann ich das je wiedergutmachen?« Er trug die Uniform eines SS-Sturmbannführers. Die schwarze Jacke wies Spuren seines Frühstücks auf.
»Schreib’s meinem guten alten Herzen an«, sagte March. »Und werd nur nicht übermütig. An der Leiche war nichts, was hilft, die Personalien festzustellen, und seit Sonntag werden in Berlin über hundert Personen vermisst. Es wird Stunden dauern, auch nur die Liste durchzugehen. Und da ich meinem Jungen versprochen habe, mit ihm heute Nachmittag auszugehen, wirst du dich damit allein herumschlagen müssen.«
Er zündete sich eine Zigarette an und beschrieb die Einzelheiten: den Ort, den nicht vorhandenen Fuß, seinen Verdacht betreffend Jost. Jäger nahm alles mit einer Reihe von Grunzern auf. Er war ein schwabbeliger, schmuddeliger, massiger Mann, zwei Meter groß, mit plumpen Händen und Füßen. Er war fünfzig, fast zehn Jahre älter als March, aber sie teilten sich seit 1959 ein Büro und hatten oft als Mannschaft zusammengearbeitet. Die Kollegen am Werderschen Markt spotteten hinter dem Rücken über sie: der Fuchs und der Bär. Und vielleicht hatten sie auch etwas von einem alten Ehepaar an sich, in der Art, wie sie sich zankten und dann doch wieder zusammenhielten.
»Hier ist die Vermisstenliste.« March setzte sich an seinen Schreibtisch und rollte den Ausdruck aus: Namen, Geburtsdaten, Zeit des Verschwindens, Anschrift der Auskunftspersonen. Jäger lehnte sich über seine Schulter. Er rauchte stummelige, dicke Zigarren, und seine Uniform stank danach. »Laut dem guten Doktor Eisler starb unser Mann vermutlich irgendwann nach sechs Uhr gestern Abend, also wird ihn wohl niemand vor frühestens sieben oder acht Uhr vermisst haben. Vielleicht wartet man sogar ab, ob er heute irgendwann noch auftaucht. Vielleicht steht er also gar nicht auf der Liste. Aber wir sollten auch zwei andere Möglichkeiten erwägen, oder? Erstens: Er war schon einige Zeit verschwunden, bevor er gestorben ist. Zweitens – und wir wissen aus bitterer Erfahrung, dass das nicht unmöglich ist: Eisler hat die Todeszeit zu hoch angesetzt.«
»Der Kerl taugt nicht mal zum Tierarzt«, sagte Jäger.
March zählte schnell. »Einhundertzwei Namen. Ich würd das Alter von unserem Mann auf sechzig schätzen.«
»Sag sicherheitshalber lieber fünfzig. Nach zwölf Stunden in der Brühe sieht niemand mehr besonders gut aus.«
»Wohl wahr. Also schließen wir jeden auf der Liste aus, der nach 1914 geboren ist. Dann dürften noch rund ein Dutzend übrig bleiben. Die Identifizierung könnte nicht leichter sein – fehlt dem Opa ein Fuß?« March faltete das Blatt, riss es entzwei und gab die eine Hälfte Jäger. »Welche Orpo-Reviere liegen an der Havel?«
»Nikolassee«, sagte Jäger. »Wannsee. Kladow. Gatow. Pichelsdorf – aber das ist wohl schon zu weit im Norden.«
Während der nächsten halben Stunde rief March eines nach dem anderen an, einschließlich Pichelsdorf, um nachzufragen, ob irgendwo Kleidung gefunden worden sei oder ob einer der örtlichen Säufer der Beschreibung des Mannes im See entspreche. Nichts. Er wandte seine Aufmerksamkeit seiner Hälfte der Liste zu. Um 11.30 Uhr hatte er jeden infrage kommenden Namen abgeklärt. Er stand auf und reckte sich.
»Herr Niemand.«
Jäger war mit seinen Anrufen zehn Minuten früher fertig gewesen und starrte rauchend aus dem Fenster. »Beliebter Junge, was? Lässt selbst dich begehrt aussehen.« Er nahm die Zigarre aus dem Mund und zupfte sich Tabakfetzen von der Zunge. »Ich seh mal nach, ob der Dienstraum noch weitere Namen reinbekommen hat. Überlass das mir. Viel Spaß mit Paule.«
Die späte Morgenmesse in der hässlichen Kirche gegenüber dem Kripohauptquartier war gerade vorbei. March stand auf der anderen Seite der Straße und beobachtete den Pfarrer, der in einem schäbigen Regenmantel die Kirchentür schloss. Religion wurde in Deutschland von Staats wegen behindert. March fragte sich, wie viele Gläubige den Spitzeln der Gestapo getrotzt und der Messe beigewohnt hatten. Ein halbes Dutzend? Der Pfarrer ließ den schweren Schlüssel in die Tasche gleiten und wandte sich um. Er sah, wie March ihn anblickte, und schlurfte sofort davon, die Augen niedergeschlagen wie jemand, den man bei einer illegalen Handlung erwischt hat. March knöpfte seinen Regenmantel zu und folgte ihm in den schmutzigen Berliner Morgen.
3
Mit dem Bau des Triumphbogens ist 1946 begonnen, und die Arbeiten sind rechtzeitig zum Tag der Nationalen Wiedergeburt 1950 vollendet worden. Die Idee für den Entwurf kam vom Führer selbst und beruht auf Zeichnungen, die er während der Kriegsjahre gemacht hat.«
Die Passagiere in dem Stadtrundfahrtbus – zumindest jene, die das Gesagte verstanden – verdauten die Information. Sie erhoben sich von den Sitzen oder lehnten sich in den Gang, um eine bessere Sicht zu haben. Xaver March, der etwa in der Mitte des Busses saß, hob seinen Sohn auf den Schoß. Die Stadtführerin, eine mittelalte Frau, in das Grün des Reichsfremdenverkehrsministeriums gekleidet, stand vorn, die Beine weit auseinander, mit dem Rücken zur Windschutzscheibe. Ihre Stimme kam kalt über die Lautsprecheranlage.
»Der Bogen ist aus Granit und hat ein Volumen von 2 365 685 Kubikmetern.« Sie nieste. »Der Arc de Triomphe in Paris passt neunundvierzig Mal hinein.«
Einen Augenblick lang dräute der Bogen über ihnen. Dann fuhren sie durch ihn hindurch – ein ungeheurer steingerippter Tunnel, länger als ein Fußballfeld, höher als ein fünfzehnstöckiges Hochhaus, mit der gewölbten, verschatteten Decke einer Kathedrale. Die Scheinwerfer und Rücklichter von acht Straßenspuren tanzten durch das nachmittägliche Düster.
»Der Bogen ist 118 Meter hoch. Er ist 168 Meter breit und 119 Meter lang. In die Innenwände sind die Namen der drei Millionen Soldaten eingemeißelt, die bei der Verteidigung des Vaterlandes in den Kriegen von 1914 bis 1918 und 1939 bis 1946 gefallen sind.«
Sie nieste wieder. Die Passagiere verrenkten sich pflichtbewusst den Hals, um auf die Liste der Gefallenen zu sehen. Es war eine gemischte Gesellschaft: eine Gruppe Japaner mit Kameras; ein amerikanisches Paar mit einem kleinen Mädchen in Paules Alter; einige deutsche Siedler aus dem Ostland oder der Ukraine, zu Führergeburtstag in Berlin. March sah beiseite, als sie an der Liste der Gefallenen vorüberfuhren. Irgendwo standen da die Namen seines Vaters und seiner beiden Großväter. Er starrte auf die Stadtführerin. Als sie glaubte, unbeobachtet zu sein, wandte sie sich um und wischte sich die Nase schnell am Ärmel ab. Der Wagen tauchte im Nieselregen wieder auf.
»Nachdem wir den Triumphbogen verlassen haben, kommen wir in das mittlere Stück der Siegesallee. Die Allee wurde von Reichsminister Albert Speer entworfen und 1957 fertiggestellt. Sie ist 123 Meter breit und 5,6 Kilometer lang. Sie ist sowohl breiter als auch zweieinhalbmal länger als die Champs-Élysées in Paris.«
Höher, länger, größer, breiter, teurer … Selbst nach dem Sieg, dachte March, hatte Deutschland einen Minderwertigkeitskomplex. Nichts stand für sich selbst. Alles musste mit dem verglichen werden, was das Ausland hatte.
»Der Blick von dieser Stelle aus nach Norden entlang der Siegesallee gilt als eines der Weltwunder.«
»Eines der Weltwunder«, wiederholte Paule flüsternd.
Und das war es, selbst an einem Tag wie diesem. Im dichten Verkehr erstreckte sich die Allee vor ihnen, flankiert auf beiden Seiten von den Glas- und Granitwänden der Neubauten Speers: Ministerien, Ämter, große Geschäfte, Kinos, Wohnblocks. Am fernen Ende des Lichterstroms erhob sich im Sprühregen grau wie ein Schlachtschiff die Große Reichshalle, die Kuppel halb in den niedrigen Wolken verborgen.
Von den Siedlern kam anerkennendes Gemurmel. »Das ist ja wie ein Gebirge«, sagte die Frau, die hinter March saß. Sie war in Begleitung ihres Mannes und ihrer vier Söhne. Sie hatten die Reise vermutlich den ganzen Winter über geplant. Eine Broschüre des Fremdenverkehrsministeriums und ein Traum vom April in Berlin: ein tröstliches Ziel tausend Kilometer von zu Hause entfernt, das in den schneegefesselten, mondlosen Nächten in Minsk oder Kiew ihr Herz erwärmt. Wie mochten sie hergekommen sein? Vielleicht eine organisierte Reise von Kraft durch Freude: zwei Stunden im Junkers-Düsenklipper mit einem Zwischenaufenthalt in Warschau. Oder eine Dreitagefahrt im Familienvolkswagen auf der Autobahn von Moskau nach Berlin.
Paule strampelte sich aus dem Griff seines Vaters und ging unsicher nach vorn. March kniff sich mit Daumen und Zeigefinger in den Nasenrücken, eine nervöse Angewohnheit, die er sich – wann? – wohl im U-Boot-Dienst angeeignet hatte, wo die Schrauben britischer Kriegsschiffe so nahe dröhnten, dass der Schiffskörper erzitterte und man nie wusste, ob die nächsten Wasserbomben die letzten sein würden, die man erlebte. Er war 1948 mit Verdacht auf Tuberkulose aus der Marine ausgemustert worden und hatte ein Jahr zur Erholung verbracht. Danach war er, weil er nichts Besseres fand, der Marine-Küstenpolizei beigetreten, in Wilhelmshaven, als Leutnant. In jenem Jahr hatte er Klara Eckart geheiratet, eine Krankenschwester, die er in dem TB-Sanatorium kennengelernt hatte. 1952 war er in die Hamburger Kripo eingetreten. 1954, als sie schwanger war und die Ehe bereits zu scheitern drohte, war er nach Berlin befördert worden. Paul – Paule – war genau vor zehn Jahren und einem Monat geboren worden.
Was war schiefgegangen? Er machte Klara keine Vorwürfe. Sie hatte sich nicht verändert. Sie war immer eine starke Frau gewesen, die bestimmte einfache Dinge vom Leben wollte: ein Heim, eine Familie, Freunde, Anerkennung. Aber March – er hatte sich verändert. Nach zehn Jahren in der Marine und zwölf Monaten Isolation war er in einer Welt an Land gegangen, die er kaum noch kannte. Wenn er zur Arbeit ging, Fernsehsendungen ansah, mit Freunden aß, sogar wenn er – Gott verzeih’s – mit seiner Frau schlief, stellte er sich manchmal vor, dass er immer noch an Bord eines U-Bootes war: unter der Oberfläche des Alltagslebens kreuzend, einsam und wachsam.
Er hatte Paule mittags von Klaras Wohnung abgeholt – einem Einfamilienhaus in einem trübsinnigen Nachkriegswohnviertel in Lichtenrade, dem südlichen Vorort. In der Straße parken, zweimal hupen, auf die Bewegung des Vorhangs am Wohnzimmerfenster warten. Das war die Routine, die sich, ohne abgesprochen zu werden, seit ihrer Scheidung vor fünf Jahren ergeben hatte – ein Weg, peinliche Begegnungen zu vermeiden; ein Ritual, das an jedem vierten Sonntag zu erdulden war, falls die Arbeit es gestattete, unter den strengen Vorschriften des Reichsehegesetzes. Es geschah nur selten, dass er seinen Sohn an einem Dienstag sah, doch waren jetzt Schulferien. Seit 1959 hatten die Kinder zu Führergeburtstag anstatt zu Ostern eine Woche frei.
Die Tür hatte sich geöffnet, und Paule war erschienen, wie ein schüchterner Schauspieler, den man gegen seinen Willen auf die Bühne hinausstieß. Er trug seine neue Pimpfuniform – steifes, schwarzes Hemd und dunkelblaue, kurze Hosen – und war wortlos in den Wagen geklettert. March hatte ihn unbeholfen umarmt.
»Du siehst schick aus. Wie geht’s in der Schule?«
»Alles in Ordnung.«
»Und deiner Mutter?«
Der Junge zuckte die Achseln.
»Worauf hast du Lust?«
Er zuckte wieder die Achseln.
Sie hatten in der Budapester Straße gegenüber dem Zoo gegessen, in einem modernen Restaurant mit Vinylstühlen und Plastiktischen: Vater und Sohn, der eine Bier und Würstchen, der andere Apfelsaft und Buletten. Sie hatten über Pimpfe gesprochen, und Paule war aufgetaut. Solange man kein Pimpf war, war man gar nichts, eines der »nicht uniformierten Wesen, die noch nie einen Heimabend und einen Ausmarsch mitgemacht haben«. Man konnte ab zehn eintreten und bis vierzehn bleiben und danach in die eigentliche Hitlerjugend überwechseln.
»Ich war Bester bei der Aufnahmeprüfung.«
»Guter Junge.«
»Wir mussten sechzig Meter unter zwölf Sekunden laufen«, sagte Paule. »Weitsprung und Weitwurf. Einen Geländemarsch – anderthalb Tage. Schwertworte aufsagen. Und man muss das ganze Horst-Wessel-Lied auswendig können.«
March befürchtete, dass er das Lied gleich anstimmte, also fragte er schnell: »Und dein Dolch?«
Paule griff nach seinem Koppel, und auf der Stirn bildete sich vor Konzentration eine Falte. Wie ähnlich er seiner Mutter sah, dachte March. Die gleichen hohen Wangenknochen und der volle Mund, dieselben ernsten braunen Augen, weit auseinander. Paule legte den Dolch behutsam vor ihn auf den Tisch. Er nahm ihn auf. Das erinnerte ihn an den Tag, wo er seinen eigenen bekommen hatte – wann war das gewesen? 1934? Die Aufregung eines Jungen, der glaubte, jetzt sei er in die Gemeinschaft der Männer aufgenommen. Er drehte ihn um, und das Hakenkreuz am Griff glitzerte im Licht. Er wog das Gewicht des Dolchs in der Hand, dann gab er ihn zurück.
»Ich bin stolz auf dich«, log er. »Was möchtest du jetzt machen? Wir können ins Kino gehen. Oder in den Zoo.«
»Ich möchte eine Stadtrundfahrt machen.«
»Aber das haben wir doch schon beim letzten Mal gemacht. Und das Mal davor.«
»Macht nichts. Ich möchte es gern.«
»Die Große Reichshalle ist das größte Gebäude auf Erden. Sie erhebt sich in eine Höhe von über einem Viertelkilometer, und an bestimmten Tagen – wie etwa heute – verschwindet die Kuppelspitze aus der Sicht. Die Kuppel selbst misst einhundertvierzig Meter im Durchmesser, und der Petersdom zu Rom passt sechzehnmal hinein.«
Sie hatten das Ende der großen Allee erreicht und fuhren auf den Großen Platz, den Adolf-Hitler-Platz. Zur Rechten begrenzten ihn das Hauptquartier des Oberkommandos der Wehrmacht und der Reichstag, zur Linken die neue Reichskanzlei und der Führerpalast. Davor lag die Halle. Ihr Grau löste sich in dem Maße auf, je näher man kam. Jetzt konnten sie sehen, was ihre Führerin ihnen erzählte: dass die tragenden Säulen der Vorderfront aus rotem Granit waren, in Schweden gebrochen, und auf beiden Seiten von goldenen Statuen flankiert, Atlas und Tellus, die auf ihren Schultern Himmels- und Erdkugel trugen.
Das Gebäude war so kristallweiß wie ein Hochzeitskuchen, die Kuppel aus gehämmertem Kupfer dumpfgrün. Paule stand vorn im Bus ganz still.
»Die Große Halle wird nur für die feierlichsten Zeremonien des Deutschen Reiches verwendet und fasst 180 000 Personen. Ein interessantes und unvorhergesehenes Phänomen: Der Atem einer solchen Menschenmenge steigt in die Kuppel auf und bildet dort Wolken, die kondensieren und als leichter Regen herabfallen. Die Große Halle ist das einzige Gebäude auf Erden, das ein eigenes Klima schafft …«
March hatte das alles schon gehört. Er blickte aus dem Fenster und sah nur die Leiche im Schlamm. Badehosen! Was hatte sich der alte Mann dabei gedacht, am Montagabend zu schwimmen? Berlin war schon seit dem späten Nachmittag von schwarzen Wolken verschlungen worden. Als der Sturm schließlich losgebrochen war, war der Regen in Stahlstäben heruntergeschossen und hatte Straßen und Dächer durchbohrt und den Donner ertränkt. Selbstmord vielleicht? Man stelle sich vor: in den kalten See waten, in die Mitte hinausschwimmen, Wassertreten in der Dunkelheit, die Blitze über den Bäumen beobachten, darauf warten, dass die Erschöpfung den Rest tut …
Paule war an seinen Platz zurückgekehrt und hüpfte vor Aufregung auf und ab.
»Werden wir den Führer sehen, Papa?«
Das Hirngespinst schwand, und March fühlte sich schuldig. Das Tagträumen von seiner Arbeit war genau das, worüber Klara sich immer beklagt hatte: Selbst wenn du hier bist, bist du nicht richtig hier.
»Ich glaube nicht«, sagte er.
Wieder die Führerin: »Zur Linken die Reichskanzlei und die Residenz des Führers. Die gesamte Fassade misst siebenhundert Meter und übertrifft um hundert Meter die Fassade des Palastes von Ludwig XIV. in Versailles.«
Die Kanzlei zog langsam vorüber, während der Bus daran entlangfuhr: Marmorsäulen und rote Mosaiken, Bronzelöwen, vergoldete Silhouetten, gebrochene Schriftzeichen – ein chinesischer Drache von einem Bauwerk, der da zur Seite des Platzes schlief. Eine Vier-Mann-Ehrenwache der SS stand unter einer sich blähenden Hakenkreuzfahne stramm. Es gab keine Fenster, aber fünf Stockwerke über der Erde war in die Wand der Balkon eingelassen, auf dem der Führer sich zu jenen Gelegenheiten zeigte, wo sich eine Million Menschen auf dem Platz versammelten. Selbst jetzt gab es einige Dutzend Neugierige, die zu den geschlossenen Jalousien hochstarrten, die Gesichter vor Erwartung ganz blass, sehnsuchtsvoll …
March sah seinen Sohn an. Paule war wie versteinert. Er hielt den kleinen Dolch wie ein Kruzifix umklammert.
Der Bus brachte sie zurück zum Ausgangspunkt der Rundfahrt vor dem Bahnhof der Berlin–Gotenland-Eisenbahn. Es war fünf Uhr vorbei, als sie aus dem Bus stiegen und die letzten Ränder des natürlichen Lichts erloschen. Der Tag gab sich selbst mit Abscheu auf.
Der Eingang zum Bahnhof spie Leute aus – Soldaten mit Rucksack in Begleitung von Freundin oder Frau, Fremdarbeiter mit Pappkoffern und mit Kordeln verschnürten, schäbigen Bündeln und Siedler, die nach zwei Tagen Bahnfahrt aus der Steppe auftauchten und verblüfft die Lichter und die Menge anglotzten. Überall sah man Uniformen. Dunkelblau, grün, braun, schwarz, feldgrau. Es glich einer Fabrik bei Schichtende. Da waren die Fabrikgeräusche von rangierendem Metall und schrillem Pfeifen und der Fabrikgeruch nach Hitze und Öl, schaler Luft und Stahlstaub. Ausrufezeichen schrien von den Wänden. Seid ständig wachsam! – Achtung! Meldet sofort verdächtige Pakete! – Terroristenwarnung!
Von hier aus gingen haushohe Züge auf vier Meter breiter Gleisspur zu den Außenposten des Deutschen Reiches ab – nach Gotenland (früher die Krim) und Theoderichshafen (früher Sewastopol); ins Generalkommissariat Taurien und dessen Hauptstadt Melitopol; nach Wolhynien-Podolien, Schitomir, Kiew, Nikolajew, Dnjepropetrowsk, Charkow, Rostow, Saratow … Hier war der Kopfbahnhof einer neuen Welt. Die Ankündigungen von Ankünften und Abfahrten unterbrachen die Coriolan-Ouvertüre im öffentlichen Lautsprechersystem. March wollte Paule an die Hand nehmen, als sie sich ihren Weg durch die Menge suchten, aber der Junge schüttelte sie ab.
Sie brauchten eine Viertelstunde, mit dem Wagen aus der unterirdischen Garage herauszukommen, und eine weitere, aus den verstopften Straßen um den Bahnhof herauszukommen. Sie fuhren schweigend. Und erst als sie fast zurück in Lichtenrade waren, platzte es aus Paule förmlich heraus: »Du bist ein Asozialer, wa?«
Das war ein so eigenartiges Wort aus dem Mund eines Zehnjährigen, und es wurde so sorgfältig ausgesprochen, dass March fast laut herauslachte. Ein Asozialer: nur noch einen Schritt vom Verräter nach dem Verbrecherlexikon der Partei entfernt. Ein Nichtbeiträger zur Winterhilfe. Ein Nichtmitglied der ungezählten NS-Organisationen. Des NS-Skiverbandes. Des Bundes der NS-Wanderer. Des Großdeutschen NS-Motorklubs. Der Gesellschaft von NS-Kriminalpolizeibeamten. Eines Nachmittags hatte er im Lustgarten sogar eine Parade der NS-Liga der Träger der Lebensrettungsmedaille gesehen.
»Das ist Unsinn.«
»Onkel Erich sagt, dass es wahr ist.«
Erich Helfferich. Der war jetzt also »Onkel Erich« geworden. Ein Fanatiker der übelsten Sorte, ein Ganztagsbürokrat im Berliner Hauptquartier der Partei. Ein aufdringlicher bebrillter Pfadfinderführer … March spürte, wie sich seine Hand um das Lenkrad krampfte. Helfferich war seit einem Jahr mit Klara zusammen.
»Er sagt, dass du den Führergruß verweigerst und Witze über die Partei reißt.«
»Und woher will er das alles wissen?«
»Er sagt, dass es im Parteihauptquartier eine Akte über dich gibt und dass es nur eine Frage der Zeit ist, dass sie dich hoppnehmen.« Dem Jungen kamen vor Scham fast die Tränen. »Ich glaub, das stimmt.«
»Paule!«
Sie fuhren vor dem Haus vor.
»Ich hasse dich.« Er sagte das mit ruhiger, flacher Stimme und stieg aus dem Wagen. March öffnete seine Tür, lief um den Wagen herum und folgte ihm auf dem Weg zum Haus. Er konnte von drinnen den Hund bellen hören.
»Paule!«, rief er.
Die Tür öffnete sich. Klara stand in der Uniform der SS-Frauenschaft da. Hinter ihr sah March die braun gekleidete Gestalt Helfferichs lauern. Der Hund, ein junger Schäferhund, kam herausgerannt und sprang an Paule hoch, der sich eilig an seiner Mutter vorbeidrängte und im Haus verschwand. March wollte ihm folgen, aber Klara versperrte ihm den Weg.
»Lass den Jungen in Frieden. Verschwinde. Lass uns alle in Ruhe.«
Sie schnappte sich den Hund und zerrte ihn am Halsband zurück. In sein Jaulen hinein knallte die Tür zu.
Auf dem Rückweg nach Berlin-Mitte dachte March über den Hund nach. Dabei wurde ihm klar, dass der Hund das einzige Lebewesen in dem ganzen Haus war, das keine Uniform trug.
Wenn er sich nicht so elend gefühlt hätte, hätte er schallend gelacht.
4
Was für ’n Scheißtag«, sagte Max Jäger am Werderschen Markt. Es war halb acht abends, und er zog sich die Jacke an. »Kein persönlicher Besitz aufgetaucht, keine Kleidung. Ich bin die Vermisstenliste bis Donnerstag zurückgegangen. Nichts. Damit sind über vierundzwanzig Stunden seit dem vermutlichen Todeszeitpunkt vergangen, und nicht eine Seele hat ihn vermisst. Bist du dir sicher, dass der nicht nur so ’n Penner ist?«
March schüttelte kurz den Kopf. »Zu gut genährt. Und Penner haben keine Badehosen. Normalerweise.«
»Und zu allem Überfluss muss ich heute Abend zu einer Parteiversammlung.« Jäger nahm noch einen Zug an seinem Stumpen und drückte ihn dann aus. »Die deutsche Mutter: Kämpferin des Volkes an der Heimatfront.«
Wie alle Kripoermittler einschließlich March hatte Jäger den SS-Rang eines Sturmbannführers. Anders als March aber war er im Jahr zuvor der Partei beigetreten. Nicht dass March ihm das vorwarf. Man musste Parteimitglied sein, damit man befördert wurde.
»Kommt Hannelore mit?«
»Hannelore? Eine Trägerin des Ehrenkreuzes der Deutschen Mutter in Bronze? Natürlich kommt sie mit.« Jäger blickte auf die Uhr. »Gerade noch Zeit für ein Bier. Was meinst du?«
»Heute Abend nicht, danke. Ich komm mit dir runter.«
Sie trennten sich auf der Treppe zum Kripogebäude. Mit einem Winken machte sich Jäger nach links zur Kneipe in der Oberwallstraße auf, während March sich nach rechts dem Fluss zuwandte. Er schritt zügig aus. Der Regen hatte aufgehört, aber die Luft war immer noch feucht und dunstig. Die Vorkriegsstraßenlampen schimmerten auf dem schwarzen Pflaster. Von der Spree kam der tiefe, durch die Häuser gedämpfte Ton eines Nebelhorns.
Er bog um die Ecke und wanderte den Fluss entlang, wo er die kalte Nachtluft im Gesicht genoss. Ein Flusskahn tuckerte stromauf, eine einsame Laterne am Bug, hinter dem Heck ein Kessel kochenden dunklen Wassers. Davon abgesehen herrschte Schweigen. Hier gab es keine Autos, keine Menschen. Die Stadt hätte in der Dunkelheit verdampft sein können. Er verließ widerstrebend den Fluss und überquerte den Spittelmarkt zur Seydelstraße. Wenige Minuten später betrat er die Leichenhalle der Stadt Berlin.
Eisler war nach Hause gegangen. Keine große Überraschung. »Ich liebe dich«, atmete eine Frauenstimme in den verlassenen Empfang. »Und ich möchte deine Kinder austragen.« Ein Aufseher in bekleckerter weißer Jacke wandte sich widerstrebend von seinem tragbaren Fernsehgerät ab und überprüfte Marchs Ausweis. Er trug eine Notiz in sein Kontrollbuch ein, nahm einen Schlüsselbund und winkte dem Ermittler, ihm zu folgen. Hinter ihnen erklang die Titelmusik der abendlichen Familienserie des Reichsrundfunks.
Eine Schwingtür führte in einen Gang, der Dutzenden anderen am Werderschen Markt glich. Irgendwo, dachte March, musste es einen Reichsdirektor für grünes Linoleum geben. Er folgte dem Aufseher in den Aufzug. Das Metallgitter schloss sich krachend, und sie fuhren in die Keller hinab.
Am Eingang zum Aufbewahrungsraum zündeten sie sich beide unter dem Rauchen-verboten-Schild eine Zigarette an – zwei Profis, die dieselbe Vorbeugungsmaßnahme trafen, nicht gegen den Leichengeruch (der Raum war tiefgekühlt: keine Spur von Verwesungsgestank), aber gegen die stechenden Dünste der Desinfektionsmittel.
»Sie wollen also den alten Knaben sehen, der heute Morgen kurz nach acht reingekommen ist, ja?«
»Richtig«, sagte March.
Der Aufseher zog an einem langen Handgriff und schwenkte die schwere Tür auf. Beim Eintreten gab es ein Zischen kalter Luft. Grelle Neonröhren beleuchteten den Flur aus weißen Kacheln, der sich von beiden Seiten leicht zu dem Abfluss in der Mitte hin senkte. Schwere Metallschubladen waren wie Aktenschränke in die Wände eingelassen. Der Aufseher nahm eine Liste vom Haken neben dem Lichtschalter, ging an den Laden entlang und überprüfte die Nummern.
»Der hier.«
Er klemmte sich die Liste unter den Arm und zog heftig an der Lade. Sie glitt heraus. March trat hinzu und schlug das weiße Laken zurück.
»Wenn Sie wollen, können Sie gehen«, sagte er, ohne sich umzudrehen. »Ich rufe Sie, wenn ich fertig bin.«
»Ist nicht erlaubt. Vorschriften.«
»Für den Fall, dass ich Beweise frisiere? Ich bitte Sie.«
Auch bei der zweiten Begegnung gewann die Leiche nicht. Ein hartes, fleischiges Gesicht, kleine Augen und ein grausamer Mund. Der Schädel war fast kahl, abgesehen von einer merkwürdigen Strähne weißen Haars. Die Nase war scharfrückig mit einer tiefen Eindellung an beiden Nasenflügeln. Er musste seit vielen Jahren Brille getragen haben. Das Gesicht selbst wies außer den symmetrischen Kratzern auf beiden Wangen keine Verletzung auf. Er schob die Finger in den Mund, stieß aber nur auf den weichen Gaumen. Irgendwann musste das vollständige falsche Gebiss herausgeschlagen worden sein.
March zog das Laken weiter zurück. Die Schultern waren breit, der Rumpf eines kräftigen Mannes, der gerade begonnen hatte, dicker zu werden. Er faltete das Laken sauber einige Zentimeter über dem Stumpf zusammen. Er benahm sich Toten gegenüber immer respektvoll. Kein Gesellschaftsarzt am Kurfürstendamm ging mit seinen Patienten zartfühlender um als Xaver March mit seinen Leichen.
Er hauchte Wärme in seine Hände und griff dann in die Mantelinnentasche, wo er ein schmales, blechernes Stempelkissenetui und zwei weiße Karten herausholte. Der Zigarettenrauch in seinem Mund schmeckte bitter. Er ergriff das linke Handgelenk der Leiche – die Kälte erschütterte ihn immer aufs Neue – und zwang die Finger auseinander. Sorgfältig presste er jede Fingerspitze auf das Kissen mit der schwarzen Tinte. Dann legte er das Etui ab, nahm eine der Karten auf und presste jeden einzelnen Finger darauf. Nachdem er das zu seiner Zufriedenheit erledigt hatte, wiederholte er die Prozedur mit der rechten Hand. Der Aufseher beobachtete ihn fasziniert.
Die schwarzen Schmierflecken an den weißen Händen sahen scheußlich aus – eine Entweihung.
»Machen Sie ihn bitte sauber«, sagte March.