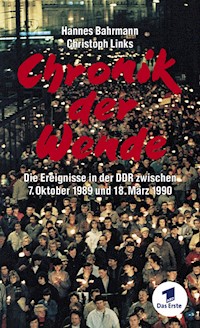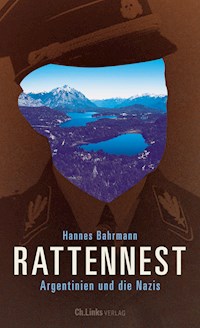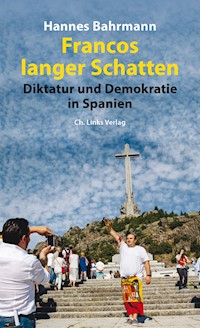9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ch. Links Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Politik & Zeitgeschichte
- Sprache: Deutsch
Mit gewaltigen Finanzmitteln aus dem Erdölverkauf wollte Hugo Chávez in Venezuela den »Sozialismus des 21. Jahrhunderts« einführen. Das Konzept stammte von deutschen Soziologen, die Umsetzung erfolgte mit kubanischen Beratern. Doch die Revolution scheiterte grandios. Heute ist Venezuela hoch verschuldet und verzeichnet Weltrekorde bei Inflation und Kriminalität. Die Versorgung ist zusammengebrochen.Die Armut, die eigentlich bekämpft werden sollte, hat sich seit den Präsidentschaften von Chávez und Maduro verdoppelt. Die Proteste auf den Straßen nehmen zu. Was ist schiefgelaufen?
Hannes Bahrmann blickt in die Geschichte des Landes zurück, zieht eine kritische Bilanz der Entwicklung der letzten Jahre und zeigt die tieferen Ursachen auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
HANNES BAHRMANN
VENEZUELA
Die gescheiterte Revolution
Für Christoph
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
1. Auflage als E-Book, März 2018
entspricht der 1. Druckauflage vom März 2018
© Christoph Links Verlag GmbH
Schönhauser Allee 36, 10435 Berlin, Tel.: (030) 44 02 32-0
www.christoph-links-verlag.de; [email protected]
Cover: Nadja Caspar, Ch. Links Verlag, unter Verwendung eines Fotos aus Caracas vom August 2017 (Marcelino Ueslei, dpa – Picture-Alliance)
Karte: Peter Palm, Berlin
eISBN 978-3-86284-411-1
Inhalt
Einleitung
Die Vorgeschichte
Machtfaktor Kuba
Die revolutionäre Phase
Machtsicherung in höchster Not
Der »Sozialismus des 21. Jahrhunderts«
Die ALBA-Strategie
Der Tod der Goldenen Gans
Korruption – einfach unvorstellbar
Chaotische Lebensverhältnisse
Persönliche Nachbetrachtung
Anhang
Chronik Venezuelas
Biografien der handelnden Personen
Quellen und Literatur
Abbildungsnachweis
Basisdaten
Über den Autor
Einleitung
»Die Wahrheit ist immer konkret.«
Wladimir Iljitsch Lenin
Es begann symbolisch: Am 27. Juni 1989 schnitten die Außenminister Ungarns und Österreichs ein Loch in einen Stacheldrahtzaun. Der »Eiserne Vorhang« zwischen Ost und West war geöffnet. Zehntausende DDR-Bürger flüchteten hindurch. Möglich wurde dies durch den sowjetischen Partei- und Staatschef Michail Gorbatschow, der zuvor die sogenannte Breshnew-Doktrin aufgehoben hatte. Sie verbot den Mitgliedsstaaten des Ostblocks, eigene Wege ohne Abstimmung mit der UdSSR zu gehen. Andernfalls musste – wie im Fall des Einmarschs der Truppen des Warschauer Vertrages am 21. August 1968 in die Tschechoslowakei – mit einer militärischen Intervention gerechnet werden.
Es war der Beginn des Endes der sozialistischen Staatengemeinschaft. Die Berliner Mauer fiel am 9. November, am 11. März 1990 erklärte Litauen als erste Sowjetrepublik die Unabhängigkeit, am 1. Juli 1991 löste sich der Warschauer Pakt auf und in der Silvesternacht 1991 hörte die Sowjetunion auf zu existieren.
Auch in Lateinamerika waren die Veränderungen spürbar. Mit dem Ende des Sozialismus in Europa verlor Kuba drei Viertel seiner Importe und 95 Prozent seiner Exportmärkte. Seit dem Sieg der Revolution im Jahr 1959 hatte die Sowjetunion über 100 Milliarden Dollar in die strategisch wichtige Insel gepumpt. In dieser Rechnung war noch nicht einmal die Militärhilfe enthalten. Kuba hatte ab den siebziger Jahren in Afrika arbeitsteilig Kriege geführt: Die UdSSR lieferte die Militärtechnik und Zehntausende Kubaner kämpften. So wurde die Unabhängigkeit Namibias erreicht und das Überleben der marxistischen Regierung Angolas gesichert. Mit dem Ausbleiben der Hilfe aus Moskau brach der wirtschaftliche Notstand in Kuba aus.
Kubas engste Verbündete, die Sandinisten in Nicaragua, gingen allzu siegessicher in die Wahlen im Februar 1990 – und verloren. Sie hatten ignoriert, dass mit dem Ende des Sozialismus in Europa auch die lateinamerikanische Linke gehörig unter Druck geraten war. Hinzu kam, dass nach einem jahrelangen Bürgerkrieg offenbar wurde, dass die massiv von den USA aufgerüsteten Contras nicht in der Lage waren, die von den sozialistischen Ländern aufgerüsteten Sandinisten mit Gewalt von der Macht zu vertreiben. Die Kandidatin des oppositionellen Bündnisses UNO, Doña Violeta Barrios de Chamorro, trat vor die Wähler und versprach einen schnellen Frieden. »Überall auf der Welt begraben die Völker den Kommunismus und rufen die Demokratie aus«, erklärte sie ihren Zuhörern. »Deshalb stellt eure Uhren neu: Stellt sie auf die gleiche Zeit wie in Polen, Bulgarien, der Tschechoslowakei.«
Danach folgten Jahre, in denen der Sozialismus weltweit keine Konjunktur mehr hatte. Neuansätze waren scheinbar nicht gefragt, zu groß war der Frust über die epochale Niederlage. Wenn neue Ideen für die gesellschaftliche Entwicklung vorgetragen wurden, dann waren sie sektoral, begrenzt auf neue Technologien wie das Internet, ökologische Methoden in der Landwirtschaft oder Formen des gesellschaftlichen Umgangs: Gender-Gerechtigkeit, Toleranz, Fairness, Vielfalt, Umweltschutz. In jedem Fall sollte es ohne Personenkult, ohne Einheitspartei und ohne Diktatur ablaufen.
Dann erstand der Sozialismus wieder auf – im südamerikanischen Venezuela. Hugo Chávez, ein Offizier, versuchte den Neubeginn. Zunächst mit einem Putsch, mit dem er 1992 scheiterte, dann sechs Jahre später bei Wahlen, die er gewann. Venezuela ist reich durch die Ausbeutung von Bodenschätzen. Es verfügt heute über die weltweit größten Erdölreserven, riesige Eisenerzvorkommen, Gold und Silber. Seit hundert Jahren gehört das Land zu den weltweit größten Ölexporteuren. Mit öffentlichen Mitteln wurde während der Jahre der antikommunistischen Diktatur von Marcos Pérez Jiménez (1952 bis 1958) die technische und soziale Infrastruktur ausgebaut. In den 1970er Jahren profitierte Venezuela mit seinen knapp 10 000 Bohrtürmen vom Boykott der arabischen Förderer, die damit die USA und Europa bestrafen wollten, weil sie Israel unterstützten. Das Land mutierte zum »Saudi-Venezuela«. Das Pro-Kopf-Einkommen erreichte das Niveau des Wirtschaftswunderlandes Bundesrepublik Deutschland. Dann fiel der Ölpreis in den 80er Jahren und das Land versank in der Rezession. Während der nachfolgenden christdemokratischen Regierungen ging das Wachstum stark zurück, während die Auslandsschulden extrem anstiegen. Die Lage der sozial Schwächeren verschlechterte sich spürbar. Das Pro-Kopf-Einkommen war um 35 Prozent zurückgegangen, die Inflation lag bei 100 Prozent, die Korruption war legendär.
In dieser Situation siegte Hugo Chávez bei den Wahlen von 1998 mit dem Versprechen, den Armen zu helfen und die Korruption einzudämmen. Gleich bei seinem Amtsantritt stellte der neue Präsident seinen revolutionären »Plan Bolívar 2000« vor. Er bestand aus zahlreichen Notprogrammen, um das Leben der Ärmsten zu verbessern. Chávez schickte das Militär in die Armenviertel und entlegenen Landesteile, wo sie Lebensmittelpakete verteilten, Straßen reparierten, Häuser, Schulen und Krankenhäuser ausbesserten, den Müll beseitigten. Das war in doppelter Hinsicht ein geschickter Schachzug: Zum einen erfüllte er auf breiter Front die Wahlversprechen, zum anderen änderte sich die Wahrnehmung des Militärs in der Bevölkerung. In den vorangegangenen Jahren waren zunehmend Soldaten bei »Befriedungsaktionen« zur Niederschlagung von Streiks oder Landbesetzungen eingesetzt worden.
Auch die Linke in Venezuela fremdelte zunächst mit dem Oberstleutnant an der Macht. Deshalb waren die Kommandeure angehalten worden, ihre Arbeit mit den Basisorganisationen vor Ort zu koordinieren und Kontakte zu den zumeist linken Bewegungen in den Elendsvierteln herzustellen. Dann folgte ab 2000 / 2001 die zweite Phase des »Plan Bolívar«: Kostenlose Gesundheitsversorgung, Schulspeisung, sozialer Wohnungsbau, zinsgünstige Kredite an Kooperativen und Kleinbauern. Ein weiterer wichtiger Meilenstein war der Aufbau eines Sozialversicherungs- und Rentensystems, auch für Invalide und Berufsunfähige.
Chávez machte kein Hehl daraus, dass er die bürgerliche Demokratie in Venezuela verachtete. Sie war für ihn »eine faule Mango«, »Dreck« oder »Abfall«. Er orientierte sich eher am bekannten lateinamerikanischen Modell des charismatischen Führers. Sein Credo: Der Caudillo ist der Repräsentant einer Massenbewegung, die sich mit ihm identifiziert und der allein durch deren Zustimmung führt, ohne formale oder gesetzliche Legitimation. Nur folgerichtig bezeichnete er noch acht Jahre nach seiner Machtübernahme 2010 den früheren Diktator Marcos Pérez Jiménez als den »besten Präsidenten, den Venezuela jemals gehabt hat«.
Folgerichtig machte er sich nach seinem Wahlsieg daran, die staatlichen Institutionen durch die »Bolivarianische Revolution«* grundlegend zu verändern. Schon bei seiner Vereidigung im Februar 1999 legte er seine Hand auf die Verfassung und sprach vor den anwesenden Parlamentariern und den Fernsehzuschauern im ganzen Land: »Ich schwöre vor Gott, vor dem Vaterland und vor meinem Volke auf diese todgeweihte Verfassung …«
In einem atemberaubenden Tempo setzte er Wahlen zu einer Verfassunggebenden Versammlung an, für die fast 88 Prozent der beteiligten Venezolaner stimmten – 62 Prozent der Wahlberechtigten blieben der Abstimmung jedoch fern. Der neuen Verfassung stimmten Ende 1999 dann knapp 72 Prozent der Wähler zu, die Mehrheit ging allerdings wieder nicht zu den Urnen. Auf dieser Grundlage unterstellte Präsident Chávez das Oberste Gericht der Kontrolle durch die Regierung und erklärte das erst im Jahr zuvor gewählte Parlament für überflüssig. Neu geschaffen wurden zwei Instanzen: die Poder Ciudadano (ein Bürgerrat) und ein Nationaler Wahlrat (Consejo Nacional Electoral CNE). Der Bürgerrat hat die Aufgabe der Kontrolle der öffentlichen Verwaltung zur Bekämpfung der Korruption, und der Wahlrat sollte über die Einhaltung der Rechtmäßigkeit der Wahlen wachen. Beide Organe unterstanden mittelbar dem Präsidenten.
So hatte sich Chávez im Handstreich den Staat untertan gemacht: Die Legislative kontrollierte er mit der Mehrheit seiner Anhänger. Die Unabhängigkeit der Gerichte war abgeschafft, die Richter wurden vom Parlament ernannt, und die Staatsmacht hatte mit der Schaffung des Bürgerrates einen Durchgriff auf die Generalstaatsanwaltschaft sowie den zentralen Rechnungshof und durch den Wahlrat die Kontrolle über den Ablauf aller Wahlen.
Die Eckpunkte seines Konzepts der »Bolivarianischen Revolution« waren bewusst vage gehalten: Verringerung der Armut, Kampf gegen Korruption, politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit. Das war eher beliebig. Einzig die politische Beteiligung stach aus diesem Konzept hervor. Chávez konzentrierte sich dabei auf die Mehrheitsbevölkerung, die Bewohner der städtischen Elendssiedlungen. Hier fand sich in den ersten Jahren seiner Regierung der Kern seines Gesellschaftskonzepts wieder: eine von oben gelenkte Basisbewegung. Hierzu gründete er 2001 die »Bolivarianischen Zirkel«, die zu Spitzenzeiten über zwei Millionen Mitglieder zählten. Im Grunde genommen waren es Nachbarschaftsvereinigungen, die das Leben in den Elendssiedlungen im Sinne der Regierung zu organisieren hatten und dafür staatliche Mittel zur Verbesserung der Lebensverhältnisse erhielten. Von Anbeginn spaltete Chávez das Land in seine besitzlosen Anhänger und seine privilegierten Gegner. Zu letzteren zählte er auch Arbeiter und Angestellte, Gewerkschaften und die politischen Parteien des alten Systems.
Die Unternehmer reagierten mit Kapitalflucht und der zeitweiligen Schließung ihrer Fabriken. Die Verhältnisse ähnelten schnell denen im sozialistischen Chile 1973 vor dem Militärputsch. Und auch in Venezuela geschah dies. Am 11. April 2002 demonstrierten Unternehmer und Gewerkschaften zu Hunderttausenden. Zuvor war bereits ein Streik ausgerufen worden, der bis zum Sturz der Regierung anhalten sollte. Anlass des Ausstands war die Zerschlagung der wirtschaftlichen Autonomie des staatlichen Erdölkonzerns PDVSA (ausgesprochen PeDeVeSa) und die Ersetzung des Führungspersonals durch Ergebene von Hugo Chávez.
Der Präsident wurde am 12. April von Teilen der Militärführung verhaftet und seines Amtes enthoben. Der Chef des Unternehmerverbandes Fedecámeras, Pedro Carmona, übernahm die Amtsgeschäfte und kündigte Wahlen an. 30 Generäle erklärten auf CNN, dass der Verbleib von Chávez im Amt eine Gefahr für das Land darstelle und forderten das übrige Militär auf, sich ihnen anzuschließen. Die staatlichen Fernsehsender wurden mit einem Störsignal lahmgelegt. Anschließend begannen Verhaftungsaktionen gegen Minister und Anhänger des alten Präsidenten. Die erste Maßnahme des Neuen war es, die verbilligten Erdöllieferungen an Kuba sofort einzustellen. Tags darauf wurde Pedro Carmona vom Erzbischof von Caracas zum neuen Staatspräsidenten vereidigt.
Im Eiltempo folgten die Dekrete: Auflösung des Parlaments, Amtsenthebung der Gouverneure, Entlassung der Mitglieder des Obersten Gerichts und Ernennung eines neuen Generalstabs der Streitkräfte. Damit war Carmona jedoch zu weit gegangen. Unmut regte sich erneut unter den Militärs. Gegen die neue Staatsmacht standen vor allem die zivilen Basisorganisationen auf. Aus den Armenvierteln von Caracas strömten die Unterstützer von Chávez ins Stadtzentrum, errichteten Barrikaden, stürmten Polizeireviere und befreiten dort verhaftete Anhänger des gestürzten Präsidenten. Nun reagierte auch die bisherige Militärführung und bereitete den Gegenschlag vor. Der Präsidentenpalast wurde am 14. April von Chávez-treuen Fallschirmspringern kontrolliert, die neue Regierung für abgesetzt erklärt, Chávez’ Vizepräsident, Hauptmann Diosdado Cabello, übernahm provisorisch die Regierungsgeschäfte, bis der gestürzte Staatschef aus seiner Gefangenschaft auf der Insel La Orchila befreit und zurückgebracht worden war.
Carmonas Staatsstreich sollte weitreichende Folgen haben und begründet seither die unversöhnliche Grundhaltung der Chávisten zur Opposition: entweder die oder wir. Für eine Politik des Brückenschlags war nach dem April 2002 keine Grundlage mehr vorhanden. Die vier Jahre zuvor eingeleitete Revolution radikalisierte sich weiter. Zwei Personalien verdeutlichten dies: An die Spitze des wichtigsten Unternehmens, der staatlichen Erdölgesellschaft PDVSA, rückte Alí Rodriguez. Er war in den 1960er und 70er Jahren Angehöriger der von Kuba unterstützten marxistischen Guerrilla FALN und wurde unter dem Namen Comandante Fausto als Sprengstoffexperte bekannt. Erst 14 Jahre nach dem offiziellen Ende der Kämpfe und der verkündeten Amnestie legte er 1983 die Waffen nieder und schloss sich einer Absplitterung der Kommunistischen Partei Venezuelas an, mit der er sich 1997 überwarf.
Zum neuen Energieminister ernannte Chávez 2002 Rafael Darío Ramírez. An seiner fachlichen Eignung gab es weniger Zweifel, als an seinen verwandtschaftlichen Verhältnissen: Sein Vater war einer der Finanziers der Guerrilla gewesen und bestens bekannt mit Alí Rodriguez. Es war jedoch nicht der Vater, der international für Aufsehen sorgte. Es ist vielmehr sein Neffe, Ilich Ramírez, der in einem französischen Hochsicherheitsgefängnis eine lebenslange Haftstrafe verbüßt. Dieser war lange vor Chávez der bekannteste (und berüchtigtste) Venezolaner. Man kannte ihn unter dem Namen »Carlos« oder »Der Schakal«. Er war der weltweit meist gesuchte Terrorist. Man kann sich seine Verwandtschaft natürlich nicht aussuchen, doch »Carlos« hat eine eigene Geschichte im Venezuela unter Chávez.
Ilich Ramírez (Jahrgang 1949) wuchs in einer kommunistischen Familie auf. Sein Vater verteilte die Namen seines Idols gleichmäßig über seine drei Söhne: Vladimir, Ilich, Lenin. Ab 1968 studierte Ilich an der Patrice-Lumumba-Universität in Moskau, die er zwei Jahre später aber verlassen musste, weil die sowjetischen Behörden ihm das Stipendium entzogen. Er wechselte zur Volksfront für die Befreiung Palästinas PFLP, für die er 1973 sein erstes Attentat in London verübte, dem unzählige weitere folgten. Ende 1975 organisierte er einen Anschlag auf das OPEC-Hauptquartier in Wien, bei dem drei Menschen getötet und 60 als Geiseln genommen wurden. Ihm wurde auch eine Beteiligung am Bombenanschlag auf das »Maison de France« in West-Berlin 1983 nachgesagt. 1994 verhafteten ihn französische Spezialeinheiten im Sudan.
Und was hat das mit Chávez zu tun? Bei seiner Antrittsrede verstörte der neue Präsident im Februar 1999 die zahlreich anwesenden Staatsgäste mit der Bemerkung, bei »Carlos« handele es sich um »einen angesehenen Landsmann«. Einen Monat darauf versuchte er bereits, dessen Freilassung aus dem französischen Gefängnis zu erreichen. Später wurde bekannt, dass Chávez einen regen Briefwechsel mit dem Top-Terroristen unterhielt. Die Briefe des Präsidenten wurden dem Häftling per Diplomatenpost von Vertretern der Botschaft in Paris ins Gefängnis La Santé überbracht.
Gesteigert wurde dies noch einmal Jahre später – »Carlos« war inzwischen zum Islam übergetreten und hatte sich nach dem 11. September 2001 der Sache von al-Qaida verschrieben –, da brachte Chávez auf einer Konferenz von Linksparteien in Caracas im Jahr 2009 die Rede auf den Top-Terroristen. Er sei von den französischen Behörden »verschleppt« und »ungerecht verurteilt« worden. Damit waren auch international die Verhältnisse klargestellt: Das chavistische Venezuela positionierte sich gegen den Westen.
* * *
Eine zentrale Rolle in dieser Entwicklung spielt Kuba. Fidel Castro war mit Chávez an der Macht am Ziel alter Wünsche. Er hatte schon 1959 versucht, den gewählten venezolanischen Präsidenten Rómulo Betancourt zur Lieferung von Geld, Waffen und Öl an Kuba zu bewegen, und als dies nicht gelang, nahm er in den 60er Jahren den bewaffneten Kampf gegen die demokratische Regierung in Caracas auf. Kuba bildete Guerrilleros aus, schickte Waffen und intervenierte mehrmals mit kubanischen Militärs, die mit Landungsunternehmen illegal ins Land gebracht wurden.
Seit dem Amtsantritt von Chávez 1999 floss nun endlich das ersehnte Öl, und Fidel Castro verfolgte eisern das Ziel, die Regierung in Caracas so lange wie irgend möglich an der Macht zu halten, schließlich hing davon auch das wirtschaftliche Überleben der sozialistischen Insel ab. Er entwickelte soziale Konzepte für den venezolanischen Präsidenten, um die Wählerschaft an ihn zu binden.
Nach Havanna liefen viele Stränge zur Absicherung der Macht. Von hier regierte der 2011 an Krebs erkrankte Hugo Chávez, der sich in Havanna viele Monate behandeln ließ, hier wurde die Entscheidung getroffen, wer nach seinem absehbaren Tod die Macht übernehmen sollte: Nicolás Maduro, ein Mann der Kubaner. Sie hatten ihn – lange vor Chávez – in den 80er Jahren auf der Insel ausgebildet und als »Perspektivkader« der Lateinamerika-Abteilung des ZK der KP Kubas aufgebaut. Er studierte 1986 / 1987 an der Parteihochschule »Ñico López« Marxismus-Leninismus, Politische Ökonomie und die Geschichte der revolutionären Bewegung Lateinamerikas. Sein offizieller Lebenslauf weist viele Leerstellen auf, auch die Ausbildung in Kuba wird darin nicht erwähnt. Er hatte Kontakt zu Fidel und Raúl Castro, vor allem aber zu Innenminister Ramiro Valdés. So war seine Ernennung 2013 nur folgerichtig, denn Kuba ist in Venezuela in allen Sicherheitsbereichen mit Tausenden Beratern vertreten. Kubaner haben besondere Befugnisse, die ihnen der neue Präsident offiziell bestätigte.
Eine herausragende Rolle spielte der kubanische Berater Orlando Borrego, dem Maduro die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik seines Landes übertrug. Borrego war einst die rechte Hand von Ernesto »Che« Guevara und nach dem Sieg der kubanischen Revolution der Verantwortliche für die Industrialisierungspolitik, zunächst als Hauptabteilungsleiter und ab 1961 als Vizeminister für Industrie. Seine zentralistische Politik ruinierte die Wirtschaft des einst reichen Inselstaates. (Siehe dazu auch das Buch »Abschied vom Mythos – sechs Jahrzehnte kubanische Revolution«.)
Che Guevara gestand zwar sein komplettes Scheitern ein, für das er »einen absurden, realitätsfernen Plan mit absurden Zielen und imaginären Mitteln« verantwortlich machte und zog sich aus der kubanischen Politik zurück, Borrego jedoch blieb. Er wurde Zuckerminister, Ende der 60er Jahre angesichts der katastrophalen Ergebnisse der Zuckerernte aber entlassen. Danach promovierte er in der Sowjetunion im Fach Ökonomie des Sozialismus und beriet den kubanischen Ministerrat, bis er in Venezuela seine Karriere krönte.
Chávez rettete dank seiner Petro-Dollars nicht nur Kuba in der Existenzkrise. Er finanzierte auch die Rückkehr von Daniel Ortega an die Macht in Nicaragua, bezahlte argentinische Staatsschulden und lieferte Öl zu Vorzugspreisen an Länder Lateinamerikas.
Nachdem seine Macht ausreichend gesichert war, verkündete Hugo Chávez 2006 den »Sozialismus des 21. Jahrhunderts«. Das Konzept stammte von einem deutschen Soziologen, die Umsetzung erfolgte maßgeblich durch Fidel Castro und seine Entsandten. Heinz Dieterich, einer von Chávez’ frühen Beratern, hatte das neue Sozialismus-Modell entwickelt. Er distanzierte sich darin sowohl vom »industriellen Kapitalismus« als auch vom »real existierenden Sozialismus«. Beide Systeme hätten die drängenden Fragen der Menschheit nicht zufriedenstellend beantworten können. Statt auf die Marx‘sche Tauschwerttheorie setzt er auf eine Äquivalenztheorie, wonach die Entlohnung generell nach aufgebrachter Arbeitszeit erfolgen soll. Zudem kritisierte er die »vertikalen Partei-, Gesellschafts- und Staatsstrukturen«, an deren Stelle er eine basisorientierte Demokratie über Internetbeteiligung setzen wollte. Dieterich stützt sich dabei auch auf den Bremer Wissenschaftler Arno Peters.
Die ZEIT schrieb 2008: »Peters hat über den Computer-Sozialismus geschrieben, die globale Planung der Wirtschaft durch Computer. Peters besaß aber keinen Rechner, seine Texte schrieb er mit Füller und faxte sie Dieterich. Die Anekdote scheint symptomatisch für ihr Gesellschaftsmodell: Alles wirkt theoretisch, als sei es nicht für Menschen bestimmt. Wie es aussieht, befindet sich der Kapitalismus tatsächlich in einer Krise, und wahrscheinlich funktioniert er in Lateinamerika viel weniger als im Westen. Aber Dieterichs Alternative klingt wie eine Mischung aus DDR, Kuba und Cyberspace. Überholt und utopisch zugleich.«
* * *
Nach 19 Jahren ist das neuerliche Sozialismusexperiment gescheitert. Es hatte das Ziel, das Leben der Armen und Unterprivilegierten in Venezuela zu verbessern. Inmitten einer Sonderkonjunktur hoher und höchster Weltmarktpreise für Rohöl (2005 – 2014) wurden weit mehr als zwei Billionen (2 000 000 000 000) Euro verbraucht. Gut die Hälfte davon stammt aus Erdöl- und Rohstoffeinnahmen, ein Viertel aus Steuern und ein Viertel aus Krediten. Diese ungeheuren Ausgaben sollen nach einer Schätzung mehr sein, als der venezolanische Staat in den 188 Jahren seit seiner Unabhängigkeit von Spanien bis zum Beginn der »Bolivarianischen Revolution« eingenommen hat. Und das sind die Ergebnisse des außergewöhnlich hohen finanziellen Einsatzes:
•Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, fast doppelt so viele wie vor dem Amtsantritt von Chávez.
•Im Land wird gehungert, drei Viertel der Venezolaner haben 2016 im Schnitt acht Kilo an Gewicht verloren.
•Um den Warenkorb zur Deckung der Grundbedürfnisse zu bezahlen, bedarf es ein Mehrfaches des Mindestlohns, und darin ist noch nicht die Inflation eingerechnet.
•Die Arbeitslosigkeit ist die zweithöchste des Kontinents.
•Die medizinische Versorgung ist in weiten Teilen nicht mehr gewährleistet.
•Venezuela gilt als das gefährlichste Land der Erde.
•Venezuela hat mit nahezu 1000 Prozent die weltweit höchste Inflationsrate.
•Venezuela ist mit 170 Milliarden Dollar verschuldet und kann seine Zinsen kaum noch zahlen; ein Zahlungsausfall wäre die größte Staatspleite aller Zeiten.
•Die Devisenreserven Venezuelas sind weitgehend erschöpft.
•Die Investitionsrate ist mit weitem Abstand die niedrigste in Lateinamerika.
•Venezuela muss Erdöl zur Versorgung des Landes importieren, da die eigene Förderung durch langfristige Exportverträge gebunden ist.
Wie konnte es zu einem derartigen Desaster kommen?
Es gibt es kaum Anzeichen dafür, dass das Land von außen nachhaltig destabilisiert wurde, Venezuela stand in den letzten 188 Jahren nie im Krieg mit einer äußeren Macht und wurde jüngst auch nicht Opfer einer verheerenden Unwetterkatastrophe. Die USA, die in der Propaganda stets als imperialistisches Feindbild präsentiert werden und die für die Regierenden an allem schuld sind, hatten keine bekanntgewordenen Aktionen unternommen, die zur Rechtfertigung für dieses Desaster herangezogen werden könnten. Im Gegenteil: Die wirtschaftliche Zusammenarbeit funktioniert. Die Vereinigten Staaten sind auch weiterhin Venezuelas größter Handelspartner; Venezuela betreibt in den USA die drittgrößte Tankstellenkette (CITGO); im Juni 2017 kaufte die US-Investmentbank Goldman Sachs staatliche Schuldscheine im Nennwert von 2,8 Milliarden Dollar und füllte damit die leeren Kassen der Regierung in Caracas. Einen Monat später schloss Venezuela einen Vertrag mit dem US-Dienstleister für die Erdölindustrie Halliburton.
Auch politisch läuft es anders, als man gemeinhin annimmt. Für Donald Trump öffnete Anfang 2017 die klamme Regierung in Caracas großzügig die Kasse: Sie spendete für dessen Amtseinführung so viel, wie Pepsi Cola, der Mobilfunkanbieter Verizon und der Einzelhandelsriese Walmart zusammen. Seit vielen Jahren sind die teuersten Lobbykanzleien in Washington mandatiert, für die Interessen der Regierung in Caracas zu werben. Es ist gut angelegtes Geld, denn die Wirtschaftssanktionen, die die US-Regierung im August 2017 erließen, umgingen gekonnt jene Felder, die den Chávisten wirklich wehtun würden. Donald Trump verkündete, dass der Handel mit neuen venezolanischen Staatsanleihen verboten werde. Dabei hatten die USA das Schicksal der Regierung in Caracas in der Hand: Jeden Tag bekam sie 30 Millionen Dollar für ihre Öllieferungen in die USA. Würde Washington diese Lieferungen stoppen, müsste Präsident Nicolás Maduro den sofortigen Staatsbankrott erklären.
Der inzwischen wieder niedrigere Ölpreis ist auch kein hinreichender Grund für die hoffnungslose Lage. Chávez konnte bei seinem Wahlsieg mit einem Ölpreis von 10 Dollar kalkulieren. Ende Oktober 2017 stand er bei 55 Dollar. Und zwischen 2004 und 2012 fuhr die staatliche Erdölfirma PDVSA Rekorde am laufenden Band ein. Am 30. August 2005 stiegen die Rohölpreise aufgrund des verheerenden Hurrikans Katrina, der die Ölförderung im Golf von Mexiko und die Raffination in den USA beeinträchtigt hatte, auf 71 US-Dollar pro Barrel. Am 26. November 2007 kletterte der Ölpreis auf einen Jahreshöchststand von 99 Dollar. Am 2. Januar 2008 stieg der Ölpreis im Handelsverlauf erstmals auf die dreistellige Marke von 100 US-Dollar, und sechs Monate später erreichte er mit 147 Dollar einen neuen, nie zuvor erreichten Höchststand.
Als zentrales Argument für die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit für die Regierungen von Chávez und Maduro wird stets angeführt, dass sie seit 1998 (fast) jede Wahl gewonnen habe. War das wirklich so? Spätestens seit dem Referendum zur Abwahl von Chávez im August 2004 gibt es daran schwerwiegende Zweifel. Damals konnte Chávez die deprimierenden Umfrageergebnisse von 30 Prozent und damit den Verlust der Macht abwenden und mit fast doppelt so vielen Stimmen einen Sieg davontragen. Viele Indizien belegen, dass dieser wundersame Erfolg der Beginn einer Serie von manipulierten Wahlergebnissen sein könnte, deren Höhepunkt das Referendum zur Schaffung einer erneuten Verfassunggebenden Versammlung und zur Entmachtung des Parlaments vom 30. Juli 2017 darstellt. Der Generalsekretär der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), Luis Almagro, bezeichnete es als den »größten Wahlbetrug in der Geschichte Lateinamerikas«. Die seit 2007 amtierende Generalstaatsanwältin Venezuelas, Luisa Ortega, leitete staatsanwaltschaftliche Ermittlungen gegen die obersten Wahlhüter ein – und wurde wenige Tage darauf abgesetzt. Mittlerweile musste sie nach Morddrohungen aus dem Land fliehen.
Es ist unstrittig, dass viel Geld für die Armen ausgegeben wurde: In den vierzehn Jahren der Regierung unter Hugo Chávez (1999 – 2013) waren es nach offiziellen Angaben über 500 Milliarden Dollar für soziale Projekte – mehr Geld, als in allen anderen lateinamerikanischen Ländern. Doch wie fielen die Ergebnisse dieser eindrucksvollen Summe aus? In einem Vergleich der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (CEPAL) schneidet Venezuela nicht besonders gut ab: Die Armut verringerte sich dort im Zeitraum 1999 – 2011 um 38,5 Prozent. Chile, Brasilien oder Peru schafften mit deutlich weniger Mitteleinsatz bessere Ergebnisse. Und Uruguay schaffte in nur vier Jahren (2007 – 2011) eine Verringerung der Armut um 63 Prozent. Ab 2013 war Venezuela das einzige lateinamerikanische Land, in dem die Armut wieder zunahm. 2014 überstieg die ermittelte Armut mit 48,4 Prozent den Stand vor Amtsantritt von Hugo Chávez (45 Prozent) und seit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch ab 2015 erreicht die Armut katastrophale Ausmaße von 80 Prozent und mehr.
Die österreichische Journalistin Hanna Silbermayr, die seit Jahren in Caracas lebt, schilderte im Sommer 2017 auf krautreporter.de ihren Alltag: »In Venezuela fehlt es an grundlegenden Produkten des alltäglichen und medizinischen Bedarfs. In den Supermärkten gibt es kein Mehl, keinen Kaffee, keine Milch, keinen Zucker. Brot ist auch gerade Mangelware. Ich habe seit zwei Monaten keines mehr gegessen. Zahnpasta bekommst Du nicht, Shampoo und Seife genauso wenig, Babywindeln und Toilettenpapier erst recht nicht. Und in den Apotheken fehlt es an so simplen Dingen wie Aspirin oder Verhütungsmitteln.«
Die Katholische Universität »Andrés Bello« in Caracas fand in einer repräsentativen Erhebung Ende 2016 heraus, dass für 53 Prozent der Venezolaner das tägliche Essen ihr Hauptproblem sei. 36 Prozent gaben an, dass sie für Nahrung bereits werthaltige Dinge verkaufen mussten. Die Caritas untersuchte im April 2017 insbesondere Kinder in den Armenvierteln der Hauptstadt und stellte fest, dass 11,4 Prozent von ihnen unterernährt waren. Bei einem Wert über zehn Prozent sprechen Hilfsorganisationen von einer Ernährungskrise. »Die Hälfte der Schüler besucht den Unterricht nicht mehr, weil sie nichts zu essen haben. Lehrer berichten uns, dass schlecht ernährte Kinder im Unterricht vor Hunger in Ohnmacht fallen«, sagte Janeth Márquez, Direktorin von Caritas Venezuela.
Die dramatische Lage bestätigte auch die venezolanische Journalistin Sarai Suárez. »Viele Leute sind abgemagert bis auf die Knochen. Das ist keine Übertreibung, das ist das Beispiel eines Öl-Landes, das komplett ruiniert ist von seiner eigenen schlechten Verwaltung. Die Supermärkte und die Bäckereien sind ohne Ware, die Apotheken ohne Medikamente. Harmlose Krankheiten werden lebensbedrohlich, weil nicht die einfachsten Mittel vorhanden sind. Die Ärzte sagen: Wir praktizieren heute in Venezuela unter Bedingungen wie im Krieg. Die Krankenhäuser haben nicht mal Verbandszeug.«
Susanna Raffali ist Ernährungsexpertin aus Caracas. Sie war für internationale Hilfsorganisationen in Katastrophengebieten wie in Indonesien nach dem verheerenden Tsunami, in Pakistan oder in Flüchtlingscamps im Süden Algeriens im Einsatz. »Wenn man mir vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich zuhause die gleiche Arbeit verrichten muss, wie in Afrika oder Südasien nach Naturkatastrophen, ich hätte das niemals für möglich gehalten.«
Dabei kann es auch ganz anders gehen: José Mujica (genannt »El Pepe«) war Guerrillero der Tupamaros, 14 Jahre im Gefängnis, überwiegend in Einzelhaft und von 2010 bis 2015 Präsident von Uruguay. Er ist bis heute ein leuchtendes Vorbild für gute Regierungsarbeit, lebte auch als Präsident auf seinem kleinen Bauernhof am Rande Montevideos, lehnte einen Dienstwagen ab und fuhr stattdessen mit seinem uralten VW-Käfer. Sein Präsidentengehalt spendete er größtenteils für soziale Zwecke. In seiner Regierungszeit machte Uruguay die größten Fortschritte bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit.
»El Pepe« unterstützte einst die Politik von Hugo Chávez. Heute sieht er die Lage in Venezuela als verfahren an. Maduro sei beratungsresistent und lehne Hilfe von außen ab. »Mit den vergangenen Öleinnahmen hätte Venezuela seine Lebensmittelproduktion auf sehr lange Sicht sichern können, dies wurde sträflich versäumt. Inzwischen ist es sehr schwierig, dem Land von außen auf die Sprünge zu helfen. Wir haben es versucht, sind aber gescheitert. Wir wollten helfen, aber es gab keinen Weg.« Im April 2017 antwortete er, angesprochen auf eine Vermittlung im Konflikt zwischen Regierung und Opposition in Venezuela: »Ich bin ›Pepe‹, kein Zauberer.«
* Es gibt derzeit zwei Meinungen darüber, ob es bolivarisch oder bolivarianisch heißen soll. In diesem Buch wird bolivarisch dort verwendet, wo es direkt um Simón Bolívar, seine Ideen und sein Werk geht. So ist die Verfassung aus seiner Feder die bolivarische Verfassung. Die »bolivarianische Verfassung« ist zwar Bolívar gewidmet, aber nicht von ihm erschaffen.
Die Vorgeschichte
»Die mythenbildende Kraft der Volksphantasiehat sich zu allen Zeiten in der Erfindung ›großer Männer‹ bewährt.Das schlagendste Beispiel dieser Art ist unstreitig Simón Bolívar.«
Karl Marx
Hätte Chávez das Ende seiner Revolution in diesen Tagen miterlebt, er hätte angesichts der Verhältnisse wohl ein ähnliches Fazit wie sein großes Vorbild Simón Bolívar ziehen müssen. Der schrieb nach zwanzig Jahren Kampf um die Unabhängigkeit 1830:
1.»Lateinamerika ist für uns unregierbar.
2.Wer der Revolution dient, pflügt das Meer.
3.Das einzige, was man in Amerika machen kann, ist emigrieren.
4.Dieses Land wird unweigerlich in die Hände zügelloser Tyrannen fallen, die allen Farben und Rassen angehören.
5.Zerfressen von den Verbrechen, erschöpft von der Barbarei, werden uns die Europäer verachten und nicht einmal mehr erobern wollen.«
Ungeachtet dieses deprimierenden Resümees kurz vor seinem Tode, ist außer Ernesto »Che« Guevara kein anderer lateinamerikanischer Freiheitskämpfer so oft abgebildet und verklärt worden wie Bolívar. Straßen und Schulen tragen seinen Namen, die venezolanische Währung, Städte und Provinzen und sogar ein Land – Bolivien. Seit einem Erlass aus dem Jahre 1876 muss in Venezuela der Hauptplatz jedes noch so kleinen Ortes nach dem Libertador (Befreier) benannt werden. Seine Büste ist in Venezuela allgegenwärtig, ob in Amtsstuben, auf Plätzen oder in Parks. Selbst sein Pferd ziert das Staatswappen der heutigen Bolivarischen Republik Venezuela.
Hugo Chávez war dem Befreier förmlich verfallen. Bei seinen Auslandsreisen wurden die Hotels oder Residenzen, in denen er übernachtete, angewiesen, ein lebensgroßes Bild Bolívars aufzuhängen. Bei Kabinettssitzungen blieb neben dem Präsidenten stets ein Stuhl frei, damit sich der Angebetete setzen konnte, sollte er überraschenderweise doch einmal vorbeikommen. Aus jeder Flasche Rum, die er öffnete, goss er den ersten Schluck auf den Boden, mit den Worten: »Für Simón Bolívar«. Wenn er allein sein Essen einnahm, war ein zweites Gedeck auf dem Tisch, und manch ein Kellner berichtete später, Chávez bei einer angeregten Unterhaltung angetroffen zu haben. Auf den verwunderten Blick eines Kellners soll er geantwortet haben: »Ich habe mich gerade mit Bolívar unterhalten.«
2010 ließ Chávez die Gebeine Bolívars aus dem Pantheon in Caracas holen, um sie in Spanien auf ihre Echtheit prüfen zu lassen. Ein Jahr später präsentierte er einen neuen Luxussarg für den nunmehr geprüften echten Befreier. »Wir wissen jetzt zweifellos und für immer, dass Du hier bist, Vater, Du bist hier mit uns, das bist Du«, sagte Chávez bei der Feier im Pantheon. Der neue Mahagoni-Sarg war mit Perlen und Diamanten sowie acht von der venezolanischen Zentralbank gestifteten Goldsternen verziert. Bis zum 17. Dezember 2030, dem 200. Todestag Bolívars, sollte ein Mausoleum errichtet werden.
Wer war dieser Simón José António de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco?
Er wurde 1778 in eine Familie spanischer Aristokraten aus dem Baskenland in Caracas geboren. Sein Vater besaß Bergwerke, Plantagen und Sklaven und war einer der reichsten Venezolaner der damaligen Zeit. Man wurde Ausgang des 18. Jahrhunderts in Südamerika nicht sehr alt – mit neun Jahren war Simón Bolívar bereits Vollwaise und mit 21 Jahren Witwer.
Landläufig sieht man in lateinamerikanischen Kämpfern verwegene Gestalten mit üppigen Schnauzbärten, mit viel Temperament und wenig Plan. Bolívar war das Gegenteil: Seine Erscheinung war nicht sehr eindrucksvoll, er war klein und schmächtig, dafür aber von überragendem Geist. Er gehörte zweifellos zu den weltweit bedeutendsten Denkern und Politikern des 19. Jahrhunderts.
Der Kämpfer für die kontinentale Unabhängigkeit Simón Bolívar (1783 – 1830)
Bolívar hatte Glück mit seinen Lehrern: Andrés Bello, einer der klügsten Lateinamerikaner seiner Zeit, Gefährte von Alexander von Humboldt auf dessen Reisen durch den Kontinent, unterrichtete ihn in Geographie und Literatur. Noch größeren Einfluss hatte Simón Rodríguez. Er machte den jungen Bolívar mit den Philosophen der damaligen Zeit vertraut. Beim englischen Staatstheoretiker Thomas Hobbes lernte er dessen Gesellschaftsverständnis einer aufgeklärten Monarchie, wonach alle Menschen bei der Überwindung von Furcht und Unsicherheit ihre Freiheitsrechte auf den Souverän übertragen, der sie voreinander schützt. Der französische Aufklärer Claude Adrien Helvetius lehrte ihn, dass das Glück aller die Voraussetzung für das Glück des Einzelnen ist. Alle Menschen seien gleich, Unterschiede durch Besitz gelte es zu begrenzen.
Der Höhepunkt der Unterrichtungen war für seinen Lehrer das Werk von Jean-Jacques Rousseau, dem Wegbereiter der französischen Revolution. Hier wurde Bolívar vertraut mit dessen Grundauffassung, dass alle Menschen von Natur aus gut seien, aber dann durch die gesellschaftlichen Verhältnisse Neid, Missgunst und Niedertracht die Oberhand gewinnen würden. Daher sei es notwendig, einen Sozialvertrag zu schließen, der ein einvernehmliches Zusammenleben regele. Zudem lernte Bolívar über Rodríguez auch die Grundprinzipien der Republik, Gewaltenteilung und Volkssouveränität, kennen.
Als sein Lehrer wegen Widerstands gegen die spanische Kolonialverwaltung das Land verlassen musste, trat Bolívar als Kadett in die Militäranstalt Milicias de los Valles de Aragua ein. Nach zwei Jahren wurde er zum Unterleutnant befördert und zu weiterreichenden Studien nach Madrid geschickt. Dort wohnte er bei einem Amerikaner, der der Geliebte der Königin war und ihm auch Zugang zum Hof verschaffte. Im Anschluss an seine Studien unternahm der junge Venezolaner ausgedehnte Reisen durch Europa, beobachtete die Krönung Napoleons, traf Alexander von Humboldt, war an Königshöfen ein ebenso gern gesehener Gast wie in den literarischen Salons.
1807 kehrte Bolívar nach Venezuela zurück. Zur damaligen Zeit lebten dort weniger als eine Million Einwohner. 200 000 zählten sich zur weißen Oberschicht, 60 000 Sklaven schufteten am anderen Ende der sozialen Skala und dazwischen lebten die Mestizen und Mulatten von der Produktion von Kolonialwaren. Es gärte im Land. Der damals 57-jährige Francisco Miranda unternahm bereits konkrete Schritte zur Beseitigung der spanischen Fremdherrschaft. Er hatte sich aktiv an der französischen Revolution beteiligt und war dort zum General aufgestiegen. Anschließend reiste er quer durch Europa, um Waffen und Geld für den Unabhängigkeitskampf daheim zu sammeln. Schließlich konnte er ein kleines Expeditionsheer ausrüsten, das 1806 in See stach. Das Unternehmen scheiterte jedoch, ehe es begonnen hatte, viele starben, Miranda gelang die Flucht.
Sein Ziel war es, die Amerikaner des gesamten Kontinents zu vereinen. Eine föderative Regierung sollte ihren Sitz an seiner engsten Stelle nehmen: in Panama. Staatsreligion sollte der Katholizismus sein, aber ohne die Inquisition. Einen Namen für das neue Staatswesen hatte Miranda auch schon: El Império Americano. Er war der Erste, der den Ureinwohnern Amerikas eine zentrale Rolle zudachte. Zwei Inkas sollten die Regierung ernennen und führen, einer in Panama, der andere reisend, um sich den Problemen der Bewohner vor Ort zu widmen.
1810 gelang der Putsch gegen die spanische Kolonialverwaltung. Er wurde zum Signal einer kontinentalen Erhebung. Die Aufständischen übernahmen die Stadtverwaltung von Caracas. Doch angesichts der Übermacht des Gegners suchten sie nach Unterstützung durch eine Großmacht. Mit dieser Mission betrauten sie den damals 27-jährigen Simón Bolívar. Der sprach bei den Vereinigten Staaten vor, doch die beriefen sich auf ihre Neutralität. Auch England winkte ab, weil es mit Spanien gegen Napoleon verbündet war. In London traf er Francisco Miranda, der sich ihm auf der Heimreise anschloss und den Vorsitz der ersten Republik Venezuela von 1810 übernahm. Beide verfolgten die Idee einer kontinentalen Einigung.
Bolívar hatte ein festumrissenes Zukunftskonzept. Statt eines Königs sah Bolívar einen starken Präsidenten an der Spitze des Staates. Wie beim Vorbild der englischen Verfassung sollten feste Regeln das Zusammenleben organisieren. Zu gewährleisten seien bürgerliche Freiheiten, so die Freiheit der Rede, des Gewissens und der Presse. Mann und Frau seien gleich zu behandeln. Ein oberster Rat nach dem Vorbild der griechischen Antike sollte mit seinen Gesetzen einen verbindlichen Sittenkodex schaffen, an den sich jedermann zu halten hatte. Begabte junge Menschen sollten unabhängig von ihrer Herkunft gefördert werden, ein Institut hatte die Aufgabe, geeignete Schriften für die Volksaufklärung herauszugeben. Arbeit und Wissen sollten Leitmotive des neuen Staats sein. Soweit der Plan.
Doch der Kampf um die Unabhängigkeit zwang Bolívar, sich in der zweiten Hälfte seines Lebens in bewaffneten Auseinandersetzungen aufzureiben. Es zeigte sich, dass der kleine, schmächtige Mann das Zeug zu einem großen Feldherrn hatte. Er verfügte über schier unbegrenzte Energien, verkraftete Niederlagen, war körperlichen Strapazen gewachsen und schreckte auch vor Grausamkeiten nicht zurück. Mit den Jahren wuchsen seine Ruhmsucht und sein ausgeprägter Machtwille. Bei seinen Feldzügen legte er in Lateinamerika mehr an Kilometern zurück als die großen historischen Feldherrn Hannibal, Alexander der Große und Cäsar zusammen. Hunderttausende seiner Soldaten fanden den Tod, er überlebte, aber neben den Worten und der Schrift nahm das Schwert einen immer größeren Platz ein.