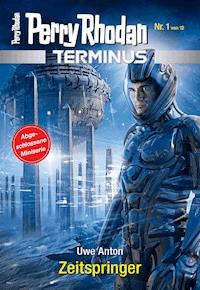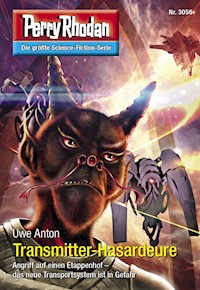3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fabylon
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Science Fiction 2
- Sprache: Deutsch
15 Geschichten aus der Welt von Morgen, bitterböse, ironisch, pointiert und vor allem gut erzählt. Willkommen in der Wirklichkeit Der Moment der Wahrheit Heimkehr Das Gitter In der Androidenfabrik Ich liebe deinen Stolz und deine Einsamkeit Galaabend im Hypersensio Ein kurzes, vertrauliches Gespräch mit dem Herausgeber Venus ist tot Roboter im Warnstreik Die schleichende Revolution Das große, kleine Schiff Roboterlogik Das Schloss Jurassic Mark
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Uwe Anton
Venus ist tot
Science Fiction-Geschichten
fabEbooks
Der Autor
Uwe Anton, Jahrgang 1956, gehört zu den bekanntesten Autoren der deutschen Science Fiction und Phantastik, hat neben Romanen zahlreiche Sachbücher verfasst, ist ein anerkannter (Comic-)Übersetzer, Herausgeber und Spezialist für Philip K. Dick.
Hinweis: Die Printausgabe (ISBN 978-3-927071-23-0) enthält ein Nachwort und bibliographische Anmerkungen.
Umschlagbild: Helmut Wenske
© der Print-Ausgabe 2008 by Fabylon Verlag
© des eBooks 2012 by fabEbooks
ISBN: 978-3-943570-01-4
Für Martina, Max, Jonas und Jenny.
Der aufregende, irrwitzige Alltag mit ihnen bietet Stoff für unzählige
weitere Geschichten, die noch geschrieben werden müssen.
VORWORT
von
Andreas Decker
Ein Fenster in die Vergangenheit.
Das sind die Erzählungen von Uwe Anton, die in diesem Band gesammelt sind. Und nein, es sind keine Zeitreisegeschichten – man kann sich also das entsetzte (oder enttäuschte) Aufstöhnen sparen –, auch wenn sie heute in vielerlei Hinsicht den Anschein haben, aus einer parallelen Dimension zu kommen.
Denn diese Geschichten, die größtenteils zwischen Ende der siebziger bis Ende der achtziger Jahre entstanden, bieten einen winzigen Einblick in eine Zeit, in der die Science Fiction in Deutschland nicht nur an der Schwelle zur gesellschaftlichen und literarischen Akzeptanz stand – zumindest war das die Theorie und der sehnlichste Wunsch vieler Autoren –, sondern es auch noch etwas gab, das sich heute wie ein Märchen anhört.
Einen zahlenden Markt für Kurzgeschichten.
Nun, er zahlte nicht gut, und er war auch nicht groß. Aber es gab ihn.
Man könnte jetzt lange über Wert, Werdegang und vor allem Publikumsakzeptanz der SF-Kurzgeschichte referieren, die wie so vieles Gute – und Schlechte – aus Amerika importiert wurde. Tatsache ist, dass diese Zeitspanne in der Szene der deutschen SF-Schaffenden von Aufbruchsstimmung und Optimismus erfüllt war, denn etwas war passiert, was zuvor nicht möglich gewesen war. Verlage waren bereit, deutschen Autoren die Chance zu geben, Kurzgeschichten zu veröffentlichen und nicht nur auf das scheinbar unerschöpfliche Reservoir angloamerikanischer Werke zurückzugreifen. Plötzlich hatte jeder Taschenbuchverlag, der Science Fiction publizierte, Anthologien mit deutschen Autoren im Programm. Das Spektrum war breit, die Qualität auch, wie es immer bei solchen Dingen ist. Eben die Guten, die Schlechten und die Hässlichen, und die Einschätzung variierte je nach SF-Stammtisch und Fandomsfraktion.
Das funktionierte auch einige Jahre, aber die Kurzgeschichte konnte sich hierzulande dann doch nicht den erhofften Stellenwert erkämpfen, den sich ihre Macher gewünscht haben. Am Ende dieser Ära und mit dem Beginn der telekommunikativen Massenmediengesellschaft, die eine ganz neue Art gerade des Medienkonsumenten hervorbrachte, der zumindest in der westlichen Gesellschaft eine radikal andere Sozialisation erfuhr (bei dem Harry Potter zum Trotz das Leseerlebnis nicht gerade an erster Stelle steht – nicht einmal an letzter, was das angeht), ging diesem speziellen Markt still und leise und nur von wenigen beweint die Luft aus.
(Und nur um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, mit Markt meine ich einen den Autoren bezahlenden Markt mit einer ordentlichen Auflage und flächendeckendem Vertrieb, der sich kommerziell behaupten kann. Im Zeitalter des Book-on-Demand mag das eine unpopuläre Ansicht sein, aber mal ehrlich, was nutzt es, die tollste Geschichte der Welt geschrieben zu haben, wenn sie niemand liest? Das ist fast schon wie die Frage, ob der Baum im Wald ein Geräusch macht, wenn er umfällt und keiner in der Nähe ist, um es zu hören.)
Doch dieser Markt hatte genau wie die damaligen SF-Heftromanreihen nicht nur den Nutzen, für Beschäftigung zu sorgen, er hatte auch einen Nebeneffekt, der heute fehlt.
Die Gelegenheit, sein Handwerk als Autor zu lernen.
Schreiben hat in jedem Genre viel mit Talent, Sprache und Ideen zu tun, aber in vielerlei Hinsicht ist es auch ein Handwerk, das gelernt sein muss. Und ein gesunder Kurzgeschichtenmarkt bot diese Chance. Er bot nicht nur eine Plattform für mehr oder weniger gelungene Nachahmungen konsumierter US-SF, sondern manchmal auch die Gelegenheit, etwas Eigenständiges zu erschaffen. So selten sie auch genutzt worden sein mag.
Und das ist nicht nur eine Theorie. Die meisten der amerikanischen Autoren haben es vorgemacht. Leute wie Robert Silverberg haben mit Kurzgeschichten ihren Lebensunterhalt verdient, viele Klassiker der SF haben als Kurzgeschichte oder Novelle ihren Anfang genommen, bevor sie zu Romanen umgearbeitet wurden. Es ist bedauerlich, dass es diese Möglichkeiten hierzulande nicht mehr gibt.
Uwe Anton nun hat das Genre Science Fiction nicht immer schon geliebt, er hat das Schreiben zu seinem Beruf gemacht. Und wie jeder vernünftige Geschäftsmann hat er die Gelegenheiten ergriffen, die sich boten. Also schrieb auch er eine Reihe von Kurzgeschichten, die mal hier und mal da erschienen, stellte selbst Anthologien zusammen, nutzte die Möglichkeiten, seine Begeisterung und Faszination für bestimmte Autoren weiterzugeben; in diesem Zusammenhang seien vor allem seine Arbeiten über Philip K. Dick erwähnt.
Die hier zusammengetragenen Geschichten sind eine bunte Mischung; die Palette reicht von Erzählungen wie Willkommen in der Wirklichkeit, die Motive von Philip K. Dick aufgreift, über Auftragsarbeiten wie Roboterlogik bis zu Geschichten wie Das Schloss, in der es um Computerspiele geht.
Und gerade das Letztere ist ein exemplarischer Blick in die Vergangenheit des Genres, denn zum Beispiel gerade diese Erzählung greift einerseits die zur Entstehungszeit neue Idee des in einer virtuellen Umgebung gefangenen Spielers auf, die mittlerweile zum öden Klischee verkommen ist. Andererseits bezieht sie wie auch andere Geschichten eine Technik in die Handlung ein, die der heutige junge und dynamische World-of-Warcraft-Spieler mit der gleichen Verständnislosigkeit wie die Faustkeile der Steinzeitmenschen betrachten dürfte.
Und so illustrieren diese Geschichten auch deutlich das Dilemma nicht nur der deutschen Science Fiction; die Botschaft ist hochaktuell geblieben, nur die Verpackung ist von der realen Entwicklung manchmal überholt worden und sieht darum im Zweifelsfall alt und angestaubt aus. Was bei einer Literaturgattung, die vor allem in die Zukunft gerichtet ist und sich gern visionär gibt, nicht unbedingt förderlich ist.
Aber das ist nicht die Schuld dieser Geschichten, das ist der Zeitgeist. Aber auch der Zeitgeist und die sich ständig im Wandel befindliche Umwelt sind machtlos gegenüber einer Sache: der Idee. Natürlich ist es heute urkomisch, wenn man als Leser von den Lochkarten liest, die den Supercomputer des Raumschiffs zum Mars bedienen. Aber was dahinter steckt, die Idee und die Vision von einem Computer, der zu so etwas fähig ist und den es zum Zeitpunkt der Entstehung der Geschichte noch nicht gab, diese Leistung kann nicht einmal das angesammelte Gerümpel der vergangenen Jahre schmälern. Und so bedienen diese Geschichten in diesem Band nicht nur die Nostalgie der Altleser; in den besten von ihnen steckt ein wahrer Kern, der den Leser nicht nur unterhält, sondern auch seine Gefühle anspricht.
Und das ist eine Wirklichkeit, die zeitlos ist und bleibt. Und daher immer willkommen sein wird.
Wuppertal, April 2008
Andreas Decker, geb. 1960 in Wuppertal, ist ausgebildeter Buchhändler und Altenpfleger und arbeitet seit Jahren als Übersetzer (u.a. David Wellington, Robert Jordan), Drehbuchautor (»Ein Fall für Zwei«), Autor (unter verschiedenen Pseudonymen), Gutachter und Außenlektor.
Einführung zu
Willkommen in der Wirklichkeit
Dies ist mein »Erstgeborener« und mir daher, obwohl das kein gutes Elternteil eingestehen würde, vielleicht ein klein, klein wenig lieber als alle später entstandenen Geschichten, zumal ich auch noch Gelegenheit hatte, kräftig nachzuarbeiten und zu verbessern.
Die Story erschien erstmals, als ich gerade 18 Jahre alt war, und Nachahmung ist natürlich die ehrlichste Form von Schmeichelei. Wenn es eine Geschichte von mir gibt, die von meinem damaligen (und sicherlich auch heutigen) Vorbild Philip K. Dick beeinflusst wurde, dann diese. Schon der Titel weist auf das grundlegende Thema im Werk des 1982 verstorbenen amerikanischen Autors hin, die Suche nach der Wirklichkeit, dem Sinn des Lebens. Und wenn man gerade mal 18 Jahre alt ist, gehört es sich natürlich, auch eine politische Botschaft mit der Suche nach dem Sinn des Lebens zu verbinden – eine, die ich heute übrigens noch immer unterschreiben würde.
Nachdem ich die Geschichte geschrieben hatte, gab ich sie meinem Kollegen Ronald M. Hahn, der damals ebenfalls geradezu ein Idol und der Inbegriff des schriftstellerischen Erfolgs für mich war, und er brachte sie, wie ich neidlos eingestehen muss, in eine lesbare Form. Sie erschien mit der Autorenangabe »L.D. Palmer & Thorn Forrester« 1974 in »Erber’s Gruselkrimi Doppelband« 25.
(Der Apostroph stammt nicht von mir, sondern vom Verlag; der Inhaber hatte vielleicht den einzigen Duden im Haus damals gerade seinem vor kurzem schulpflichtig gewordenen Sohn verliehen. Und L.D. Palmer war das Pseudonym, das ich mir für Veröffentlichungen im Genre Science Fiction ausgedacht hatte; ebenfalls eine Hommage an Philip K. Dick bzw. seinen Roman THE THREE STIGMATA OF PALMER ELDRITCH. Aus »Palmer Eldritch« wurde einfach »L.D. Palmer«. Dick fand das witzig und war durchaus geschmeichelt, als ich es ihm in einem Brief nebenbei mitteilte.)
Hauptbestandteil des immerhin 132 Seiten umfassenden Hefts war Ronalds Gruselkrimi »Das Erbe der Vergangenheit«, der Rest wurde von Kurzgeschichten bestritten. Völlig überrascht stellte ich bei den Recherchen für diese Zeilen fest, dass in diesem Band auch eine Story – »Die Krypta von Shaggay’h« – von Helmut Wenske enthalten ist, der auch das Titelbild für diese Collection gestaltet hat.
In manchen Bibliographien wird Ronald M. Hahn bei den späteren Veröffentlichungen dieser Geschichte als Co-Autor angegeben, doch das ist falsch. Für die nächste Veröffentlichung dieser Geschichte in der Reihe TERRA ASTRA (schon wieder L. D. Palmer: Vor dem Ende der Welt) im Jahre 1981 nahm ich meine Urfassung und überarbeitete und erweiterte sie so gut, wie es meine damaligen Kenntnisse in diesem Beruf ermöglichten. Schon diese Fassung ist also allein auf meinem Mist gewachsen.
Das gilt ebenfalls für die nächste Veröffentlichung der Geschichte, die mir einigen Ärger einbrachte. Ich gab damals, 1990, für den Heyne-Verlag eine Anthologie mit Geschichten heraus, die unter dem Einfluss von – natürlich! – Philip K. Dick entstanden waren. Meine Story diente als Titel – WILLKOMMEN IN DER WIRKLICHKEIT –, und ich überarbeitete sie für diese Ausgabe noch einmal.
Allerdings hatte ein SF-Fan aus Berlin gerade einen »genialen« Roman angefangen, der genau diesen Titel trug, und bezichtigte mich in diversen SF-Fan-Magazinen des geistigen Diebstahls. Ich hätte ihm ja wenigstens mal eine Flasche Wein als Anerkennung zukommen lassen können. Nachdem ich ihm dann Kopien der beiden schon vor Jahren unter diesem Titel veröffentlichten Fassungen dieser Geschichte zugeschickt hatte, musste er sich in eben genau diesen SF-Fan-Magazinen entschuldigen. Auf eine Flasche Wein warte ich noch heute, und der tolle Roman ist nie erschienen, aber ich hatte Jahre später das Vergnügen, zwei Romane zu lektorieren, die er für PERRY RHODAN bei Heyne schrieb. Da schließt sich der Kreis gewissermaßen.
Anfang der 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts war – fast ausschließlich durch Pina Bausch, die bei den Wuppertaler Bühnen tätig war, schon damals meine adoptierte Heimatstadt – das Tanztheater groß in Mode gekommen. Andere Bühnen zogen nach, und Waltraut Körver-Badji von den Städtischen Bühnen Münster war so beeindruckt von Willkommen in der Wirklichkeit, dass sie meine Geschichte kaufte, um daraus ein Tanztheater zu machen. Ich war bei der Generalprobe dabei, ohne große Möglichkeiten zum Eingreifen zu haben – was mir allerdings auch fern lag, obwohl ich natürlich auf die getreue Interpretation meines Werks achten wollte – und feierte die Premiere dann groß: Ich buchte Hotelzimmer und lud zehn Freunde zu der Veranstaltung und anschließendem Abendessen ein. (Mit dem, der während der Aufführung eingeschlafen ist, habe ich seit Jahren keinen Kontakt mehr, wenn auch aus völlig anderen Gründen.) In der Festzeitschrift der Städtischen Bühnen Münster erschien meine Geschichte dann erneut, und zwar in meiner alleinigen Fassung letzter Hand, die auch in diesem Band enthalten ist.
WILLKOMMEN IN DER WIRKLICHKEIT
Die ganze Zeit über, während der Zug mit monotonem Rattern die weite Ebene überquerte, dämmerte Kendrick in einem unruhigen Halbschlaf vor sich hin. Erst als die blockierten Räder laut aufkreischten, schreckte er hoch.
Der Geruch von Lysol haftete in seiner Nase, von aseptischer Sauberkeit. Unwillkürlich fühlte er sich an ein Krankenhaus erinnert und nicht an ein verqualmtes, stickiges Zugabteil.
Er war allein. Die Mitreisenden mussten den Zug bei einem früheren Halt verlassen haben. Er trat zur Tür; sie hatte sich verklemmt und ließ sich nur schwer öffnen. Als er auf den Gang hinaustrat, sah er, dass nicht nur sein Abteil, sondern der ganze Wagen bis auf ihn menschenleer war. Flüchtig erinnerte er sich an die Geschichte vom Geisterzug, der führerlos durch die Landschaft gerast war.
Er grinste kurz. Dieser Zug war real, und er musste aussteigen. Ein Wunder, dass er den Halt nicht verschlafen hatte.
Kendrick wartete, bis die Masse der Waggons endlich zum Stehen kam, stieß dann die Tür auf und sah auf den Bahnhof hinaus. Niemand war auf dem Bahnsteig zu sehen, alles war leer und verlassen.
»Provinznest«, murmelte er. Er hatte schon lange vorgehabt, dieser Gegend den Rücken zu kehren, doch bislang hatte ihn immer etwas zurückgehalten. Zuerst war es Tessa gewesen, dann seine gutgehende Praxis, dann die Ernennung zum Beisitzer bei den Bürgerschaftswahlen. Kendrick seufzte. Er hatte sich zu stark engagiert; nun würde es kaum noch ein Fortkommen geben.
Verdrossen trat er den Heimweg an. Er hatte es nicht weit; sein Haus lag etwa zehn Minuten zu Fuß vom Bahnhof Pine County entfernt. Insgeheim freute er sich sogar ein wenig. Tessa würde auf ihn warten, mit einem köstlich duftenden Abendessen – Steak mit Pilzen, wenn er sich recht entsann. Unwillkürlich lächelte er über sich selbst. Gerade hatte er noch rebellische Gedanken gehegt, vielleicht sogar davon geträumt, die Fesseln seiner bürgerlichen Existenz abzuschütteln, alles hinter sich zu lassen, die Praxis, die bescheidene Lokalpolitik, und nun dachte er wie ein Spießbürger aus dem Bilderbuch an seine treusorgende Frau, die ihn, hübsch zurechtgemacht, mit einem fertig gedeckten Tisch erwartete.
»Wie war dein Tag, Schatz?« – »Wie immer, Liebes. Anstrengend. Chris macht wieder Schwierigkeiten. Und deiner, Liebes?« – »Wie immer, Schatz. Terri war auf eine Tasse Kaffee hier. Weißt du, was sie erfahren hat? Die Pierce von nebenan ist im vierten Monat schwanger. Und das, obwohl sie seit einem dreiviertel Jahr von ihrem Mann getrennt lebt! Willst du vor dem Essen einen Drink, Schatz?«
Der Blick auf die sich vor ihm ausbreitende Stadt ließ ihn stutzen. Die Straßen waren wie ausgestorben, und das am frühen Abend.
Kendrick schüttelte den Kopf. Natürlich, Pine County war nicht San Francisco, wo die Musik bis morgens um sieben aus den Diskotheken dröhnte, aber dass der Ort um diese Zeit in sanfter Stille vor sich hinschlummerte, war mehr als ungewöhnlich.
»Ach was«, murmelte er, »wir wohnen eben in der tiefsten Provinz.« Er pfiff eine kleine Melodie, doch sie klang noch schiefer als sonst. Betroffen stellte er fest, dass er unwillkürlich schneller als gewöhnlich ausschritt.
Und ... dieser Geruch. Lysol. Aseptische Reinheit.
Kein Hauch von Benzin in der Luft, kein Duft der Blumen und Sträucher. Strenge, keimfreie Sauberkeit.
Über seine Netzhaut huschte ein Blitz. Einen Sekundenbruchteil lang sah er Schläuche, Skalen, helles Plastik, weißen, frisch gestärkten Stoff. Alles war weiß um ihn herum. Es war, als würde er in einem Glas Milch ertrinken.
Und auch sein Gehör war betroffen. Er vernahm einen steten, konstanten Piepton, der ihn mit seiner Gleichförmigkeit durchdrang, ausfüllte.
Etwas ließ ihn stolpern. Der milchpulverstaubige Boden des Bürgersteigs schoss rasend schnell auf ihn zu, die Umgebung verschwamm vor seinen Augen. Mühsam rappelte er sich wieder auf und lehnte sich gegen eine Wand ... Hauswand ... Krankenhauswand?
Er blinzelte. Das allgegenwärtige Weiß löste sich auf, und hell leuchtende Farben ließen seine Augen tränen. Er konnte nicht mehr richtig sehen. Etwas, das ihn an einen roten Schleier erinnerte, legte sich über seine Pupillen, und dann verwandelte sich seine Umgebung vollends in ein verschwommenes, rotes Negativ. Unvermittelt gaben seine Knie nach. Er glitt an der Wand hinab, stürzte zu Boden.
Mit plötzlich aufkeimender Panik versuchte er, alle Kraft zusammenzunehmen und sich wieder aufzurichten, doch mit einem Schlag fühlte er sich unendlich schwach. Sein Herz hämmerte mit einer solch immensen Stärke, dass er glaubte, kurz vor einem Kollaps zu stehen. Er versuchte zu schreien, doch nicht der leiseste Ton entwich seiner zusammengedrückten Kehle.
Schmerz. Kälte Angst.
Eine Stimme. Körperlos, allgegenwärtig. »Schlaganfall. Zur Intensivstation. Nein, warten Sie, sämtliche Reaktionen sind plötzlich wieder normal ... Was ist hier los?«
Was ist hier los?, dachte Kendrick. Und: Ich muss mich bewegen. Mühsam schnappte er nach Luft.
Was war geschehen? Allmählich klärten sich seine Gedanken. Er war ohnmächtig geworden, hatte einen Schwächeanfall erlitten. Jetzt lag er auf der Straße. Wie viel Zeit war inzwischen verstrichen?
Er blinzelte. Es war heller Tag. Seine Füße waren gefühllos, die Hände schmerzten. Er litt unter unsäglichem Muskelkater.
Hatte er wirklich mehrere Stunden lang bewusstlos auf der Straße gelegen? Er konnte es nicht glauben. Wieso hatte ihn niemand bemerkt? Wieso hatte sich niemand um ihn gekümmert, ihm geholfen, die Ambulanz gerufen, ins Krankenhaus bringen lassen?
Einen Augenblick lang glaubte er, sich an den Lysolgeruch eines Krankenhauses zu erinnern, an komplizierte technische Geräte, deren Sinn und Zweck selbst ihm, keinem Berufsfremden, unverständlich blieben.
Verwirrt schüttelte er den Kopf. Der dumpfe Schmerz, der sich in ihm breitgemacht hatte, wich allmählich einer kalten, gefühllosen Leere. Er rollte sich herum. Zwar fror er schrecklich, doch ansonsten schien er unverletzt zu sein. Er schüttelte kurz die Glieder, um festzustellen, ob er sich bei dem Sturz etwas gebrochen hatte.
Negativ. Doch zum Aufstehen war er noch zu schwach. Seine Beine zitterten wie im Fieber, als er sich an der steinernen Hauswand emporzog. Mutlos ließ er sich wieder hinab sinken.
Die Kälte ergriff nun vollständig Besitz von ihm. Es war ein Wunder, dass er nicht erfroren war, denn der Tageszeit nach zu urteilen musste er zehn, zwölf Stunden hier gelegen haben. Am Himmel stand eine schwache Morgensonne.
Aber es lag nicht nur an der Sonne ... Irgendetwas stimmt hier nicht, war nicht wie sonst, wie es immer war, wie es sein muss ...
Taumelnd kam er endlich wieder auf die Füße. Er machte gefühllos ein paar Schritte; bis zu seinem Haus war es nicht mehr weit. War er erst einmal dort angekommen, musste er sofort telefonisch einen Kollegen aus einem der Nachbarorte konsultieren.
Es traf Kendrick wie ein Schock, als er plötzlich erkannte, was um ihn herum nicht so war wie sonst, was die Umgebung so unwirklich und steril machte. Es war kein Geräusch zu hören! Auf ihm lastete völlige Stille. Nirgendwo der Klang einer menschlichen Stimme, keine Autos auf den Straßen – nicht einmal ein Vogel am Himmel! Die Stadt schien völlig ausgestorben zu sein. Aber das ... das war unmöglich! Doch nicht morgens um acht Uhr, wenn sich all die Pendler auf den Weg zum Bahnhof machten, um zu ihren Arbeitsstätten in San Francisco zu fahren, die Mütter die Kinder in die Schulen brachten, die Geschäftsleute ihre Läden öffneten ...
Wie im Traum fand Kendrick den Weg, bis er schließlich das Haus sah, dessen Hypothek in fünf Jahren abbezahlt sein würde ... das ihn vollends an dieses Kleinstadtkaff fesselte. Mit steifen Fingern wühlte er in den Hosentaschen und fand endlich seinen Schlüssel. Nur mit Mühe gelang es ihm, die Tür aufzuschließen. Statt Blut schien Eiswasser durch seine Adern zu fließen.
Vorsichtig drückte er die Tür ins Schloss. Der lange Korridor, in den alle Zimmer mündeten und der schließlich in der Treppe zum Obergeschoss endete, schien nicht der eines Wohnhauses, sondern der einer riesigen Sportarena zu sein, eine unendlich lange Katakombe, in der sich eine durchdringende Eiseskälte ausgebreitet hatte. Er taumelte ins Schlafzimmer, drehte die Heizung auf und ließ sich dann in voller Kleidung auf sein Bett fallen.
»Tessa!«, krächzte er. »Wo bist du, Tessa?« Aber der Gedanke verlor sich irgendwo in der samtenen Schwärze, mit der ihn schon der Schlaf umfasste.
Als er erwachte, schienen seine Glieder vollkommen steif zu sein. Kendrick unterdrückte die aufkeimende Panik und zwang sich zur Ruhe. Er lag da und lauschte den Tönen seines Herzens, schloss die Augen und bemühte sich, logisch zu denken. Was war geschehen?
Ein durchdringender Piepston drohte seine Gedanken zu unterwerfen. Piep ... piep piep … regelmäßig, jede Sekunde ein neues Piep piep ...
»Alle Körperfunktionen normal«, sagte eine Stimme aus dem Nichts. Er assoziierte sie mit einem Gesicht, doch es blieb verschwommen, wurde nicht greifbar.
Er riss die Augen wieder auf, und das Geräusch verschwand.
Langsam kehrte die Erinnerung zurück. Er war ohnmächtig geworden und hatte sich mit letzter Kraft zu seinem Haus schleppen können ...
Er schwang die Beine vom Bett und richtete sich auf.
Verwundert registrierte er, dass sie sein Gewicht trugen. Mühsam machte er ein paar Schritte, und langsam kam wieder Gefühl in seinen Körper. Er sah auf die Uhr. Sie war stehen geblieben, zeigte halb drei.
Sich am Geländer festhaltend, ging er die Treppe hinab und in die Küche. Es war immer noch sehr kalt, und die Heizung schien endgültig den Geist aufgegeben zu haben. Als er den Warmwasserhahn aufdrehte und die Hände darunter hielt, zuckte er zurück.
Das Wasser war so kalt, dass die Berührung damit schmerzte. Aus einem heißen Kaffee wird wohl nichts, dachte er. Er ging zum Kühlschrank und öffnete ihn. In dessen Innerem blieb es dunkel, das Lämpchen leuchtete nicht auf. Es schien keinen Strom zu geben.
»Tessa?«, rief er. Keine Antwort.
Als er aus dem Fenster schaute, hatte er Mühe, die sofort zurückkehrende Schwäche zu unterdrücken. Die Sonne war gerade aufgegangen; offensichtlich hatte er vierundzwanzig Stunden geschlafen.
Und nichts regte sich. Alles war totenstill. Die Alltagsgerüche, an die er sich im Lauf der Jahre gewöhnt hatte – der viel zu laute Plattenspieler der Pierce nebenan, das Geplärre der Dennison-Babys, die Autos, die unter dem Fenster vorbeifuhren, das ewige Gekläffe von Parkers Hund – all das fehlte.
Es bewegte sich nichts in der Stadt, bis auf ein paar Blätter, die der Wind vor sich her durch die Straßen trieb. Jedes menschliche und tierische Leben schien aus Pine County geflohen zu sein. Nur die Autos waren geblieben, ordnungsgemäß an den Straßenrändern geparkt. Pine County war schließlich eine ordentliche Stadt, in der alles seine Richtigkeit haben musste.
Ein penetranter Geruch stieg Kendrick in die Nase und vertrieb den leichten Lysol-Gestank, den er noch immer wahrzunehmen glaubte. Die Tiefkühltruhe! Wenn sie keinen Strom mehr hatte, würden die Lebensmittel innerhalb kurzer Zeit bis auf das letzte Stück verderben.
Aber es war schon zu spät. Die Vorräte waren bereits ungenießbar. Er schlug die Tür so fest zu, dass der Schrank erzitterte.
Im Bad benetzte er sein Gesicht mit dem eiskalten Wasser. Dann nahm er den Schlüssel, verließ das Haus und schloss die Tür hinter sich ab. Tessa würde bei ihrer Mutter sein, nachdem er sie am Abend zuvor mit dem fertigen Essen so lange hatte warten lassen und sich derart verspätet hatte. Aber dass sie die Lebensmittel einfach verkommen ließ ...
Am Abend zuvor? War es nicht der vorletzte gewesen? Hatte er nicht einen Tag im Haus verschlafen? Seine zeitliche Orientierung war aus den Fugen geraten. Und warum hatte Tessa keine Hilfe geholt, nachdem sie ihn besinnungslos auf dem Bett gefunden hatte?
Er schüttelte den Kopf und bemühte sich, zielsicher auszuschreiten. Er musste sich unbedingt etwas Essbares besorgen; sein Magen revoltierte schon, weil er seit fast zwei Tagen nichts mehr zu sich genommen hatte.
Auf der Straße verharrte er einen Augenblick lang.
Hatte er sich in der Zeit geirrt? Sicher, im Sommer wurde es hier schon gegen fünf Uhr in der Frühe hell. Schlief die Stadt etwa noch? Aber wo blieb dann das Gezwitscher der Vögel, das ihn jeden Morgen weckte?
Träumte er? Ach was! Dennoch kniff Kendrick sich in den Arm. Er spürte den Schmerz überdeutlich.
»Mal sehen«, sagte er halblaut zu sich selbst. Kurzentschlossen drückte er an der nächsten Haustür die Klingel.
Nichts. Nicht das geringste Geräusch. Jeder mechanische oder elektrische Prozess schien genauso tot zu sein wie die Stadt selbst. Er sah durch ein geschlossenes Fenster, drückte das Gesicht ganz nah an die Scheibe. In dem dahinterliegenden Raum regte sich nichts.
Er wandte sich um, ging zu dem kleinen Lebensmittelgeschäft, dessen Besitzer er seit Jahren kannte, einer seiner Patienten ...
Lebensmittelgeschäft?, dachte er. Aber hatte es nicht schon vor Jahren schließen müssen, als die 7-11-Kette eine Filiale in Pine County eröffnete? Aber da war das Geschäft, und daneben die Baustelle, die er seit Tagen verfluchte. Auch sie lag totenstill da, obwohl die Bauarbeiter, die bereits um fünf Uhr mit ihren Presslufthämmern die ganze Straße in Aufruhr versetzten, wegen ihrer Pünktlichkeit bekannt und bei den Anwohnern gleichzeitig gefürchtet und verhasst waren.
Von einem ganzen Berg, der dort von den Bauarbeitern aufgehäuft worden war, hob Kendrick einen Pflasterstein auf. Langsam, Schritt für Schritt, ging er auf den Laden zu. Die Tür war verschlossen. Wütend holte er aus und warf den Stein durch das Schaufenster des Ladens. Endlich ein lautes Geräusch! Die absolute Stille zerbarst in einem herrlichen Klirren.
Er trat die Scheibe vollends ein und kletterte in den Laden. Die Kühltruhe beachtete er gar nicht. Er riss ein Paket Scheibenbrot auf, nahm ein Stück Hartwurst und aß. Mit Orangensaft spülte er das Frühstück hinunter.
»Verhungern werde ich jedenfalls nicht«, murmelte er und verließ den Laden auf dem gleichen Weg, auf dem er ihn betreten hatte.
Da knallte irgendwo eine Tür.
Kendrick verharrte einen Augenblick lang, so unwirklich erschien ihm das Geräusch. Dann fuhr er herum und lief los. Wieder knallte die Tür zu. »Ist hier jemand?«, rief er. Der laute Klang seiner eigenen Stimme erschreckte ihn.
Die Tür schlug erneut zu. Der Wind! Es war nur der Wind gewesen!
»Ganz ruhig«, sagte er laut zu sich selbst. Sein Atem ging schnell und rasselnd. »Jemand will mich um den Verstand bringen. Irgendjemand versucht, mich in den Wahnsinn zu treiben. Eine Verschwörung ... «
Unsinn, schalt er sich selbst. Gas und Wasser und Strom konnte man abstellen – aber nicht den Vögeln das Singen verbieten!
»Ich muss aus Pine County raus.« Er schritt auf die am Straßenrand geparkten Wagen zu. Der erste war ordnungsgemäß verschlossen. Pine County war eben eine ordentliche Stadt, deren Bürger die Vorschriften und Gesetze beachteten. Beim zweiten war der Zündschlüssel abgezogen. Er wusste zwar, dass es Möglichkeiten gab, ein Auto kurzzuschließen, hatte aber nicht die geringste Ahnung, wie man das bewerkstelligte.
Zu wenig Krimis gesehen, dachte er. Keine Chance.
Er musste weitersuchen.
Dann hatte er Glück. Er fand einen unverschlossenen Wagen, dessen Zündschlüssel steckte. Er versuchte den Wagen zu starten, doch der Motor sprang nicht an, gurgelte nicht einmal.
Das war also auch keine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Aber wie konnte er aus diesem Irrenhaus rauskommen? Züge schienen Pine County auch nicht mehr anzufahren, sonst hätte er ihren Lärm von seinem Haus aus gehört.
Der nächste Ort lag gut zehn Meilen entfernt. Er hatte keine andere Wahl, als es zu Fuß zu versuchen. Zweifelnd betrachtete er seine modischen Lackschuhe. Damit würde er wohl kaum weiter als ein paar Meilen kommen, ohne sich Blasen zu laufen.
Die Kirchturmuhr unterbrach seinen Gedankengang.
Sie schlug die Mittagsstunde.
Das Glockenspiel war so alltäglich, dass es Kendrick zuerst überhaupt nicht auffiel. Doch dann schien etwas in seinem Kopf zu platzen. Die Kirchturmuhr! Alle Uhren standen still, aber die Kirchturmuhr ... sie schlug sogar erschreckend laut.
Er lief los. Als er die Kirche erreicht hatte, erwartete ihn eine neue Überraschung – in Gestalt eines kleinen Hundes, der Kendrick misstrauisch musterte.
»Na, mein Kleiner?« Kendrick bückte sich, streckte die Hand nach dem Tier aus. Es gehörte einer undefinierbaren Rasse an. »Bist du ganz allein? Dann komm mal her ... na, komm schon ...«
Der Hund bellte. »Nur ruhig, mein Kleiner«, sagte Kendrick besänftigend, ihn mit der ausgestreckten Rechten lockend. »Komm her, Hundchen, und sag, wie du heißt ...«
Ihm wurde der Unfug bewusst, den er redete, aber er fuhr dennoch fort. Der Hund schien genau zu spüren, dass hier etwas nicht stimmte. Als Kendrick ihn fassen wollte, lief er los. Kendrick folgte ihm, doch der Abstand vergrößerte sich zusehends.
Plötzlich war das Tier verschwunden. Kendrick hielt keuchend inne. Er hatte es höchstens für drei Sekunden aus dem Blickfeld verloren, als er um die Ecke gebogen war ...
»Ein Hund kann sich nicht in Luft auflösen!«, knurrte Kendrick. Oder doch? Sein Gesicht wurde eine Spur nachdenklicher. Die ganze Stadt um ihn herum war schließlich leer, und allem Anschein nach hatte sich die Bevölkerung tatsächlich in Luft aufgelöst.
Suchend sah er sich um. An der Wand eines Schuppens vor ihm fehlte ein Brett – Platz genug für einen kleinen Mischling, um hindurchzuschlüpfen.
Als Kendrick näher kam, hörte er aus dem Innern des Holzverschlags ein heiseres Bellen. Er verstand zwar nicht sonderlich viel von Hunden, glaubte aber, deutliche Angst aus dem Gekläff herauszuhören.
Vorsichtig öffnete er die Tür des Schuppens. Muffiger Geruch schlug ihm entgegen. Es war dunkel. Langsam tastete er mit der Hand nach einem Lichtschalter, fand jedoch keinen.
Er glaubte, noch einen Geruch wahrzunehmen, der irgendwo tief unter dem Moder im Schuppen lag – den Geruch von Lysol, von krankenhausreiner Sauberkeit.
Ein Geräusch ließ ihn zusammenzucken. Durch die Türöffnung fiel etwas Licht in den Raum, aber in seinem Gesichtsfeld befanden sich lediglich einige Kisten.
Wieder das Geräusch – aber diesmal hinter ihm!
Kendrick fuhr herum, doch da schlug etwas mit fürchterlicher Gewalt gegen seinen Hinterkopf, und sein Denken setzte aus.
Er sah Bilder – ein roter Leuchtimpuls, der horizontal anstieg und abfiel, eine Zackenlinie auf einem Bildschirm. Er hörte ein gleichförmiges Pressen von Luft, wie aus einem Blasebalg. Und er roch ... Lysol.
Dann reduzierten sich diese Eindrücke zu einem gewaltigen Brummen in seinem Schädel, als befände sich ein Bienenschwarm darin. Stöhnend betastete er seinen Kopf. Man hatte gute Arbeit geleistet – Blut benetzte seine Finger.
Er schüttelte sich, doch der Schmerz blieb.
Jemand hatte ihn in einen Hinterhalt gelockt. Aber wer? Und warum hatte man ihn nicht beseitigt wie alle anderen Einwohner der Stadt?
Taumelnd erhob er sich. Einen Augenblick lang dachte er an eine der wenigen Krimiserien im Fernsehen, die er gelegentlich verfolgt hatte: dort hatte sich der hartgesottene Held nach einem Niederschlag mit einem Revolverknauf lässig erhoben, ein Blendax-Lächeln gezeigt, sich den wohlfeilen Zwirn glatt gestrichen und war wieder frisch ans Werk gegangen.
Die Wirklichkeit sah etwas anders aus. Kendricks kraftlose Finger glitten an der Scheunentür ab. Erst beim zweiten Versuch gelang es ihm, sie zu öffnen.
Heller Sonnenschein schlug ihm entgegen, und: Verkehrslärm, Hundegekläff, das Geschrei spielender Kinder. Überall lästige Tauben. Menschen, die sich unterhielten und umhergingen. Die ganze Stadt brodelte vor Leben.
»Was ist los, junger Mann? Wie sehen Sie überhaupt aus?« Eine ältere Frau musterte ihn misstrauisch und griff instinktiv fester nach dem Knauf ihres Regenschirms, den sie in der Hand trug. Wohl auch der Konsum zahlloser Krimis, dachte Kendrick resignierend. Und: diese alte Dame hätte wahrscheinlich ein Auto kurzschließen können, was ihm nicht gelungen war.
»Haben Sie zu viel getrunken?«, fragte die Frau. »Aber so sehen Sie mir gar nicht aus. Hat man Sie überfallen? Niedergeschlagen? Beraubt?«
Kendrick versuchte, die Belastbarkeit seines Schädels mit einem Nicken auf die Probe zu stellen. »Überfall ...«, krächzte er.
»Mein Gott, das ist ja furchtbar«, entsetzte sich die Frau. »Und das hier in Pine County! In San Francisco, ja, aber hier ... Sie bluten ja! Sie müssen ins Krankenhaus! So können Sie doch nicht ...«
»Schon gut«, unterbrach Kendrick ihren Redeschwall. »Sagen Sie mir nur ... was für einen Tag haben wir heute?«
»Geht es Ihnen wirklich gut?« Das Gesicht der alten Dame war ein einziges Fragezeichen.
»Natürlich. Aber was für einen Tag haben wir?«
»Mittwoch. Sollten Sie nicht doch lieber ...«
»Danke. Wirklich, mir geht es gut.« Und das war auch nicht einmal gelogen: er fühlte sich schon wieder sicherer auf den Füßen.
Mittwoch, dachte er. In der Tat, Montagabend war er zurückgekommen. Er hatte also nicht geträumt – in seiner Erinnerung fehlte ein Tag.
»Warten Sie bitte!«, rief er der davoneilenden Frau nach, der es allmählich doch zu unheimlich zu werden schien. »Einen Augenblick nur!«
Die Frau drehte sich um. Misstrauen lag in ihrem Blick. »Junger Mann, allmählich müssten Sie sich schon schlüssig werden, was Sie wollen.«
»Nur eine Frage noch. Was haben Sie gestern gemacht?«
Sie stierte ihn an, als hätte er ihr einen unsittlichen Antrag unterbreitet. »Was ich gestern gemacht habe?«, entgegnete sie spitz. »Wie soll ich das verstehen?«
Kendrick bekam den Eindruck, dass er noch eine einzige dumme Frage stellen musste, und sie würde die Polizei rufen. Dennoch drängte er weiter. »Es ist wichtig. Bitte!«
»Ich weiß zwar nicht, was Sie mit dieser Frage bezwecken, aber ... gestern war ein ganz normaler Tag. Ein Tag wie jeder andere.«
»Sie waren also in der Stadt?«, fragte Kendrick hastig. Er musste endlich Gewissheit haben.
»Aber sicher.«
»Und es ist nichts ... Außergewöhnliches passiert?«
»Nein. Hm ... Vielleicht doch ...«
»Was?«, fragte er ungeduldig. Ihm war klar, dass die Frau ihn mittlerweile für verrückt hielt, doch die Spannung in ihm stand kurz vorm Bersten.
»Man hat eingebrochen. Beim Lebensmittelhändler.«
Kendrick fasste sich ans Kinn. Es ist also wirklich geschehen, dachte er verzweifelt. Ich bin in dieser Stadt gewesen, habe niemanden gesehen außer einem kleinen Hund.Die ganze Stadt leer bis auf mich und diese kleine Promenadenmischung ... Ich habe die Scheibe des Lebensmittelladens eingeschlagen und Sachen gestohlen, und niemand hat mich gesehen, und ich habe auch niemanden gesehen ...
»Das ist doch unmöglich!«, murmelte er. Einen Augenblick lang fühlte er seinen Herzschlag wie einen Schmiedehammer in seiner Brust.
»Was denn, junger Mann?«
Kendrick schreckte auf und winkte ab. »Nichts. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für Ihre Hilfe.«
Er lief davon, zurück zu seinem Haus. Als er an dem Lebensmittelladen vorbeikam, sah er zwei Glaser, die damit beschäftigt waren, eine neue Schaufensterscheibe einzusetzen.
In Gedanken versunken öffnete er die Tür. Drinnen brannte Licht. Die Küchentür schlug, und plötzlich stand eine junge Frau, die er noch nie zuvor gesehen hatte, vor ihm und starrte ihn aus weit aufgerissenen Augen an.
»Ist das denn die Möglichkeit?«, schrie sie in hellstem Diskant los, der Wut und Überraschung zugleich ausdrückte. »Jetzt wagen Sie es sogar schon am helllichten Tag! Verschwinden Sie, oder ich rufe die Polizei!«
Kendrick machte einen Schritt auf die Frau zu. Sie wich vor ihm zurück und kreischte auf, schrille, harte Töne. Er ergriff ihre Arme und schüttelte sie. »Was geht hier vor?«, herrschte er sie an. »Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen?«
Sie riss die Augen noch weiter auf, hörte endlich auf zu schreien und schnappte wie ein Fisch nach Luft. »Was ich hier zu suchen habe?«, brachte sie schließlich hervor. »Ich wohne hier!«
»Immer mit der Ruhe!«, sagte Kendrick. Hatte er sich im Haus geirrt? Aber nein, er kannte die Möbel um ihn herum genau. Er hatte sie selbst ausgesucht, gemeinsam mit Tessa, in einem großen Discount-Markt in San Francisco ...
»Hier wohnt Dr. Philip Kendrick«, sagte er mit einer erzwungenen Ruhe, die ihn selbst überraschte. »Und das bin ich!«
»Sie sind ja verrückt!«, sagte die Frau kategorisch. »Sie sind nicht Dr. Philip Kendrick.« Ihre Augen suchten die Wohnung ab – nach einer Waffe, wusste Kendrick plötzlich. »Ich kenne ihn persönlich sehr gut«, wisperte die Frau und wich einen Schritt zurück. »Ich bin seine Frau.«
»Sie sind ... wer?« Kendrick stöhnte auf. Die Augen traten ihm aus den Höhlen, und die gesamte Wut und Angst, die sich in ihm aufgestaut hatte, entlud sich mit einem Schlag. »Ich bin Kendrick!«, rief er. »Ich! Ich! Und niemand sonst!« Immer wieder schrie er es.
Er hörte erst zu zetern auf, als von außen die Tür geöffnet wurde. Ein uniformierter Polizist drängte sich durch den Spalt, die gezogene Schusswaffe auf Kendrick gerichtet. »Polizei!«, rief er. »Keine Bewegung! An die Wand!« Und, mit einem Seitenblick auf die Frau: »Alles in Ordnung, Janet?«
Sie nickte stumm.
»An die Wand, Freundchen!«, wiederholte der Polizist.
Die Mündung der Waffe deutete jetzt genau auf Kendricks Brustkorb.
»Hören Sie ...«, beschwor Kendrick den Mann, doch der Polizist unterbrach ihn mit einer Geste, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließ.
Kendrick gehorchte.
Der Polizist tastete ihn nach Waffen ab. »Wer sind Sie?«, fragte er dann. »Was wollen Sie hier?«
»Mein Name ist Philip Kendrick«, gab Kendrick gepresst zurück. Ein abstruser Verdacht stieg in ihm empor. Vielleicht gehörten die beiden zusammen, waren ein ausgekochtes Gangsterpärchen, und er hatte sie bei dem Versuch überrascht, seine Wohnung auszurauben ... das würde auch erklären, wieso der angebliche Polizist so schnell zur Stelle gewesen war. Er war der zweite Mann, der den Tatort sicherte ...
»Sie sind ... wer?« Das ungläubige Erstaunen im Gesicht des Polizisten war echt. Der Mann schaute von Kendrick hinüber zu der Frau, griff sich dann mit einer fahrigen Bewegung ans Kinn und schüttelte den Kopf.
»Er ist verrückt, Jim!«, sagte die Frau. Ihre Stimme schwebte noch immer am Rand der Hysterie. »Er muss irgendwo entsprungen sein.«
Draußen quietschten Bremsen. Vielleicht kommt jetzt die echte Polizei, dachte Kendrick erleichtert.
»Das ist Mrs. Kendrick«, sagte der Polizist langsam zu Kendrick und deutete auf die Frau. »Sie ist seit zehn Jahren mit Dr. Kendrick verheiratet. Ich kenne die beiden ziemlich gut, und nicht nur, weil wir Nachbarn sind. Dr. Kendrick ist mein Bruder.«
Kendrick begann zu zittern. Er hatte nie einen Bruder gehabt, nur eine Zwillingsschwester, und die war sechs Wochen nach der Geburt gestorben.
Vor dem Haus erklang eine Stimme. Kendrick atmete auf. Jetzt kam die echte Polizei. Jetzt würde sich alles aufklären.
Aber dann verdüsterte sich sein Blick wieder. Draußen stürmte ein Rudel Polizisten die Auffahrt hinauf, und dieses saubere Pärchen dachte offenbar nicht im Traum daran, sich aus dem Staub zu machen. Und die Worte, die der angebliche Polizist an ihn gerichtet hatte, hatten verdammt echt, so verdammt glaubhaft geklungen.
»Aber ... ich ... ich kann beweisen, wer ich bin ...«, stammelte Kendrick, einem Nervenzusammenbruch nahe. Mit zitternden Fingern durchwühlte er die Taschen seines Anzugs.
Sie waren leer. Natürlich. Man hatte ihn niedergeschlagen und dann ausgeraubt. Keine Papiere, kein Geld, nichts.
Zwei weitere Polizisten betraten das Haus. »Alles in Ordnung, Jungs«, sagte der erste, und die Frau, die sich als Mrs. Kendrick ausgab, tippte sich mit dem Finger vielsagend gegen die Stirn, dabei mit dem Kopf auf Kendrick deutend.
»Sie kommen mit«, sagte der Polizist. »Machen Sie kein Aufsehen!«
»Nehmen Sie diesen angeblichen Polizisten und die Frau mit«, sagte Kendrick zu den beiden anderen Beamten. »Sie sind in mein Haus eingedrungen und geben sich als mein Bruder und meine Frau aus. Ich beschwöre Sie, ich habe nie einen Bruder gehabt, und das ist auch nicht meine Frau. Sie ... Sie müssen die Personalien der beiden feststellen!«
»Ich glaube, das erübrigt sich. Sergeant Kendrick ist der Bruder von Dr. Philip Kendrick, und diese Dame ist Dr. Kendricks Frau.«
»Aber ...« Kendrick brauchte fünf Sekunden, ehe die Worte des Polizisten in sein Bewusstsein gedrungen waren. »Das ist nicht wahr!«, schrie er. »Ich bin Dr. Kendrick! Das ist eine Verschwörung!« Er stürzte auf den neben ihm stehenden Polizisten zu und griff nach dessen Waffe. Der Mann sprang zur Seite und versetzte Kendrick einen Schlag in den Nacken. Plötzlich wirbelte der Fußboden auf ihn zu, und ...
... er erwachte auf einer harten Pritsche und sah saubere, weiß getünchte Wände und Gitterstäbe, die seinen Zellenraum von einem schmalen Gang abgrenzten.
Man hatte ihn eingesperrt! Er befand sich in einer Zelle des Bezirksgefängnisses von Pine County. Es war nur ein kleines Gebäude, das direkt an das Büro des Sheriffs anschloss. Kendrick erinnerte sich, hier im Zellentrakt einmal einen Vagabunden behandelt zu haben, der Läuse eingeschleppt hatte.
Diese Gefahr bestand nun wohl nicht mehr. Es stank bestialisch nach Lysol.
Er stieg von der Pritsche und rüttelte an den Gittern. Die fünf anderen Zellen des Trakts waren leer. Pine County war eben ein ordentlicher, ruhiger, angenehmer Ort.
Nach einer Weile steckte ein älterer Mann den Kopf durch die Türöffnung, die, wie Kendrick noch wusste, zum Büro des Sheriffs führte. Kendricks Hoffnung, mit dem Sheriff oder einem Beamten, der ihn noch von diesem Besuch her kannte, den Irrtum sofort aufklären zu können, erfüllte sich nicht: Dieser Mann war ihm unbekannt. Offenbar hatte der Aufseher, mit dem Kendrick damals gesprochen hatte, mittlerweile die Stelle gewechselt.
»Sind Sie der neue Aufseher?«, fragte Kendrick.
Der Mann schüttelte den Kopf. »Der neue?« Er musterte ihn verwundert. »Tut mir leid. Ich habe den Job hier seit über zehn Jahren.«
»Hören Sie«, sagte Kendrick, »ich spiele doch nicht in einem drittklassigen Film mit? Ich kenne Ihren Vorgänger. Er heißt O'Farrell, und ich habe noch vor einigen Monaten persönlich mit ihm gesprochen, als ich hier einen Gefangenen behandelte.«
»Wenn Sie meinen«, sagte der Aufseher gleichmütig, und Kendrick vermeinte, so etwas wie Mitleid in seinen Augen zu sehen. Er schien ihn wirklich für geistesgestört zu halten.
»Ich weiß nicht, was hier gespielt wird«, flüsterte Kendrick und streckte eine Hand durch die Gitter, »aber dieses Spiel ist verdammt schmutzig. Wir schreiben doch das Jahr 2009, oder?«
»Sicher tun wir das.« Der Alte trat zwei Schritte zurück. »Beruhigen Sie sich lieber. Sie haben allerhand mitgemacht. Wir haben bereits nach dem Arzt geschickt. Ihre Kopfverletzung ...«
»Ich bin nicht verrückt!«, schrie Kendrick. Dann erst hatte er die Worte des Alten vollends begriffen. »Sie haben ... was?« Er fühlte, wie seine Knie nachgaben.
»Nach dem Arzt geschickt.«
»Nach welchem?«, keuchte Kendrick.
»Wir haben nur einen in Pine County. Eine ziemliche Kapazität. Erst letzte Woche war er noch als Gastredner auf einem medizinischen Kongress. Und er arbeitet zweimal die Woche in einer Gemeinschaftspraxis in San Francisco.«
Kendrick nickte grimmig. »Ich weiß. Sie meinen Dr. Kendrick, nicht wahr?«
»Natürlich.« Der Aufseher verzog keine Miene. Entweder war er nicht informiert über das, was Kendrick zugestoßen war, oder er verstellte sich mit einem phantastischen schauspielerischen Talent, mit dem er für diese Schmierenkomödie eine glatte Überbesetzung war.
»Aber ich bin Dr. Kendrick!«, rief Kendrick. »Warum glauben Sie mir nicht? Hat sich denn alles gegen mich verschworen? Ich bin es! Ich! Ich!«
Aus dem dunklen Gang erklang ein schüchternes Räuspern. »Das kann wohl schlecht möglich sein«, sagte ein großer, schwarzhaariger Mann mit einem scharf geschnittenen Gesicht. Er trug eine dunkle Arzttasche in der Hand.
»Wer sind Sie?« In Kendrick krampfte sich alles zusammen.
»Ich bin Dr. Kendrick«, entgegnete der Mann mit stoischer Ruhe. »Mir scheint, Sie sind ein wenig durcheinander, Sir. Sie haben einen Schlag auf den Kopf abbekommen, sagte man mir.«
Kendrick musterte den Fremden mit offenem Mund.
Er kannte ihn nicht, hatte ihn nie im Leben zuvor gesehen. Der Mann war ihm völlig unbekannt.
Der Aufseher öffnete die Gittertür und ließ den Schwarzhaarigen eintreten. »Glauben Sie, dass es daran liegt, Doktor?«, fragte er den angeblichen Dr. Kendrick neugierig. Dabei ließ er den echten keine Sekunde aus den Augen. Offenbar hielt er ihn für einen gefährlichen Irren und rechnete jede Sekunde mit einem Angriff.
»Glauben Sie mir«, sagte Kendrick. Er zwang sich zur Ruhe und wiederholte seine Geschichte. »Ich bin der einzig wirkliche Dr. Kendrick«, schloss er.
»Natürlich«, sagte der angebliche Arzt. »Regen Sie sich nicht unnötig auf.« Er öffnete die Tasche und zog eine Spritze auf. Dabei warf er dem Aufseher einen Blick zu, der Bände sprach. »Ich werde Ihnen jetzt ein Beruhigungsmittel geben, und dann ...«
Kendrick wich zurück. »Bleiben Sie mir mit der Spritze vom Leib.« Verzweifelt suchte er nach einer Fluchtmöglichkeit.
»Keine Angst, ich habe nicht vor, Sie zu ermorden«, erwiderte der falsche Dr. Kendrick.
Kendrick hob die Fäuste zur Abwehr.
»Dann nicht.« Der falsche Arzt zuckte resigniert mit den Achseln. Er wirkte keineswegs unsympathisch und spielte seine Rolle ausgezeichnet. »Niemand will Sie hier zu etwas zwingen.«
»Gehen Sie zum Teufel«, schnauzte Kendrick. »Ich will hier raus.«
»Tut mir leid«, sagte der Aufseher. »Aber wenn Sie Hunger haben, bringe ich Ihnen gern etwas zum Abendessen.«
»Danke. Unter solchen Umständen vergeht einem der Appetit. Was haben Sie mit mir vor? Wir sind unter uns, also reden Sie Klartext. Sie brauchen sich nicht zu verstellen.«
»Ich weiß nicht, was Sie meinen«, entgegnete der Aufseher zögernd. »Ich habe nichts damit zu tun. Der Bezirksrichter wird morgen über Ihren Fall entscheiden.«
»Über meinen Fall?« Kendrick warf einen flehentlichen Blick zum Himmel. Nur ruhig, sagte er sich. »Wie spät ist es jetzt?«
»Warum fragen Sie?« Der Aufseher deutete auf seinen Arm. »Sie haben doch selbst eine Uhr!«