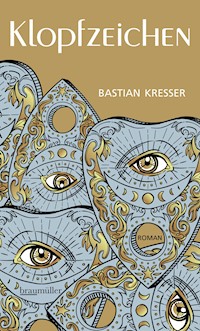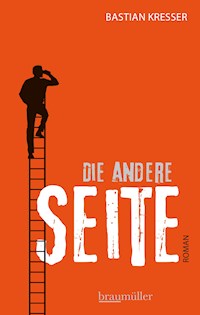22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Braumüller Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Berliner Manager Marc Steiner belegt nach einem Burnout einen Messerschmiedekurs im Spreewald beim verschlossenen, zugleich charismatischen Niels Bergmann. Dort lernt er nicht nur das Schmieden, sondern auch Niels' Reich kennen – eine Welt nach eigenen Regeln. Zwischen den beiden entsteht eine unerwartete Freundschaft, und bald wird Marc Teil dieses abgeschotteten Kosmos – mit meterhohem Zaun, Bunker und rätselhaften Besuchern. Als Marc die Journalistin Nina kennenlernt und ihr Niels vorstellt, wird sie jedoch sofort misstrauisch: Mit diesem Mann stimmt etwas nicht. Sie beginnt zu recherchieren – die vermeintliche Idylle kippt und plötzlich steht alles auf dem Spiel. Was als handwerkliches Retreat begann, wird zur existenziellen Auseinandersetzung mit Wahrheit, Manipulation und moralischen Grenzen. "Verformung" ist ein vielschichtiger Gegenwartsroman über Selbstverlust und Neuanfang, Kontrolle und Hingabe – intensiv, atmosphärisch und voller Spannung. "Wunderbar zum Lesen und filmisch zu träumen. Verformung hinterlässt tiefe Spuren und man wird animiert, seinen eigenen Film zu gestalten." Robert Dornhelm, Regisseur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 415
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
I
II
III
IV
Impressum
Für Eva Maria
I
Würde man Niels Bergmanns Hof im beschaulichen Spreewald aus der Luftperspektive betrachten – etwa mit einer Drohne, wie es viele Neugierige in den Tagen und Wochen nach dem Vorfall getan haben –, den meisten würde vermutlich gar nichts Besonderes auffallen. Vielleicht, dass Niels Bergmanns Grundstück abgelegener und vor allem deutlich größer ist als das der anderen Ansässigen. Das ist jedoch nicht überraschend. In diesem trostlosen Ort im Osten Deutschlands gibt es im Gegensatz zu so vielen anderen Spreewälder Ortschaften, die seit dem Mauerfall den Tourismus für sich entdeckt haben oder sich als perfekte Wochenendresidenz für die Berliner High Society inszenieren, keinen Reichtum, keine Wellnesstempel oder riesige, dekadente Anwesen. Wer in diesem Dorf wohnt, hat es sich nicht ausgesucht. Jeder zieht vor seiner Geburt ein Los und die, die hier geboren werden, haben eine Niete erwischt. Pech gehabt. Naturschutzgebiet, sorbische Gastfreundschaft, Kulturlandschaft und köstliche Spreewälder Gurken hin oder her.
Wer Niels Bergmanns Grundstück mit einer Drohne von oben ins Visier nimmt, wird vermutlich bemerken, dass es auf diesem Grundstück aufgeräumter ist als auf anderen. Keine vertrockneten Hecken, kein vergilbter Aufstellpool – alles wirkt, als gehöre es genau dorthin. Was kein Zufall ist.
In der Mitte des Grundstücks steht das Hauptgebäude, ein ehemaliger Bauernhof, umgebaut, ausgebaut, hergerichtet. Beinahe das gesamte Dach ist mit schwarz glänzenden Photovoltaikpanelen bedeckt. Rechts anliegend an das Hauptgebäude befinden sich die Werkstatt und die Schmiede. Daneben stehen zwei große metallene Tanks – Gas und Diesel – und hinter dem Haus ein weiterer Propangastank.
Etwas versetzt vor der Garage sieht man zwei kleine, seltsam geformte, schwarze Objekte. Nur bei genauerem Hinsehen, beziehungsweise wenn man mit der Drohnenkamera heranzoomt, erkennt man, dass es sich dabei um zwei stählerne Ambosse handelt. Ein etwas befremdlicher und nicht gerade zeitgenössischer Anblick, der jedoch Sinn ergibt, wenn man Niels Bergmann etwas besser kennengelernt oder bei ihm einen Schmiedekurs besucht hat. Das ganze Grundstück ist umgeben von einem vier Meter hohen, blickdichten Zaun mit Überwachungskameras, Bewegungssensoren und einem elektronischen Rolltor.
In den Tagen und Wochen vor Niels Bergmanns Festnahme öffnete und schloss sich dieses Tor regelmäßig. Immer wieder kamen Autos. Die meisten mit Kennzeichen aus dem Osten, einige aus anderen Teilen Deutschlands. Es ertönte ein Klingelton, das Tor öffnete sich. Die Besucher parkten vor dem Haus, Niels Bergmann trat heraus, begrüßte sie – stets wortkarg, manchmal mit einem Kopfnicken, selten mit einem Handschlag, noch seltener mit einer Umarmung – und führte sie anschließend ins Haus. Mal blieben sie eine Viertelstunde, mal stundenlang. Dann verließen sie den Hof wieder, ebenso wortlos, wie sie gekommen waren.
Vermutlich steht vor dem Haus auch der riesige amerikanische Pick-up-Truck mit der übergroßen Ladefläche. Er parkte vor Niels Bergmanns Festnahme fast immer dort, da dieser das Grundstück nicht oft verlassen hatte. Nun, da er sich in Untersuchungshaft befindet, wird man den Truck bestimmt wieder dort abgestellt haben. Weil er dorthin gehört.
Mit man ist Marc Steiner gemeint, derjenige, der in den Monaten vor dem Leichenfund am meisten Kontakt mit Niels Bergmann hatte, den man beinahe täglich auf dessen Grundstück antraf und den die wenigen Ansässigen, die sich überreden ließen, mit Vertretern der Medien zu sprechen, als wohl engsten Freund von Bergmann bezeichnet haben. Und das, obwohl dieser Marc Steiner ein Studierter aus Berlin ist – und dazu auch noch Österreicher.
Es ist schwierig, sich Marc hinter dem Steuer dieses Ungetüms vorzustellen. Er ist es zwar gewohnt, große Autos zu fahren – sein Audi A6 mit knapp fünf Metern Länge ist ein stattliches Fahrzeug –, doch im Vergleich zu Niels Bergmanns Dodge Pick-up-Truck wirkt Marc Steiners A6 nahezu wie ein Spielzeugauto. Allgemein fällt es einem schwer, sich jemanden wie Marc in einer Umgebung wie dieser vorzustellen. Ganz besonders, wenn man ihm einige Monate zuvor über den Weg gelaufen wäre. Damals ein gutaussehender, gepflegter, leicht übergewichtiger, beruflich erfolgreicher Marketing-Manager, der auch in der Freizeit Hemd und Sakko trug, neunzig Prozent seiner Zeit im Büro verbrachte, gern Serien auf Netflix schaute, alle paar Monate ins Kino und noch seltener ins Theater ging und der seit der Mittelschule keine Werkstatt mehr betreten hatte. Ein Mann, der, da er eine Wohnung ohne Garten besitzt, nicht einmal kleine Gartenarbeiten erledigen musste und dem Dreck unter den Fingernägeln fremd war. Das letzte Mal, als Marc ein Werkzeug in der Hand hielt – das war noch bevor er Niels Bergmann kennenlernte und sich sein Leben wie auch seine Einstellung zu körperlicher Arbeit veränderten –, war vor neun Jahren, als er die Reifen seines Autos wechseln wollte und sich dann, als er unsicher war, an welcher Stelle er den Wagenheber ansetzen sollte, dafür entschied, diese Arbeit besser von einem Mechaniker erledigen zu lassen. Seine Hände kannten nur Tastatur und Maus. Realistische Gefahren in seinem Leben waren nicht Verbrennungen oder Schnittverletzungen, sondern eine Sehnenscheidenentzündung am Handgelenk – vom vielen Tippen. Seine Rückenschmerzen resultierten nicht von harter Arbeit, sondern vom langen Sitzen.
Nein, das ist unfair. Es gab auch vor seinem ersten Treffen mit Niels Bergmann eine Gelegenheit, bei der er seine handwerklichen Fähigkeiten unter Beweis stellen musste. Nämlich, nachdem Manuela und er sich getrennt hatten und er in seine Wohnung gezogen war. Zum ersten Mal seit Jahren war er gezwungen, Schraubenzieher, Zange, Inbusschlüssel und Bohrer in die Hand zu nehmen, Werkzeug, das er sich von seinem Freund Jonas ausgeliehen hatte, um das Nötigste zuerst in der alten Wohnung auseinander und dann in der neuen wieder zusammenzubauen. Das Nötigste waren damals ein Bett zum Schlafen, eine Couch, ein paar Schränke für seine Kleidung, ein Küchentisch und ein Fernsehregal. Jonas half ihm dabei. Doch sie schafften es nicht, alles an einem Tag fertig zu montieren, und Marc hat den Rest auf ein andermal verschoben. Noch immer stehen im ungenutzten Zimmer seiner Berliner Wohnung ungeöffnete IKEA-Kartons – seit Monaten. Wann sich das ändern wird, ist ungewiss.
***
Vier Monate bevor Marc Niels Bergmann kennenlernt, den er in seinem Kopf und später auch in seinen Erzählungen seinen Schmied oder seinen Meister nennt, befindet er sich in einer Lebensphase, vor der er sich insgeheim gefürchtet hat, seitdem er nach Berlin gezogen ist. Er ist in einer Stadt, die nicht seine ist, fünfzig, allein, Single würde man sagen, wenn er einige Jahre jünger wäre – nun trifft es einsam vermutlich besser – und muss noch einmal von ganz vorne beginnen.
Er hat es kommen sehen, wollte es lange nicht wahrhaben – dann nahm alles wie von selbst seinen Lauf. Die Streitigkeiten mit Manuela häuften sich, seine Laune wie auch ihre ständig am Tiefpunkt. Was früher von selbst ging, musste plötzlich erzwungen werden. Die Leichtigkeit – er mag dieses Wort nicht, mochte es noch nie – weg.
Marc steht in seiner neuen Wohnung, betrachtet das Chaos um sich herum und fühlt: Nichts. Im selben Moment, in dem er sich dem trivialen Klischee dieses Wortes bewusst wird, korrigiert er sich: Was er empfindet, ist Leere. Oder Erschöpfung.
Beides sind nach wie vor Nebeneffekte seines Beinahe-Burnouts der vorangegangenen Monate – so nennt Marc diese Phase seines Lebens. Es war eine herausfordernde Zeit. Zuerst die Panikattacken, anfangs nur in der Nacht. Schwer atmend, keuchend, schweißgebadet wachte er auf, sein Herz hämmerte. Er brauchte jedes Mal geraume Zeit, um wieder zur Ruhe zu kommen. Dann, einige Wochen später, kamen die Attacken auch während des Tages. Herzklopfen vor Meetings, Schwindel während Präsentationen, zwei Mal dermaßen stark, dass er unterbrechen und sich setzen musste. In seiner freien Zeit: Schweißausbrüche und Engegefühl in der Brust beim Gedanken an die Arbeit. Er konsultierte einen Arzt. Seine stille Hoffnung: Vitamin- oder Eisenmangel. Nehmen Sie täglich dreimal eine von diesen Tabletten. In einigen Tagen ist alles wieder gut.
Leider war es anders. Die Diagnose: Sie sind gesund. In Österreich würde man sagen: Pumperlgsund. Der Berliner Arzt sagt nur: Gesund. Der Grund für den Schwindel und die Schweißausbrüche: psychisch. Alles nur im Kopf. Tabletten bekam er keine.
Etwas später kam erschwerend die lähmende Angst hinzu, Entscheidungen zu treffen, beziehungsweise die Furcht, eine dieser Entscheidungen könnte die falsche sein. Und das in einer Position, in der man ständig entscheidungsfähig sein muss, tagein, tagaus. Das Los eines gut bezahlten Managers.
Bald darauf folgte nahtlos die Schlaflosigkeit. Nächte, in denen er stundenlang wach in seinem Bett lag, die Augen geschlossen, doch geistig hellwach, in denen er stundenlang darauf wartete, endlich einzuschlafen, und in denen er dem regelmäßigen Atmen seiner Freundin – damals hatte er sie noch – lauschte und sie um ihren Schlaf beneidete.
Das Beinahe-Burnout hielt an, lange dominierten diese zehrenden Gefühle Marcs Leben, doch irgendwann wurde es wieder besser. Nicht so wie davor. Nicht gut, aber besser. Die Ängste, der Schwindel, das Gewicht auf seinem Nacken – nur noch Schatten von dem, was sie noch kurze Zeit zuvor waren. Nur die Einschlafschwierigkeiten verschwanden nicht. Sie begleiten ihn, verfolgen ihn. Doch auch sie sind nicht mehr so intensiv und zehrend wie zuvor.
Marcs Diagnose: Erfolgreich unter dem Beinahe-Burnout durchgetaucht wie unter einer riesigen Welle.
Seine Freundin hingegen bezeichnete sein Beinahe-Burnout stets als vollwertiges Burnout. – Ex-Freundin, wird Marc nicht müde zu betonen. Er akzentuiert das Präfix, als hinge sein Leben davon ab. Ex-Partnerin. Ex-Beziehung. Ehemalige Lebensgefährtin. Er schüttelt den Kopf. Alles Scheiße. Ex-Frau wäre besser. Das hat Substanz. Doch dafür hätten sie heiraten müssen. Aber das wollte er nicht, und sie auch nicht. Keine Kinder, keine Hochzeit. Marc denkt: Vielleicht wollte sie sich die Option offenhalten, jederzeit gehen zu können. Vielleicht war auch er derjenige, der das wollte. Wer weiß. Dann die Trennung und jetzt: Ex-Freundin. Das klingt wie bei zwei Sechzehnjährigen, die ein paar Wochen zusammen waren und sich danach wieder getrennt haben. Aber was soll’s. – Marcs Ex-Freundin hat sogar eine Liste gemacht. Drei Wochen vor der Trennung hatte sie ihm diese dann vorgelesen – all seine Symptome, fein säuberlich notiert: Schlaflosigkeit, Schwindel, Rückenschmerzen, Zynismus. Alles aufgelistet. Als wäre er ein Fall, kein Mensch.
„Du hast dich zurückgezogen“, sagt Marc zu niemandem, während er in seiner neuenWohnung steht, die er eigentlich nicht so nennen will, weil man sich in seinem Alter nicht mehr neu einrichten will. Sie ist bedeutend kleiner als seine alte – in der jedoch auch zwei Personen gelebt haben. Nicht aufgrund der fehlenden finanziellen Mittel. Geld hat Marc genug. Keine Kinder, acht Jahre lang ein gutes, danach weitere zehn Jahre ein sehr gutes und schließlich sechs Jahre lang ein hervorragendes Einkommen, einen Firmenwagen, keine (teuren) Hobbys. Er hat sich für diese Behausung entschieden, da er nicht lange suchen wollte, und sie alles hat, was er braucht.
Marc steht im leeren Wohnzimmer und fragt sich, wie es so weit kommen konnte. Wer sich zuerst von wem entfernt hatte – es spielt keine Rolle. Am Ende waren sie allein. Jeder für sich.
Von Manuelas Freunden hörte er bald nichts mehr. Auch die Männer, mit denen er sich gut verstanden hatte, schwiegen. Sie hatten sich, so wie es sich gehörte, loyal für eine Seite entschieden. Obwohl es schmerzte, nahm Marc es ihnen nicht übel. Er hätte dasselbe getan.
Als der Umzug bevorstand, trennte sich endgültig die Spreu vom Weizen und übrig blieben Jonas und Sonja – ein Paar, das Marc vor einigen Jahren bei einer Firmenfeier besser kennengelernt hat – ohne Manuela, ohne ihre Hilfe. Seine Freunde, nicht ihre. Die anderen darf sie behalten. Jonas und Sonja gehören ihm.
Die beiden stammen aus Ulm, sind seit sechzehn Jahren verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Sonja ist Architektin und Jonas arbeitet ebenfalls für Siemens. Nicht in der Marketingabteilung wie Marc – zum Glück, ansonsten wäre die Chance sehr hoch gewesen, dass Jonas für Marc gearbeitet hätte, was wiederum eine Freundschaft unmöglich gemacht hätte – sondern als Systementwickler.
Als Marc und Manuela sich trennen, sind die beiden für ihn da. Beim Umzug, beim Zusammenbauen der Möbel, mit gemeinsamen Spaziergängen und Kaffee und Kuchen.
Zuerst das Beinahe-Burnout, dann die Trennung, dann der Umzug und daraufhin vier Monate sowohl beruflicher als auch privater Limbus, in denen Marc nun versucht, sich mit seinem neuen Leben anzufreunden, sich auf sein Sabbatical vorbereitet, Arbeit und Aufgaben verteilt, sein Team und die Partner instruiert und versucht, das Positive an dieser einmaligen Gelegenheit zu erkennen.
Es gelingt ihm nur sehr schwer.
Falsch.
Es gelingt ihm nicht.
Und dann, neun Tage nach seinem fünfzigsten Geburtstag – gefeiert im Büro mit Kuchen und Sekt, fünfzehn Minuten lang, gemeinsam mit seinem Team, das sich geistig schon von ihm verabschiedet hatte – beginnt Marcs Sabbatical. Er hat eine saubere Übergabe gemacht. All seine Mails werden automatisch weitergeleitet, sein Firmenhandy liegt ausgeschaltet in der Schublade seines Bürotisches. Sieben Monate ohne Arbeit, ohne berufliche Mails, ohne Telefonanrufe und ohne Verpflichtungen. Sieben Monate für sich selbst.
Es ist der erste April. Sein nächster Arbeitstag wird am ersten November sein.
Ist es der ideale Zeitpunkt? Nein. Definitiv nicht. Als er sich vor zwei Jahren entschieden hat, eine siebenmonatige Auszeit zu nehmen, bestand die Grundidee darin, diese freie Zeit als wohlverdiente Belohnung zu nutzen. Eine Prämie für mehr als ein Vierteljahrhundert harte Arbeit, in denen Marcs Privatleben, seine Beziehungen als auch er selbst nur zu oft zu kurz gekommen sind. In seiner Vorstellung verbrachte er die freie Zeit spazierend, lesend, reisend. Tagsüber für sich, meditativ, intrinsisch, morgens und abends und an den Wochenenden gemeinsam mit Manuela. Er hat sich ausgemalt, eventuell eine längere gemeinsame Reise in einem Land südlich des Äquators zu machen. Südamerika, vielleicht sogar Australien. Das wäre der Plan gewesen. Wie er sich nicht gesehen hat: allein und ausgebrannt in einer ihm fremden Wohnung.
In seinem nun verwaisten Büro bei Siemens hängt ein Spruch auf der weißen Pinnwand hinter seinem Schreibtisch, ausgedruckt, ausgeschnitten und mit einem kleinen Magneten an der Wand befestigt: Die Kunst, Pläne zu machen, besteht darin, den Schwierigkeiten ihrer Ausführung zuvorzukommen. – Luc de Clapiers.
Wenn sein Sabbatical zu Ende ist, wird dieses Stück Papier im Müll landen, geht es Marc durch den Kopf.
Allein sind die Tage länger als zu zweit. Das hat Marc auch schon vor Beginn des Sabbaticals herausgefunden. Manuela und er trennten sich und es schien, als hätten die Tage plötzlich nicht mehr vierundzwanzig, sondern dreißig Stunden. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte er zumindest die Arbeit, die ihn ablenkte. Nun, da er nichts zu tun hat, keine Verpflichtungen, keine Meetings, keine Termine, ziehen sich die freien Tage wie Kaugummi. Längst hat sich sowohl der Körper als auch der Geist über die vielen Jahre hinweg an das frühe Weckerläuten gewöhnt. Ausschlafen lässt er einen vielleicht am Sonntag, bis neun. Aber an jedem anderen Morgen, als kenne auch Marcs tiefstes Inneres den genauen Wochentag, erwacht er spätestens um viertel vor sieben. Es ist auch lächerlich. Was hat er denn erwartet? Von fünfzig Wochenstunden auf null. Morgens allein. Tagsüber für sich. Und abends ungestört.
„Großartig“, sagt Marc. „Das ist großartig.“
***
Die erste freie Woche: Große Pläne. Zeit für sich selbst. Eine Möglichkeit, Berlin endlich richtig kennenzulernen. Seine Wahlheimat seit zehn Jahren, die er bewohnt und immer noch nicht kennt. Die Stadt, die Manuela ausgesucht hat, in die er ihr gefolgt ist. Die anfangs wie ein größeres Wien gewirkt, sich aber bald als etwas völlig anderes entpuppt hat. Die Stadt, die ihm imponiert, deren aufwühlende Geschichte allgegenwärtig ist, auf die er stolz ist und die ihm regelmäßig Angst einflößt. Die Berliner sind anders als die Wiener – und auch anders als er. Derber, manchmal. Lustiger, oft. Härter, immer. Er hat sich auch nach zehn Jahren nicht an alles gewöhnt, was diese Stadt ihm entgegenschmeißt.
„Spielst du mit dem Gedanken, zurück nach Wien zu gehen?“, fragte ihn Jonas, als es mit Manuela vorbei war.
„Nein“, gab Marc als Antwort. „Kommt nicht in Frage.“
In Wahrheit war diese Idee eine Zeit lang omnipräsent. Es hätte ihm eine gewisse Sicherheit zurückgegeben. Doch letzten Endes hat er sich dagegen entschieden, da es einer Kapitulation gleichgekommen wäre. Nein, Marc will nicht, dass andere Entscheidungen für ihn treffen. So glaubt er zumindest. Bald wird er, ohne es zu merken, diese Meinung revidieren.
So wacht er am ersten Tag seines Sabbaticals um Viertel vor sieben auf, macht sich einen Kaffee und fasst den Entschluss, diese freie Zeit mit etwas zu beginnen, auf das er stolz sein kann. Er geht in sein altes Fitnesscenter, das sich in der Nähe seiner ehemaligen Wohnung befindet. Manuela ist ebenfalls umgezogen, und doch ist er ständig auf den unangenehmen Moment gefasst, ihr auf der Straße zu begegnen. Es passiert nicht. Als er das Fitnessstudio betritt, erwartet er, dass er der einzige Besucher sein wird, muss jedoch feststellen, dass es nur so von Fitnessbegeisterten wimmelt. Eine halbe Stunde lang rennt er auf dem Laufband, wirft immer wieder einen nervösen Blick über seine Schulter und fragt sich, wie die vielen Menschen es sich leisten können, an einem Montagvormittag nicht bei der Arbeit, sondern hier zu sein. Nach dem Laufband versucht er sich an einigen Yogaübungen, gibt jedoch bald auf – er fühlt sich beobachtet und fehl am Platz.
Eineinhalb Stunden später ist er wieder in seiner Wohnung. Er schaut eine Zeit lang Frühstücksfernsehen – er kann sich nicht erinnern, wann er das zum letzten Mal getan hat –, spielt mit dem Gedanken, einen Spaziergang zu machen, verwirft ihn aber, als es zu nieseln beginnt. Er überfliegt die Nachrichten und saugt schließlich seine Wohnung. Die nächsten zwei Tage liegt er viel auf der Couch, spielt mit dem Smartphone, zwingt sich regelmäßig dazu, nicht an die Arbeit zu denken – sein Mantra: Alles ist in Ordnung. Er hat eine saubere Übergabe gemacht und die Firma läuft auch ohne ihn. Er überlegt, was er schon immer einmal machen wollte, für das er aber bisher nie Zeit und Muße gehabt hat.
In einem Anflug von Motivation fasst er den Entschluss, in den kommenden Wochen und Monaten jeden Tag einen kleinen Ausflug zu unternehmen, auf Entdeckungsreise zu gehen und Ecken von Berlin kennenzulernen, die ihm noch fremd sind. Er will die Stadt erkunden, macht sich auf den Weg – kehrt jedoch bald wieder um, da es zu regnen beginnt. Der Tag endet auf der Couch.
Am nächsten Morgen macht er sich einen Kaffee to go und startet seine Entdeckungsreise.
Mit der S-Bahn fährt er zum Bahnhof Grunewald, um dem Teufelsberg, einer ehemaligen Abhöranlage der US-Streitkräfte, einen Besuch abzustatten. Nachdem er bei der Station angekommen ist, muss er eine knappe halbe Stunde lang durch Wald und Weinberge gehen und erreicht schließlich die inzwischen verfallene und über und über mit Graffiti besprühte Anlage. Natürlich ist er auch hier, wie nirgendwo in dieser Stadt, nicht allein. Überall Touristen, Sprayer, Influencer mit Selfie-Sticks.
Die Sonne steht hoch und brennt mit voller Kraft auf seinen Kopf. Er hätte eine Kappe anziehen sollen, denkt er und merkt, dass er gar keine besitzt. Manuela hat ihm einst erklärt, dass Basecaps, da sie so eng aufliegen, schlecht für die Haare seien und Haarausfall begünstigen könnten. Seitdem trägt er keine Kappen mehr. Nun bereut er es.
Schwitzend wandert er über das Gelände, macht das eine oder andere Foto, ohne recht zu wissen, für wen er es tut. Nach einer Stunde macht er sich wieder auf den beschwerlichen Weg zurück. Zu Hause angekommen, stellt er sich unter die Dusche, bestellt eine Pizza und verbringt den restlichen Tag fernsehschauend auf der Couch. Vor dem Schlafengehen wirft er einen Blick auf sein Handy, denkt kurz an die Arbeit und spürt, wie sich eine innere Anspannung in ihm breitmacht. Um diesem Gefühl entgegenzuwirken, schaltet er das Smartphone über Nacht aus. Es hilft nur bedingt.
Am nächsten Tag ist es zu heiß für einen Ausflug. Am übernächsten ebenfalls.
Am ersten Wochenende seines Sabbaticals trifft sich Marc mit Jonas und Sonja. Eine Woche ohne Verpflichtungen ist vergangen, und er hat, außer seinem Ausflug zum Teufelsberg, nichts zu berichten.
„Ist dir langweilig?“, fragt Jonas.
Marc spielt die Wahrheit herunter. Er verschweigt, wie er tagelang seine Wohnung putzte, spielte, im Internet surfte. Und wie ihn die leeren Stunden fast in den Wahnsinn trieben.
„Ein bisschen vielleicht. Aber eher habe ich das Gefühl, dass die Zeit völlig schmucklos verrinnt. Kein Tick Tack, wie bei einer Uhr, sondern vielmehr ein Sanduhrrinnen. Der Sand fließt und fließt und irgendwann, ohne Ankündigung, werden sich plötzlich sämtliche Sandkörner in der unteren Hälfte befinden.“
Jonas verzieht gespielt entsetzt das Gesicht. „Und das macht dir nichts aus?“
Marc zuckt mit den Schultern.
„Hast du schon Pläne für die kommenden Wochen?“, klinkt sich Sonja ein.
Marc denkt nach, stellt sich vor, seine Wohnung endlich einzurichten, sie einrichten zu müssen, Entscheidungen zu treffen, was wo hingehört, allein die restlichen Möbel aufzubauen und dabei ständig daran zu denken, wie viel einfacher es zu zweit wäre – und spürt wieder einen leichten Anflug von Schwindel. Er schüttelt den Kopf.
Verschwörerisch werfen sich Sonja und Jonas einen Blick zu, Sonja nickt leicht, Jonas tut es ihr gleich. Er steht auf, geht in den Vorraum und kommt mit einem Kuvert in der Hand zurück.
Darin: ein Gutschein für einen sechstägigen Messerschmiedekurs. Marc weiß nicht recht, was er davon halten soll.
„Das wird dir helfen, ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen“, sagt Sonja. Marc versucht, ihr Gesicht zu lesen. Verständnis? Unterstützung? Mitleid? „Vincent, der Mann von Alexandra“, erklärt sie, „die kennst du, oder?“ Marc zuckt mit den Schultern. „Der hat jedenfalls einen Kurs bei diesem Schmied im Spreewald gemacht und hat tagelang davon geschwärmt.“
„Ich habe mir gedacht, das passt zu dir“, sagt Jonas. „Dieser Schmied ist anscheinend ein richtiges Unikat. Ein bisschen verschroben, aber offenbar besitzt er ein unfassbares Wissen über das Handwerk.“
Sonja schmunzelt. „Und über noch so einige andere Dinge. Frag ihn dann doch mal, was er von Politikern hält. Oder wie die Zukunft aussehen wird. Er hat wohl eine recht spannende Einstellung dazu.“
Marc blickt auf den Gutschein in seiner Hand.
„In diesen sechs Tagen schmiedet man zwei Messer“, erklärt Jonas. „Damaststahl. Das ist das mit den vielen verschiedenen Lagen.“ Er zückt sein Handy und zeigt ihm über die Google-Bildersuche einige Fotos. Klingen mit dramatischen, kontrastreichen Mustern. Wellen, Ringen, Blumen oder Linien, die sich über das polierte Metall ziehen. Marc kennt diese auffälligen Klingen und muss sich eingestehen, dass der Gedanke, mit eigenen Händen ein derartiges Messer zu schmieden, einen gewissen Reiz mit sich bringt. Doch schnell drängt sich ein Gedanke auf, gewaltsam, unangenehm, der ein Gefühl auslöst, das ab dem dreißigsten manchmal, ab dem vierzigsten öfter und ab dem fünfzigsten Lebensjahr ständig präsent war: Panik vor etwas Neuem. Er ist es gewohnt, das, was er tut, zu beherrschen. Er befindet sich in seiner Blase, traut sich manchmal Richtung Rand, doch begibt sich, wenn es nicht unbedingt notwendig ist, nicht aus seiner Komfortzone. Sich etwas völlig Neuem zu stellen, etwas, in dem er möglicherweise versagen könnte, das ist den Jungen vorbehalten. Viele über fünfzig vermeiden das gezielt.
„Kann ich das?“, fragt er und spürt eine Welle der Unsicherheit, ein Gefühl, dem er nun schon seit Jahren zwar unbewusst, aber doch gezielt aus dem Weg gegangen ist. Es ist lange her, dass er sich diese Frage gestellt hat. Stellen musste. In seinem Job ist er derjenige mit den Antworten. Er ist in seine Arbeit hineingewachsen, ist inzwischen dafür zuständig, andere zu führen, zu koordinieren, Probleme zu erkennen und – sollte er die Lösung nicht kennen – genau diese anderen zu beauftragen, die Lösung zu finden. Nun soll er, der keinerlei Erfahrung mit Maschinen, Stahl, Werkzeug oder handwerklicher Arbeit im Allgemeinen hat, ein Messer schmieden. „Ich glaube, ich kann das nicht“, sagt er und spürt, welche Macht diese Worte haben, wie tief sie in sein Selbstvertrauen einschneiden und wie oft ihn, seitdem ihn Manuela verlassen hat, genau diese Worte verfolgt haben. Der Selbstzweifel ist zu einem neuen Begleiter geworden. Jahrelang hat Marc vor Selbstbewusstsein gestrotzt. Nun weiß er nicht, wo diese Sicherheit geblieben ist. Vor langer Zeit hat er eine Tochter eines Bekannten die Worte äußern gehört – You suck at life – und sich damals köstlich darüber amüsiert. Jetzt kann er darüber nicht mehr lachen.
„Natürlich kannst du das“, sagt Jonas, der sich in einer Lebensphase befindet, die ihn nicht jeden Morgen mit einem Gefühl des Versagens aufwachen lässt. „Du hast ja einen Lehrer, der dir das zeigt. Und du bist ja auch nicht allein. Diese Kurse finden immer zu dritt oder zu viert statt.“ Marc atmet hörbar aus. „Ich habe heute mit dem Schmied telefoniert und übernächste Woche hätte er noch einen Slot frei“, sagt Jonas.
Ohne darüber nachzudenken, greift Marc nach seinem Telefon, um einen Blick in seinen Terminkalender zu werfen. Bevor er es überhaupt entsperrt, steckt er sein Smartphone sofort wieder ein. Er weiß, dass er Zeit hat, dass er, ohne es überprüfen zu müssen, zusagen kann und es mit Sicherheit zu keinen Terminkollisionen kommt – was sich völlig surreal anfühlt.
„Soll ich die Woche für dich buchen?“, fragt Jonas.
Marc lässt die letzten sechs Tage Revue passieren. Das Sabbatical sollte eine wertvolle Erfahrung sein. Bisher war es ausschließlich verschwendete Zeit.
Er nickt. Jonas und Sonja freuen sich.
„Die Schmiede ist vielleicht eine Stunde von hier“, sagt Sonja. „Nimm dir also am besten ein Zimmer im Spreewald. Wird dir guttun.“
„Mal sehen“, sagt Marc, blickt noch einmal auf den Gutschein und stellt sich vor, wie er in einer dreckigen Werkstatt steht, mit ungelenken Bewegungen auf ein glühendes Stück Metall drischt und dieser Schmied sich entweder über ihn lustig macht oder – noch schlimmer – ihm das Gefühl gibt, dass er von seiner Leistung – und letztendlich von Marc selbst – enttäuscht ist.
„Du wirst sehen“, unterbricht Jonas den negativen Gedankenstrudel. „Das ist genau das Richtige für dich.“
***
Zu Hause googelt Marc den Schmied und findet schnell seine Website. Professionell gemacht, übersichtlich aufgebaut, Fotos von verschiedenen Messern, der Werkstatt und auch ein Bild von ihm. Niels Bergmann. Gelernter Kfz-Mechaniker und seit mehr als fünfzehn Jahren Messerschmied. Vielleicht fünfzig, kantiges Gesicht, etwas eingefallene Wangen, wacher Blick, schwarze Hornbrille, kurz geschorenes Haar, Dreitagebart. Unscheinbar. Unauffällig.
Eine Woche lang bereitet sich Marc auf den Workshop vor. Endlich hat er wieder eine Aufgabe. Er macht sich mit der Materie vertraut. Er googelt die verschiedensten Messerarten, fertigt, wie er es in Lehrvideos gesehen hat, Schablonen an und klickt sich durch unzählige YouTube-Videos zu diesem Thema. Angefangen von Dokumentationen über japanische Traditionsschmieden bis zur Realityshow Forged in Fire – Wettkampf der Schmiede. Marc sieht sich Folge für Folge an.
Sein Vorhaben, jeden Tag einen Ausflug zu machen und seine Stadt besser kennenzulernen, hat er erst einmal auf die lange Bank geschoben. Er wird damit beginnen, wenn der Schmiedekurs vorbei ist. Stattdessen fährt er in den Baumarkt, kauft sich, wie auf der Webseite des Schmieds beschrieben, ein paar Lederhandschuhe, Ohrenstöpsel und eine Schutzbrille. Wieder zu Hause liegt er auf der Couch, trinkt Kaffee und Wasser, abends ein, zwei Flaschen Bier, schaut Forged in Fire und versucht, die Bewegungen, Begriffe und Abläufe geistig zu verinnerlichen. Er stellt sich vor, wie er verschwitzt und dreckig vor einem Amboss steht. Ein befremdlicher Gedanke.
Er hat sich entgegen Sonjas Rat kein Zimmer im Spreewald genommen, weil ihn der letzte Familienurlaub dort nachhaltig abgeschreckt hat und er kein Bedürfnis empfindet, mehr Zeit als nötig an diesem Ort zu verbringen.
Am Montagmorgen fährt er bereits um halb sieben los. Er kämpft sich durch den Berliner Frühverkehr. Auf der A13 Richtung Cottbus beschleunigt er, rast über die kerzengerade Autobahn, fährt eine Dreiviertelstunde später wieder ab und lässt sich von seinem Handy die längste Zeit über eine langweilige Landstraße lotsen. Nach und nach verändert sich die Landschaft. Nachdem er die Kleinstadt Lübben hinter sich gelassen hat, kommt lange nichts. Endlose Felder, dann wieder Wald, bis schließlich links und rechts die ersten Spreekanäle auftauchen. Seiner Wikipedia-Recherche zufolge gibt es insgesamt knapp dreihundert Kilometer an Flussläufen, die für kleine Boote und Kähne befahrbar sind. Als er keine zwei Minuten später eine Familie – Eltern und zwei Kinder – sieht, die in orangefarbenen Plastikkajaks über das Wasser gleiten, kehren Erinnerungen zurück: Sommer nach dem Mauerfall, Familienurlaub mit dem Wohnwagen. Zwei Wochen im Osten. Zwei Kinder, ein stickiger Innenraum, ständige Streitereien. Die Mückenplage. Noch heute trägt er zwei Narben.
Es war ein letzter und verzweifelter Versuch seiner Eltern, die Familienstruktur wiederherzustellen und die offensichtlichen Probleme irgendwie wieder zu kitten.
Es war der letzte Urlaub zu viert. Bald darauf: zuerst Trennung, dann Scheidung.
Er erinnert sich kaum an schöne Momente des gemeinsamen Urlaubs. Nur an die Enge, den miefigen Geruch, die langen Kanufahrten, die nichts retteten, sondern alles nur noch schlimmer machten. Damals verwandelte sich Freude in Ablehnung, Geborgenheit in Verlust. Seitdem: keine Bootsfahrt, keine Kanus, kein Spreewald. Bis heute.
Bei einer unscheinbaren Kreuzung biegt er links ab und fährt knapp zehn Minuten lang durch einen Wald, entlang einer einspurigen Straße, die sich in einem ausgesprochen schlechten Zustand befindet, bis sich schließlich der Wald lichtet und den Blick auf eine Ortschaft freigibt. Direkt nach dem Ortsschild steht ein leerstehendes ehemaliges Gasthaus, die Tür mit einem Brett vernagelt, einige der Scheiben eingeschlagen, der Rasen davor verwildert. Es folgen einfache, recht weit auseinanderstehende Häuser. Einige haben eine bunte Fassade, die meisten jedoch inzwischen blass und abgeblättert. Allein die im charakteristischen Fachwerkdesign gebauten Häuser verleihen dem Ort einen Hauch von Rustikalität.
Marc wirft einen Blick auf die Uhr. Es ist zehn vor acht. Das Dorf wirkt vollkommen ausgestorben. Keine Autos auf der Straße, keine Bewohner auf den Gehwegen oder in den Gärten, keine spielenden oder lärmenden Kinder. Er lässt die Fensterscheibe hinunter und vernimmt, außer dem Brummen des Motors, kein einziges Geräusch. Er durchquert die winzige Ortschaft und erreicht an deren Ende eine Schotterstraße.
Vor dem meterhohen, blickdichten Zaun mit dem wuchtigen Tor bleibt er stehen, parkt direkt davor und ist sich nicht ganz sicher, ob dies wirklich die richtige Adresse ist. Er bemerkt, dass sein Handy keinen Empfang mehr hat. Willkommen im Spreewald. Er steigt aus und drückt die Klingel, die neben dem Tor befestigt ist. Kurz darauf öffnet sich das Tor. Als es sich wenig später hinter ihm schließt, hat er einen Moment lang das Gefühl, eingesperrt zu sein.
Vor dem Haus stehen zwei dunkle Ambosse, schwarz, massiv. Marc hat noch nie einen in echt gesehen. Sie wirken wie Relikte aus längst vergangenen Tagen. Er steigt aus dem Wagen und schaut sich um. Aus der Haustür tritt ein Mann, zündet sich im Gehen eine Zigarette an, bleibt stehen, verschränkt die Arme. Kein Lächeln. Kein Nicken. Nur ein prüfender Blick. Marc lächelt, so gut es eben geht, versucht, Haltung zu bewahren. Er ist es gewohnt, in der Hierarchie weit oben zu stehen, derjenige zu sein, der die anderen beäugt, bewertet, evaluiert. Hier, in diesem abgelegenen Kaff im Spreewald, auf diesem seltsamen Gelände, das wie ein Gefängnis von einem meterhohen Zaun umgeben ist, ist es anders. Er passt nicht hierher, weiß nicht einmal, ob er mitbringt, was für die kommenden Tage notwendig sein wird. Er ist ein Fremdkörper und fühlt sich – hilflos, verloren, unsicher.
Der Mann – Niels Bergmann – geht auf ihn zu, langsame Schritte, der Kies knirscht unter seinen Füßen. Marc kommt es vor, als würde er eine weiße Wand betrachten. Dann öffnet sich Niels Bergmanns Gesicht, sein Blick wird freundlich, seine Mundwinkel ziehen nach oben.
„Alles gut“, sagt er beruhigend, streckt ihm die Hand entgegen. Marc schüttelt sie dankbar. „Ist nicht deine Welt, nicht wahr?“ Marcs Unsicherheit lässt ihn schweigen. Niels klopft ihm freundschaftlich auf die Schulter. „Wird schon“, sagt er und stößt ein raues Lachen hervor. „Lass uns an die Arbeit gehen, dann wird’s besser.“
***
„Am Anfang warst du wie ein Reh“, sagt Niels. Das ist schon etwas später. Marc ist inzwischen ein Teil dieser Welt geworden.
Niels’ Stimme ist nicht mehr die vom ersten Tag. An jenem Morgen war sie beruhigend, unterstützend, da Marc es gebraucht hat. Nun ist Niels er selbst.
„Blödsinn“, antwortet Marc, wirft einen Blick in den Schmiedeofen und zieht sich die dicken Lederhandschuhe über. „War ich nicht.“
Auch seine Stimme ist nicht mehr die vom ersten Tag. Er hat es inzwischen geschafft, er selbst zu sein. Oder zumindest eine Version, die besser an diesen Ort passt.
„Hilflos warst du und ängstlich“, sagt Niels Bergmann. „So wie alle, die hierherkommen und noch nie in ihrem Leben einen Hammer in der Hand gehalten haben.“ Niels grinst – man sieht ihm an, was er von den vielen Bürohengsten hält, die über die Jahre hinweg in seiner Werkstatt gearbeitet haben.
Beinahe alle lobten den Workshop, beschrieben ihn als lebensveränderndes Ereignis, verfassten eine positive Bewertung – und kamen nie wieder. „War nicht ihre Welt“, sagt Niels – er mag diesen Begriff und zündet sich eine Zigarette an.
„Ist auch nicht meine“, antwortet Marc selbstbewusst und greift nach der Schmiedezange.
Niels lehnt sich zurück und beobachtet die Bewegungen seines Schülers.
„Inzwischen schon, irgendwie“, sagt er und grinst kurz.
Marc nickt zustimmend, bevor er mit der Zange in die Esse fährt und das glühende Stück Stahl herausholt. Er platziert es auf dem schwarzen Amboss, stellt sich im richtigen Winkel auf, holt aus und lässt den schweren Hammer auf das Metall sausen. Das satte Geräusch von Stahl auf Stahl. Marc kann sich wie immer ein Lächeln nicht verkneifen. Er schlägt erneut zu. Und noch einmal. Das Material beginnt, sich zu verformen.
„Du musst mit dem Stahl und nicht gegen ihn arbeiten“, hat ihm der Schmied erklärt. Das war noch ganz am Anfang. Als Marc noch Angst vor der Hitze, dem Feuer, dem glühenden Stahl und der Verletzungsgefahr hatte. Als Niels Bergmanns Werkstatt und seine bloße Anwesenheit ihn noch nervös gemacht haben. Damals hat er den spirituellen Aspekt in dieser Arbeit, in diesem Ort, in dieser von Niels Bergmann erschaffenen Welt noch nicht erkannt. Bald darauf hat sich das verändert. „Du musst versuchen, mit und nicht gegen den Stahl zu arbeiten. Wenn du die Klinge an einer Stelle dünner klopfst, wandert das Material und wird woanders dicker oder länger. Es ist eine Kooperation mit dem Stahl, verstehst du? Teamwork.“
Damals hat Marc nur genickt. Inzwischen versteht er. Es entsteht eine Beziehung zwischen dem Schmied und dem Material, die mehr ist als bloße körperliche Arbeit. Die Tätigkeit selbst sieht aus wie rohe Gewalt, doch man muss sich konzentrieren, etwas von sich hergeben, Feingefühl und vor allem Geduld mitbringen. Letzteres ist eine Eigenschaft, die er beinahe schon verlernt hatte.
Wieder schlägt Marc mit dem Hammer zu. Rot und gelb glühende Funken fliegen in alle Richtungen, die meisten prallen von seiner Lederschürze – die eigentlich Niels Bergmanns Schürze ist – ab. Ein Zunderstück landet auf seinem bloßen Schienbein und brennt sich in seine Haut. Marc spürt den Schmerz – und lässt ihn zu. Er weiß, in wenigen Sekunden wird er wieder verschwunden sein. Es ist eine unveränderliche Tatsache, und dieses Wissen gibt ihm Sicherheit.
In seinen Ohren dröhnt es, seine linke Hand, die nach wie vor mit der Zange fest das Werkstück ergreift, beginnt zu krampfen, und der Bizeps des rechten Arms schmerzt vom Gewicht des Hammers.
In Marcs Kopf: Glücksgefühle, Euphorie. Die Kombination aus körperlicher Anstrengung, Kreativität, Monotonie und einem klar ersichtlichen Ergebnis lässt in bestimmten Teilen seines Gehirns Unmengen an Serotonin ausschütten. Die Arbeit ist eine wunderbar archaische Tätigkeit, grob, rau, hart und gleichzeitig komplex und präzise. Ehrlich, geht es Marc durch den Kopf. Ehrlicher als all das, was er bisher in seinem Leben getan hat.
Einen Moment lang denkt er an seinen Beruf, den er seit Jahren nur noch Job nennt. An ein Leben zwischen Agenturbriefings, Kaffeeküchen und PowerPoint-Präsentationen. Marketing ist Lügen, Übertreibung, Schönrednerei. Nicht die Wahrheit, nicht einmal ihre Umrisse. Wer etwas anderes glaubt, hat sich selbst davon überzeugt.
Marc ist gut in seinem Beruf. Besser als viele andere. Früher hat es ihm Freude bereitet, in den letzten Monaten war von seiner Begeisterung nichts mehr zu spüren. Jede neue Aufgabe war ihm eine Belastung geworden, jede Entscheidung ein zusätzliches Gewicht auf seinen Schultern.
„Das reicht“, sagt Niels schließlich und deutet mit dem Kinn auf die Drahtbürste. Nun sagt der Schmied, was zu tun ist. Marc tut es. Und zum ersten Mal seit Jahren ist das genug. Er legt den Hammer zur Seite, nimmt die Bürste, zieht mit routinierten Bewegungen den schwarzen Zunder von der werdenden Klinge, schiebt den Isolierstein zur Seite und legt das inzwischen dunkelrote Stück Stahl zurück in den Ofen.
Er weiß, was zu tun ist, kennt die einzelnen Arbeitsschritte – und sollte er etwas nicht wissen, kann ihm nichts passieren. Der Schmied gibt ihm eine Sicherheit, die er zuvor nicht kannte.
***
Als Marc Niels Bergmann kennenlernt, denkt er sich bei all dem nichts. Der Zaun ist nur ein Zaun. Verdammt hoch zwar und etwas eigenartig. Aber das ist seine Sache.
Der Schmied nimmt ihn in Empfang und führt ihn an den zwei freistehenden Ambossen vorbei zur Werkstatt. Im Vorübergehen fährt Marc mit der flachen Hand über die glatte, kühle Oberfläche.
Im vorderen Teil der Werkstatt befindet sich der Bereich, der für Autoreparaturen benutzt wird. Eine Zwei-Säulen-Hebebühne, eine Vielzahl an Werkzeugen, deren Funktion Marc kaum erahnen kann, daneben ein fein sortiertes Regal mit Schrauben, Muttern, Dichtungen. Der Boden ist voller Ölflecken und Spuren vergangener Reparaturen. Es riecht nach Motoröl und Gummi. Niels Bergmann ist gelernter Kfz-Mechaniker. Lange war dies sein Hauptberuf, erzählt er, doch inzwischen laufen die Schmiedeworkshops so gut, dass er, was seine Mechanikertätigkeit betrifft, nur noch Aufträge seiner Stammkundschaft annimmt.
„Wie viele Kurse gibst du?“, fragt Marc.
„Verschieden“, antwortet Niels. „Manchmal in der Woche einen. Manchmal länger keinen. Kommt darauf an.“
„Auf was?“ Niels geht nicht darauf ein und zuckt mit den Schultern. „Und was sind das für Menschen?“
Niels blickt ihn einen Moment lang fragend an und findet direkt die Antwort auf seine Frage in Marcs Gesicht.
„Du meinst, ob sie Vorkenntnisse mitbringen?“ Ernst blickt er Marc ins Gesicht. „Die meisten ja. Viele haben eine Metallerausbildung, beinahe alle haben bereits langjährige Erfahrung mit Messerschmieden.“ Bevor Marc sich die Frage stellen kann, wie er seine inzwischen kaum aushaltbare Unsicherheit am besten vor Niels Bergmann verstecken kann, schüttelt dieser grinsend den Kopf. „Natürlich nicht! Das sind fast immer Bürohengste wie du, die zum ersten Mal was mit den Händen machen. Manchmal haben sie einen Gutschein geschenkt bekommen, manchmal ist es eine Teambuilding-Veranstaltung. Mir ist das alles egal. Zu mir kann jeder kommen.“
Sie begeben sich in den hinteren und geräumigen Teil der Werkstatt. Der Geruch wie auch die Stimmung sind plötzlich eine andere. Die Kfz-Werkstatt wirkt wie ein typischer Arbeitsplatz. Die Schmiede hingegen strahlt eine weitaus ruhigere und geradezu meditative Aura aus. Es herrscht eine perfekte Ordnung, alles, was sich in diesem Raum befindet, hat seinen festen Platz, der Fußboden als auch die Arbeitsflächen sind derartig sauber, dass man wortwörtlich davon essen könnte. Statt des öligen Geruchs liegt nun etwas Rauchiges, Metallisches in der Luft. Natürlicher als im vorderen Teil der Werkstatt. An der Wand steht eine mehrere Meter lange Werkbank, über der zahlreiche Werkzeuge hängen. Zangen in allen Größen, Feilen, eine Messerlehre, Gewindeschneider und ein Dutzend Schleifbänder. Auf der Arbeitsfläche liegen bereits fein säuberlich vorbereitet mehrere lange, dünne Stahlplatten und eine große Metallschere. Im Raum verteilt stehen zwei riesige Schleifmaschinen, eine Bandsäge, zwei Schweißgeräte und noch etwas weiter hinten als definiertes Zentrum des Raums ein massiver, stählerner Amboss, größer und wuchtiger als die beiden vor der Werkstatt. Nicht weit davon entfernt befindet sich die Esse und ein monströser, blauer Lufthammer. Marc kann nur einen Bruchteil der Maschinen und Werkzeuge benennen, die Teil dieser Schmiedewerkstatt sind.
Während sie durch die unglaublich aufgeräumte Werkstatt gehen und Niels die Funktion der einzelnen Werkzeuge und Maschinen erklärt, ärgert sich Marc darüber, keinen Notizblock bei sich zu haben. Er fragt sich, wie er wohl auf den erfahrenen Schmied wirkt, erwischt sich dabei, wie er durch regelmäßiges Nicken, kurze Kommentare und hochgezogene Augenbrauen den Eindruck erwecken will, vollkommen bei der Sache zu sein, und hat dadurch gleichzeitig Schwierigkeiten, dem Gesagten zu folgen. Er fühlt sich wie ein Anfänger. Was, wenn er sich an etwas, das ihm der Schmied gerade erklärt, später nicht mehr erinnert, wenn er etwas falsch versteht oder – noch schlimmer – wenn er bei jeder Kleinigkeit nachfragen muss – etwas, das er selbst nicht ausstehen kann? Was wenn er Fehler begeht, eine Maschine kaputt macht, sich verletzt oder das Werkstück beschädigt?
Er sucht in Niels Bergmanns Gesicht nach Anzeichen, was dieser von ihm denkt, doch er findet nichts. Sein Gegenüber spricht ruhig, sachlich und schaut Marc nur sehr selten an. Im Gegensatz zu ihm ist sein Fokus ausschließlich auf die kommende Arbeit ausgerichtet.
Im hintersten Teil der Werkstatt befindet sich ein kleines Büro, durch das man über eine Treppe in den oberen Stock des anliegenden Hauses gelangt. Ein alter Schreibtisch, darauf eine Kaffeemaschine, ein Telefon, ein Bildschirm, Papierkram. An den Wänden: Dutzende Messer in den verschiedensten Größen. Angefangen von einfachen und praktischen Küchenmessern bis hin zu riesigen Jagdmessern mit geschwungenen Klingen und prunkvoll verzierten Griffen. Marc bewundert die Werkstücke und fragt, ob alle von Niels stammen. „Selbstverständlich“, gibt dieser zurück. Marc nickt anerkennend. Niels scheint die wohlwollende Geste gar nicht zu bemerken. Entweder das oder sie ist ihm egal, geht es Marc durch den Kopf. Seine Meinung, sein Lob, seine Anerkennung bedeuten ihm nichts, da seine Meinung und letztendlich er selbst hier an diesem Ort keine Bedeutung haben.
Er sei ein Glückspilz, sagt Niels Bergmann, während Marc so tut, als würde er die Muster auf den Klingen betrachten und er sich in Wirklichkeit über seine unsichere und unsouveräne Art ärgert. Normalerweise gebe er diese Kurse immer für drei Teilnehmer gleichzeitig, erklärt ihm der Schmied, doch die anderen zwei seien in letzter Sekunde ausgefallen und hätten den Workshop auf September verschoben. „Jetzt hast du eine Woche lang einen Privatlehrer. Ist doch auch was.“
Marc ist sich nicht sicher, was er davon halten soll. Der Gedanke, dass Niels sich ausschließlich auf ihn konzentrieren wird, verunsichert ihn.
Einige Minuten lang erklärt Niels das Ziel der nächsten Tage und fasst in wenigen Worten die Arbeitsschritte zusammen: Stahlsorten kombinieren, ein Paket schweißen, erhitzen, auspressen, falten, härten, schleifen – am Ende entstehen zwei Messer mit Griff.
„Mehr ist das nicht“, sagt Niels Bergmann und klopft in die Hände. „Und jetzt lass uns endlich anfangen.“
Als hätte er einen Schalter umgelegt, ändert sich die Stimmung. Eben noch locker, wirkt Niels plötzlich ernst – beinahe militärisch. Marc ist irritiert, aber auch angesteckt. Sie stehen vor der Werkbank, Marc zeigt Niels die Schablonen, die er zu Hause angefertigt hat, und fragt, ob es möglich wäre, ein größeres Jagdmesser und danach ein Küchenmesser zu schmieden.
„Du fragst mich, ob du das darfst?“, fragt Niels Bergmann sichtlich irritiert. „Du kannst tun, was du willst.“ Marc blickt ihn etwas verunsichert an. „Willst du diese zwei Messer schmieden?“
„Ja“, antwortet Marc und versucht, Selbstsicherheit in seine Stimme zu legen.
„Hervorragend“, sagt Niels Bergmann und betrachtet die Schablonen etwas genauer. „Hier etwas länger und hier stimmt der Winkel noch nicht ganz, aber ansonsten sieht das sehr gut aus.“ Er blickt Marc ins Gesicht. „Du hast dich vorbereitet?“ Marc nickt. „Gute Arbeit. Das macht nicht jeder.“
Marc verspürt aufsteigenden Stolz in sich.
Niels Bergmann denkt einen Moment lang nach, kritzelt etwas auf einen Block und entscheidet dann, wie viele Lagen Stahl die Messer haben werden: einhundertachtundneunzig.
Niels rechnet kurz, notiert eine Kombination aus drei Stahlsorten – exakt zusammengestellt für Härte und Flexibilität. „Einhundertachtundneunzig Lagen“, sagt er. „Das gibt ein ordentliches Muster.“ Marc beobachtet fasziniert, wie präzise der Meister plant – als sei es das Selbstverständlichste der Welt. Niels Bergmann spricht schnell, aber präzise. Während seiner Ausführungen blickt er immer wieder in Marcs Gesicht und liest daraus ab, ob dieser ihm folgen kann oder nicht. Marc gelingt es ohne große Mühe. Wie sein Meister ist auch er vollkommen konzentriert.
„Verstanden?“, fragt Niels am Ende. Marc nickt.
Dann erhält er seine erste Aufgabe: Zuallererst müssen die dünnen Stahlplättchen abgemessen, eingezeichnet und dann händisch mit einer Handhebelschere zugeschnitten werden – eine mühsame und kraftraubende Arbeit, aufgrund derer Marc eine knappe Dreiviertelstunde lang an der Werkbank steht. Der Schmied verschwindet inzwischen in seinem Büro. Marc will sich keine Blöße geben, versucht, so präzise wie nur möglich zu arbeiten, zeichnet die Linien millimetergenau ein und konzentriert sich darauf, jeden Schnitt an exakt der richtigen Stelle zu setzen. Als er endlich fertig ist, streckt er sich und spürt ein Ziehen in seinem Rücken und in seinen Armen. Er ist es nicht gewohnt, so lange am gleichen Fleck zu stehen und die schwere Schere zu bedienen. Marc lässt sich jedoch nichts anmerken und präsentiert, als er mit dieser Aufgabe fertig ist, seinem Schmied das Endresultat: dreiunddreißig vollkommen gleich lang zugeschnittene Stahlplättchen. Niels kontrolliert nicht, ob Marc genau genug gearbeitet hat, sondern erklärt ihm ohne Umschweife, was als Nächstes ansteht. Die drei unterschiedlichen Sorten von Stahlplättchen müssen in einer genauen Reihenfolge übereinandergestapelt und dann an den Rändern verschweißt werden.
„Gib acht, dass die Reihenfolge stimmt, verstanden?“
„Verstanden“, antwortet Marc.
„Hast du schon einmal geschweißt?“
Marc muss schlucken. Er schüttelt den Kopf und spürt die Scham, die in ihm hochsteigt. Ein fünfzigjähriger Mann, der noch nie mit den Händen gearbeitet hat.
„Nein“, sagt er leise.
Der Schmied reagiert anders, als Marc es erwartet hat. Kein abschätzender Blick, kein herablassender Kommentar. Er winkt ihn zu sich und erklärt ihm völlig unaufgeregt die Handhabung eines Schweißgeräts, zeigt ihm die Funktion der Schweißbrille und betont, dass es wichtig ist, nicht länger an einer Stelle zu verweilen und die Schweißnaht möglichst gleichmäßig zu ziehen.
„Verstanden?“, fragt er, und als Marc etwas unsicher nickt, klopft er ihm freundschaftlich auf die Schulter. „Das schaffst du. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist.“ Er lässt ihn wieder allein und geht in sein kleines Büro im hinteren Teil der Werkstatt.
Marc putzt jedes Plättchen mit Aceton, stapelt sie in der vorgegebenen Reihenfolge, achtet darauf, dass sie perfekt aufeinanderliegen, fixiert das Paket mit einer Schraubzwinge und greift mit zitternden Händen zum Gerät. Wieder ist es ihm etwas peinlich, den Schmied als Unterstützung hinzuzurufen, doch als er seinen Namen sagt, tritt dieser mit einem freundlichen und motivierenden Lächeln auf den Lippen aus seinem Büro und klatscht in die Hände.
„Jetzt kommt was Spannendes“, sagt er, stellt sich leicht versetzt hinter Marc und zeigt ihm, wo er ansetzen soll.
Marc atmet tief ein, klappt die Maske herunter und setzt den ersten Schweißpunkt. Die kleine Explosion lässt ihn zusammenzucken. Noch ehe er sich dafür schämen kann, klopft ihm Niels auf die Schulter.
„Weitermachen.“ Marc atmet erneut tief ein und aus, führt den Stab wieder an das Metall, jetzt jedoch auf die Reaktion gefasst, und zieht eine gleichmäßige Schweißnaht über das Stahlpaket. Zufrieden betrachtet er sein Werk.
„Gut“, sagt Niels und zeigt Marc einen erhobenen Daumen. „Brauchst du noch meine Hilfe?“
Die Frage beinhaltet keine Wertung, keine Bevormundung. Der Schmied will seinem Schüler nicht das Gefühl geben, auf sich allein gestellt zu sein, und ihn gleichzeitig dazu motivieren, selbstständig zu arbeiten, damit er später auf den Prozess zurückblicken und ehrlich sagen kann, dass er das Messer völlig allein angefertigt hat.
„Ich komme klar“, antwortet Marc und überspielt dabei seine Selbstzweifel.
Niels nickt und zieht sich wieder zurück in sein Büro.
Wieder atmet Marc tief ein, klappt die Maske herunter und macht mit der Arbeit weiter. Anders als zuvor lässt er sich durch die kleine Explosion nicht verunsichern.
Nachdem er die restlichen Schweißnähte gesetzt hat, überreicht ihm Niels eine etwa einen halben Meter lange Stahlstange und gibt Marc die Anweisung, sie an das Paket zu schweißen. Inzwischen hat er keine Probleme mehr damit und es gelingt ihm sofort. Stolz begutachtet er das Resultat. Niels reagiert nicht darauf.
Er führt Marc zur Esse und erklärt, wie man das Gasgemisch einstellt und zündet. Marc platziert das Stahlpaket mittig in den glühenden Schmiedeofen. Nun heißt es warten – fast zwanzig Minuten, bis der Stahl auf Temperatur ist.
„Was machst du beruflich?“, fragt Niels.
„Eigentlich bei Siemens“, antwortet Marc. „Marketing.“
Niels pfeift verschwörerisch durch die Zähne. „Siemens. Eine heiße Firma“, sagt er und zündet sich eine Zigarette an.
„Wieso denn?“, fragt Marc etwas irritiert. Gerne wäre er auch Raucher. Dann würde er wissen, was er mit seinen Händen tun soll. Niels reagiert nicht auf Marcs Frage, sondern lächelt nur schmal.
„‚Eigentlich‘ Siemens“, wiederholt er seine Worte. „Was heißt ‚eigentlich‘? Hast du Urlaub?“
„Sabbatical. Sieben Monate“, antwortet Marc und spürt, wie er sich dafür schämt. Er hat nicht das Gefühl, dass er es verdient hat, derart lange frei zu haben.
Niels Bergmann mustert seinen Schüler einen Moment lang und nickt schließlich. „Hattest du nötig, oder?“ Marc senkt seinen Blick und fährt sich mit der Zunge über die Lippen. „Burnout?“ Marc nickt. „Das ist scheiße.“ In Niels Bergmanns Stimme liegt keine Vorsicht, keine Verurteilung, keine gespielte Anteilnahme oder Furcht vor diesem heiklen Thema. „Schlimm?“, fragt er und blickt Marc dabei in die Augen.
Marc ist von der offenen und unvoreingenommenen Art dieses fremden Mannes aus dem Konzept gebracht. Eine Minute zuvor hat er sich gefürchtet, eine falsche Frage zu stellen, und nun hat er plötzlich das Gefühl, dass sich dieser Mann, mit dem er scheinbar nichts gemein hat, für ihn interessiert, dass er ihn – anders als seine Mitarbeiter, sein Chef oder auch Jonas oder Sonja – vielleicht sogar verstehen könnte. Marc beginnt zu erzählen und Niels Bergmann hört zu, als würde es in diesem Moment niemand und nichts anderes geben.
Es ist lange her, dass er über seine Probleme sprechen konnte, ohne dabei in einen Strudel zu geraten, der ihn nach unten zieht und ihn noch mehr verunsichert. Dieses Mal ist etwas anders.
Ohne es geplant zu haben, öffnet Marc sich diesem fremden Mann. Er spricht über die Zeit vor eineinhalb Jahren, in der alles zu viel wurde, erwähnt die Schwindelattacken, die Angstzustände, die Tage, an denen er seine Wohnung nicht verlassen konnte. Niels nickt hier und da, rollt den Filter seiner glühenden Zigarette zwischen Daumen und Zeigefinger und blickt Marc immer wieder in die Augen.
„War die Arbeit das Einzige, was dich damals gestresst hat?“, hakt er irgendwann nach. Marc wundert sich über diese doch recht persönliche Frage. Jedem anderen hätte er