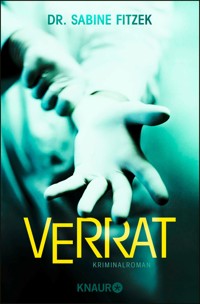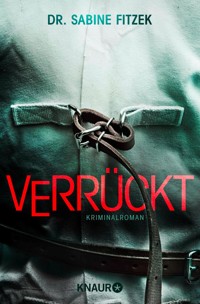9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kammowski ermittelt
- Sprache: Deutsch
Sterbehilfe – oder Mord? »Vergänglich« ist der 5. Medizin-Krimi von Sabine Fitzek, der mit Insider-Wissen und brisanten Einblicken in unser Gesundheitssystem punktet. Vom Mitarbeiter eines Pflegedienstes wird der Berliner Kommissar Kammowski zu einem Todesfall gerufen. Auf den ersten Blick sieht alles nach einer assistierten Selbsttötung mithilfe eines Schweizer Vereins für Sterbehilfe aus – der 72-jährige Theodor von Hausmann war unheilbar an ALS erkrankt und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Doch seine Tochter ist fassungslos: Ihr Vater wollte unbedingt, dass sie an seiner Seite ist, wenn er stirbt; ein Apartment am Meer war bereits gebucht. Auch einige weitere Indizien sprechen dafür, dass von Hausmann sich nicht selbst das Leben genommen hat. Aber wer würde einen Mann ermorden, der seinen eigenen Tod bereits geplant hat? Beunruhigend, emotional und hochspannend geht Sabine Fitzek im 5. Band ihrer Krimi-Reihe der Frage nach, wie anfällig für Missbrauch die Sterbehilfe ist – und wie dubiose »Heiler« mit der Gesundheit und den Gefühlen kranker Menschen spielen. Die Krimi-Reihe um Kommissar Kammowski aus Berlin ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Verrat - Verrückt - Verstorben - Vertuscht - Vergänglich
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 421
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Sabine Fitzek
Vergänglich
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Vom Mitarbeiter eines Pflegedienstes wird Kommissar Kammowski zu einem Todesfall gerufen. Auf den ersten Blick sieht alles nach einer assistierten Selbsttötung mithilfe eines Schweizer Vereins für Sterbehilfe aus – der 72-jährige Theodor von Hausmann war unheilbar an ALS erkrankt und hat einen Abschiedsbrief hinterlassen. Doch seine Tochter ist fassungslos: Ihr Vater wollte unbedingt, dass sie an seiner Seite ist, wenn er stirbt; ein Apartment am Meer war bereits gebucht. Auch andere Indizien sprechen dafür, dass von Hausmann sich nicht selbst das Leben genommen hat. Aber wer würde einen Mann ermorden, der seinen eigenen Tod bereits geplant hat?
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Zweiter Teil
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Kapitel 66
Kapitel 67
Kapitel 68
Kapitel 69
Kapitel 70
Kapitel 71
Kapitel 72
Kapitel 73
Kapitel 74
Kapitel 75
Kapitel 76
Kapitel 77
Kapitel 78
Kapitel 79
Nachwort, Juli 2023
Danksagung und persönliche Worte
Erster Teil
Kapitel 1
Was von selbst kommt …
Irgendetwas stimmte nicht mit seinem Fuß. Im letzten Moment gelang es Theodor, das Bein hochzureißen und so den Sturz zu verhindern. Aber er machte einige unkontrollierte Abfangschritte, die die Aufmerksamkeit von Passanten erregten. Schon wieder war er an einer kleinen Schwelle hängen geblieben. Einer lächerlich kleinen Schwelle: einem wenige Millimeter herausragenden Stein im Kopfsteinpflaster. Dass gleich drei Menschen zu Hilfe eilten, machte die Sache nicht besser. Er war doch kein alter Mann, dem man über die Straße helfen musste!
Theo war immer ein nüchterner Mensch gewesen. Einer, der sich nichts vormachte und eins und eins zusammenzählen konnte. Fakt war: Er musste sich neuerdings auf jeden Schritt konzentrieren, um nicht über die eigenen Zehen zu stolpern. Vor Jahren hatte er einmal einen Bandscheibenvorfall gehabt. Da war es ähnlich gewesen, aber damals hatte er furchtbare Schmerzen gehabt, hatte sich überhaupt nicht mehr rühren können, und die Schwäche des Fußes war erst vom Arzt festgestellt worden.
Schmerzen hatte er jetzt nicht. Dann konnte es wohl auch nichts Schlimmes sein! Am besten, man versuchte, es gar nicht zu beachten. Was von selbst kommt, geht auch von selbst wieder! Ein Standardspruch seines Vaters, mit dem er selbst bisher ebenfalls ganz gut gefahren war, wenn er auch sonst für die zackigen Sprüche des Alten nicht viel übriggehabt hatte. In der letzten Zeit musste er häufiger an ihn denken, obwohl er schon fast dreißig Jahre tot war. Sie hatten sich nie richtig ausgesöhnt. Nichts hatte er dem Vater recht machen können. Nur nicht so werden wie er, das hatte er sich von Kindheit an vorgenommen, aber wenn er heute in den Spiegel sah, sah ihm das scharfkantige, nicht hässliche, aber harte Gesicht seines Vaters entgegen, in das das Leben tiefe Furchen hineingegraben hatte, die nur von den warmen braunen Augen der Mutter und den Lachfältchen etwas gemildert wurden.
»Was ist denn heute mit dir los?«, unterbrach Nadja seine Gedanken etwas unwirsch. Sie hatte bereits mehrmals auf ihn warten müssen. Der samstägliche Einkaufsbummel war eines ihrer gemeinsamen Rituale geworden, der Höhepunkt von Nadjas Woche, eine ihrer Lieblingsbeschäftigungen, der sie mit großem Engagement und energischen Schritten nachging und auf die sie wegen des Lockdowns wochenlang hatte verzichten müssen. Endlich waren die Restaurants und Geschäfte wieder geöffnet – wenn auch mit nervigen Abstands- und Hygieneregeln – und sie wollte das nun ausgiebig zelebrieren.
Theodor liebte es, seine schöne Freundin glücklich zu sehen. Er gehörte nicht zu den Männern, die genervte Blicke auf die Uhr warfen, wenn ihre Frau zu lange in der Umkleidekabine verschwand. Er mochte es, ihre perfekte Figur in schönen Kleidern zu bewundern oder ihr von unpassenden abzuraten. Oft suchte er selbst die Kleiderständer der Boutiquen durch und machte ihr Vorschläge, wofür er in der Regel ein Lob der Verkäuferin ob seines guten Geschmacks einheimste und neidische Blicke anderer Kundinnen auf sich zog.
In der Regel begannen sie diese Tage am späten Vormittag mit Sekt und Kaviar in der »Fressmeile« des KaDeWe. Zum Einkaufen ging Nadja aber lieber in die Fachgeschäfte am Ku’damm. Im KaDeWe war es ihr zu voll, zu touristisch, »zu viele Russen«, was Theo immer zu einem Grinsen veranlasste. Schließlich war Nadja selbst Russin, wenngleich deutschstämmig und schon viele Jahre in Deutschland lebend.
»Wo willst du denn heute noch hin?«, fragte er. Normalerweise arbeiteten sie die gesamte Luxusmeile ab und ließen sich erst nach Stunden erschöpft, hungrig und mit Paketen bepackt in einem der Restaurants nieder. Und als er ihren erstaunten Blick sah, ergänzte er: »Wir könnten uns heute doch gleich ein Taxi zu Max Mara nehmen, was meinst du? Ich glaube, der Sekt hat mich etwas müde gemacht.«
»Das ist eine sehr gute Idee«, sagte Nadja freudig und hakte sich bei ihm unter. »Sollen wir warten, bis eines vorbeikommt, oder rufst du uns eins?«
Theo hatte das Handy schon in der Hand.
Kapitel 2
Die Einschläge kommen näher
Einige Wochen später saß Theodor im Wartezimmer eines Neurologen. Diesmal schien der Spruch seines Vaters sich nicht zu bewahrheiten. Die Schwäche im Fuß wollte einfach nicht abklingen. Theodor hatte sogar den Eindruck, dass sie etwas zugenommen hatte.
Während er sich die Wartezeit mit abgegriffenen Zeitschriften vertrieb, die ihn nicht interessierten, ging ihm allerhand durch den Kopf. Was, wenn er einen Schlaganfall hatte? Er war jetzt in dem Alter. Mit zweiundsiebzig musste man mit so was rechnen. Nicht wenige Bekannte oder ehemalige Kollegen hatte es schon erwischt, und keineswegs nur die, die sich gehen ließen, fett wurden, zu viel Alkohol tranken und nie Sport trieben. Sein langjähriger Tennispartner und Freund Gerd lag jetzt mit einer Lähmung in der Reha. Musste schlimm um ihn stehen. Theo hatte Claudia, Gerds Frau, angerufen und angeboten, ihn zu besuchen, aber sie hatte abgeraten. Gerd könne nicht sprechen, und Besuch quäle ihn nur. Außerdem seien Besuche in der Rehaklinik wegen Corona ohnehin schwierig bis unmöglich. Theo war erleichtert gewesen, Krankenbesuche waren nicht so seine Sache.
Und Gerd war nicht der Einzige: Ein Geschäftspartner, zu dem Theo nach dem Verkauf seiner Firma vier Jahre zuvor noch lockeren Kontakt gehalten hatte, war von einer Sekunde auf die andere im Fitnessstudio tot umgefallen. Herzinfarkt.
Tja, so war das in ihrem Alter, die Einschläge kamen näher. Aber eine Fußlähmung hatte in seinem Umfeld keiner gehabt. Jedenfalls nicht, soweit er wusste. Sicher war es nur ein eingeklemmter Nerv.
Theo sah sich in dem Wartezimmer um. Ein Sammelsurium abgeschabter Holz- und billiger Korbstühle war auf brüchigem PVC-Boden zu einem U angeordnet, dazwischen hier und da eine traurige Topfpflanze und ein Stehboard für Zeitschriften und Informationsbroschüren der Drogenberatungsstelle. Der selbst gebaut wirkende Anmeldetresen war vom Wartebereich durch eine dünne Stellwand nur notdürftig abgetrennt, sodass man zwangsläufig jedes Gespräch, das am Tresen geführt wurde, mitbekam.
Theos Blick fiel auf eines der Bilder an den Wänden. Vergilbte Drucke in zerkratzten Kunststoffwechselrahmen. Hinter eine der Kunststoffscheiben hatte sich – sicher schon vor Jahren – ein Insekt gedrängt und war dort verendet. Auf einmal hatte Theo ein Kloßgefühl im Hals. Die Stühle des Wartebereichs waren bereits alle besetzt, es kamen immer weitere Personen mit Wünschen in die Praxis und bildeten vor dem Tresen eine Schlange, die bereits bis in den Flur reichte. Eine aufgeheizte, aggressive Stimmung dampfte von ihr ab. Die Atmosphäre einer Bahnhofswartehalle, wo der Beamte gerade den einzigen Fahrkartenschalter schloss.
Obwohl die Praxis in einem Altbau lag und die Fenster weit offen standen, war es heiß. Nach einem kühlen und regnerischen Mai hatte der Juni mit sommerlichen Temperaturen überrascht. Die Praxis befand sich im ersten Stock und war nach Süden ausgerichtet, die hohen Fenster fingen die Sonne ungehindert ein. Es roch nach Mensch und nach aufdringlichem Parfüm. Ein Standventilator kämpfte vergebens gegen die Hitze an. Unentwegt klingelte das Telefon, was niemanden zu interessieren schien. Am Anmeldetresen stritt sich eine energische alte Dame mit der völlig entnervten medizinischen Fachangestellten darüber, ob sie denn nun einen Termin habe oder nicht. Außerdem sehe sie es nicht ein, eine Maske zu tragen. Darunter bekomme sie keine Luft, und schließlich habe sie eine medizinische Befreiung. Die Angestellte hinter dem Tresen redete ihrerseits auf die Frau ein und versuchte, ihr zu erklären, dass sie heute nicht drankommen könne, weil sie keinen Termin habe. Es könne zwar durchaus sein, dass der Irrtum auf ihrer Seite liege, sie machten ja auch einmal Fehler, das sei schließlich menschlich, aber das ändere nun einmal nichts daran, dass der Arzt für heute ausgelastet sei. Es seien schon andere Patienten mit dringenderen Problemen ohne Termin gekommen. Außerdem müsse sie jetzt sofort eine Maske aufsetzen, weil das wegen Corona nun mal Vorschrift sei.
»Niemals rechtfertigen, sofort deeskalieren«, ging Theo durch den Kopf. Einer der Grundsätze professioneller Kommunikation. Das Ganze hier machte keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Er war noch nie bei einem Neurologen gewesen. Sein Hausarzt hatte ihm mehrere genannt, aber die hatten alle keine kurzfristigen Termine gehabt, und so hatte er sich über das Internet selbst umgesehen und sich für den Erstbesten entschieden, der ihm einen Termin noch in derselben Woche angeboten hatte. Und nun saß er hier in Reinickendorf in dieser heruntergekommenen Praxis und wartete schon seit zwei Stunden. Ein Gefühl von Beklemmung packte ihn. In einem Anflug von Panik sprang er auf, warf der verdutzten Sprechstundenhilfe eine Entschuldigung zu und verließ fluchtartig das Haus.
Abends traf Theo sich mit seinem Freund Frank Möbius. Die beiden kannten sich schon seit vielen Jahren und sahen sich, wenn nichts dazwischenkam, immer am ersten Freitag des Monats zum Abendessen. Eine Männerrunde, zu der bis vor Kurzem auch Gerd Hoffmann gehört hatte.
»Das sieht nicht gut aus mit Gerd«, wusste Frank zu berichten. »Claudia ist mit den Nerven völlig runter. Ich habe heute mit ihr telefoniert. Sie hat erzählt, dass er bisher das rechte Bein nur ein ganz klein wenig bewegen kann. Der rechte Arm ist komplett gelähmt und wenn er was sagen will, kommen immer dieselben drei Wörter raus. Furchtbar! Die Ärzte sagen, es kann sich noch etwas bessern, aber der Alte wird er wohl nie mehr werden.«
Sie schwiegen betreten.
»Dabei ist er der Jüngste von uns dreien«, sagte Theo. Gerd war im vergangenen Sommer erst fünfundsechzig geworden, während Frank und er in diesem Jahr zweiundsiebzig wurden.
»Ja, irgendwann trifft es uns alle«, sagte Frank. »Bei dir alles in Ordnung?«
Theo erzählte, dass er sich wegen seines Fußes Sorgen machte. Dass der Hausarzt gesagt hatte, er müsse damit zu einem Neurologen. Er berichtete von seiner Termin-Odyssee und seiner Flucht aus der Praxis.
»Ich frage mal Mareike«, versprach Frank. Seine Frau Mareike war bis vor Kurzem als Ärztin tätig gewesen und hatte noch Kontakte. »Sicher kann sie dir einen Termin bei einem vernünftigen Arzt vermitteln. Und wie geht’s Nadja und den Kindern?«, wechselte er dann das Thema. Offenbar war ihm das Gespräch etwas zu krankheitslastig.
Theo zuckte die Achseln. »Nadja geht es gut, solange sie Geld ausgeben kann. Du kennst sie ja. Und an Geld mangelt es zum Glück nicht.« Er grinste. Dann wurde er wieder ernst. »Zu den Kindern habe ich kaum noch Kontakt. Wir telefonieren gelegentlich. Das ist alles.«
»Mensch, Theo, ich verstehe dich nicht. Du hast doch auch nur dieses eine Leben. Versuch doch, dich mit den Kindern auszusöhnen! Die haben es doch auch nicht leicht gehabt nach dem Tod ihrer Mutter.«
Theo hob eine Augenbraue. Das sah er ganz anders, aber er sagte nichts. Frank der Harmoniemensch. Das war er immer schon gewesen. Eigentlich ein Langweiler, der außer von seiner Arbeit nur von seiner Familie zu erzählen wusste. Manchmal fragte sich Theo, warum sie schon so lange befreundet waren. Eigentlich hatten sie nicht viel gemeinsam. Vielleicht war es gerade dieser Gegensatz, der sie füreinander anziehend machte. Die Möglichkeit, an dem, was sie selbst nicht repräsentierten, in den Geschichten des anderen teilhaben zu können, ohne es selbst ausleben zu müssen. Sich immer wieder sagen zu können: Wie gut, dass ich nicht so leben muss wie der …
Frank hatte das ganze Drama mit Ulrike mitbekommen. Ulrike, Theos erste Frau, die einzige, die er jemals geheiratet hatte, von der er sich bereits in jungen Jahren, als die Kinder noch klein waren, hatte scheiden lassen und die sich einige Jahre später das Leben genommen hatte. Da sah Theo bei sich selbst aber keinerlei Schuld. Ulrike war immer schon depressiv gewesen, das lag bei ihr in der Familie, die Mutter war genauso. Und genau das war ja einer der Gründe gewesen, warum er sich von ihr getrennt hatte. Er hatte es einfach nicht mehr ausgehalten. Sie waren so unterschiedlich gewesen, er voller Tatendrang und sie immer müde, ohne Interessen, ohne Ziele.
Die Kinder hatten dann einige Jahre bei den Eltern von Ulrike gelebt. Erstens hatten die es angeboten und gern gemacht, und zweitens: Wie hätte er das allein hinbekommen sollen? Er war damals gerade dabei gewesen, seinen Betrieb aufzubauen. Für Kinder hatte er einfach keine Zeit gehabt. Aber er hatte alles getan, damit es ihnen finanziell an nichts fehlte. Natürlich wusste er, dass Frank der Meinung war, das sei nicht genug gewesen, aber es war das, was er hatte ermöglichen können. Er hatte ihnen eine ordentliche Schulbildung und ein sorgenfreies Studium ermöglicht. Das war mehr, als er selbst jemals von seinem Vater bekommen hatte. Nachdem er sich geweigert hatte, in den Elektrobetrieb seines Vaters einzusteigen, und stattdessen studieren wollte, hatte sein Vater ihm jede finanzielle Unterstützung entzogen. Das ganze BWL-Studium hatte er sich selbst finanziert. Das war nicht einfach gewesen. Seinen Kindern dagegen hatte es an nichts gefehlt, dafür hatte er gesorgt. Und was hatten sie daraus gemacht? Nichts. Valentin hatte sein BWL-Studium abgebrochen, hatte sich als Restaurantbetreiber versucht, war mehrfach gescheitert. Zum großen Streit war es gekommen, als Valentin von ihm einen größeren Geldbetrag erbeten hatte, um seinen letzten Konkurs zu verhindern. Aber Theo investierte nicht in aussichtslose Projekte. Eben weil er genau das nicht tat, war er ja zu Geld gekommen.
Und Melanie, seine Tochter, hatte sich lange für gar keine Ausbildung oder ein Studium entscheiden können. Dann hatte sie einige Jahre angeblich Management studiert. Theo hatte das nicht ernst genommen. Seine doch eher phlegmatische Tochter sah er nicht in leitenden Positionen von Unternehmen. Und so hatte er sich gedacht, dass das ihre Methode gewesen war, ihm noch einige Jahre Geld aus der Tasche zu ziehen. Vermutlich war sie nicht einmal irgendwo eingeschrieben gewesen. Und bei den letzten Treffen war von einem Studium nicht mehr die Rede gewesen. Sie kam ganz nach der Mutter. Hielt sich mit seiner finanziellen Unterstützung und Gelegenheitsjobs über Wasser und ließ das Leben an sich vorbeiziehen, als sei sie eine unbeteiligte Zuschauerin am Wegesrand. Und die Typen, die sie zu den seltenen gemeinsamen Treffen anschleppte, waren seiner Meinung nach alle mehr als windig.
Nun, beide waren erwachsene Menschen, die selbst wissen mussten, was sie taten. Er fühlte sich ihnen jedenfalls nicht mehr verpflichtet.
Kapitel 3
Der beste Freund
Frank entschied sich trotz der späten Stunde, kein Taxi zu rufen, sondern die knappe halbe Stunde nach Hause zu laufen, obwohl Mareike sich sicher schon fragte, wo er blieb. Rasch schrieb er ihr eine Nachricht, dass er auf dem Heimweg sei.
Die Nacht war warm, fast wie im Hochsommer, die Luft dicht und prall gefüllt von den schweren Duftmolekülen der Lindenblüte. Frank mochte diesen süßlichen Geruch. Er liebte die Geräusche der nächtlichen Stadt, den Straßenverkehr, das gedämpfte Lachen der Menschen, die gut gelaunt in den Straßenkneipen ihr Leben genossen. Das Gespräch mit Theo war ihm sehr nahegegangen. Er konnte seinen Freund beim besten Willen nicht verstehen. Für ihn wäre es undenkbar gewesen, sich so mit seinen Kindern zu entzweien. Neben seiner Frau waren die Kinder für ihn immer das Wichtigste gewesen. Er war fassungslos angesichts der Härte, der Unversöhnlichkeit, die Theo an den Tag legte.
Mareike, die noch wach war, als er gegen Mitternacht nach Hause kam, pflichtete ihm bei.
»Ich verstehe ohnehin nicht, warum ausgerechnet dieser Mensch dein bester Freund ist. Denk doch nur einmal, wie er Ulrike damals behandelt hat. Er hat sie in den Tod getrieben, das ist jedenfalls meine Meinung.«
Frank widersprach. »Jetzt tust du ihm unrecht. Es stimmt schon, Ulrike hat sich im Stich gelassen gefühlt. Aber die Trennung ist damals von ihr ausgegangen. Nur, als sie dann vollzogen war, ist sie damit nicht klargekommen. Vielleicht wollte sie nur eine Drohkulisse aufbauen und hat nicht damit gerechnet, dass er sich sofort darauf einlässt. Jedenfalls hat sie nicht in ein Leben ohne Theo zurückgefunden. Ein Leben, in dem er noch eine große Karriere vor sich hatte und sie nichts mit sich anzufangen wusste. Ich bin aber überzeugt davon, dass es ihr, wenn sie Theo nie begegnet wäre, nicht anders ergangen wäre.«
»Du bist witzig, sie hatte die Kinder an der Backe und keinen Beruf, wie sollte sie da etwas aus ihrem Leben machen?«, empörte sich Mareike.
»Ja, aber sie hätte von ihm jede Unterstützung bekommen, die sie gebraucht hätte, um sich beruflich weiterzuentwickeln. Sie war zu träge, um etwas aus sich zu machen. Sie hat Theo sein Leben geneidet, und sie hat die Kinder gegen ihren Vater aufgebracht, hat so Dinge gesagt wie: ›Der lebt jetzt im Luxus, und wir haben nichts mehr.‹«
»War es denn nicht so?«
»Natürlich nicht. Sie hat bei der Scheidung ihren Anteil bekommen und die Kinder ihren Unterhalt. Kleinlich ist Theo nie gewesen. Außerdem: So richtig zu Geld ist er erst nach der Scheidung gekommen. Aber natürlich hatte sie nicht mehr dasselbe Leben wie zuvor. Sie hat selbst nie gearbeitet, hat nie einen Beruf gelernt und war einfach der Meinung, dass ihr Leben nach der Scheidung genauso weitergehen soll wie zuvor, nur ohne Theodor.«
»Der Fehler war, dass sie überhaupt geheiratet und zwei Kinder bekommen haben. Die hatten einfach nichts gemeinsam«, sagte Mareike.
Frank nickte, gab ihr einen Kuss und sagte: »Ich liebe dich, Mareike.«
Sie bedachte ihn mit einem Lächeln. »Schlaf gut«, sagte sie und knipste die Nachttischlampe aus.
»Du auch«, murmelte Frank und dachte einmal mehr, dass er um nichts in der Welt mit Theo hätte tauschen wollen.
Kapitel 4
Der Horcher an der Wand …
Gut gelaunt stürmte Toni die Treppe runter in die Küche. Sie hatte sich morgens in aller Frühe einen Milchkaffee ins Bett geholt und noch einige Stunden gelesen. Jetzt meldete sich der Hunger. Zu ihrer Überraschung traf sie beide Eltern noch in der Küche an.
Die Mutter war gerade dabei, den Frühstückstisch abzuräumen, während Franz, ihr Vater, bei einem letzten Kaffee sein »Verdauungszigarettchen« rauchte und in der Tageszeitung blätterte. Dass sie dem Vater um zehn noch am Frühstückstisch begegnete, war in den Frühjahrs- und Sommermonaten eine Seltenheit. Üblicherweise war er schon vor sechs auf den Beinen und kam erst zum Mittagessen, das bei Pichlmeiers immer um Punkt zwölf auf dem Tisch stand, wieder rein.
Auf dem Hopfenbauernhof, der sich mit seinen fünfzig Hektar Anbaufläche nun schon in der dritten Generation im Familienbesitz befand, gab es immer reichlich zu tun. Die Großeltern lebten zwar noch auf dem Hof, hatten aber ihre eigene kleine Wohnung im »Altenteil«. Nach einigen Grabenkämpfen am Anfang, als der Vater den Hof übernommen hatte, hielten sie sich aus dem Hauptgeschäft weitgehend heraus und kümmerten sich fast ausschließlich um den Gemüsegarten und ein bisschen Kleinvieh. Nur beim Hochbinden des Hopfens und bei der Ernte am Ende des Sommers half der Großvater immer noch. Da wurde jede Hand gebraucht.
Die Hauptarbeit und die Verantwortung lasteten nun auf Tonis Eltern, und sie stemmten die Arbeit mit einem Angestellten, dem Andi, und vielen Saisonkräften. Von denen kamen die meisten aus Polen, manche halfen schon seit vielen Jahren aus. Im Frühling, wenn der Hopfen innerhalb weniger Wochen hochgebunden werden musste, glich der Hof einem Taubenschlag, denn alle Helfer waren auch hier untergebracht und wurden in der Küche verköstigt. Privatsphäre hatte man da nicht mehr, aber Toni hatte diese Wochen im Frühjahr immer geliebt.
In diesem Jahr war es erstmals ruhiger gewesen. Die polnischen Helfer hatten wegen Corona nicht einreisen dürfen. Das waren für die Eltern angsterfüllte Tage gewesen. Wo sollte man die vielen Hände anderweitig herbekommen? Da hatte auch Toni mit rangemusst. Sie hatte gerade ihr Abitur in der Tasche gehabt, und die bunt zusammengewürfelte Gruppe, die Arbeit im Freien und die gemeinsamen Essen am Abend hatten ihr großen Spaß gemacht. Sie würde in den Hochphasen der Arbeit immer gern helfen, das war doch klar, aber den Betrieb einmal übernehmen? Nein, da hatte sie andere Pläne. Sie wusste, es war der sehnlichste Wunsch ihres Vaters, dass sie einmal seine Nachfolge antrat, am besten gemeinsam mit Andi, der ohnehin schon wie ein Sohn für ihn war. Aber weder wollte sie Hopfenbäuerin werden, noch wollte sie Andi heiraten. Das mussten sich die Eltern einfach aus dem Kopf schlagen!
Die Mutter, Maria, hatte Tonis fragenden Blick aufgefangen und erklärte: »Peronospora. Es gab einen Spritzaufruf der Bayerischen Landesanstalt für alle Sorten, die nach dem zehnten September geerntet werden.«
Und der Vater ergänzte: »Gestern war es zu windig zum Ausbringen. Da mussten der Andi und ich in der Nacht raus. Ist ein feiner Junge, der Andi. Was würde ich ohne den bloß machen? Bis zwei Uhr in der Nacht waren wir auf den Beinen.«
Peronospora, Mehltau, Spinnmilbenbefall, Hagelschaden, fehlende Saisonarbeiter … mit diesen landwirtschaftlichen Hiobsbotschaften war Toni aufgewachsen. Immer gab es neue Probleme. Kaum war das eine gelöst, stellte sich das nächste ein. Sie konnte sich an kein Jahr erinnern, in dem es keine Schwierigkeiten gegeben hatte. Und immer die kleinen, »unauffälligen« Hinweise des Vaters, die um die Vorzüge von Andi kreisten. Das nervte allmählich. Als sie vierzehn gewesen war, hatte sie sich tatsächlich einmal in den zwei Jahre älteren Andi, der damals beim Vater in der Lehre war, verliebt. Auf einem Ball der freiwilligen Feuerwehr, der er natürlich angehörte, hatten sie auch einmal geknutscht. Aber das war es dann auch. Sie hatten beide rasch erkannt, dass sie keine Seelenverwandten waren. Andi war wie ihr Vater, er interessierte sich ausschließlich für die Landwirtschaft. Mit ihm konnte man stundenlang über Vor- und Nachteile bestimmter Hopfensorten diskutieren, über falschen und echten Mehltau oder Obstbaumbeschneidung. Aber ein Buch hatte er zuletzt in der Schule gelesen, und die hatte er nach der zehnten Klasse verlassen. Er hatte auch nicht vor, je wieder ein Buch in die Hand zu nehmen. Sie waren gute Freunde, und Andi war ein wirklich netter Kerl, aber einfach nicht ihr Typ, und soweit sie wusste, umschwärmte er gerade ein Mädchen, das im Ort in einer Bäckerei arbeitete.
»Oma hat gefragt, ob du ihr heute im Garten helfen kannst, das Unkraut wuchert«, unterbrach Maria Tonis Gedanken.
»O nein, heute bitte keine Gartenarbeit«, entfuhr es Toni, die sich auf einen Nachmittag mit ihrem Buch in der Hängematte gefreut hatte. »Ich habe Ferien, und es ist heute doch viel zu heiß!« Sie wies auf das Küchenfenster, das einen Ausschnitt strahlend blauen Himmels mit kleinen weißen Farbklecksen zeigte. Der Sturm am Vorabend hatte alle Regenwolken verscheucht, und obwohl die Uhr noch lange nicht Mittag zeigte, war es schon heiß und die Regenfeuchte im Boden verdampfte zu einer drückenden Schwüle.
Die Mutter sah sie streng an. »Antonia, du hast keine Ferien. Du bist jetzt mehr als drei Monate aus der Schule. Du kannst nicht weiter in den Tag hineinleben, du musst deinen Beitrag leisten wie alle anderen auch. Auch du isst das Gemüse aus Omas Garten. Für sie ist es heute genauso heiß, und sie ist alt, du aber bist jung.« Energisch griff sie nach dem Trockenhandtuch und wandte sich dem Geschirr zu, das auf der Spüle abtropfte. Obwohl es im Haushalt eine Spülmaschine gab, spülte Maria das Geschirr vom Frühstück gern von Hand ab. Toni hatte ihr schon tausendmal erklärt, dass das teurer sei, als es in der Geschirrspülmaschine zu sammeln und diese nur anzustellen, wenn sie voll war.
Maria hatte ziemlich anklagend geklungen. Toni schaute ihre Mutter überrascht an. Von den beiden Eltern war Maria die Ausgeglichenere. Im Gegensatz zum Vater, der auch einmal wütend werden konnte, war die Mutter zwar streng, aber meist ruhig und verständnisvoll. Wieso warfen ihr alle auf einmal Faulheit vor? Monatelang hatte sie für ihr Abi gepaukt. Konnten die ihr jetzt nicht mal etwas Muße gönnen?
»Aber ich helfe doch«, sagte sie schließlich in Richtung der Mutter, die ihr immer noch den Rücken zuwandte. Sie überlegte und zählte dann auf: »Gestern habe ich zum Beispiel die Wäsche aufgehängt und beim Kartoffelschälen geholfen.«
Maria stöhnte.
Etwas müde sagte sie dann. »Toni, das wird nicht reichen. Davon kann man nicht leben. Du musst einen Beruf erlernen. Papa hat dir doch die Broschüren der Landbauschule hingelegt, im September fangen die Ausbildungen an. Ich habe mich erkundigt, noch gibt es freie Plätze …«
»Darüber wollte ich ohnehin mit euch sprechen.« Toni stockte, nahm schließlich ihren ganzen Mut zusammen und sagte: »Also … Ich habe mir das in den letzten Wochen gut überlegt. Ich will keinen landwirtschaftlichen Beruf, ich möchte studieren. Und ich möchte zum Studieren nach Berlin.« Nach kurzem Zögern fuhr sie trotzig fort: »Ich habe mich für das Wintersemester in Germanistik eingeschrieben.« Jetzt war es heraus. Sie hatte es extra so energisch formuliert, damit gar kein Zweifel mehr aufkam, dass dies eine endgültige Entscheidung war.
Ein lauter Knall ließ Toni und Maria zusammenschrecken. Der Vater, der weiter in seiner Zeitung geblättert und den Anschein erweckt hatte, als höre er dem Gespräch zwischen Mutter und Tochter nicht zu, schlug so heftig mit der Faust auf den Tisch, dass die Tassen klirrten und der Kaffee überschwappte.
»Herrgottsakra, da haben wir doch wohl auch noch ein Wort mitzureden.«
Mit dem Streit, der sich jetzt entspann, hatte Antonia gerechnet, schließlich kannte sie ihren jähzornigen Vater und ihre strenge Mutter. Aber die Unversöhnlichkeit und Härte erschreckten sie doch.
»Geh, wenn du gehen willst, aber glaub ja nicht, dass du zurückkommen kannst oder dass ich dir deine Spinnereien auch noch finanziere«, waren seine letzten Worte, bevor er die Küchentür hinter sich zuschlug und Toni und ihre Mutter allein zurückließ. Toni schaute Hilfe suchend zu Maria, aber die wich ihrem Blick aus, drehte sich wieder zur Spüle um und fing an, diese mit Nachdruck zu polieren.
Antonia ging weinend in ihr Zimmer und warf sich aufs Bett. Mit Widerstand hatte sie gerechnet, aber sie hatte doch auf Verständnis gehofft.
Nach einiger Zeit stand sie auf, trocknete sich die Tränen und packte den großen Rucksack, den sie vor zwei Jahren für einen Schulausflug angeschafft hatten. Denen würde sie es zeigen!
Zum Abitur hatte sie von den Eltern einen kleinen Wagen geschenkt bekommen. Hier auf dem Land war man ja ohne Auto aufgeschmissen. Sie simste einer Freundin in München, die zusagte, sie für einige Tage aufnehmen zu können. Diese Freundin hatte wiederum Freunde in Berlin, wo Antonia wahrscheinlich erst einmal unterschlüpfen konnte. Dann brauchte sie einen Job, eine Wohnung …
Aber einfach so am helllichten Tag abzurauschen, das wagte sie nun doch nicht. Ihrem Vater war alles zuzutrauen, auch dass er sie in ihrem Zimmer einschloss. Sie nahm sich vor, zu warten, bis die Eltern abends zu Bett gegangen waren.
Gegen zweiundzwanzig Uhr war es endlich so weit. Die Eltern schalteten den Fernseher aus und kamen nach oben in ihr Schlafzimmer; die alten hölzernen Stiegen ächzten unter ihren Schritten.
Toni wartete noch eine halbe Stunde, dann schlich sie sich am Elternschlafzimmer vorbei. Kurz horchte sie an der Tür. Die beiden schliefen noch nicht, sondern unterhielten sich.
»Da kannste nix machen«, sagte der Vater gerade, »ist eben nicht unser Blut. Wir hätten besser einen Jungen adoptieren sollen und nicht ein Mädchen.«
»Du weißt genau, dass es keinen Jungen gab«, erwiderte die Mutter.
Die Antwort des Vaters verhallte in einer Mischung aus Übelkeit und Hitze, die in Toni hochstieg und sie erstarren ließ.
Sie war adoptiert! Verdammt, das erklärte einiges! Deshalb hatte sie sich immer als anders, als nicht dazugehörend empfunden. Die hatten sie all die Jahre belogen!
Jetzt gab sie sich keine Mühe mehr, leise zu sein. Sie rannte die Treppe hinunter, riss ihre Jacke vom Garderobenständer, griff im Vorbeigehen nach den Turnschuhen, stürmte aus dem Haus, startete mit nackten Füßen den Motor ihres Opel Corsa und fuhr vom Hof. Im Rückspiegel sah sie die stämmige Gestalt ihrer Mutter reglos in der Eingangstür stehen.
Kapitel 5
Die Diagnose
Theodor sah die Ärztin ungläubig an. »Wollen Sie mir jetzt ernsthaft sagen, dass man da nichts machen kann?« Er hob eine Augenbraue und fixierte sein Gegenüber, ein Blick, von dem er wusste, dass er die meisten Menschen einschüchterte.
Dies war mittlerweile die fünfte von mehreren Ärzten und Ärztinnen verschiedenster Fachrichtungen, die er wegen »dieser Sache« konsultierte. Sich und anderen gegenüber sprach er nur noch von »dieser Sache«. Zusätzlich zu dem Schlappfuß hatte sich inzwischen noch eine Schwäche der rechten Hand eingestellt. Es fiel ihm schwer, Dosen aufzumachen, und selbst einfachste Tätigkeiten wie das Zuknöpfen seiner Hemden oder das Binden der Schnürsenkel wurden zur täglichen Herausforderung. Er sah sich schon beige Schuhe mit Klettverschluss kaufen, eine Vorstellung, bei der sich ihm die Nackenhaare aufstellten. Er war doch kein Rentner!
Obwohl er gesetzlich versichert war – dafür hatte er sich damals wegen der Kinder entschieden, weil das günstiger war, als wenn er alle privat versichert hätte –, ging er inzwischen nur noch als Selbstzahler zu Ärzten. Sonst bekam man ja gar keinen Termin.
Jedes Mal dasselbe Spiel: Sie hörten sich seine Geschichte fünf Minuten lang an, dann schlugen sie eine ganze Latte teurer Untersuchungen vor, die zum Teil schon mehrfach erfolgt waren, wollten ihn in ein Krankenhaus einweisen, was er entschieden ablehnte, und am Ende war er genauso schlau wie zuvor.
Zu dieser Ärztin hatte er eigentlich mehr Vertrauen gehabt als zu ihren Vorgängern. Die Praxis war geschmackvoll eingerichtet, nicht so überkandidelt wie manche Privatpraxen, aber auch nicht so heruntergewirtschaftet wie die erste, die er wegen der Sache aufgesucht hatte. Und die Ärztin war nicht so ein junges Huhn, sondern vielleicht Anfang fünfzig, hatte sich aber ganz gut gehalten. Sie hatte einen wachen und intelligenten Blick, und auf das routinierte Flirten, mit dem er jeder attraktiven Frau begegnete, hatte sie zumindest nicht unfreundlich reagiert.
Von dem Selbstzahlerkram halte sie nichts, hatte sie gesagt, wenn er gesetzlich versichert sei, dann sei das für sie in Ordnung. Auf seine Erklärung, aufs Geld komme es ihm nun wirklich nicht an, Hauptsache, sie könne ihm helfen, hatte sie gesagt: »Das wird sich zeigen«, und ihn angelächelt.
Sie hatte sich die Zeit genommen, sich alle seine Beschwerden genau beschreiben zu lassen und zu protokollieren, und ihn dann gründlich untersucht.
Schließlich war sie sehr ernst geworden, hatte gesagt, sie müsse sich die Ergebnisse aller Voruntersuchungen noch einmal in Ruhe anschauen und einige elektrophysiologische Untersuchungen vornehmen, er müsse noch einmal wiederkommen.
Und nun saß er ihr wieder gegenüber und erhielt seine Diagnose. Zumindest einen »hochgradigen Verdacht«, wie sie sich ausdrückte. Nur war das eine Erkrankung, die er nicht haben wollte. Von der er sich auch nicht ernsthaft vorstellen konnte, dass er sie hatte. So viel Pech konnte man doch nicht haben, oder? Er war doch bisher immer gesund gewesen, hatte sich mit viel Sport fit gehalten! Zwar hatte er nicht ganz auf Fleisch verzichtet, aber er hatte sich doch einigermaßen gesund ernährt. Und nun das. Amyotrophe Lateralsklerose. Das konnte ja niemand aussprechen, deshalb sagten alle wohl auch ALS dazu. Theo hatte schon einmal davon gehört. Er las regelmäßig die Sportnachrichten. Wenn er sich richtig erinnerte, war einige Jahre zuvor ein Fußballspieler vom VfL Wolfsburg daran gestorben, das war noch ein ganz junger Kerl gewesen.
Die Ärztin sagte, der Verlauf der Erkrankung sei von Fall zu Fall unterschiedlich, es könnten wenige Monate sein oder auch viele Jahre. Nur heilbar sei sie leider nicht, und immer schreite sie voran. Es gebe zwar ein zugelassenes Medikament, doch das könne den Verlauf wohl nur sehr wenig beeinflussen.
»Wie lange habe ich noch?«, fuhr Theo die Ärztin unerwartet heftig an.
Sie hielt seinem Blick stand und sagte: »Das kann ich nicht vorhersagen. Im Durchschnitt hat man nach der Diagnose noch zweieinhalb Jahre, aber es gibt eben immer wieder auch Ausnahmen. Sie haben sicher von dem Physiker Stephen Hawking gehört?«
»Stephen Hawking?«, fragte Theo entsetzt. »Das war doch dieser Krüppel, oder?«
Die Ärztin sah ihn regungslos an. Dann seufzte sie und erwiderte: »Nun, ich würde sagen, in erster Linie war er ein berühmter Physiker, der mit dieser Erkrankung viele Jahrzehnte gelebt hat.«
Theo machte eine abwehrende Handbewegung und schwieg.
Natürlich war das der Krüppel. Wollte sie ihm jetzt eine Moralpredigt halten, weil er das Kind beim Namen nannte? Nein, das konnte einfach nicht sein. Zweieinhalb Jahre? Er war doch erst zweiundsiebzig! Die Ärztin musste sich irren. Er sprang auf. Er würde jetzt erst einmal einen richtigen Fachmann hinzuziehen. Wer wusste schon, wo die hier ihr Examen gemacht hatte! Die hatte auf ihrem Praxisschild ja nicht einmal einen Doktortitel stehen.
Kapitel 6
Berliner Wohnungsnot
Es war gar nicht so einfach gewesen, in Berlin einen Job und eine Unterkunft zu finden, und Tonis Ersparnisse gingen mit schwindelerregender Geschwindigkeit zur Neige. Zwar war sie bei den Freunden ihrer Freundin Lea untergeschlüpft, aber die verlangten auch einen Mietanteil von ihr. Viele Studenten »verdienten« sich etwas dazu, indem sie in den Semesterferien, wenn sie zu Hause bei den Eltern waren, ihr Zimmer untervermieteten. Die Berliner Wohnungsknappheit machte es möglich.
Ursprünglich hatte Toni auf eine Anstellung in einer Bar oder einer Kneipe spekuliert. Sie hatte in den Schulferien häufiger in Biergärten gejobbt. Aber nach Corona waren viele Restaurants und Clubs pleitegegangen, es gab kaum noch Touristen in Berlin, die gesamte Gastronomie lag am Boden. Schließlich hatte sie in einem Corona-Testzentrum Arbeit gefunden. Das wurde gar nicht schlecht bezahlt. Doch auch die Wohnungssuche erwies sich als sehr viel schwieriger, als sie gedacht hatte. Die Studentin, deren Zimmer sie gerade nutzte, würde Ende September wiederkommen, bis dahin musste sie etwas gefunden haben.
Am vergangenen Wochenende hatte sie immerhin vier Vorstellungen in Wohngemeinschaften gehabt – was schon ziemlich gut war, denn viele WGs meldeten sich auf ihre Anfrage gar nicht –, letztlich hatten sie sich aber alle für andere Kandidaten entschieden.
Toni war inzwischen regelrecht eingeschüchtert. Diese Vorstellungsrunden waren schlimmer als Vorstellungsgespräche für den Traumjob. Eine WG hatte allen Ernstes in ihrem Fragenkatalog zur Bewerbung gefragt, ob sie bereit sei, zum Probeputzen vorbeizukommen. Die Wohnungsgeber hatten sie von oben bis unten gemustert, ihre Klamotten kommentiert und ein regelrechtes Kreuzverhör veranstaltet: »Na, dann erzähl mal, was bringst du denn Besonderes mit? Warum sollten wir uns ausgerechnet für dich entscheiden?«
Toni war vor Angst erstarrt und hatte kein Wort mehr herausbekommen. Der Typ, den sie mit ihr vorgeladen hatten, war da bedeutend schlagfertiger gewesen. Er hatte seine Gitarre dabeigehabt und gleich mal ein Stück zum Besten gegeben – natürlich spielte er gnadenlos gut –, und er hatte angeboten, jedem, der Lust darauf hätte, kostenlos Unterricht zu erteilen. Außerdem arbeitete er gelegentlich im Tier, einem angesagten Club in Neukölln. Nun ja, die WG hatte ihr abgesagt.
Als Antonia nun im vierten Stock eines unscheinbaren Hauses in der Bellermannstraße im tiefsten Wedding klingelte, machte sie sich nicht mehr viel Hoffnung. Die junge Frau, die ihr öffnete, schien wenige Jahre älter zu sein als sie, vielleicht Mitte zwanzig, machte aber einen ganz netten Eindruck. Sie stellte sich als Charlotte vor und bat sie, die Maske aufzulassen. Sie selbst trug auch eine FFP2-Maske. Sie führte Toni in ein großes Gemeinschaftszimmer, das auch als Esszimmer genutzt wurde, denn die Küche war winzig und musste ohne Tisch auskommen.
In dieser WG wohnten offenbar nur Medizinstudenten. Die anderen zwei, Malte und Lizzy, kamen zehn Minuten später hinzu, und keiner fragte sie nach besonderen Fähigkeiten oder Vergünstigungen. Den dreien war es das Wichtigste, dass Toni die Miete regelmäßig zahlte und versprach, nicht dauernd Party zu machen. Sie wollten jemanden, der oder die auch studierte, sie nicht beim Lernen störte, keine Probleme mit dem Putzplan für Küche und Bad hatte und sich am gemeinschaftlichen Kochen beteiligte, was nach Möglichkeit einmal pro Woche stattfinden sollte. Natürlich nur, wenn nicht gerade Prüfungszeit war. Jetzt, in den ausgehenden Sommermonaten, das neue Semester begann ja erst im Oktober, waren sie mit Praktika im Krankenhaus oder Jobs beschäftigt; Malte wollte auch noch einen kurzen Urlaub machen. Sie würden alle nicht oft zu Hause sein, sich also nicht groß um sie kümmern können. Toni beteuerte rasch, das sei für sie kein Problem.
»Bist du zum ersten Mal von zu Hause weg?«, fragte Lizzy noch einmal zweifelnd nach.
Toni nickte. »Ja, aber das ist wirklich in Ordnung, ich habe ja Freunde in Berlin. Die, bei denen ich jetzt wohne. Da ist es nur auf Dauer zu eng.«
Das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Mit den Leuten aus der WG, in der sie im Moment noch wohnte, hatte sie kaum ein Wort gewechselt, und auch sonst kannte sie noch niemanden in der Stadt. In Wahrheit hatte sie sich noch nie im Leben so einsam gefühlt und es gab Tage, da schwankten ihre Gedanken zwischen »Alles hinschmeißen und nach Hause gehen« und »Sich lieber gleich das Leben nehmen«. Aber Charlotte, Malte und Lizzy reichte die kleine Notlüge glücklicherweise, sie fragten nicht weiter nach.
»Also dann, Toni«, sagte Malte, »auf gutes Zusammenwohnen«, und schob ihr einen Untermietvertrag und einen Kugelschreiber über den Tisch.
»Echt jetzt? Ihr lasst mich einziehen?« Toni konnte ihr Glück nicht fassen. Das Zimmer war zwar sehr klein und nicht sehr hell, weil es nur ein Fenster zum Hinterhof hatte, aber das war ihr egal. Sie hatte ohnehin weder Möbel noch Geld, sich welche zu kaufen.
Charlotte schien ihre Gedanken erraten zu haben. Sie zeigte auf eine hochkant gestellte Matratze neben einem Sideboard. »Wir haben da noch eine Gästematratze, die kannst du erst mal benutzen, bis du deine Sachen dahast. Zahlen musst du erst ab Oktober, aber einziehen kannst du sofort, wenn du willst. Das Zimmer ist ja frei. Es ist auch frisch gestrichen. Wenn du ausziehst, musst du renovieren, aber das steht ja auch in dem Vertrag, den du gerade unterschrieben hast.«
Toni nickte selig. »Dann gehe ich mal meine Sachen holen.«
Kapitel 7
Pauls Beef
Theodor schaute demonstrativ auf seine Armbanduhr. Valentin war jetzt dreißig Minuten zu spät. Er wollte nicht länger warten und gab dem Kellner ein Zeichen, dass er die Vorspeise servieren könne. Die Speisenfolge in seinem Lieblingslokal hatte er bereits im Vorweg festgelegt.
Endlich konnte man wieder essen gehen. Die Lockdown-Monate im Frühjahr waren nervtötend gewesen. Nadja konnte gar nicht kochen und hatte auch keinen Spaß daran. Er selbst kochte sehr gern und auch ganz gut, aber nur, wenn ihm gerade danach war. Und in den letzten Wochen fiel es ihm immer schwerer, weil die rechte Hand ihm den Dienst verweigerte.
Gedankenverloren strich er mit dem Finger über die Zwischenräume zwischen den Sehnen. An der kranken Hand waren die Furchen viel tiefer, und unter der Haut vibrierte es ständig.
»Valentin kommt sicher gleich«, versuchte Melanie, die die Wogen der Wut bei ihrem Vater nur zu deutlich wahrnahm, zu beschwichtigen. »Er hat mir versprochen, diesmal pünktlich zu sein.«
»Ja, dann geht seine Uhr vielleicht falsch«, antwortete Theodor in einem Ton, der Melanie verstummen ließ. »Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe jetzt Hunger und sehe nicht ein, dass vier Menschen ihre Lebenszeit vergeuden sollen, nur weil einer keine Disziplin hat.«
»Ja, ich habe auch Hunger«, verkündete Nadja.
Melanie hielt seinem Blick nicht stand, sondern schlug die Augen nieder. Sie hat die Schönheit ihrer Mutter, aber denselben unsteten Blick, dieselbe Ängstlichkeit. Wie ein scheues Reh, dachte Theodor.
Gerade das hatte ihn an Ulrike anfangs so fasziniert. Dass sie so gar nicht mit ihrer Schönheit kokettierte, sich ihrer nicht bewusst war. Dass sie ihn bewunderte und sich nach seinem Schutz sehnte. Aber nach einiger Zeit war ihm das langweilig geworden. Sie war wie ein Grashalm im Wind gewesen, und er hatte sie dafür verachtet, dass sie keine Haltung hatte. Und sich selbst hatte er gehasst, weil das in ihm den Impuls auslöste, sie immer noch kleiner zu machen.
Dass sie es geschafft hatte, sich von ihm zu trennen, hatte ihn gewundert, zunächst auch gekränkt, aber letztlich war er erleichtert gewesen. Sie hatten nicht zueinander gepasst.
Sein Blick fiel auf Melanies Freund, der sich bisher nicht am Tischgespräch beteiligt hatte. Unentwegt tippten seine langen, schlaksigen Finger auf dem Handy herum, als ging ihn das Ganze hier überhaupt nichts an. Als sei er nur zufällig und ganz unverbindlich zugegen. Theo meinte sich zu erinnern, dass Melanie ihn auch schon bei ihrem letzten Treffen im Schlepptau gehabt hatte, aber sicher war er sich nicht. Sein Blick fiel auf den Siegelring, den der Kerl am Finger, und das goldene Kettchen, das er um den Hals trug. Ein Ohrstecker machte den krönenden Abschluss. Theo fand Schmuck bei einem Mann unmöglich. Er fand diesen ganzen Typen unmöglich, aber er beherrschte sich.
»Was machen Sie denn so beruflich?«, versuchte er ein Gespräch anzufangen.
Der Freund, dessen Name ihm partout nicht einfallen wollte, sah nur kurz auf und beschäftigte sich dann weiter mit seinem Handy.
»So dies und das«, gab er knapp von sich.
»Aha, dies und das! Darf ich fragen, um was es sich bei dies handelt und worin es sich von das unterscheidet?«
»Papa, bitte, sei doch nicht so inquisitorisch«, ging Melanie dazwischen. »Du weißt doch, dass Stefan im Online-Handel tätig ist.«
»So, weiß ich das?«
Stefan blickte kurz auf. »Sorry, ich hab da gerade einen großen Deal am Laufen. Ich muss mich mal kurz entschuldigen.« Dann grinste er, erhob sich und zeigte in Richtung Terrasse. »Da ist der Empfang besser. Holst du mir in der Zwischenzeit einen Gin Tonic und bringst ihn mir raus, Herzchen?« Er nahm Melanies Kinn kurz zwischen Daumen und Zeigefinger und deutete einen Kuss an, eine Geste, die Theo herablassend fand, zumal gegenüber einer erwachsenen Frau.
Melanie schien sich nicht daran zu stören. Sie lächelte ihren Freund an, nickte, stand auf, ging zur Bar, orderte den Cocktail und brachte ihn nach draußen. Stefan bedankte sich mit einem Augenzwinkern und klopfte ihr auf den Po. Dann widmete er sich wieder seinem Handy.
»Mein Gott, Melanie, du bist doch nicht sein Laufbursche«, sagte Theo, als sie sich wieder zu ihnen setzte. »Wenn er einen Drink will, kann er den doch beim Kellner bestellen.«
»Ach, das mach ich doch gern.«
Der Kellner servierte die Hauptspeise, Ribeye-Steak mit Ofenkartoffel und grünen Bohnen, und Theo begann mit Appetit zu essen. Melanies Blick wanderte zwischen dem telefonierenden Stefan, dem Steak auf ihrem Teller und ihrem Vater hin und her. Sie nahm ihr Besteck in die Hand, legte es aber gleich wieder ab.
Und dann ging die Tür auf, und Valentin kam herein. Augenscheinlich betrunken, gab er seiner Schwester einen flüchtigen Kuss auf die Wange, schlug Stefan, der seine Telefonate beendet hatte und wieder an den Tisch gekommen war, etwas zu fest auf die Schulter und warf seinem Vater ein zu lautes »Hey, Paps« zu, was der mit einem verachtungsvollen Blick quittierte. Nadja ignorierte er komplett.
Valentin behauptete, er habe sich mit der Location geirrt und eine halbe Stunde im falschen Restaurant an der Bar auf sie gewartet. Eine Lüge, die ebenso unverschämt wie fadenscheinig war, denn Theodor lud sie, wenn er sie denn einlud, immer ins Pauls Beef ein, jedenfalls seit mindestens fünf Jahren.
Theodor verzichtete auf eine Antwort, was Valentin dazu verleitete, nachzulegen.
»Ich dachte, wir sind uns einig, dass das Pauls ein peinlicher, überteuerter Spießerladen ist.« Das sagte er so laut, dass sich der Kellner und einige Gäste konsterniert nach ihm umsahen.
»Behauptet wer?«, fragte Theodor mit schneidender Stimme. »Etwa derjenige, der es geschafft hat, innerhalb von fünf Jahren zwei Restaurants in den Konkurs zu treiben? Der weder einen Berufs- noch einen Studienabschluss hat? Der nicht einmal zu einer Einladung seines Vaters, von dessen regelmäßigen Zuwendungen er abhängig ist, pünktlich erscheinen oder auch nur etwas Ordentliches anziehen kann? Schau dich doch an, du siehst aus wie ein Clochard!«
Das Schweigen, das sich anschloss, war umso lauter, als nun die angeregten Gespräche von den Nachbartischen zu ihnen herüberklangen, obwohl alles mit extragroßem Hygieneabstand à la Corona angeordnet war.
Stefan hatte sein Steak verschlungen und war erneut zu wichtigen Telefonaten auf die Terrasse verschwunden. Nun kam er zurück und verkündete: »Tut mir leid, ich muss los. Geschäfte. Da ist gerade etwas sehr Wichtiges aufgepoppt. Danke für die Einladung, Theo.« Und zu Melanie gewandt: »Warte heute nicht auf mich, Kleines, wird spät werden.«
Theo erstarrte, wollte das »du« schon korrigieren, verkniff sich den Kommentar aber und nickte nur kurz. Als Stefan gegangen war, wandte er sich an seine Tochter.
»Was willst du von diesem Kerl? Merkst du denn gar nicht, wie schlecht er dich behandelt? Du glaubst doch nicht wirklich, dass der jetzt was zu arbeiten hat, oder? Samstagabend um zehn?«
Melanie begann ihren Freund zu verteidigen. Doch das ließ Theodor nicht gelten. »Such dir endlich mal einen richtigen Mann, einen echten Partner und nicht so einen windigen Typen. Du wirst auch nicht jünger!«
Melanie brach in Tränen aus, was Valentin dazu veranlasste, seinen Vater anzuherrschen: »Du musst hier nicht den weisen Mann raushängen lassen! Was ist denn deiner Meinung nach ein echter Partner? Nadja vielleicht? Wie alt ist sie noch gleich? Fünfundzwanzig? Wie alt bist du? Siebzig? Oder achtzig? Komm, Melanie, das bringt hier doch alles nichts, lass uns gehen. Soll der Alte doch an seinem Fraß und seinem Geld ersticken.« Und wieder zu Theo gewandt, blaffte er: »Wenn du nur einen Funken Empathie hättest oder dich für deine Kinder interessieren würdest, dann hättest du vielleicht gemerkt, dass deine Tochter seit zehn Jahren Vegetarierin ist und es ziemlich dämlich ist, sie zweimal im Jahr in ein Steakrestaurant einzuladen.« Er wies auf den Teller. Melanie hatte von der Kartoffel und den Bohnen gegessen, das Steak aber nicht angerührt.
Schließlich stand Valentin auf, zog Melanie, die immer noch weinte, mit sich zur Garderobe und wäre fast mit dem irritierten Kellner zusammengestoßen, der sein Dessert noch servieren wollte und nicht verstand, warum auf einmal alle aufbrachen.
»Lassen Sie es gut sein, mein Freund«, sagte Theodor. »Heute kein Dessert. Bringen Sie mir bitte die Rechnung, und verzeihen Sie das unmögliche Auftreten meiner Kinder. Es wird nicht wieder vorkommen.«
Gleich am nächsten Morgen rief er Frank Möbius an, der nicht nur sein Freund, sondern auch Anwalt und Notar war und alle Finanzangelegenheiten für ihn regelte, und wies ihn an, die monatlichen Zuwendungen an seine Kinder zu stoppen und eine Änderung seines Testaments vorzubereiten. Die Kinder sollten über den gesetzlichen Pflichtteil hinaus nicht mehr bedacht werden. Die Wohnung, in der sie zusammenlebten, sollte Nadja erhalten, und der Rest seines Geldes sollte gemeinnützigen Vereinen zugutekommen: einem, der die medizinische Forschung einer neurologischen Erkrankung unterstützte, und einem zur Förderung der Sterbehilfe in Deutschland.
»Du machst einen Riesenfehler«, versuchte Frank ihn umzustimmen, »das kannst du deinen Kindern nicht antun!«
Aber Theodor wollte nicht mehr darüber diskutieren. »Die Entscheidung ist gefallen, Frank. Glaub mir, es ist nur zu ihrem Besten. Wenn sie jetzt nicht die Kurve kriegen und ihr Leben in die Hand nehmen, kriegen sie sie nie mehr. Außerdem wird nicht mehr viel Geld übrig sein, wenn ich abtrete. Ich will mein Leben selbst noch genießen. Wer weiß, wie lange mir das noch möglich ist.«
Am Abend überraschte er Nadja mit der Aussicht auf eine dreimonatige Weltreise auf der AIDA. Außenkabine mit Balkon. Ehrenplatz beim Captain’s Dinner. Davon hatte sie doch immer geträumt.
»Ich liebe dich«, sagte sie und umarmte ihn. Dann zuckte sie zusammen. »Mein Gott, ich habe dafür ja gar nichts anzuziehen.«
Theo lachte. »Das, mein Schatz, müssen wir dann rasch ändern.«
Kapitel 8
Die Einsamkeit der Großstadt
Es war ein düsterer Samstagmorgen im Januar, als Antonia von lauter Musik erwachte. Genervt schaute sie auf die Uhr. Gerade mal acht! Sie schloss noch einmal die Augen und versuchte, dem ungeliebten Zustand des Wachseins noch einen Moment lang zu entfliehen. Wieder lag ein grauer Tag vor ihr, ein Tag von dem sie sich nichts Gutes erhoffte.
Toni hatte sich in Berlin noch nicht wirklich eingelebt. Die Einführungsseminare und überhaupt die meisten Veranstaltungen an der Uni hatten bisher online stattgefunden, und bei den wenigen Präsenzveranstaltungen traute sie sich nicht, jemanden anzusprechen.
Schon als Kind war sie eher schüchtern gewesen, sie hatte noch nie zu den extrovertierten Menschen gehört, die sofort mit jedem ins Gespräch kamen. Aber in der Schule hatte sie dann doch irgendwann einen Kreis vertrauter Freundinnen gehabt, vor denen sie keine Scheu verspürte. Jetzt meinte sie die abschätzenden Blicke der anderen Erstsemester zu spüren. Sie schienen sich alle schon von der Schule oder von sonst woher zu kennen. Niemand war unfreundlich zu ihr, aber es interessierte sich auch niemand für sie. Sie wurde einfach übersehen.
Auf der Erstsemesterparty, die wegen Corona erst jetzt im Januar veranstaltet worden war, war sie sich so verloren vorgekommen, dass sie rasch wieder gegangen war. Sie hatte es einfach nicht mehr ausgehalten. Sie hatte das Gefühl gehabt, dass alle sie anstarrten und dachten, was will die denn hier? Zu Hause, während der Schulzeit hatte sie sich nie Gedanken über ihre Kleidung gemacht, jetzt kam sie sich im Vergleich zu den anderen altbacken und uncool vor.
Auch zu den Mitbewohnern in der neuen WG hatte sie ein eher oberflächliches Verhältnis. Sie waren nett, aber genau wie die Leute aus der ersten WG überwiegend mit sich selbst beschäftigt und nicht daran interessiert, neue Freundschaften einzugehen. Man sah sich nicht sehr häufig und wenn, dann nur zu einem flüchtigen Hallo an Kaffeemaschine oder Kühlschrank. Die anfangs von den anderen als so wichtig dargestellten wöchentlichen Koch- und Spieletreffen waren überwiegend ausgefallen.