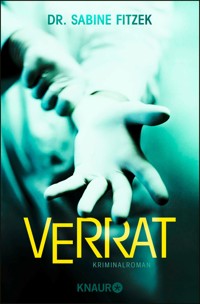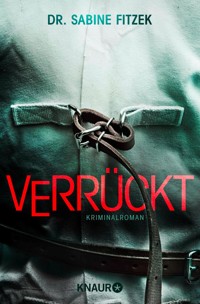4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kammowski ermittelt
- Sprache: Deutsch
Brisanter Nervenkitzel mit Insider-Wissen: der 4. Medizin-Krimi von Sabine Fitzek Im 4. Teil der Krimi-Reihe muss der Berliner Kommissar Kammowski den Mord an einer Apothekenhelferin aufklären. Alles sieht nach einem Mord im Drogen-Milieu aus, als die Leiche der jungen Apothekenhelferin Emma mit Morphium im Blut und abgetrenntem kleinem Finger aufgefunden wird. Routinemäßig befragt Kommissar Kammowski Emmas Kollegen und ihren Chef Detlef von Theising, der eine traditionsreiche und offenbar sehr lukrative Apotheke in Berlin-Köpenick betreibt. Der Mann ist glaubhaft geschockt über Emmas Tod, die wie eine Tochter für ihn war. Und wie so viele andere der Befragten hat er ein wasserdichtes Alibi. Die Ermittlungen treten auf der Stelle – bis sich herausstellt, dass Emma etwas auf der Spur war, über das sie nicht mal mit ihrem Freund sprechen wollte … Sabine Fitzek, Neurologin mit 10 Jahren Chefarzt-Erfahrung, schreibt ihre hochspannenden Medizin-Krimis mit fundiertem Insider-Wissen um die Missstände in unserem Gesundheitssystem. Die in Berlin angesiedelte Krimi-Reihe »Kammowski ermittelt« ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Verrat - Verrückt - Verstorben - Vertuscht
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Sabine Fitzek
Vertuscht
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Alles sieht nach einem Mord im Drogen-Milieu aus, als die Leiche der jungen Apothekenhelferin Emma mit Morphium im Blut und abgetrenntem kleinem Finger aufgefunden wird. Routinemäßig befragt Kommissar Kammowski Emmas Kollegen und ihren Chef Detlef von Theising, der eine traditionsreiche und offenbar sehr lukrative Apotheke in Berlin-Köpenick betreibt. Der Mann ist glaubhaft geschockt über Emmas Tod, die wie eine Tochter für ihn war. Und wie so viele andere der Befragten hat er ein wasserdichtes Alibi. Die Ermittlungen treten auf der Stelle – bis sich herausstellt, dass Emma etwas auf der Spur war, über das sie nicht mal mit ihrem Freund sprechen wollte …
Sabine Fitzek, Neurologin mit 10 Jahren Chefarzt-Erfahrung, schreibt ihre hochspannenden Medizin-Krimis mit fundiertem Insider-Wissen um die Missstände in unserem Gesundheitssystem.
Inhaltsübersicht
Prolog
TEIL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
TEIL 2
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Nachwort
Danksagung
Prolog
Eine junge Frau sitzt mitten in einer Halle auf einem Stuhl. Es ist eine dieser hohen alten Hallen, aus Holz und mit Ziegelfundament, in denen sie im Winter die Segelboote lagern. Jetzt, an Ostern, sind viele Boote trotz des schlechten Wetters bereits im Wasser. Diese Halle allerdings wird vom Verein auch im Winter nicht mehr genutzt, weil sie inzwischen zu klein ist und es an vielen Stellen hereinregnet. Die Reparatur hätte mehr gekostet als die neue Leichtbauhalle auf der anderen Seite der Bootsstege, die man, als das Betonfundament erst einmal gegossen war, innerhalb weniger Stunden errichtet hatte.
Die junge Frau ist mit groben Stricken an Armen und Beinen gefesselt und an dem klapprigen Holzstuhl festgebunden. Sie hängt mehr in den Seilen, als dass sie säße. Das lockige lange Haar fällt ihr strähnig über die Schultern. Es wirkt, als sei sie gerade geschwommen, als sei das Haar noch feucht, doch dann zeigt sich, dass es kein Wasser ist, sondern wohl eher Schweiß und Blut, die ihre Haare verkleben.
Die schlanke junge Frau, fast noch ein Mädchen, ist nur mit Jeans und einem T-Shirt bekleidet. Die Halle ist nicht beheizt, es ist kalt. Sie muss frieren, aber das sieht man ihr nicht an. Vermutlich ist sie bereits stark unterkühlt.
Man hat sie geknebelt und ihr den Mund mit Klebeband verschlossen. Sie sträubt sich nicht gegen die Fesseln. Sie schreit nicht. Sie rührt sich nicht. Sie ist nicht bei Bewusstsein. Von ihrer rechten Hand, die hinter der Stuhllehne mit der linken zusammengebunden ist, tropft langsam, aber stetig Blut und sammelt sich zu ihren Füßen in einer Lache. Die ist bereits zu einer beachtlichen Größe angewachsen. Mittendrin liegt ein zylinderförmiges Gebilde. Erst bei genauerem Hinsehen wird klar, was es ist. Man hat der jungen Frau den kleinen Finger abgeschnitten.
Ihr Brustkorb hebt und senkt sich sacht. Noch atmet sie.
Die Halle ist dunkel, nur vom Mondschein schwach erhellt. Nichts rührt sich. Es riecht nach Maschinenöl und Tauen. Entlang der Wände ziehen Ratten geschäftig ihrer Wege. Die wuseligen kleinen Tiere heben sich von den Schatten der Wände und Ecken kaum ab. Man ahnt sie mehr, als dass man sie sähe. Nur wer sehr gute Ohren hat, hört ihre quiekende Unterhaltung. Noch interessieren sie sich nicht für den Menschen da in der Mitte der Halle, auf den durch die defekten Fenster im Dach gespenstisch das fahle Mondlicht fällt. Noch lebt der Mensch. Sie haben Zeit.
Plötzlich öffnet sich in dem großen Hallentor eine Tür. Eine Gestalt betritt das Bootshaus. Sie trägt Hose und Pullover, es ist nicht zu erkennen, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Gestalt ist in Eile, schaut sich aber zunächst vorsichtig um. Mit einer starken Taschenlampe leuchtet sie die Ecken aus. Sie sind allein. Rasch tritt sie an die Frau heran und betrachtet sie im grellen Licht der Taschenlampe einen Moment lang, als müsse sie sich besinnen, was zu tun sei. Dann zieht sie ihr das T-Shirt hoch und reißt die vier Pflaster ab, die auf dem Dekolleté kleben. Sorgfältig reinigt sie die Haut mit etwas Benzol und einem Taschentuch von Kleberresten, dann zieht sie das T-Shirt wieder herunter. Die Frau hat von der Aktion kaum etwas mitbekommen. Sie stöhnt jetzt leise, ist aber immer noch bewusstlos. Rasch verstaut die Gestalt Benzol, Taschentuch und Pflaster in ihrer Reisetasche und kramt daraus eine Mülltüte und Panzerband hervor. Noch einmal betrachtet sie die junge Frau, zögert kurz, vielleicht Ausdruck eines Bedauerns. Fast zärtlich streicht sie ihr über die Wange, dann stülpt sie ihr mit einer entschiedenen Bewegung die Tüte über den Kopf und verschließt sie mit Klebeband, das sie in mehreren Runden um den Hals wickelt. Die Frau scheint zu erwachen, beginnt sich zu wehren, kann aber nichts ausrichten, denn die Seile halten sie fest. Sie kippt mitsamt dem Stuhl um. Wütend schreit die Gestalt auf. Sie ist vor Schreck beiseitegesprungen und in die Blutlache getreten. Sie atmet dreimal tief ein und aus und schaut sich noch einmal sorgfältig um. Dann steuert sie fast gemächlich auf das Hallentor zu.
Der Todeskampf dauert quälend lange Minuten. Die sterbende Frau schnappt vergebens nach Luft und gibt panische, durch die Plastiktüte gedämpfte Laute von sich. Die Gestalt dreht sich nicht um. Langsam, aber ohne innezuhalten, strebt sie dem Ausgang zu. Als sie am Hallentor angekommen ist, ist es wieder still, und sie schaut doch noch einmal zurück. Ein letztes Mal streift das grelle Licht ihrer Lampe den Tatort. Nichts bewegt sich mehr. Sie atmet sichtlich auf, knipst die Taschenlampe aus, verschließt die Tür von außen und entfernt sich raschen Schrittes. Die Dämmerung schwebt schon als pastellener Streifen über dem Horizont. Die Gestalt startet den Motor, ihre Hände umfassen das Lenkrad. Sie zittern heftig.
TEIL 1
Kapitel 1
Als sie sich erhob, spürte sie einen kurzen Schwindel. Sie schwankte, machte einen Ausfallschritt zur Seite, drohte zu stürzen, konnte sich aber mit einem Griff an die Schreibtischkante stabilisieren.
»Setzen Sie sich gern noch einmal«, sagte die Onkologin besorgt.
Elke Brunner wollte sich aber nicht wieder setzen, sie wollte dieser Schwäche nicht nachgeben. Nicht hier. Nicht jetzt. Sie hatten alles ausführlich beredet, das Gespräch war beendet. Es war ihr so vorgekommen, als hätte sie dem Ganzen als unbeteiligte Zuhörerin beigewohnt. Als hätte das alles gar nichts mit ihr zu tun. Nun lagen die Fakten auf dem Tisch. Entweder würde sie die Tortur der Chemotherapie noch einmal über sich ergehen lassen, oder sie wäre in einem Jahr tot. Vielleicht auch etwas früher, hatte die Onkologin gesagt.
Elke mochte Frau Dr. Braun. Nicht etwa, weil sie besonders einfühlsam gewesen wäre. Sie war eher das Gegenteil. Ihre nüchterne Art, die Fakten so darzulegen, wie sie aus ihrer Sicht waren, ohne etwas zu beschönigen und ohne jede emotionale Beteiligung, grenzte an Körperverletzung. Sie hatte Elkes statistische Überlebenschancen genauso referiert, wie sie vermutlich, wäre sie Hautärztin gewesen, die Ergebnisse einer Studie zur optimalen Behandlungsmethode von Warzen wiedergegeben hätte: Gehen Sie bei Vollmond um Mitternacht mit einer schwarzen Katze auf einen Friedhof, auf dem tags zuvor ein Mörder begraben wurde. Werfen Sie sich etwas Salz über jede Schulter, und spucken Sie dann auf die Katze. Das führt in zwanzig Prozent der Fälle zum Verschwinden der Warzen. Oder Sie nehmen dieses Medikament ein. Das hat zur Folge, dass sich die gesamte Schleimhaut im Körper ablöst. Das ist sehr schmerzhaft, gibt sich aber wieder. Danach haben Sie eine dreißigprozentige Chance, dass die Warzen nicht wiederkommen. Wir gehen in beiden Fällen davon aus, dass der Placeboeffekt nicht unerheblich ist. Daher tun Sie am besten das, wovon Sie selbst am meisten überzeugt sind.
Elke musste über ihre skurrilen, an Tom Sawyer und Huckleberry Finn angelehnten Gedanken laut lachen. Als Kind hatte sie eine Kassette mit dem Hörspiel besessen, die hatte sie gehört, bis sie sie auswendig mitsprechen konnte, immer und immer wieder.
Die Onkologin schaute sie erstaunt an, sagte aber nichts. Sie war es wohl gewohnt, dass die Menschen auf schlechte Nachrichten unterschiedlich und zum Teil auch exzentrisch reagierten.
Sie hatte gesagt, Elke habe die Wahl, und genauso hatte sie es gemeint. Punktum. Entweder so oder so. Das war unbarmherzig und wohltuend zugleich. Schöner wäre natürlich gewesen, sie hätte gesagt: Wir machen das jetzt so und so, dann kriegen wir das schon in den Griff. Wenn es denn gestimmt hätte. Aber Elke war in den Monaten ihrer Krankheit zur Laien-Expertin für Brustkrebs geworden. Ihr konnte man kein X für ein U vormachen. Metastasen in Leber, Lunge und Knochen – sie wusste, was das bedeutete. Und wenn sie etwas gar nicht brauchen konnte, jedenfalls jetzt und hier, dann war es Mitgefühl, davon las sie genug in den Augen ihres Mannes, ihrer Kinder, ihrer Eltern. Ein Mitgefühl, das ihr ständig weiszumachen suchte, dass es schon nicht so schlimm sei, dass noch Hoffnung bestehe, dass man nur nicht aufgeben dürfe. Ein vorgetäuschter Hoffnungsglauben, gepaart mit aufgesetzter Fröhlichkeit, die den Schwindel nicht verbergen konnte. Eine Rücksicht, die dazu führte, dass sie ihr jeden Wunsch von den Augen ablasen und ihr gerade dadurch keine Verschnaufpause gönnten von der Einsicht, dass das Sterben eigentlich schon begonnen hatte. Als ob man eine im Verblühen begriffene Rose vor jedem Windzug schützte, der ihr die Blütenblätter rauben würde.
Elke Brunner verabschiedete sich, zog sich den Mantel an und band den warmen Schal fest um den Hals. Dann trat sie hinaus in die kalte Januarluft. Obwohl sich an dem schmuddeligen Wetter nichts verändert hatte, seit sie die Praxis betreten hatte, kam es ihr so vor, als wäre alles noch düsterer geworden.
Kapitel 2
Der Februar war kalt, aber sonnig gewesen, was nach dem nasskalten und dunklen Januar gutgetan und die Stimmung um einiges gehoben hatte. Und jetzt, Anfang März, war es auch nicht mehr ganz so kalt. Obwohl die Zeitungen schon wieder schrieben, dass für die Jahreszeit zu wenig Niederschläge fielen, genoss Berlin das anhaltend schöne Wetter. Überall roch es nach Frühling. Elke Brunner kaufte sich gleich drei Sträuße bunter Tulpen. Als sie aus der Straßenbahn stieg, hatten die Eimer voller frischer Blumen in allen Farben, die in der Auslage des Blumengeschäfts in der Sonne leuchteten, sie so angelacht, dass sie nicht hatte widerstehen können. Auf dem kurzen Fußweg nach Hause lächelten wildfremde Passanten sie an. Lag das am Wetter? Oder an dem vielleicht etwas übertrieben großen Strauß, den sie bei sich trug? Irrte sie sich oder hatte die dreifarbige Katze, die sich auf dem Mäuerchen die Sonne auf den Pelz scheinen ließ, ihr im Vorbeigehen zugezwinkert?
Sie hätte die Welt umarmen können. Die Chemotherapie, vor der sie sich so gefürchtet hatte, war diesmal gar nicht so schlimm. Kein Vergleich zum letzten Mal, als es ihr wochenlang schlecht gegangen war. Damals hatte sie sich immer wieder übergeben müssen, war so schwach gewesen, dass sie selbst kleinste Wege nur mit Hilfe bewältigt hatte.
Die Onkologin, bei der sie heute zur Kontrolluntersuchung gewesen war, hatte sich mit ihr gefreut. Sie erinnerte sich daran, wie schwer Elke sich getan hatte, einer erneuten Chemo zuzustimmen.
»Jetzt muss die Behandlung nur noch wirken. Mal sehen, was die Computertomografie sagt. Ich rufe Sie an, sobald ich den Bericht des Radiologen vorliegen habe.«
»Ich bin jetzt ganz optimistisch, Frau Doktor Braun, ich fühle mich so gut wie schon lange nicht mehr.«
Auch Elkes Mann konnte ihr Glück kaum fassen. In Momenten, in denen er sich unbeobachtet wähnte, schaute er sie immer wieder ganz komisch von der Seite an. Er hatte sich extra Urlaub genommen, um sie durch die schwere Zeit zu begleiten, obwohl ihn das um die Beförderung zum Abteilungsleiter gebracht hatte. Gesagt hatte er das nicht, aber Elke wusste genau, was er ihr zuliebe aufs Spiel setzte. Andererseits hätte sie das Ganze ohne ihn nicht noch einmal durchgestanden, da war sie sich sicher. Und im Angesicht des drohenden Todes bekamen Dinge wie Karriere und nächste Gehaltsstufe ohnehin eine andere Bedeutung.
Doch dann war gar keine schwere Zeit gekommen. Sechs von zehn geplanten Behandlungszyklen hatte Elke nun schon hinter sich, und es ging ihr wunderbar. Sogar ihre Blutwerte waren gut, das hatte ihr die Onkologin heute noch einmal bestätigt. Beim letzten Mal waren die Blutwerte so schlecht geworden, dass die Behandlungszyklen einige Wochen hatten ausgesetzt werden müssen.
Wie konnte es sein, dass man einmal an einer Therapie fast zu sterben glaubte und beim nächsten Mal keinerlei Nebenwirkungen spürte? Es hieß ja immer, die Psyche spiele bei allem mit. Vielleicht lag es daran, dass sie sich damals innerlich gegen die Substanz gesträubt hatte? Sie hatte keinen Krebs gewollt, und sie hatte sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Nicht nur gegen den Krebs, sondern gegen alles, was damit zusammenhing. Sogar gegen die Familie, die sie sehr unterstützt hatte, war sie aggressiv gewesen. Wenn sie nach fünf Schritten das Gefühl gehabt hatte, einen Marathon gelaufen zu sein, hatte sie sich selbst und ihre Schwäche verflucht. Und sie hatte geschrien und geweint und hatte sich mit jeder Faser ihres Körpers gegen das Schicksal, das ihr eine solche Zumutung in den Weg legte, aufgebäumt.
Als der Tumor zurückkam, war es anders gewesen. Nicht, dass sie sich damit arrangiert hätte, sie wollte noch immer keinen Krebs. Noch immer lag sie nachts stundenlang wach und fragte sich: Warum ausgerechnet ich? Aber etwas in ihrem Inneren sagte ihr, dass die Kraft nicht mehr ausreichte, um weiter dagegen anzukämpfen. Sie fühlte sich ausgebrannt. Sie wehrte sich nicht mehr gegen den Krebs, und sie wehrte sich nicht mehr gegen das Medikament. Sicher war das der Grund, warum es diesmal so gnädig mit ihr umging.
Zu Hause angekommen, arrangierte sie die Blumen in einer Kristallvase auf dem Esszimmertisch, legte sich auf die Couch und genoss das lärmende Treiben der Kohlmeisen an ihrem Futterhäuschen auf der Terrasse. Sie war glücklich.
Eine halbe Stunde später kam ihr Mann mit dem Einkauf nach Hause. Er hatte ihr einen großen Strauß roter Tulpen mitgebracht und schaute etwas enttäuscht, als er sah, dass sie schon welche gekauft hatte.
»Sie sind wunderschön, und Blumen kann ich heute gar nicht genug um mich haben«, lachte sie und erzählte ihm von ihrem Besuch bei der Onkologin. Gemeinsam verstauten sie den Einkauf in den Schränken und im Kühlschrank. Alles ging ihr heute so leicht von der Hand, sie fühlte sich so gut wie schon lange nicht.
Am Abend überredete sie ihren Mann, seinen Urlaub abzusagen. Sie kam gut allein zurecht, es war einfach nicht notwendig, dass er noch länger zu Hause blieb.
Wie um zu unterstreichen, wie viel besser es ihr schon ging, schlug sie schließlich vor, am kommenden Wochenende doch die Einladung zu Birgits Geburtstag anzunehmen.
»Bist du dir sicher, ist das nicht zu anstrengend?«, fragte er zweifelnd.
»Das wird mich endlich mal wieder auf andere Gedanken bringen«, wischte sie seine Einwände vom Tisch. »Mir geht es blendend.« Sie stand auf, setzte sich auf seinen Schoß und schlang ihre Arme um seinen Hals. »Was hältst du davon, wenn wir jetzt ins Bett gingen und später etwas vom Thai bestellten? Einen Sekt habe ich schon in den Kühlschrank gestellt.«
Kapitel 3
Detlef von Theising und seine Frau Birgit zogen sich noch rasch um. Birgit war eben erst mit den letzten Vorbereitungen für das Menü fertig geworden, sie hatte den ganzen Tag in der Küche gestanden. Sie war stolz darauf, dass sie immer alles selbst zubereitete, und Detlef, dem das eigentlich eher lästig war und der liebend gern einen Caterer beauftragt hätte, hatte sich damit abgefunden. Zumindest war Birgit inzwischen so versiert, dass die früher übliche stressbedingte Schreierei kurz vor dem Eintreffen der Gäste in letzter Zeit meist ausblieb.
Die schöne alte Villa mit ihrem parkähnlichen Garten erstrahlte in vollem Glanz. Das Gebäude selbst war illuminiert, die alten Bäume und Sträucher wurden von Strahlern in Szene gesetzt, und zusätzlich hatte Birgit Öllampen in die Bäume gehängt, die leise im Wind schaukelten und schöne Akzente setzten. Detlef hatte in der Feuerschale Holz aufgeschichtet, das wollten sie später anzünden.
Es war noch zu früh im Jahr, zu kalt, um abends im Garten zu sitzen, aber Birgit hatte im Wintergarten gedeckt. Das war fast wie draußen sitzen, denn sie hatten die Schiebetüren zum Garten weit geöffnet und im Innern den Kamin angemacht, und so saßen sie im Warmen und würden sich später von dort aus an dem Feuer im Garten erfreuen können.
Beim Essen selbst war alles noch harmonisch. Nichts deutete darauf hin, dass der Abend diesmal komplett entgleisen würde. Die Einladungen der von Theisings waren legendär. Birgit verwendete viel Zeit darauf, sich immer etwas Neues einfallen zu lassen, und der Ablauf eines solchen Abends wurde generalstabsmäßig geplant. Auch diesmal hatte sie nicht gespart, und der Champagner war in Mengen geflossen.
»Wunderschön habt ihr es hier, ihr könntet euren Garten für SCHÖNER WOHNEN fotografieren lassen«, sagte Elke nach dem Nachtisch. »Und du hast dich mal wieder selbst übertroffen, das Essen war ein Gedicht.«
Birgit lächelte dankbar. Die anderen nickten. Sie kamen alle gern, auch wenn sie hinterher über Birgits Hang zum Perfektionismus und Detlefs Angeberei gerne lästerten. Vor allem die Frauen. Nicht zuletzt deshalb, weil die Maßstäbe für eigene Einladungen in den letzten Jahren immer weiter in die Höhe geschraubt worden waren. Bitte erwartet diesmal nicht viel, wir wollen doch nur mal wieder nett zusammensitzen, es gibt nur was ganz Einfaches. Ich möchte ja auch etwas von euch haben und nicht nur in der Küche stehen, versuchten einige krampfhaft dagegenzuhalten, um dann doch wieder dem Drang zur Rivalität selbst unter Freunden nachzugeben.
Sie waren eine Gruppe von rund acht Paaren aus dem Tennisclub, dem Rotary-Club und der Gemeinde, die sich seit über zehn Jahren zu Geburtstagen und anderen Anlässen gegenseitig einluden und sich als Freunde bezeichneten. Sie nagten alle nicht am Hungertuch, aber mit dem Reichtum der Apothekerfamilie von Theising konnte es keiner von ihnen aufnehmen.
Pfarrer Heinrich hatte sich fest vorgenommen, Birgit und Detlef an diesem Abend auf den noch nicht gedeckten Heizkostenposten der Kirche anzusprechen. Am Sonntag nach dem Gottesdienst hatte er bereits eine Bemerkung fallen lassen, doch die hatte leider keine Resonanz gefunden. Er überlegte, wie er das Gespräch unverfänglich darauf lenken konnte.
»Ihr heizt also noch euren Kamin an? Versteht mich nicht falsch, ich bin glücklich darüber, sonst wäre es heute doch etwas frisch gewesen hier im Wintergarten bei geöffneten Türen. Und ist Feuer in Garten und Kamin nicht inzwischen verboten? Wegen der Umwelt?«
Detlef schüttelte pikiert den Kopf, und Pfarrer Heinrich begriff sofort, dass er die Sache falsch angepackt hatte.
»Was soll verboten sein? Den eigenen Kamin zu beheizen? So weit kommt es noch! Wir haben unseren Holzvorrat gerade wieder vom Schornsteinfeger aufstocken lassen.«
»Na ja, verboten ist es vielleicht noch nicht, aber man sollte sich doch überlegen, ob man nicht wenigstens einen Filter in den Kamin einbauen lässt, und Feuer im Garten sollte man so nahe am Wald ohnehin nicht mehr machen«, bemerkte Rainer, der Ingenieur aus dem Rotary-Club. Er hatte eine Firma für Sonnenkollektoren, die in den letzten Jahren, nach dem Wegfall der staatlichen Fördermaßnahmen, knapp an der Pleite vorbeigeschrammt war. Er hatte dem Wein heute Abend bereits gut zugesprochen. »Und ob man es mit Blick auf die Klimaproblematik wirklich noch verantworten kann, bei geöffneten Fenstern den Kamin einzuheizen und ein Lagerfeuer anzumachen, sollte man sich auch überlegen. Ich bin sicher kein Grüner, aber wir müssen alle umdenken. Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, auf Lagerfeuer zu verzichten, stimmt’s, Kerstin?«
Er schaute hinüber zu seiner Frau, die pflichtschuldig nickte und hinzufügte: »Wenn jeder denkt, der andere sollte erst mal vorlegen, dann wird das nichts mit dem Klima.«
»Das ist doch Quatsch. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff«, erwiderte Detlef. »Wir produzieren mit unserem Feuer nur so viel CO2, wie der nächste Baum durch sein Wachstum wieder bindet. Wir heizen das Haus mit Holzpellets und den Kamin mit Holz. Das ist sicher umweltschonender als eure dreißig Jahre alte Gastherme.«
Der Hieb hatte gesessen. Alle in der Runde wussten, dass Rainer in finanziellen Schwierigkeiten steckte und im zurückliegenden Winter öfter Probleme mit seiner Heizung gehabt hatte, die er längst hätte erneuern müssen.
Der Pfarrer versuchte zu vermitteln und dabei sein Anliegen doch noch zu platzieren.
»Es hat nicht jeder deine finanziellen Möglichkeiten, Detlef. Wir erfreuen uns alle an euren großzügigen Einladungen, aber manchmal ist weniger mehr, und die Gemeinde wäre wirklich glücklich, wenn ihr euch noch einmal mit einer Spende an den Heizkosten der Kirche beteiligen könntet. Wir haben jetzt schon drei Kollekten darauf verwendet, und der Posten ist immer noch nicht zusammen.«
»Wofür ich das Geld, das ich allein mit meiner Hände Arbeit verdient habe, ausgebe, ist immer noch meine Sache. Das lasse ich mir von niemandem vorschreiben, schon gar nicht von einem Pfarrer, der einmal in der Woche drei Stunden arbeitet, aber für vierzig Stunden Geld kassiert, von unserer Kirchensteuer wohlgemerkt. Wie viel hast du denn schon selbst in den Heizkostenetat gespendet?«
Der Pfarrer blieb eine Antwort schuldig und überlegte sich einmal mehr, ob es nicht falsch gewesen war, mit Gemeindemitgliedern ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Im Priesterseminar damals hatte sein Lehrer davor gewarnt. Wollt ihr als Respektsperson akzeptiert werden, braucht ihr Distanz zu den Leuten. Gemeindemitglieder sollten keine Freunde sein. Er hatte sich immer um Distanz bemüht, aber er war auch nur ein Mensch, der menschliche Kontakte brauchte, und er war nun seit dreißig Jahren der Pfarrer dieser Gemeinde.
Was war heute nur los? Normalerweise waren das nette Runden, in denen man sich gegenseitig bestätigte, wie gern man sich hatte, und einen geselligen Abend miteinander verbrachte. Birgit überlegte krampfhaft, wie das Ganze zu retten wäre.
Detlef hatte, wie die meisten, viel getrunken, übersah die warnenden Blicke seiner Frau und ging noch einmal zum Angriff über: »Wie handhabt ihr das denn mit euren Feuerchen im Kirchgarten? Baust du da jetzt auch einen Filter ein? Beim Osterfeuer oder wenn die Pfarrjugend am Lagerfeuer ihre schrägen Lieder trällert?«
»Du willst doch jetzt nicht das rituelle Osterfeuer der Gemeinde einmal im Jahr mit dem Abfackeln von Holz in deinem Garten gleichsetzen, oder?«, fragte Heinrich zurück. Er hatte sich wieder im Griff, aber klein beigeben wollte er nicht. Er mochte Birgit. Er hatte sie zur Kommunion und zur Hochzeit geführt. Ihre Familie war schon immer in der Gemeinde aktiv gewesen, auch in den schwierigen DDR-Zeiten. So hatte er auch die Einladung zu ihrem Geburtstag angenommen. Dieser Detlef dagegen war ein Fremdkörper. Formal gehörte er der evangelischen Kirche an, aber wegen seiner Frau war er de facto schon seit vielen Jahren Mitglied ihrer Gemeinde. Dabei huldigte er offensichtlich nur einem Gott: dem Mammon. Anmaßend, ein- und ungebildet – so beurteilte er, Pfarrer Heinrich, den »eingeheirateten Süddeutschen« klammheimlich.
Birgit sprang auf. »Wer will denn noch einen Kaffee? Oder vielleicht einen Grappa? Oder beides?«
Es kamen wieder unverfängliche Gesprächsthemen auf, und fast hätte der Abend noch gerettet werden können. Doch Detlef war gekränkt. Er beteiligte sich kaum noch an der Unterhaltung und schüttete umso mehr Grappa in sich hinein.
»Habt ihr schon den Film über Gundermann gesehen?«, fragte Marianne. Sie war neben Detlef die einzige Westlerin in ihrem Kreis. »Ich war begeistert. Eine Dokumentation, die nichts beschönigt, die aber auch die Texte und die tolle Musik würdigt.«
Thorsten und Elke hatten den biografischen Musikfilm über den Liedermacher Gerhard Gundermann auch gesehen, blieben aber reserviert in ihrer Bewertung, was dazu führte, dass Marianne umso mehr auf sie einredete, um sie doch noch zu überzeugen.
Elke sah sehr blass aus, wie Birgit fand. Thorsten und Elke waren sonst gesellige Menschen, mit denen man viel Spaß haben konnte. Heute sah es aus, als würden die beiden das Ende des Abends herbeisehnen. Aber das lag vielleicht nicht nur an Marianne. Birgit hatte Gerüchte gehört, wonach bei Elke der Krebs zurückgekommen war. Sie nahm sich vor, sie in den nächsten Tagen einmal anzurufen. In so einer großen Runde konnte man über so etwas nicht sprechen. Die meisten anderen kannten den Film, von dem Marianne immer noch erzählte, nicht und zeigten sich wenig interessiert, was Marianne ärgerte.
»Vielleicht haben wir zu sehr unter dem System gelitten«, sagte einer aus dem Rotary-Club. »Da können wir mit der Musik eines Stasiinformanten nichts mehr anfangen.«
»Aber der Gundermann war doch mit seinen Texten auch nicht systemkonform! Soweit ich weiß, haben die den sogar aus der SED ausgeschlossen, weil er sich für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Braunkohle-Tagebau eingesetzt hat«, ereiferte sich Marianne.
»Tut mir leid, aber abends auf der Bühne groß vom Sozialismus quatschen und morgens die Freunde für die Stasi ausspionieren, das ist unverzeihlich. Von so einem Typen kann und soll man keine Musik hören.« Thorsten war Marianne über den Mund gefahren.
Sie zuckte zusammen. Sie gehörte sonst nicht zu den Menschen, die in Gesellschaft lautstarke Statements von sich gaben, und war über ihre Ansprache selbst überrascht gewesen. »Ich mein ja nur. Hinterher kann man leicht reden …«, wagte sie immerhin noch anzuschließen, doch sie wurde wiederum zurechtgewiesen, diesmal von Birgit.
»Nein, Marianne, da muss ich Thorsten jetzt mal recht geben. Du machst dir einfach keine Vorstellung davon, wie es war, in der DDR aufzuwachsen, nicht studieren zu können, weil der Vater nicht systemkonform war oder weil dein Nachbar Lügen über dich an die Stasi weitergetratscht hat. Ich hätte auch nicht die lange Apothekentradition meiner Familie weiterführen dürfen, wenn es mit der DDR so weitergegangen wäre. Wegen unseres Engagements in der Kirche hätte ich nie die Erlaubnis bekommen, Apothekerin zu werden. Das hat meinem Großvater das Herz gebrochen.«
Marianne schwieg betreten. Sie hatte im Grunde nur Birgits Geburtstagsfeier retten wollen, und statt ihr das zu danken, fiel die nun auch noch über sie her.
Birgit ihrerseits musste erstaunt feststellen, dass Detlef, der, wenn sie allein waren, immer behauptete, Marianne sei eine »dumme Nuss«, sich bemüßigt fühlte, ihr beizuspringen. Oder hatte er etwa etwas mit ihr? Detlef war, was seine Seitensprünge betraf, noch nie wählerisch gewesen. Vermutlich war es aber nur falsche Solidarität mit dem einzigen westsozialisierten Menschen neben ihm.
Als er nun aufstand, musste er sich kurz am Kamin festhalten, um nicht die Balance zu verlieren, was Birgit, die als Einzige wenig getrunken hatte, voller Verachtung beobachtete. Auch lallte er ziemlich, verschliff sämtliche Endungen. Leider war er dennoch gut zu verstehen:
»Ja, ja, Mariannchen, schau sie dir an, die Ossis, heute wollen sie alle Widerstandskämpfer gewesen sein. Ein ganzes beschissenes Land mit sechzehn Millionen Widerstandskämpfern. Aber jetzt sag ich dir mal was, das hier«, er machte eine ausladende Geste in die Runde, »sind doch alles nur ostdeutsche Hosenschisser.«
Dann drehte er sich ohne Abschied um und verschwand in die obere Etage des Hauses.
Kapitel 4
Dr. Ester Braun schloss hinter dem Ehepaar Brunner die Tür und gönnte sich trotz ihres straffen Zeitplans eine kurze Verschnaufpause.
Die CT-Untersuchungen von Frau Brunner hatten in allen Organen ein rasantes Tumorwachstum nachgewiesen. Die Chemotherapie hatte nicht angeschlagen, nahezu überall im Körper hatten sich Tochtergeschwülste angesiedelt. Seit Tagen litt die Patientin an heftigsten Schmerzen im Rücken. Jetzt wussten sie, warum: Ein Wirbelkörper war durch eine Metastase zerstört worden, zusammengebrochen und drückte auf die Nervenwurzeln.
Bei aller Professionalität und aller nötigen inneren Distanz zu den Patienten, die sie sich nach zwanzig Jahren in diesem Job angeeignet hatte, gingen ihr solche Gespräche immer noch sehr nahe. Wobei sie versuchte, sich nichts anmerken zu lassen, denn wenn die Patienten merkten, dass auch ihre Ärzte verzweifelt waren, ließen sie alle Hoffnung fahren.
Aber Hoffnung allein reichte eben nicht. Manchmal lief man dem Tumor immer nur hinterher, bekam ihn aber nicht zu packen. Bei Frau Brunner hatten sich die Metastasen seit der letzten Kontrolle massiv vermehrt. Ihre Chancen, das nächste halbe Jahr noch zu vollenden, waren gering. Falls nicht ein Wunder geschah. Aber an Wunder glaubte Dr. Braun nicht. Sie hatte während der letzten halben Stunde von Symptomkontrolle und Schmerzbehandlung gesprochen, aber nicht von Heilung. Zwischen zu viel und zu wenig Offenheit verlief ein schmaler Grat. Gegen Ende hatte sie dem Ehemann mehrere Broschüren von Hospizen in die Hand gedrückt und geraten, dort einmal Kontakt aufzunehmen.
Frau Brunner war gefasster gewesen, als Esther sie von den letzten Terminen in Erinnerung hatte, und vor allem gefasster als ihr Mann, der vor Angst erstarrt war. Manchmal schien es so zu sein, dass die Menschen, solange noch Hoffnung bestand, mit ihrem Schicksal haderten. Stand es aber einmal fest, wirkten manche erleichtert, ja fast fröhlich. Sie nahmen ihr Schicksal an und planten die verbleibende Zeit mit ihren Angehörigen. Zu diesem Menschenschlag schien Frau Brunner zu gehören. Sanft nahm sie ihrem Mann die Broschüren aus der Hand und sagte, sie hätten in den letzten Wochen doch noch einmal eine schöne Zeit zusammen gehabt, weil ihr Mann sich so liebevoll gekümmert hatte und dank der Tatsache, dass die Chemotherapie sie nicht so gequält hatte. Nun habe sie nicht angeschlagen, damit müsse man sich wohl abfinden. Oder ob es noch eine Alternative gäbe? Nein, die gab es nicht mehr. Nur noch palliative Versorgung. Frau Brunner hatte genickt und gesagt, sie wolle niemandem zur Last fallen, wünsche sich aber, dass die schrecklichen Schmerzen in der Wirbelsäule endlich nachließen.
Sie hatten sachlich über die Möglichkeiten einer palliativen Bestrahlung zur Schmerzlinderung und der medikamentösen Schmerztherapie gesprochen. Sie hatte entsprechende Rezepte und Überweisungen ausgefüllt. Der Ehemann hatte bleich danebengesessen und sich am Gespräch nicht beteiligt. Wie unterschiedlich die Menschen doch waren. Manche brachen vollends zusammen, andere schienen an der Bedrohung zu wachsen. Es kam tatsächlich immer wieder vor, dass Patienten ihre Angehörigen stützen und trösten mussten. Wie in diesem Fall. Am Ende hatte Frau Brunner ihren Ehemann aus dem Sprechzimmer geführt und beruhigend auf ihn eingeredet.
Esther Braun nahm einen Schluck von dem Pfefferminztee, von dem sie sich jeden Morgen von ihren Helferinnen eine große Kanne zubereiten ließ. Irgendwann einmal hatte sie festgestellt, dass der Tee ihr besser bekam als Kaffee, den sie früher den ganzen Tag getrunken hatte. Es war selbst angebaute und getrocknete Marokkanische Minze mit hohem Mentholgehalt. Der Tee duftete und schmeckte sehr intensiv. Sie hatte verschiedene Minzsorten angepflanzt und anfangs nicht gewusst, wie stark sie sich voneinander unterschieden. Allen gemeinsam war jedenfalls, dass sie sich im Kräuterbeet hemmungslos ausbreiteten und, wenn man nicht aufpasste, alle anderen Pflanzen verdrängten. Zum ersten Mal dachte die Ärztin darüber nach, wie ähnlich dieses Verhalten dem der Krebserkrankung war, die zu bekämpfen ihre Lebensaufgabe geworden war. Sich auf Kosten anderer auszubreiten war wohl etwas, das zum Programm der Natur dazugehörte.
Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück und gönnte sich einen ziellosen Blick aus dem Fenster, auf die kleine Gartenfläche und den mit altem Efeu bewucherten Zaun. Sie hatte sich, wie ihr Mann behauptete, im Laufe der Jahre zu einer richtigen Kräuterhexe entwickelt. Im privaten Umfeld und manchmal sogar in ihrer Praxis riet sie immer erst zu Kräutermischungen statt zu industriell gefertigten Tabletten, aber selbstverständlich gehörte sie nicht zu den Irren, die Krebserkrankungen mit Globuli behandelten. Da hielt sie sich an die Maxime: Auf einen harten Klotz gehört ein grober Keil. Und eine Tumorerkrankung war nun einmal ein harter Klotz.
In den vergangenen zwei bis drei Jahren war sie oft an sich verzweifelt. Kaum eine der von ihr verordneten Therapien schlug an. Manchmal hatte sie den Eindruck, dass die Medikamente, die sie ansetzte, überhaupt nicht mehr wirkten. Nicht nur bei Frau Brunner, auch bei anderen Patienten hatte sie beobachtet, dass die Chemotherapien, die sie verabreichte, zwar weniger Nebenwirkungen hatten als früher, aber leider auch weniger Wirkung. Es war wie verhext. Sie schien keine groben Keile mehr zur Verfügung zu haben.
Energisch schob sie die Grübeleien beiseite. Draußen warteten ihre Patienten. Sie musste weitermachen.
Aber ganz verdrängen ließ sich der Gedanke, einmal gedacht, nicht mehr. Am späten Nachmittag, nach der Sprechstunde, die Helferinnen waren schon gegangen, kam er ihr wieder in den Sinn:
Warum ist der Keil auf einmal nicht mehr grob genug?
Entschlossen griff sie zum Telefonhörer und wählte die Nummer der onkologischen Fachapotheke, die ihr seit Jahren die Infusionslösungen der Zytostatika lieferte. Das machte nicht jede Apotheke. Für die Zubereitung dieser Medikamente gab es »GMP«-Standards, »Good Manufacturing Practice«-Standards, die entsprechenden Betriebe mussten sich zertifizieren lassen und dafür sorgen, dass die Infusionslösungen zeitgenau zum Tag der Applikation frisch zubereitet und geliefert wurden. Mit der Adler-Apotheke in Köpenick arbeitete sie nun schon viele Jahre zusammen, bereits mit dem Vater von Birgit von Theising hatte sie einen regen Austausch gepflegt.
Nach wenigen Klingeltönen meldete sich Frau von Theising persönlich.
Kapitel 5
Thorsten Brunner betrat etwas abgehetzt das Hospiz. Er war bei der Arbeit gewesen, als ihn der Anruf erreichte. Er war sofort losgefahren. Sie hatten gesagt, dass er sich beeilen müsse.
Eigentlich hatte er sich wieder beurlauben lassen wollen, als Elke ins Hospiz gegangen war. Aber Elke hatte darauf bestanden, dass das nicht nötig sei. So schnell würde es mit dem Sterben schon nicht gehen, hatte sie behauptet. Erst hatte er sich gesträubt, dann aber nachgegeben. Es war bei der Arbeit im Moment auch wirklich schwierig wegzubleiben. Eine Kollegin war in Erziehungszeit gegangen, ein anderer lag mit einem Herzinfarkt im Krankenhaus. Trotzdem wusste er jetzt, dass es falsch gewesen war, auf sie zu hören.
Die Eingangshalle der zweistöckigen Einrichtung war weitläufig und freundlich mit hellem Holz und Pastellfarben gestaltet. Sesselgruppen luden zum Verweilen ein. Aber Thorsten hatte hier noch nie jemanden sitzen sehen. In einer Ecke des Flures gleich neben den Aufzügen hatte er am ersten Tag, als er seine Frau abgeliefert hatte und bedrückt allein nach Hause ging, ein Tischchen entdeckt. Neben frischen Blumen und einer flackernden Kerze, die vermutlich aus Sicherheitsgründen eine elektrische Nachbildung war, lag ein aufgeschlagenes Ringbuch. Auf der linken Seite ein auf Papier ausgedrucktes Foto von Menschen, die hier kürzlich gestorben waren, auf der rechten Seite waren die Daten des Betroffenen in verschnörkelter Schriftart zu lesen. Jeweils in Kombination mit einem Spruch, wie man ihn auf Trauerkarten finden konnte.
Wie viele Sprüche die wohl in petto hatten? Und was machen sie eigentlich, wenn gleich zwei oder drei an einem Tag sterben?, war ihm durch den Kopf gegangen. Legen sie dann weitere Ringbücher aus oder blättern sie einfach um und heften die neuen Seiten ein?
Er hatte bis zum Anfang zurückgeblättert und keine zwei Einträge vom selben Tag gefunden. Offenbar hatten die Sterbenden sich diszipliniert verhalten. Aber die Trauersprüche wiederholten sich irgendwann.
Thorsten drückte den Aufzugknopf in beide Richtungen. Er wusste, dass es dadurch nicht schneller ging, machte es aber trotzdem immer. Sein Blick fiel auf das Ringbuch.
Man sieht die Sonne langsam untergehen und erschrickt doch, wenn es plötzlich dunkel ist. (Franz Kafka)
Wir verabschieden uns von unserer Mitbewohnerin
Elke Brunner,
geboren am 11. Mai 1974,
friedlich eingeschlafen am 4. April 2022 um 14 Uhr.
Erst verstand er gar nicht, was er da las, dann erkannte er auf dem Foto seine Frau. Ein Bild aus jüngster Zeit, als man ihr die tödliche Krankheit schon ansah. Er kannte das Foto nicht, aber er wusste, sie hatten es mit ihrem Einverständnis gleich bei ihrem Einzug gemacht. Thorsten hatte sich bei den Aufnahmeformalitäten von der freundlichen Professionalität, mit der zu Beginn schon der »perfekte« Abgang geplant wurde, abgestoßen gefühlt. Elke hatte es einfach abgenickt.
Aber jetzt riss es ihm den Boden unter den Füßen weg. Von einem Strudel erfasst, ließ er sich auf einen der Sessel sinken und schloss die Augen. Einen Moment lang wusste er nicht, wo er war und was passiert war. Als wenn etwas alle Gedanken und Gefühle abgesaugt hätte. Nur mühsam fing er sich wieder. Irgendwann schaute er auf die Uhr. Es war kurz nach drei. Ärger und Groll stiegen in ihm auf. Er fühlte, wie ihm ganz heiß wurde. Obwohl er sich so beeilt hatte, hatte er es offenbar nicht mehr rechtzeitig geschafft, und eine Stunde nach ihrem Tod waren schon die vermutlich im Qualitätshandbuch für gutes Sterben festgelegten Auszugsrituale der Einrichtung in Gang gesetzt. Oder hatten sie die schon angeleiert, obwohl sie oben noch mit dem Tod rang? Am liebsten hätte er die Blumenvase mit den stinkenden Lilien gegen die Wand geworfen und der dämlichen elektrischen Kerze den Docht abgewürgt, aber er beherrschte sich. Er hatte mal irgendwo gelesen, dass Ärger oft ein sekundäres Gefühl ist, wenn man das dahinterliegende eigentliche Gefühl einfach nicht aushalten kann.
Eigentlich waren sie im Hospiz alle sehr nett gewesen. Elke war es hier gut gegangen. Soweit Sterben eben gut gehen konnte. Eine große Erleichterung für alle, weil es zu Hause immer schwieriger wurde, die Schmerzen immer unerträglicher und er immer hilfloser. Es hatte einige Tage gedauert, bis ein Platz frei geworden war. »Es muss erst noch wieder einer sterben, bis sie mich aufnehmen können«, hatte sie lakonisch gesagt und dann gelacht, als hätte sie einen Witz gemacht. Er hatte mitgelacht, aber das Lachen hatte sich falsch angefühlt.
Der Aufzug war schon mehrere Male angekommen, hatte Menschen ausgeschüttet oder aufgenommen und war nun irgendwo im Haus unterwegs. Thorsten stand auf und lief die zwei Treppen hoch zur Station, um sich von seiner Frau zu verabschieden.
Kapitel 6
Emma Hohlfeld wuschelte Simon zärtlich durchs Haar. Sie hatte ihm gerade Kaffee nachgeschenkt, er schnurrte kurz wie eine Katze, ließ sich darüber hinaus aber nicht von den Nachrichten auf seinem Smartphone ablenken. Sie hatten an diesem Sonntagmorgen lange geschlafen und ausgiebig gefrühstückt und saßen nun noch in der Küche von Emmas Großmutter. Simon hatte sich einen Joint gedreht. Eigentlich war es jetzt Emmas Küche, denn sie hatte das kleine Siedlerhaus im Kietzerfeld in Köpenick, einem Bezirk im Südosten Berlins, vor einem Dreivierteljahr von ihrer Großmutter geerbt. Bisher hatte sie nichts verändert, selbst der Nippes, den die Oma gesammelt hatte, stand noch herum, wenn auch mit einer dickeren Staubschicht bedeckt als früher. Simon hatte immer wieder mal versucht, das eine oder andere Teil in einer Schublade verschwinden zu lassen. Seinem Designerblick missfielen die kitschigen Figuren, die Blumentöpfchen und Makramee-Gehänge, aber Emma hatte alles wieder hervorgeholt. Nicht, weil ihr die Sachen so gut gefielen, aber es wäre ihr wie Verrat vorgekommen, so als würde sie den Geist der Großmutter aus ihrem Haus verjagen, jedenfalls so kurz nach ihrem Tod. Und so sah es überall im Haus noch immer so aus, als wäre Oma Kitty nur kurz zum Einkaufen gegangen. Dabei war es nicht allein Sentimentalität, die Emma so handeln ließ. Wenn Simon sich hätte entscheiden können, mit ihr zusammenzuziehen, hätte sie sich nicht dagegen gesträubt, das ganze Haus zu entkernen und gemeinsam wieder aufzubauen. Aber Simon konnte sich nicht entscheiden. Er kam und ging, wie es ihm passte.
»Kannst du nicht endlich mit dem Kiffen aufhören, Simi?«
Simon blickte nicht auf. »Ich rauch doch kaum noch was. Ich brauch das ab und zu zum Entspannen, zum Einschlafen, ich schlaf sonst nicht gut, das weißt du doch.«
»Zum Einschlafen«, echote Emma und schaute auf die Küchenuhr, die munter vor sich hin tickte. »Du hast gerade geschlafen, es ist zwölf Uhr.«
Simon überlegte kurz und sagte dann: »Aber heute ist Sonntag, und nächste Woche ist Ostern.« Dann tippte er weiter auf seinem Smartphone herum. Es entstand eine längere Pause.
»Hallo, ich spreche mit dir! Kannst du dein Handy mal kurz zur Seite legen?«
»Wieso machst du immer alles so kompliziert, Emma? Du hast doch früher auch nichts gegen einen Joint einzuwenden gehabt.«
»Das habe ich immer noch nicht. Ab und zu. Aber du rauchst jeden Tag, du hängst nur noch rum, machst du eigentlich noch irgendwas im Studium? Du hast schon lange nichts mehr über Projekte erzählt. Hast du in diesem Semester irgendeinen Schein gemacht?«
Jetzt sah Simon leicht genervt auf. »Du quatschst echt langsam wie meine Mutter. Ich habe das im Griff, keine Sorge.« Er nahm noch einen Zug, dann grinste er breit, legte den Joint beiseite, stand auf, nahm sie in den Arm und küsste sie.
Kurz versank sie in seinem Geruch, seiner Wärme, die Sicherheit und Geborgenheit ausstrahlten. Er hatte so eine Art, Menschen mit einem Lächeln, einer Geste, seinem sympathischen Aussehen für sich einzunehmen, die auch bei ihr nicht wirkungslos blieb, aber diesmal wollte sie sich nicht einlullen lassen. Sie stieß ihn beiseite, ging zu seiner Jacke, die über der Lehne eines Küchenstuhls hing, griff in die Innentasche, zog ein Bündel hervor und warf es auf den Tisch.
»Ich will, dass du aufhörst mit dem Dope, und vor allem will ich, dass du aufhörst, mit dem Zeug zu handeln und es in mein Haus zu schleppen.«
Wütend starrte Simon auf den Tisch.
»Wühlst du jetzt in meinen Sachen?«
Emma versuchte, sich zusammenzureißen, aber es gelang ihr nicht. Sie war sauer. »Das da«, sie zeigte auf das Päckchen auf dem Küchentisch, »ist mehr als ein bisschen Dope für den Eigenbedarf. Du vertickst das, und damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin froh, dass ich das hinter mir habe, dass ich eine Stelle habe. Ich will mich von niemandem mehr da hineinziehen lassen, auch nicht von dir.«
Simon versuchte einzulenken. »Ich will das doch auch nicht mehr. Ich stecke nur gerade in einem kleinen Engpass. Meine Eltern haben mir den Geldhahn zugedreht. Ich weiß gerade nicht, wovon ich meine Miete bezahlen soll.«
»Du steckst in Engpässen, seit ich dich kenne. Wenn du bei mir wohnen würdest, könntest du Geld sparen.«
Simon stöhnte. »Nicht schon wieder diese Leier, Emma. Ich kann hier nicht leben, schau dich doch mal um, das ist das Mausoleum deiner Oma, keine Wohnung. Außerdem ist das hier am Arsch der Welt, ich habe gestern wegen Schienenersatzverkehr wieder über eine Stunde gebraucht, um zu dir rauszukommen. Ich bin jung, ich will noch nicht mit jemandem zusammenwohnen wie ein altes Ehepaar.« Er stand auf, nahm seinen Kaffee, ging zum Fenster und schaute verstockt hinaus, als sei die Straße interessanter als das Gespräch mit ihr.