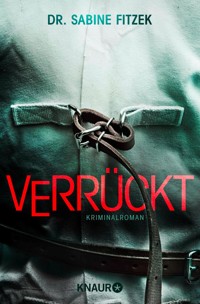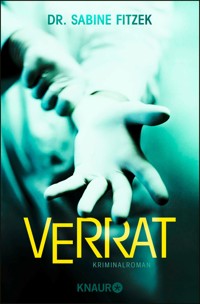
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kammowski ermittelt
- Sprache: Deutsch
Hochspannend und beklemmend nah an der Realität: wenn ein Menschenleben zum Kostenfaktor wird. Für Hauptkommissar Matthias Kammowski ist nicht nur das Wetter ein Schock, als er aus dem Kuba-Urlaub in die Berliner Kälte zurückkommt: In sein Einzelbüro – ein Privileg, das er seit Jahren erfolgreich verteidigt – hat man ihm eine junge Kollegin gesetzt, die er einarbeiten soll. Und zwar gleich mit einem brisanten Mordfall, denn der Geschäftsführer eines katholischen Klinikunternehmens wurde tot in einem Berliner Hotel aufgefunden. Als Kammowski dann auch noch Besuch von der Journalistin Christine erhält, einer alten Freundin, die ihm eine haarsträubende Verschwörungstheorie über mafiose Zustände im Berliner Gesundheitssystem präsentiert, hat der Kommissar endgültig genug. Doch dann entgeht Christine nur knapp einem Anschlag auf ihr Leben … »Verrat« ist der erste Teil einer Krimi-Reihe, die sich spannend und hochkompetent die jüngsten Skandale im Gesundheitswesen vornimmt. Die Autorin Sabine Fitzek ist Neurologin und hat über 10 Jahre als Chefärztin gearbeitet. Beste Unterhaltung für Fans von Polit-Krimis und Spannungsromanen mit gesellschaftskritischem Hintergrund. Die Medizin-Krimis mit Kommissar Kammowski aus Berlin sind in folgender Reihenfolge erschienen: • »Verrat« • »Verrückt« • »Verstorben«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 404
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Dr. Sabine Fitzek
Verrat
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Seit ihr Mann Thomas, ein angesehener Neurologe, Selbstmord begangen hat, sucht die Journalistin Christine nach einer Erklärung. Als nun Thomas’ ehemaliger Chef Kai Steinkopf tot in einem Berliner Hotel aufgefunden wird, ist ihr klar, dass es einen Zusammenhang geben muss. Steinkopf, Geschäftsführer eines Klinikunternehmens, war bekannt dafür, dass ihm der Gewinn wichtiger war als das Patientenwohl. Um an die Drahtzieher heranzukommen, ist Christine allerdings auf Hilfe angewiesen. Doch wird Hauptkommissar Matthias Kammowski ihr nur aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit Glauben schenken?
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
Epilog
Nachtrag
Danksagung
In einem der größten Abrechnungsskandale der Bundesrepublik ermittelte die Berliner Staatsanwaltschaft 2010 gegen rund 140 Ärzte wegen des Verdachts des banden- und erwerbsmäßigen Betrugs in Medizinischen Versorgungszentren (MVZ). In den meisten Fällen wurde keine Anklage erhoben. Die Verfahren gegen die Hauptbeschuldigten wurden im August 2016 gemäß § 153a Abs. 2 StPO gegen Zahlung einer Geldstrafe eingestellt.
Bei dem vorliegenden Roman handelt es sich um eine fiktive Erzählung vor dem Hintergrund teils realer, teils erdachter Geschehnisse. Die Personen der Handlung sind frei erfunden.
Prolog
Berliner Gazette
Polizei entlarvt Ärztebande – Krankenkassen um Millionen betrogen – Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt
In einer Großrazzia durchsuchten am Dienstag mehr als 300 Polizisten mehrere medizinische Einrichtungen der Barmherzigen Schwestern zu Bernau und Privatwohnungen von Ärzten in Berlin und im ganzen Bundesgebiet. Staatsanwältin Petermann geht von gewerbs- und bandenmäßigem Betrug in Millionenhöhe aus. Der Geschäftsführer und zwei Ärzte wurden verhaftet, gegen weitere 93 Ärzte wird ermittelt. Die kriminelle Bande soll gegenüber den Krankenkassen systematisch falsch abgerechnet und in die eigene Tasche gewirtschaftet haben. Es werde noch geprüft, ob dadurch auch Patienten zu Schaden kamen, so Staatsanwältin Petermann gegenüber der Berliner Gazette.
Der Klinikkonzern hat derweil Konsequenzen gezogen. »Wir werden der Angelegenheit konsequent nachgehen und vollumfänglich mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten«, sagte der von den Barmherzigen Schwestern zu Bernau neu berufene Geschäftsführer Kai Steinkopf. »Sollte es in unserem Betrieb Fehlverhalten Einzelner gegeben haben, werden wir das unverzüglich aufklären.« Bis zum Abschluss der Gerichtsverfahren gelte aber selbstverständlich das Unschuldsprinzip.
M.G.
1
Kammowski
Sonntag, 9. Februar
Frauen sind immer so schnell enttäuscht«, sagte Klaus, »dabei bedeutet ›enttäuscht sein‹ im eigentlichen Wortsinn doch nur, dass die Täuschung vorbei ist. Man ist ent-täuscht, man sieht wieder klar. Darüber könnten sie sich doch freuen. Stattdessen sehen sie rot und hauen ab.«
»Ist das von dir?« Kammowski nahm noch einen Schluck. Wenn Klaus, sein bester Freund und Backgammonpartner, philosophisch wurde, hatte er in der Regel zu viel getrunken.
»Nein«, gab Klaus zu. »Hätte aber von mir sein können. Habe ich neulich in einem Interview in der Zeit gelesen. Ist von so ’nem Tatortautor.«
»Hast du Probleme mit Ina?«
Klaus zuckte die Achseln. »Wie man’s nimmt. Könnte besser laufen.«
Kammowski kannte Klaus seit der Grundschulzeit in Dinslaken. Sie waren in derselben Straße aufgewachsen, hatten zusammen die Frösche und Ringelnattern des Rotbachs das Fürchten gelehrt, hatten so manches illegale Feuer am Rheinufer abgefackelt und darin von den Feldern erbeutete Kartoffeln geröstet.
Diese unbeschwerte Zeit hatte ein Ende gefunden, als Klaus’ Eltern, beide Lehrer, meinten, das humanistische Gymnasium in Duisburg sei besser für ihren Sohn, wohingegen Kammowski im deutlich näher gelegenen naturwissenschaftlichen Gymnasium von Dinslaken angemeldet wurde.
Aber Klaus und er hatten sich dennoch nie ganz aus den Augen verloren. Nach der Schulzeit hatten sie zum Leidwesen der Eltern, die gravierende Gegenargumente vorbrachten (Klaus’ Eltern) beziehungsweise mit Entzug von Liebe, Kontakt und Erbe drohten (Kammowskis Eltern), gemeinsam den Plan ausgeheckt, nach Berlin zu ziehen, um der westdeutschen Bundeswehr zu entgehen.
Klaus hatte Lehramt studiert und unterrichtete Deutsch und Geschichte an einem Berliner Gymnasium. Kammowski hatte es mit Jura versucht, war gescheitert und letztendlich bei der Polizei gelandet.
Klaus war so ziemlich der Einzige seiner Freunde aus der Jugendzeit, den er noch regelmäßig traf. Meist verabredeten sie sich auf ein Bier in ihrer Stammkneipe, dem Sandmann.
Klaus war intelligent, belesen, er sah gut aus und hatte Charisma, und doch hatte er mit den Frauen kein Glück. Oder zu viel Glück, wie man es nahm. Während Klaus wie jedermann mit den Jahren älter wurde, wenngleich er sich mit regelmäßigem Training einen stattlichen Muskelansatz und eine schlanke Statur bewahrte, blieben seine Frauen auf wundersame Weise immer im selben Alter – Mitte zwanzig. Sie waren jung, schön, in der Regel intelligent, aber doch wohl nie auf Augenhöhe. Oder, wenn man diese Wertung herausnehmen wollte: Sie waren Lebensabschnittspartnerinnen, die sich zwar parallel, aber doch in sehr unterschiedlichen Lebensabschnitten bewegten, was eine Zeit lang gut ging, bis ihnen klar wurde, dass aus dem Synchronspiel wohl nie ein gemeinsamer Weg werden würde. Irgendwann stellten die Frauen Ansprüche, die zu erfüllen er nicht gewillt oder nicht fähig war. Dann fiel ihm auf, dass der Altersunterschied doch recht groß war und dass sich das, was seine Frauen vom Leben erwarteten, nicht mit seinen Vorstellungen deckte. Er ging auf Distanz, dozierte über die Notwendigkeit der Erhaltung von Individualität und Unabhängigkeit in der Liebe und wurde am Ende verlassen. Kammowski hatte es noch nie erlebt, dass Klaus diesen Schritt einmal selbst getan hätte. Aber er machte auch keinen auf die jeweilige Partnerin zu. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass Liebe auch Veränderung mit sich bringen musste, dass Kompromisse notwendig waren. Manchmal kamen die Frauen dann zu Kammowski, seinem besten Freund. Aber was hätte er tun können?
»Fragt sich jetzt nur, ob der Typ sie enttäuscht hat oder ob sie sich in dem Mann getäuscht haben, was aber letztlich aufs Gleiche rauskommt«, nahm Kammowski den Faden wieder auf und beendete das sechste Spiel endlich mit einem Sieg.
»Wie meinst du das denn?«, empörte sich Klaus und winkte Anke, der Bedienung, nach zwei weiteren Bier.
»Lass mal gut sein«, sagte Kammowski mit einem Blick auf die Uhr. »Ich muss morgen früh raus.«
»Was ist denn heute mit dir los?«, fragte Klaus.
»Mir steckt noch der Jetlag in den Knochen. Und ich bin, wie du weißt, ein hart arbeitender Kriminalbeamter und kein Lehrer …«
»… der halbtags arbeitet und für ganztags Geld bekommt«, ergänzte Klaus grinsend. Er kannte die blöden Sprüche seines Freundes zur Genüge und nahm sie ihm nicht übel.
»Nein, wirklich. Ich muss morgen um acht im LKA sein. Wir sehen uns, grüß Ina von mir.« Kammowski stand auf, zahlte seinen Deckel und ging die fünfzehn Minuten zu seiner Wohnung in der Bergmannstraße. Erst als er die Haustür aufschloss, fiel ihm ein, dass der Gruß für Ina vielleicht nicht so passend gewesen war.
2
Michael
Sonntag, 9. Februar
Der junge Mann stolperte aus dem Zimmer auf den Flur hinaus und zog die Tür hinter sich zu. Dass sie nicht ganz ins Schloss fiel, registrierte er nicht. Tränen und Verzweiflung gaben seinem noch jungenhaften Gesicht etwas Fratzenhaftes. Der Hotelflur verengte sich röhrenförmig vor seinen Augen. Es war, als schwappten die Wände eines endlosen Tunnels in Wellen auf ihn zu. Orientierungslos tastete er sich voran, fast wäre er über seine eigenen Hosenbeine gestolpert. Er hatte vergessen, den Gürtel anzulegen, und nun geriet ihm die rutschende Hose unter die Füße. Hastig zerrte er sie wieder nach oben und hielt sie am Bund gerafft, während er sich mit der anderen Hand weiter die Wand entlangtastete. Er schnappte nach Luft. Wie aus weiter Ferne hörte er seine Atemzüge, unheimliche, maschinenartige Laute, die nichts mehr mit ihm und seinem Körper zu tun hatten. Die Atemnot nahm zu. Seine Hände kribbelten und verkrampften sich. Ein letzter Rest an Verstand sagte ihm, dass das nur eine seiner Panikattacken war. Er versuchte, seine Atmung zu zügeln. Aber die war im Moment komplett der willentlichen Steuerung entzogen. Irgendeine Art innerer Automat zwang ihm ein unmenschliches Tempo auf: Ein-Aus-Ein-Aus.
Eigentlich wusste Michael, was zu tun war: Sich laut und deutlich sagen, dass das hier nicht der Tod war, sondern nur ein lästiger Automatismus seines Körpers. Ein Relikt aus Zeiten, als der Mensch noch Beutetier war und sich nur mit Aufbietung letzter Adrenalinreserven vor dem Tod retten konnte. In derartigen Situationen war es ja durchaus sinnvoll, wenn sich das Herz beschleunigte und alle Energiereserven in die Muskeln gepumpt wurden. Aber in einem Berliner Hotel war diese Art von Automatismus in der Regel komplett überflüssig, denn die Herausforderungen und Komplikationen des modernen Lebens waren meist nicht mit einer Adrenalinflut zu beherrschen.
Er musste endlich langsamer atmen: Einundzwanzig, einatmen, zweiundzwanzig, ausatmen … diesmal gelang es ihm besser, die Atmung zu steuern. Jetzt nur rasch raus an die frische Luft.
Er war am Fahrstuhl angekommen. Wo war die Treppe? Die Vorstellung, jetzt im engen Lift fahren zu müssen, ließ seine Panik erneut aufflackern.
Er drehte sich einmal um die eigene Achse, konnte aber das Treppenhaus nicht finden. War das etwa am anderen Ende des Flurs?
Unvermittelt öffnete sich die Fahrstuhltür. Fast wäre er mit einem älteren Mann zusammengestoßen. Einen Moment lang kamen sie einander ganz nah, erschraken, und der junge Mann meinte, einen strengen Atem wahrzunehmen, der ihn instinktiv zurückweichen ließ. Aber er hätte, wenn man ihn später dazu befragt hätte, nicht sagen können, wie dieser Mann ausgesehen hatte, noch, wie er gerochen hatte; er hätte sich wohl nicht einmal an den Zwischenfall selbst erinnert.
Der Schmerz, den Kai ihm soeben zugefügt hatte, hatte die Welt zum Stillstand gebracht. Und als sie sich wieder zu drehen begann, war nichts mehr wie vorher gewesen. Nun irrte er durch die klirrend kalte Nacht, die von einem fernen Vollmond in ein fahles Licht getaucht wurde. Jeder seiner immer noch heftigen Atemzüge schmerzte wie tausend kleine Messerstiche in der Lunge, aber die Kälte ließ ihn etwas klarer werden. Da endlich stieg Wut in ihm hoch, und er schwor sich nicht zum ersten Mal, dass er nie wieder auf diesen Scheißkerl hereinfallen würde.
Michael irrte ziellos durch das nächtliche Berlin. Immer noch liefen Tränen über seine Wangen, war sein Gesicht vor Kummer verzerrt. Passanten sahen ihm neugierig oder mitleidig nach. Er merkte es nicht.
Bei dem Telefonat am Nachmittag hatte Kai ihn wieder einmal um den Finger gewickelt. Er hätte es wissen können und müssen. Wieder und wieder hatte sich das nun schon so oder so ähnlich abgespielt. Aber auch diesmal hatte er wohl nur das herausgehört, was er hören wollte. »Die Liebe urteilt nicht, und sie trägt nichts nach«, hatte er einmal gelesen. Das hatte ihm gefallen, und so hatte er sich nach jeder Enttäuschung wieder auf ihn eingelassen, hatte seine eigenen Gefühle auf sein Gegenüber projiziert und gehofft, dass es diesmal anders sein würde.
Aber heute war Michael sich so sicher gewesen. Kai schien endlich verstanden zu haben, dass es hier um ihre Liebe ging!
Den restlichen Tag war er in Hochstimmung gewesen. Er hatte die Arbeit in der Fahrradwerkstatt früher beenden können, er hatte ja genügend Überstunden und einen netten Chef. Im Winter war ohnehin nicht so viel zu tun. Er hatte an gar nichts anderes denken können als an Kai. Wie schön er war in seinen eleganten Anzügen mit dem gut trainierten Körper! Nach außen wirkte er selbstsicher und dominant, und in Wirklichkeit war er so empfindsam und anschmiegsam. Nie hätte man vermutet, dass er beim Liebesspiel lieber die passive Rolle einnahm. Vielleicht brauchte er das auch als Ausgleich für seine Rolle im Beruf, in der ja Dominanz erwartet wurde. Ihm hatte das gefallen. Die meisten Männer hatten in ihm, Michael, eher den passiven Partner gesehen. Dass er bei Kai meist die Führung übernehmen durfte, hatte ihn dem verhängnisvollen Irrtum erliegen lassen, dass er auch in der Beziehung selbst etwas mitzureden hatte.
Er kaufte einen ordentlichen Sekt, er wollte schließlich auch etwas beitragen zum Tête-à-Tête. Kai zahlte stets das Zimmer. Dann ging er nach Hause, badete ausgiebig, rasierte sich am ganzen Körper, benutzte ein Aftershave, von dem er wusste, dass Kai es gut an ihm leiden konnte, zog sich sorgfältig an. Kai hasste es, wenn man nachlässig gekleidet war. Schließlich machte er sich zum Treffpunkt auf. Wie schade, dass sie sich immer heimlich in einem Hotel trafen. Aber er musste zugeben, seine Wohnung entsprach nicht ganz Kais Ansprüchen, und bei ihm konnten sie sich ja nicht treffen.
Aber das sollte jetzt anders werden! Sonst hätte Kai heute nicht angerufen.
»Ich bin so glücklich, dass du es dir anders überlegt hast«, hatte Michael geflüstert, als Kai die Zimmertür öffnete und ihn anlächelte. Statt einer Antwort hatte Kai ihn beim Nacken gepackt, ihn an sich gezogen, hatte ihn geküsst und seinen Gürtel mit eiligen Griffen geöffnet. Als der Ledergürtel mit der metallenen Gürtelschnalle voraus zu Boden fiel und dabei ein leises Klacken von sich gab, war er schon nicht mehr Herr seiner Gedanken und Gefühle gewesen.
Später tranken sie von dem Sekt, rauchten, alberten herum und lagen sich schließlich träge und schläfrig in den Armen.
»So müsste es jeden Abend sein«, sagte Michael träumerisch, »wir lieben uns und gehen dann gemeinsam ins Bett.«
»Genau, und dann liest du mir noch eine Gutenachtgeschichte vor und schaukelst mich in den Schlaf.«
Michael lächelte, und in Ermangelung eines besseren Lesestoffs angelte er die Gideon-Bibel, die in allen Hotels dieser Welt wohl zu finden ist, aus dem Nachtschrank und schickte sich an, daraus vorzulesen, was Kai aber lachend zu verhindern wusste, indem er versuchte, ihm das Buch aus der Hand zu schlagen. Bei der Rangelei stießen sie den Nachttisch um, der polternd auf der Seite aufschlug.
»Das lass mal lieber, du weißt, was der Papst von uns schwulen Sündern sagt.«
Michael hätte nicht zu sagen gewusst, wann sie das letzte Mal gemeinsam so ausgelassen gewesen waren. Daher traf ihn Kais Antwort auf seine Frage, ob sie jetzt schlafen oder lieber noch etwas unternehmen wollten, wie ein Fausthieb mitten in den Magen.
»Ich muss jetzt nach Hause. Meine Frau hat das mit uns herausgefunden, und ich musste ihr versprechen, die Sache zu beenden.« Und als er merkte, wie sehr Michael diese Worte trafen, setzte er mit betonter Härte in der Stimme nach: »Jetzt starr mich nicht so an. Du weißt doch, wie es ist. Wir können nicht einfach so weitermachen. Es ist zu gefährlich geworden. Das hier sollte unser Abschiedstreffen sein.«
»Soll das heißen, dass du dich gar nicht von ihr trennen wolltest?«, flüsterte Michael entgeistert. »Aber warum hast du dich dann heute wieder mit mir getroffen? Wie kannst du mir das antun? Ich habe dir gesagt, dass ich dich nur wiedersehen will, wenn du endlich zu uns stehst!« Er hatte Kai jetzt am Arm ergriffen und schüttelte ihn, doch Kai war bedeutend kräftiger als der androgyne Michael und wehrte ihn mit Leichtigkeit ab. Die Kälte, die jetzt aus Kais stahlblauen Augen sprach, während er sich eine Zigarette anzündete, brachte Michael gänzlich zum Verstummen.
»Reiß dich zusammen, und hör auf, dich wie ein Kind zu benehmen!«, herrschte Kai ihn an. »Werde endlich erwachsen! Wir hatten unseren Spaß, aber ich habe keine Lust auf jemanden, der klammert. Du kannst doch nicht ernsthaft geglaubt haben, dass ich mich mit einem wie dir länger abgebe. Ich kann es mir in meiner Stellung nicht erlauben, mich öffentlich mit einem kleinen Strichjungen sehen zu lassen. Und wegen dem bisschen Sex werde ich gewiss nicht meine Karriere und meine Ehe aufs Spiel setzen.«
Er musterte Michael von oben bis unten, als wolle er seinen Wert abschätzen. »Ich glaube, du verpisst dich jetzt besser, und ruf mich nicht noch mal an, wir sind fertig miteinander!«
3
Karl-Heinz Peters
Sonntag, 9. Februar
Karl-Heinz Peters konnte nicht schlafen. Obwohl er seit Jahren so tat, als bekäme er von den Eheproblemen seiner Tochter nichts mit, hatte er bei seinen Besuchen alles registriert. Er hielt allerdings nichts davon, sich ungefragt in die Probleme anderer einzumischen.
Karl-Heinz Peters war in der DDR aufgewachsen. Als Funktionärssohn hatte er in Moskau studiert und später einige Jahre bei der Stasi gearbeitet. Aufgrund seiner exzellenten Sprachkenntnisse – er sprach fließend Russisch und Arabisch und ganz gut Farsi – war er später für die Regierung der DDR im Außenhandel tätig gewesen. Er war »Reisekader«, und so lebten sie wahrlich nicht schlecht. Nach der Wende gab er sich keinen Illusionen hin: Mit seiner Vergangenheit sah er für sich im Staatsdienst des vereinten Deutschland keine Chancen. Aber er hatte noch viele Kontakte in der ehemaligen Sowjetunion und im Irak. Also hatte er sich selbstständig gemacht und vermittelte seither den ehemaligen Partnerländern Reparaturen und Neubauten industrieller Großanlagen, vor allem Kraftwerke. Karl-Heinz Peters war auch im neuen Deutschland sehr erfolgreich. Allerdings lebte er kaum noch hier. Nach dem Tod seiner Frau hatte er aus steuerlichen Gründen seinen Wohnsitz in den Irak verlegt. Er kam nur noch zu Besuch und wohnte dann bei einer seiner Töchter. Die eine lebte in Stuttgart, die andere in Berlin.
Jetzt war er seit drei Wochen in Berlin, und was er beobachtete, gefiel ihm nicht. Die letzte Woche hatte er Olga und Kai immer wieder streiten gehört. Dann war sein Schwiegersohn kaum noch nach Hause gekommen. Seine Tochter war mit verquollenen Augen herumgelaufen, was sie mit einer Allergie erklärte. Aber er hatte Augen und Ohren im Kopf.
Sein Schwiegersohn hatte ihm noch nie besonders gefallen, aber keiner seiner Schwiegersöhne gefiel ihm. Welcher Vater konnte sich schon mit seinen Schwiegersöhnen anfreunden, das sah er realistisch. Doch dieser Kai war ihm von Beginn an suspekt gewesen. Er war ihm geradezu körperlich unangenehm. Nach außen war er freundlich, höflich, zuvorkommend, auch ihm gegenüber. Aber seine Augen sprachen oft eine andere Sprache. Ihn, Karl-Heinz Peters, konnte man nicht täuschen. Da hatte er es schon mit ganz anderen Kalibern zu tun gehabt. Natürlich hatte er alte Kontakte genutzt und ihn überprüfen lassen, aber nichts Gravierendes gefunden und es dann aufgegeben.
Und in den ersten Jahren der Ehe war seine Tochter ganz offensichtlich glücklich gewesen. Sie bekamen drei reizende Kinder. Kai war ehrgeizig. Er hatte sich vom Steuerberater zum Geschäftsführer eines großen Klinikkonzerns hochgearbeitet und verdiente nicht schlecht. Das musste man ihm lassen. Er hatte dieses teure Haus hier in Potsdam gekauft, und mit den Kindern ging er liebevoll um – wenn er mal da war. Aber dafür hatte Peters Verständnis. Ein Mann, der sich eine Karriere aufbauen wollte, konnte seine Zeit nicht auf dem Spielplatz vergeuden. Auch er hatte die Kindererziehung seiner Frau überlassen, und für ihn war es selbstverständlich, dass seine Tochter nach der Geburt des ersten Kindes ihre Arbeit als Übersetzerin weitgehend aufgegeben hatte und sich nur noch um die Familie kümmerte.
Aber zwischen den beiden stimmte es nicht mehr, da war er sich inzwischen sicher. Heute Abend war Kai wieder weggefahren, angeblich, um noch zu arbeiten. Am Sonntagabend, wer sollte das glauben? Kurze Zeit später hatte er gehört, wie auch seine Tochter das Haus verließ. Gut, dass die Kinder nichts mitbekamen, die schliefen. Und wie gut, dass er da war, die konnten doch nicht einfach beide wegfahren und die Kinder alleine lassen, ohne das mit ihm abzusprechen! Das war auch nicht Olgas Art. Peters war jetzt aufs Höchste alarmiert.
Er streifte durch das Haus auf der Suche nach Hinweisen. Nach kurzem Zögern nahm er sich auch Olgas Schreibtisch vor. Er war es gewohnt, vorsichtig zu sein, sie würde nichts bemerken. Er wusste, wonach er suchte. Olga schrieb seit ihrer Jugend Tagebuch. Doch dann fiel ihm ein achtlos in die Schublade geworfener Briefumschlag in die Hände. Ohne zu zögern, öffnete er ihn. Er enthielt Fotos und die Visitenkarte eines Privatdetektivs Ostermeier.
»Ts, ts, ts«, zischte Peters leise durch die Zähne. Da hatte er doch in die Vollen getroffen.
Offenbar hatte Olga Kai beschatten lassen. Kluges Mädchen. Aber was dieser Privatdetektiv Ostermeier herausgefunden hatte, schlug dem Fass den Boden aus. Die Fotos zeigten seinen lachenden Schwiegersohn im Park spazieren gehend, eng umschlungen mit einem deutlich jüngeren Mann.
Karl-Heinz Peters schoss das Blut in die Schläfen, seine Beine begannen zu zittern. Er zog den Schreibtischstuhl zu sich heran und ließ sich darauf fallen. Sein Schwiegersohn trieb sich mit Männern herum! Das erklärte einiges, für das er in den letzten Jahren keine Erklärung gehabt hatte. Er hatte es doch gewusst, mit dem Kerl stimmte etwas nicht. In Karl-Heinz Peters stieg kalte Wut auf.
4
Kai Steinkopf
Montagfrüh, 10. Februar
Kai Steinkopf atmete einmal kräftig durch und schüttelte sich, als wolle er die leise Reue von sich werfen, die sich seiner bemächtigt hatte, nachdem der Kleine aus dem Zimmer gestürmt war.
Was er von Michael gewollt und eine Zeit lang bekommen hatte, war ein bisschen Spaß, ein wenig Entspannung und guten Sex. Von Liebe war nie die Rede gewesen. Was der sich alles zusammengesponnen hatte von einem gemeinsamen Leben. Kai war doch nicht einer von Michaels Kumpanen von der Straße.
Kai nahm einen tiefen Zug aus seiner Zigarette. Auch so ein Laster, das er endlich ablegen sollte. Ihm fiel ein, dass er noch kein Insulin gespritzt hatte. Rasch berechnete er im Kopf die Menge, die notwendig war, um den Zuckergehalt des Sekts auszugleichen, und addierte noch ein paar Einheiten hinzu, denn er hatte beschlossen, beim Griechen um die Ecke noch etwas zu essen, bevor er nach Hause ging.
Kai war seit der Kindheit Diabetiker. Es gab Schöneres, aber er hatte sich damit abgefunden, und es war ihm so selbstverständlich geworden wie das Zähneputzen. Er trat mit dem Insulininjektor ans Fenster, wo das Licht der Straße ihm half, die richtige Dosis einzustellen. Dann stach er sich die dünne Kanüle in den linken Oberarm, steckte anschließend die rote Verschlusskappe aus Plastik, die er im Mund gehalten hatte, wieder auf die Spitze, warf den Injektor auf das Tischchen, drückte ein Papiertaschentuch auf die Einstichstelle und stellte sicher, dass sich kein Blutstropfen gebildet hatte, der später sein Hemd beschmutzen könnte.
Gedankenverloren blickte er auf die Straße hinunter, die um diese Uhrzeit noch recht bevölkert war. Das Hotel lag mitten im Zentrum Berlins. Des alten Westzentrums, unweit des Zoos. Heute gab es ja mindestens zwei Zentren in Berlin. Aber eigentlich war die Stadt schon immer in Kieze eingeteilt, jeder ein Kosmos für sich, jeder mit einem eigenen »Zentrum«, und wenn man es nicht darauf anlegte, musste man vom Nachbarkiez nichts mitbekommen. Ein Gefühl der Einsamkeit überfiel ihn. Er schob es energisch von sich und wandte sich rasch anderen, wichtigeren Gedanken zu.
Was war das gerade für ein Geräusch gewesen? Als sei jemand im Zimmer. Er hielt den Atem an und lauschte in die Dunkelheit. Da war nichts! Aber hatte er die Tür zum Bad nicht geschlossen? Jetzt stand sie offen.
»Fange ich jetzt schon an zu spinnen?«, rief er sich selbst zur Räson. Er verachtete sich für seine Ängstlichkeit in solchen Dingen. Seit der Kindheit kämpfte er gegen Ängste an, Angst vor Dunkelheit, Angst vor dem Alleinsein, vor dem Verlassenwerden, davor, der Schwächere zu sein, Angst vor Schmerz, und er zwang sich unter Aufbietung aller Willensstärke und Härte, die inzwischen einen wesentlichen Teil seines Charakters ausmachten, dem drängenden Gefühl, das Licht anzuschalten und im Bad nachzusehen, nicht nachzugeben. Da war nichts! Das war alles ein Produkt seiner Einbildung.
Er wandte sich wieder dem Fenster zu. In diesem Moment hörte er es wieder, ein schnarrendes Geräusch, wie wenn eine Peitsche die Luft zerteilt und sie zum Singen bringt. Als Nächstes fühlte er den Gurt um seinen Hals. Instinktiv griff er mit beiden Händen danach, versuchte, die Finger unter das Band zu bringen. Es gelang ihm nicht. Der Ledergurt lag straff an und wurde zugezogen, schnitt ihm schmerzhaft in die Haut, zerquetschte den Kehlkopf und nahm ihm den Atem. Verzweifelt ruderte er mit den Armen und versuchte, etwas hinter sich zu packen – vergeblich.
»Das kann nicht sein, nicht mir, nicht jetzt, so helft mir doch!«, wollte er schreien, brachte aber nur ein heiseres Röcheln hervor. Der Kopf schien ihm platzen zu wollen, die Augen wurden aus dem Schädel gedrückt, und der Lufthunger wollte die Bronchien zerreißen. Als ihm klar wurde, dass er nichts tun konnte, als sich dem Unvermeidbaren hinzugeben, war es ihm fast wie eine Erleichterung – der Schmerz ließ endlich nach.
5
Kammowski
Montag, 10. Februar
Kammowski erwachte noch vor dem Wecker. So war das immer, im Urlaub konnte er ohne Probleme bis zum Mittag schlafen, doch wenn er zur Arbeit musste, wachte er pünktlich auf. Auf seine innere Uhr war Verlass. Außerdem hasste er es, morgens in Hektik aufzubrechen. Er brauchte seinen Milchkaffee, seine zwei Brötchen – eins mit Honig, eins mit Wurst – und seine »stille Stunde« mit der Zeitung. Auf dem Weg zum Bäcker fiel Kammowski ein, dass er eigentlich gestern beschlossen hatte, wieder eine Diät-Phase einzulegen.
Das Handy klingelte. Er brauchte nicht aufs Display zu sehen, um zu wissen, wer anrief. Um diese Zeit konnte es nur Elly sein. Wie immer bewies seine Ex-Frau einen untrüglichen Instinkt, ihn genau dann anzurufen und mit Vorhaltungen zu überfallen, wenn er es am wenigsten gebrauchen konnte. Nun ja, gelegentlich ließ er die Erkenntnis zu, dass es ihm eigentlich nie passte. Doch heute war kein Tag für Selbstkritik. In einer Anwandlung von Trotz drückte er den Anruf weg. Einen Vorteil musste die Trennung, die sie und nicht er gewollt hatte, ja auch für ihn haben. Er konnte die Elly-Einheiten dosieren und ein wenig steuern. Sofort überfiel ihn ein schlechtes Gewissen. Was, wenn den Kindern etwas zugestoßen war? Dann würde sie noch einmal anrufen, beruhigte er sich.
Hauptkommissar Mathias Kammowski war ein kräftiger, eins achtzig großer Mann, der seit Jahren zwischen stattlicher Figur und Übergewicht schwankte, dem er durch regelmäßige Nulldiäten entgegenzuwirken suchte. Er war sich im Klaren darüber, dass das nicht die gesündeste Methode war und es klüger wäre, wenn er seine Essensgewohnheiten umstellte, aber das lag ihm nicht. Für ihn kam es nicht infrage, wochenlang Knäcke und Rohkost zu essen. Er liebte es, sich satt zu essen, liebte das Gefühl der trägen Überfüllung, gepaart mit einem Hauch schlechten Gewissens, das nur ein gehaltvolles Essen mit viel Fleisch und Fett hinterlassen konnte. Elly hatte vergeblich versucht, ihm maßvolles und gesundes Essen beizubringen.
»Ich bin eben ein Löwe«, hatte er ihr entgegnet, auf sein Sternzeichen anspielend. »Die können auch tagelang in der Sonne liegen und dann eine ganze Gazelle fressen.«
In den ersten Jahren ihrer Ehe hatte sie dann zärtlich in seine Speckrollen gekniffen und gesagt: »Da habe ich aber einen wohlhabenden König mit vielen Gazellen.« Später hatte sie nur die Augen verdreht und sich genervt abgewandt.
Vor- und Nachteile kurz abwägend, kam er zu dem Schluss, dass es keinen Grund gab, die Sache mit der Diät zu überstürzen. Die nächste Woche wäre dafür genauso geeignet. Außerdem waren seine Freunde an eine Abschiedseinladung gewöhnt. Bevor er sich in Askese begab, lud er sie gerne zu einem üppigen Mahl ein. Die Rituale des Lebens sollte man nicht ohne Not aufgeben. Sie waren es schließlich, die dem Leben den sicheren Rahmen gaben. Und die Devise des ersten Tages nach dem Urlaub lautete: keine Extravaganzen, einfach nur überleben.
So gestattete er sich ein ausgiebiges Frühstück, kümmerte sich um Kater Churchill, der angesichts des pünktlichen Futters und des morgendlichen Fellstriegelns geneigt schien, Vergebung zu gewähren. Während seines Urlaubs hatte die Nachbarin sich um den Kater gekümmert. Das tat sie stets mit großer Sorgfalt, Umsicht und frischem Tatar, aber Churchill war trotzdem immer einige Tage beleidigt.
Auf dem Flur des LKA 1 kam ihm Manfred Thomandel, sein Chef und Abteilungsleiter, entgegen und dirigierte ihn hektisch in sein Büro. »Wie war denn der Urlaub?«, fragte er, fuhr dann aber ohne eine Antwort abzuwarten fort: »Kammowski, ich habe dir die Neue zugeteilt. Sie ist seit einer Woche da. Wir hatten noch wenig Gelegenheit, uns groß um sie zu kümmern. Sie heißt Svenja Hansen. Sei nett zu ihr.« Und schon schob er ihn, gleichsam wiederum keine Antwort duldend, vor die Tür. »Wir sehen uns gleich bei der Morgenbesprechung, ich muss vorher noch ein Telefonat führen. Ach ja«, rief er ihm hinterher, »wir mussten sie in dein Büro setzen, ging wirklich nicht anders.«
Kammowski war sauer. Er fühlte sich überrumpelt und hatte nicht die geringste Lust, einen Neuling vorgesetzt zu bekommen. Er hatte in seinen knapp dreißig Berufsjahren oft genug den »Bärenführer« gemacht. So nannten sie das, wenn ein Neuer einem alten Hasen zugeordnet wurde. An sich eine sinnvolle Sache. Aber warum sollte das schon wieder er sein? Und dass er nun auch noch sein Allerheiligstes mit ihr teilen sollte, war die Höhe.
Eigentlich teilten sich beim LKA 1 die Kollegen ihre Büros zu zweit oder zu dritt. Einige Dezernate arbeiten sogar in Großraumbüros. Nur dem Abteilungschef stand ein eigenes Büro zu. Aber Kammowski hatte sich dieses Privileg so lange beharrlich erstritten, bis es ein unausgesprochenes Gesetz geworden war. Nicht, dass er nicht auch mit Kollegen zusammengearbeitet hätte. Das war gar nicht anders möglich, Polizeiarbeit ist Teamarbeit, und er war ein guter Polizist, er wurde respektiert und kam gut mit seinen Kollegen aus. Außerdem waren die meisten Büroräume ohnehin durch Zwischentüren verbunden, die in der Regel offen standen. Aber man hätte sie eben auch mal schließen können. Und er konnte es nicht leiden, wenn man sich zu nahe auf die Pelle rückte. Er wollte weder die Leberwurstbrote der Kollegen riechen noch an der Aufzucht diverser Grünpflanzen beteiligt werden und schon gar nicht vor zwölf Uhr in unnötige Gespräche über missratene Kinder, undankbare Ehefrauen oder nächtliche Eroberungen verwickelt werden. Kammowski war kein Morgenmuffel, nein, so sah er sich überhaupt nicht. Er lehnte es nur ab, am frühen Morgen mit den Gedanken, Ausdünstungen und dem Lärm anderer Menschen behelligt zu werden. Deshalb vermied er es auch nach Möglichkeit, mit der U-Bahn zu fahren. Stattdessen bewältigte er die knapp sechs Kilometer von seiner Wohnung bis zur Keithstraße in aller Regel bei jedem Wetter mit dem Rad. Und eben deshalb wünschte er sich sein eigenes Büro.
Ohne zu grüßen, betrat er das Büro und starrte auf den zweiten Schreibtisch, den man während seiner Abwesenheit in seinem Büro platziert hatte. Langsam wanderte sein Blick vom Schreibtisch zu der jungen Frau, die dahintersaß. Er sagte immer noch nichts.
»Guten Morgen«, strahlte die neue Kollegin ihn an und sprang von ihrem Stuhl auf. »Ich bin Svenja Hansen, ich freue mich, Sie kennenzulernen, darf ich du sagen?«
Kammowski erstarrte. Natürlich duzte man sich bei der Polizei, das war beim LKA 1 nicht anders als bei vermutlich allen anderen Abteilungen und Dezernaten. Aber dieses Kind war mindestens dreißig Jahre jünger als er. Da stand es ihm ja wohl zu, ihr das Du anzubieten, und nicht umgekehrt. Bevor er eine Antwort geben konnte, stürmte Kollege Werner herein.
»Habt ihr euch schon bekannt gemacht? Svenja, das hier ist Hauptkommissar Mathias Kammowski. Mathias, das ist die frischgebackene Kommissarin Svenja Hansen. Sie hat soeben die Polizeischule als Jahrgangsbeste abgeschlossen.«
Kammowski gab Svenja die Hand, rang sich ein »Herzlich willkommen« ab, und gemeinsam mit Werner machten sie sich auf in den Seminarraum zur Morgenbesprechung. Auf die Frage Svenjas war er nicht eingegangen. Aber das interessierte niemanden. Es blieb fortan einfach beim Du.
6
LKA
Montag, 10. Februar
Manfred Thomandel leitete die Morgenbesprechung routiniert und zügig. Eine vermisste Vierzehnjährige, ein unbekannter Toter im Kleistpark, eine Anzeige wegen Kindesmisshandlung, eine Messerstecherei zwischen zwei Jugendbanden, bei der ein Betroffener schwer verletzt wurde, und ein Toter in einem Hotel in der Potsdamer Straße.
»Sieht nach einem unbeabsichtigten Tod durch autoerotische Handlungen aus«, sagte Thomandel. »Die Kollegen von der Ersten Inspektion sind schon vor Ort.«
Die Erste Inspektion, das waren Polizisten, die im Zwölfstundendienst allen akuten Meldungen nachgingen, den Tatort absicherten, erste Befragungen durchführten und auch Fotos machten. Falls der Verdacht einer Straftat bestand, wurde die Kriminaltechnische Untersuchung des Landeskriminalamts eingeschaltet, die ein erkennungsdienstliches Team zusammenstellte, das alle Beweisstücke am Tatort sicherte und wiederum Fotos machte. Bei Tötungsdelikten wurde parallel die Mordkommission benachrichtigt.
Kammowski musterte nun verstohlen seine neue Partnerin, die eifrig bemüht schien, jedes Wort von Thomandel mitzuschreiben. Sie war groß, bestimmt eins fünfundsiebzig, schlank, lange Beine, gute Figur. Ihr feines, blondes, fast weißes Haar trug sie kurz geschnitten, ein schöner Rahmen für ihr Gesicht. Ihre Haut wirkte irgendwie durchsichtig, und sie trug offenbar kein Make-up, das stand ihr sehr gut.
»Ganz schön sexy, was? Was meinst du, hat sie ein Tattoo? Oder ein Bauchnabel-Piercing«, feixte Hartmann, der neben ihm saß und offenbar seinen Blicken gefolgt war.
Hartmann war ein sexistisches Arschloch, da gab es nichts. Kammowski tat so, als hätte er ihn nicht gehört, und interessierte sich plötzlich für die Details des unbekannten Toten im Kleistpark. Wach wurde er aber erst wieder, als er Thomandel sagen hörte: »Kammowski, du übernimmst bitte den Toten im Hotel, und du, Svenja, schließt dich ihm an. Und seid bitte so nett und macht mal einen Besuch in der Leydenallee, das ist die Adresse der fraglichen Kindesmisshandlung. In der 125er haben sich heute mehrere Kollegen krankgemeldet, und wir wurden um Unterstützung gebeten.«
Na toll, Kammowski hatte gehofft, den ersten Tag nach dem Urlaub erst einmal mit dem Auffrischen von Sozialkontakten verbringen zu können. Und nun hatte er nicht nur einen möglichen Mord, sondern auch noch die Vertretung der Abteilung 125, »Gewaltdelikte an Schutzbefohlenen und Kindern«, und die Neue an der Backe.
Das Hotel Aurora glich bereits einem Bienenschwarm. Es war ein kleines Hotel, zwanzig Zimmer auf vier Etagen verteilt. Der Empfangstresen links am Eingang erweiterte sich im hinteren Bereich zu einer kleinen Bar mit drei Barhockern am Tresen, dahinter eine Nische mit vier kleinen Tischen und Clubsesseln. Gegenüber dem Foyer, von diesem mit einer Glasfront abgetrennt, mit Fenstern zur Straße hin, lag der Frühstücksraum des Hotels. Wenige Hausgäste steckten dort aufgeregt die Köpfe zusammen. So ein Todesfall sprach sich rasch herum. Hinter dem Empfangstresen, und nur von dort zu begehen, lag ein kleiner Büroraum für das Personal.
Peter Olschewski von der Ersten Inspektion empfing sie in der Bar. »Ihr könnt noch nicht rein, die KTU ist noch zugange.«
Kammowski ließ sich auf einen der Ledersessel fallen, lud die anderen mit einer Geste ein, es ihm gleichzutun, und stellte Svenja vor. Dann berichtete Olschewski, was er und sein Team bislang in Erfahrung gebracht hatten.
Der Tote war gegen sieben Uhr vom Zimmermädchen gefunden worden. Sie hatte die Hotelleitung informiert und diese die Polizei. Außer dem Zimmermädchen, der Hotelleitung und der Polizei hatte niemand den Tatort betreten, der inzwischen abgesperrt war.
Bei dem Toten waren seine Kleidung, Papiere, EC- und Kreditkarten und sein Handy gefunden worden, außerdem etwas Geld. Es handelte sich um den achtundvierzigjährigen Kai Steinkopf, wohnhaft in Potsdam. Der Tod war vermutlich durch Strangulation herbeigeführt worden.
Kammowski bedankte sich bei Olschewski für den Bericht und fragte, ob er schon das Personal am Empfang gesprochen habe. »Nein, wir haben bisher nur die Personalien aufgenommen.«
»Dann lass uns mal mit dem Mann sprechen.«
Der Portier berichtete, der Gast habe das Zimmer für eine Nacht gemietet, sei aber kein Unbekannter gewesen. Er sei immer alleine gekommen, stets für eine Nacht, aber selbstverständlich wisse er nicht, ob er auch alleine geblieben sei. Das Hotel lag unweit des Straßenstrichs und war bei der Polizei einschlägig bekannt, Touristen verirrten sich eher aus Versehen hierher – wenn sie auf ihren nächtlichen Berlin-Touren zufällig auf die Bar des Hotels stießen, die rund um die Uhr geöffnet war und nachts vom Portier mitversorgt wurde.
»Haben Sie gestern etwas beobachtet, das dafür sprach, dass der Mann nicht alleine war?«, fragte Svenja den Portier.
»Ich spioniere meinen Gästen doch nicht nach«, empörte sich dieser. »Außerdem hatte ich gestern Abend keinen Dienst. Da müssen Sie schon meinen Kollegen fragen. Der kommt aber erst um 22 Uhr wieder.«
»Dann sehen wir uns jetzt mal den Tatort an, die Marsmenschen scheinen die Erde wieder verlassen zu wollen«, meinte Kammowski mit einem Blick auf einen der KTU-Beamten, der in seinem weißen Schutzanzug mit zwei Koffern soeben die Treppe herunterkam.
7
Kammowski & Svenja
Montag, 10. Februar
Die Leiche blickte sie aus blutunterlaufenen, unnatürlich weit aus den Höhlen herausgetretenen, wasserblauen Augen reglos an. Der Mann hing mehr, als dass er saß, auf der dem Eingang abgewandten Längsseite des Kingsize-Betts. Der Kopf war ungesund überstreckt und verdreht. Um den Hals des Mannes war ein dünner Ledergurt geschlungen, dessen Ende um den Metallrahmen des Bettkopfteils gespannt war. Offenbar hatte das Eigengewicht des Körpers zur Strangulation geführt. Die Gesichtsfarbe des Toten war dunkel, das Gesicht wirkte aufgequollen, eine tiefblaue, fast schwarze Zunge quoll übergroß aus dem Mund und verlieh dem Gesicht etwas Groteskes, Clownartiges.
Von dem Toten ging ein stechender Geruch aus. Der Mann war nackt, und unter seinem Körper hatte sich eine Lache von Urin angesammelt.
»Sieht aus wie ein Tod durch autoerotische Handlungen«, sagte Olschewski, der ihnen gefolgt war. »Manche finden das ja geil, sich selbst bis knapp vor die Bewusstlosigkeit zu strangulieren. Gab es da nicht vor einigen Jahren einen Popstar, der sich auch auf diese Art aus Versehen aus dem Leben befördert hat?«
»Habt ihr sonst schon was gefunden?«, unterbrach ihn Kammowski, der so einen saloppen Ton nicht mochte, aber wusste, dass sie alle ihn oft brauchten, um all die Scheiße, mit der sie durch die Arbeit konfrontiert waren, nicht zu nah an sich herankommen zu lassen.
»Seine Sachen sind alle da, auch Geld und Kreditkarten, Smartphone. Hier auf dem Tisch stehen noch zwei Gläser und eine Flasche Schampus. Er war offensichtlich nicht alleine. Und einer der Beteiligten muss Diabetiker gewesen sein. Neben der Sektflasche liegt ein Insulininjektor. Der Eingangsbereich des Hotels ist videoüberwacht. Auch der Notausgang zum Hof führt durch die Lobby. Da hätten wir jeden Gast, der ein oder aus geht, eigentlich draufhaben müssen. Aber das Teil ist seit einigen Wochen defekt.« Er zuckte resigniert die Schultern. »Unter der Kofferablage des Zimmers haben wir den Deckel eines Objektivs gefunden, aber keinen Fotoapparat. Der kann da allerdings auch schon vor längerer Zeit von einem Touristen vergessen worden sein.«
»Fingerabdrücke?«
»Guten Morgen, Kammowski«, mischte sich jetzt Susanne Pötters von der Abteilung Kriminaltechnische Untersuchung ein. »Wie viele willst du denn?«
»Wenn möglich nur die des Täters, meine Liebe.«
Kammowski mochte Susanne, hatte vor einigen Jahren auch mal mit ihr geflirtet, aber da war er noch mit Elly zusammen und trotz aller Probleme nicht ernsthaft auf Brautschau gewesen. Inzwischen war Susanne verheiratet, hatte zwei Kinder, und er war geschieden. Mit manchen Menschen stimmte das Timing einfach nicht.
»Nun ja, mein Lieber«, ging Susanne auf das Spiel ein, »ich kann dir hier mindestens fünfunddreißig verschiedene liefern, da sind bestimmt ein paar Täter dabei. Was glaubst du, wo du hier bist? Die schicken nicht jeden Tag ein Hygieneteam durch die Räume. Und ich vermute, der eine oder andere hat schon mal seine Spuren bei uns hinterlassen.«
Kammowskis Blick schweifte durch den für ein modernes Hotelzimmer recht großen Raum und verharrte an dem kleinen Tisch, auf dem die geöffnete Flasche Sekt und zwei Gläser standen. »Wie viele hast du auf den Gläsern gefunden?«
»Bericht kommt heute Nachmittag«, gab Susanne zurück. »Scheint aber so, als wäre er gestern Abend nicht alleine gewesen.«
»Wäre ich jetzt nicht draufgekommen«, grummelte Kammowski.
»Du musst auch immer das letzte Wort haben«, sagte Susanne lachend, warf ihm eine Kusshand zu und wandte sich ab.
»Ach übrigens.« Sie drehte sich im Gehen noch einmal um. »Der Mann hat vor seinem Tod noch gebeichtet.«
Kammowski antwortete nicht, aber sein Gesichtsausdruck schien weitere Erklärungen einzufordern, deshalb fuhr Susanne fort.
»Direkt neben der Leiche lag aufgeschlagen eine dieser Hotelbibeln, du weißt schon, diese Gideon-Bibeln, die du in jedem Nachttisch findest.«
»Ach ne, hätte ich jetzt gar nicht vermutet, dass man die auch in solchen Hotels hier vorhält. Was hat er denn gerade gelesen?«
»Lukas 15,7: Ich sage euch: So wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen.«
»O Himmel«, stöhnte Kammowski mit einem kurzen Blick zur Zimmerdecke. Der erste Arbeitstag nach dem Urlaub war ganz und gar nicht so, wie er ihn sich erhofft hatte.
8
Rückblick
Dr. Thomas Franke, Chefarzt der Neurologie in Berlin-Lichtenberg, beeilte sich mit seiner Chefvisite. Spätestens um sechzehn Uhr wollten seine Kollegen und er das Haus verlassen. Heute war Berliner Firmenstaffellauf, und die Neurologie hatte sich diesmal mit drei Teams angemeldet. Sie waren die »Motoneurone I bis III«, eine Anspielung auf die Nerven des Menschen, die für die Bewegung zuständig waren. Und sie traten gegen den »Verfolgungswahn« an, das waren die Kollegen aus der Psychiatrie, die »Bloody Marys«, die Chirurgen, und die »Schnellschritte«, ein Team aus der Pathologie.
Und dann gab es noch die »Roten Pumpen«, die Kardiologen, und den »Durchmarsch«, die Gastroenterologen. Und natürlich all die Teams anderer Firmen.
Thomas hatte diese Veranstaltung immer für sinnvoller gehalten als all die steifen Weihnachtsfeiern, bei denen lange Reden gehalten wurden und doch niemand das sagte, was er meinte.
Inzwischen standen sie vor dem letzten Zimmer der Visite. Thomas ließ den Blick über seine Mitarbeiter schweifen. Sehr konzentriert waren sie heute nicht gewesen. Er aber auch nicht. Und es war doch schön, dass sich die jungen Leute überhaupt noch von so einer Firmenveranstaltung ansprechen ließen, mitmachten und sogar noch ihre Partner anschleppten. Bei allem Stress – die Zunahme der Bürokratie, es wurde ja inzwischen fast mehr dokumentiert als am Patienten behandelt, die kürzeren Behandlungszeiten, der Zeitdruck – die Kliniken der Barmherzigen Schwestern waren doch immer noch etwas Besonderes gewesen. Sie hatten nicht umsonst einen guten Ruf. Man arbeitete gerne hier, und das Firmenleitziel »Im Dienste des Menschen« war nicht nur leeres Geschwätz.
Thomas versuchte, sich wieder auf die Krankengeschichte des Patienten zu konzentrieren, die ihm die Assistenzärztin gerade vortrug. Die Verdachtsdiagnose einer Multiplen Sklerose bei einer jungen Frau, die vor wenigen Monaten ihr erstes Kind geboren hatte und jetzt über Kribbeln in der linken Körperhälfte klagte, hatte sich zum Glück nicht bestätigt.
»Guten Morgen, Frau Freyschmitt«, begrüßte Thomas die junge Frau, als er in das Zimmer trat, »wir haben heute nur gute Nachrichten für Sie.«
9
Kammowski & Svenja
Montag, 10. Februar
Die Benachrichtigung der Angehörigen eines Mordopfers gehörte zu den unangenehmsten Tätigkeiten des Berufs. Im Sommer hatte Thomandel eine Fortbildung zu diesem Thema organisiert. Kammowski versuchte, sich Einzelheiten in Erinnerung zu rufen. Er hatte zwar noch die hübsche brünette Psychologin vor Augen, aber an Fakten konnte er sich nicht mehr erinnern. Kammowski seufzte. Thomandel mit seinem Fortbildungsspleen. Sie waren sicherlich das bestgeschulte Morddezernat der Republik, aber Kammowski fand nicht, dass Seminare zu diesem Thema etwas nützten. Da konnte er noch so einfühlsam sein, am Ende stand immer die unumstößliche Tatsache des Todes, und er spielte nun mal nicht gerne den Todesengel. Frauen konnten das irgendwie besser, fand er, und wenn möglich lud Kammowski diese Verpflichtung auf eine Kollegin ab. Svenja hatte zwar erst vor wenigen Wochen ihre Ausbildung abgeschlossen, aber einen Versuch war es wert.
»Das traust du dir doch sicher schon alleine zu, oder?«
Das hatte mehr wie eine Feststellung als wie eine Frage geklungen. Sie saßen gerade in Doros Café. Doro, eigentlich Dorothee Kerner, bis zu ihrer Geschlechtsumwandlung Dieter, war für Recherchen aller Art zuständig, und sie war darin ausgesprochen gut. Kevin Ordyniak, der in Svenjas Alter, aber schon etwas länger beim LKA war, hatte ihr gleich am ersten Tag alles über Doro erzählt und sie davor gewarnt, sie zu unterschätzen oder gar abschätzig zu behandeln. Das hatte Svenja auch nicht vorgehabt, aber sie war ihm dankbar für den Hinweis gewesen.
Von ihren Kaffeetassen stieg ein aromatischer Duft von warmer Milch, Kakao und Zimt auf, eine fast andächtige mittägliche Stille hatte sich im sonst so geschäftigen Revier breitgemacht. Die anderen Kollegen waren noch zu Tisch oder saßen an ihren Schreibtischen. Kammowski atmete die Stille tief in sich ein, lehnte sich in dem Korbsessel bequem zurück und schloss die Augen.
Svenja gab drei Löffel Zucker in ihren Kaffee, rührte angestrengt darin, studierte intensiv die Flüssigkeitsstrudel, die ihr Rühren hervorrief, und schwieg. Sie war davon ausgegangen, dass sie beide gleich nach dem Mittagessen gemeinsam losfahren würden, um mit der Frau des Opfers zu reden. Jetzt wollte Kammowski ihr das aufhalsen. Deshalb hatte er wohl auch darauf bestanden, erst einmal einen Kaffee zu trinken.
»Hektik ist der Schädling aller kostbaren Gedankenfrüchte«, hatte er gesagt und sie in Richtung Doros Café dirigiert. Doro hatte zwar keine Zeit für ein Schwätzchen gehabt, ihnen aber rasch zwei Kaffee an ihrem Turbo-Espresso-Automaten – hochglanzpoliert, Schweizer Modell, sündhaft teuer – gezapft. Sie hatte sogar noch Milch geschäumt, ihre Cappuccinos mit einer Prise Zimt und Kakao gewürzt und auf die Schale mit Cantuccini gezeigt. »Selbstgemacht, nach einem Rezept meiner italienischen Großmutter.« Dann war ihr Zeigefinger von den Cantuccini zum rosafarbenen Sparschwein gewandert, und sie hatte mit strengerem Tonfall hinzugefügt: »Spenden helfen, Ihr Lieblingscafé am Leben zu erhalten.« Dann war sie mit einer theaterreifen Pirouette auf ihren 7-Zentimeter-Stilettos in Richtung Thomandels Büro abgedreht.
»Von wegen italienische Großmutter«, grunzte Kammowski und nahm sich einen der Kekse, »aber die Dinger sind gut.«
Svenja sagte nichts und sah immer noch angestrengt in ihre Kaffeetasse.
Schließlich sagte Kammowski: »Du kannst ja die Kollegen von der Streife bitten, dich zu begleiten, wenn du nicht alleine fahren möchtest«, ganz so, als sei es bereits abgemachte Sache, dass es allein ihre und nicht die gemeinsame Aufgabe sei, Frau Steinkopf aufzusuchen.
Svenja überlegte fieberhaft, dann gab sie sich einen Ruck: »Nein, Kollege, das lass ich mir jetzt nicht turfen. Ich fände es ehrlich gesagt nett, wenn wir das zusammen machen könnten, zumal Thomandel uns ja auch noch in die Leydenallee geschickt hat, wegen der Kindesmisshandlung.« Ihre Stimme hatte einen weniger beiläufigen Tonfall, als sie es sich gewünscht hätte, und sie erschrak vor sich selbst und den möglichen Konsequenzen, die ihr resolutes Auftreten gegenüber einem dienstälteren Kollegen am ersten gemeinsamen Arbeitstag nach sich ziehen konnte.
»Ist ja gut, ist ja gut, das war nur eine harmlose Frage zu deinen Vorkenntnissen, kein Turfen.« Kammowski setzte ein entrüstetes Gesicht auf, als sei es nun wirklich das Allerletzte, ihm vorzuwerfen, er drücke sich vor der Arbeit. »Okay, dann lass uns mal losfahren«, sagte er schließlich versöhnlich und schüttete den Rest seines Kaffees hinunter.
Die Kleine war mit allen Wassern gewaschen und offensichtlich nicht unbelesen. Kammowski war amüsiert, ließ sich aber nichts anmerken.
Turfen, der Begriff stammte aus einem Buch, das ihm Klaus empfohlen hatte, wie die meisten der Bücher, die Kammowski las. Es handelte von der Arbeit eines Assistenzarztes in einem amerikanischen Krankenhaus, aber er und seine Kollegen, denen er das Buch weitergereicht hatte, hatten viele Parallelen zur Polizeiarbeit entdeckt, und eine Zeit lang hatten sie einige Begriffe in ihren Alltag übertragen. Turfen meinte im Original, dass man einen Patienten, den man – und die mit ihm verbundene Arbeit – nicht durch Entlassung loswerden konnte, mitsamt seiner Akte in eine andere Abteilung verschob. Im Buch wurde ein Patient aus der Chirurgischen Klinik in die Internistische »geturft«, weil er zwar ein gebrochenes Bein, aber auch einen kleinen Infekt hatte. Bei der Polizei konnten sie den Einbruch zur Sitte turfen oder umgekehrt.
Die beiden Ermittler fuhren mit dem Aufzug in die Tiefgarage und ließen sich vom Fuhrparkleiter einen Wagen zuweisen. »Gibt’s keinen Passat?« Kammowski war beim Anblick des VW Polo nicht zufrieden. »Wo soll ich da meine Beine lassen?«
Der Fahrdienstleiter zeigte sich unbeeindruckt von Kammowskis Poltern und reichte ihm die Schlüssel. »Der Sitz ist nach hinten verstellbar.«
Kammowski zuckte mit den Mundwinkeln, verkniff sich aber eine Erwiderung. Stattdessen drückte er Svenja die Schlüssel kommentarlos in die Hand. Seine frühere Leidenschaft fürs Autofahren war wie er selbst in die Jahre gekommen. Nachdem er den Beifahrersitz so weit wie möglich nach hinten verstellt hatte, streckte er die Beine aus und zog das Handy aus der Tasche. Elly hatte sich nicht wieder gemeldet. Gutes Zeichen.
»Was hast du über den Toten in Erfahrung gebracht?«, fragte er, als sie sich in den laufenden Verkehr eingeordnet hatten. Svenja gab einen knappen Bericht.