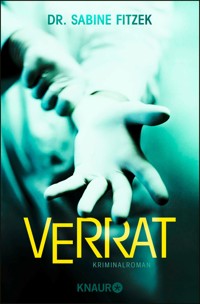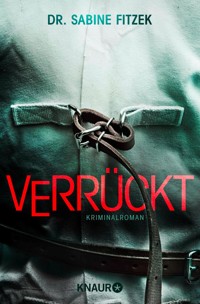
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kammowski ermittelt
- Sprache: Deutsch
Täter – oder Opfer: Wer glaubt einem Verrückten? Im 2. Teil der Medizin-Krimis um Kommissar Kammowski gerät ein Psychiatrie-Patient unter Mordverdacht Nur ein Verrückter scheint für den Mord an der 14-jährigen Lena infrage zu kommen, deren Leiche man wie Schneewittchen aufgebahrt in einem Berliner Park gefunden hat. Kommissar Kammowski von der Kripo Berlin übernimmt die Ermittlungen und kann nicht verhindern, dass der Sohn seiner Nachbarin unter Verdacht gerät: Der sensible Oliver war nicht nur mit Lena befreundet – er leidet unter einer schweren paranoiden Schizophrenie. Weil er jede Behandlung ablehnt und es bislang keinerlei Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefährdung gab, musste Oliver nach mehreren Notfall-Aufnahmen wieder aus der Psychiatrie entlassen werden. Als ein weiteres Mädchen aus Olivers Bekanntenkreis vermisst gemeldet wird, steht Kommissar Kammowski vor einer beunruhigenden Frage: Hat bei Oliver das System Psychiatrie versagt? Hochspannend und beklemmend nah an der Realität: Die Autorin Sabine Fitzek, Neurologin mit 10-jähriger Chefarzt-Erfahrung, entwickelt die Fälle ihrer Krimi-Reihe rund um Missstände im Gesundheitswesen mit großem Insider-Wissen. Die Medizin-Krimis mit Kommissar Kammowski aus Berlin sind in folgender Reihenfolge erschienen: • »Verrat« • »Verrückt« • »Verstorben«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Dr. Sabine Fitzek
Verrückt
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nur ein Verrückter scheint für den Mord an der 14-jährigen Lena infrage zu kommen, deren Leiche man wie Schneewittchen aufgebahrt in einem Berliner Park gefunden hat.
Kommissar Kammowski von der Kripo Berlin übernimmt die Ermittlungen und kann nicht verhindern, dass der Sohn seiner Nachbarin unter Verdacht gerät: Der sensible Oliver war nicht nur mit Lena befreundet – er leidet unter einer schweren paranoiden Schizophrenie. Weil er jede Behandlung ablehnt und es bislang keinerlei Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefährdung gab, musste Oliver nach mehreren Notfall-Aufnahmen wieder aus der Psychiatrie entlassen werden.
Als ein weiteres Mädchen aus Olivers Bekanntenkreis vermisst gemeldet wird, steht Kommissar Kammowski vor einer beunruhigenden Frage: Hat bei Oliver das System Psychiatrie versagt?
Hochspannend und beklemmend nah an der Realität: Die Autorin Dr. Sabine Fitzek, Neurologin mit 10-jähriger Chefarzt-Erfahrung, entwickelt die Fälle ihrer Krimi-Reihe rund um Missstände im Gesundheitswesen mit großem Insider-Wissen.
Inhaltsübersicht
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
Epilog
Prolog
Sie lagen im Gras und suchten den Himmel nach Sternen ab. Obwohl die Nacht klar war, konnten nur wenige Himmelslichterden Berliner Lichtsmog durchdringen. Vielleicht war es auch einfach noch zu früh für Sterne. Der Mann gab vor, keine Sternbilder zu kennen. Das Mädchen hoffte auf eine Sternschnuppe und erklärte ihm, wo der Große und Kleine Wagen zu finden waren. Mehr Sternbilder kannte sie nicht. Dann schwiegen sie.
Kühle stieg vom Boden auf und ließ sie frösteln. Der Tag war noch einmal warm und sonnig gewesen, aber jetzt schickte das Weltall seine Kälte durch die wolkenlose Nacht. Der Mann hatte seine Lederjacke zum Schutz vor der Feuchtigkeit unter das Mädchen gelegt. Der Duft von frisch geschnittenem Gras, erstem Laub und letzten Rosenblüten lag in der Luft. Das Mädchen zitterte, aber sie beachtete die Kälte nicht. Sie war glücklich und kostete jeden Augenblick mit ihm aus. Der Mann stützte sich auf seinen Arm, zog das Mädchen näher zu sich heran und streichelte ihr die Wange. Dabei sah er sie an, aber sein Blick hatte etwas Abwesendes.
»Woran denkst du?«, fragte sie.
»An nichts«, log er und wandte sich von ihr ab.
Stundenlang hatte er in den letzten Tagen auf sie eingeredet. Wieder und wieder hatte er seine Argumente aufgezählt. Sie hatte nichts verstanden, immer wieder Gegenargumente gebracht, schließlich geschwiegen. Aber sie hatte auch nicht nachgegeben, wie ein trotziges Kind. Das hatte ihn rasend gemacht. Jetzt war er ganz ruhig.
Das Mädchen hatte die Einladung in die Philharmonie als Sieg gewertet. Sie hatte sich gefreut. Noch nie hatte er sie irgendwohin mitgenommen, sie hatten sich bisher immer heimlich getroffen. Die Musik des Konzerts hallte immer noch in ihr nach. Sie war tief beeindruckt gewesen. Die Gewissheit, dass ihr Leben ab jetzt eine entscheidende Wendung nehmen würde, war mit der Musik in sie eingedrungen und hatte von ihr Besitz ergriffen. Alles würde gut werden.
Er war so anders als alle Männer, die sie bisher kennengelernt hatte. Musik war sein Leben, und sie, deren bisheriges Leben von Kargheit und Vernachlässigung geprägt war, saugte die Anregungen, die er ihr gab, wie ein Schwamm in sich auf und wuchs mit ihnen. Sie hatte sich plötzlich eine Zukunft für sich ausmalen können. Die Welt stand ihr offen. Alles war möglich. Über das Streitthema hatten sie bisher noch nicht wieder gesprochen.
»Du musst dir wirklich keine Sorgen machen, ich würde dich niemals verraten, und ich bin stärker, als du denkst«, hatte sie ihm versichert, als sie aus dem Auto stiegen.
»Ich weiß«, hatte er geantwortet und sie mit sanftem Druck Richtung Hasenheide dirigiert, einem Park im Stadtteil Neukölln, wo sich in Sommernächten die Verliebten des Bezirks trafen, und die Dealer. Er hatte zwei Piccolos mitgebracht und füllte ihren Inhalt in zwei Sektkelche aus Kunststoff. Wie süß von ihm! Das Mädchen liebte ihn auch für seine romantischen Ideen, mit denen er sie immer wieder überraschte. Sie liebkosten sich lange, und als er ein Kondom aus der Tasche zog, lachte sie und sagte, dass es dafür jetzt etwas spät sei. Aber er bestand darauf, es sei besser so, also ließ sie ihn gewähren. Wie schon so oft in den letzten Wochen. Der Akt selbst war für sie nie so schön, wie sie es sich in ihren Mädchenträumen ausgemalt hatte. Aber sie genoss auch jetzt seine weichen, wohlgeformten Hände auf ihrer Haut und das Gefühl, geachtet, ja, gebraucht zu werden. Sie fühlte sich zum ersten Mal in ihrem Leben als Person wahrgenommen.
Wenn er stark erregt war, wurde er manchmal grob. Aber das störte sie nicht. Schläge war sie von zu Hause seit der frühesten Kindheit gewohnt. Das hier war anders. Bei ihrem Vater und den Freunden ihrer Mutter war sie immer nur Opfer gewesen. Ein Nichts. Der Vater hatte sie und ihre Mutter geprügelt, und nachts war er dann zu ihr ins Bett gekommen und hatte gesagt, dass er ihr jetzt nicht mehr böse sei und dass sie auch lieb zu ihm sein müsse. Jetzt war der Opferrolle eine Nuance Macht beigemischt. Sie war diejenige, die diese Gefühle in dem Mann auslöste. Und sie beging den Fehler, zu glauben, dass ihr das Einfluss gab.
1
Das Haus singt, ging es Kammowski durch den Kopf. Dann: Samstag, weiterschlafen! Er rollte sich noch einmal in seine Bettdecke ein, nickte sofort wieder ein und träumte sogar kurz, irgendetwas Schönes von Engeln und fliegenden Häusern. Er schreckte plötzlich hoch. Ein Gefühl von Beunruhigung machte sich breit. Er horchte in die Stille. Das war es. Die Musik hatte aufgehört. Wahrscheinlich war er davon wach geworden. Jetzt setzte die Stimme wieder ein. Ein sehr junger Sopran, begleitet von einem Klavier. Dann wurde der Gesang wieder unterbrochen, begann von Neuem. Da übte eine Sängerin, morgens um acht Uhr, am Samstag!
Kammowski seufzte. Er liebte Musik, auch klassische, und er hatte auch nichts gegen Kirchenmusik, allerdings mochte er sie am liebsten, wenn er sie selbst an- und abschalten konnte. Noch einmal ließ er sich in die warme Bettdecke zurückfallen. Heute war kein Tag, um sich zu ärgern, oder auch nur, um sich Sorgen zu machen. Die Sonne schickte ihre frühen Strahlen in sein Schlafzimmer und verhieß einen wunderschönen Tag. Er schloss die Augen und ließ sich von der Stimme, die Reinheit und Melancholie zu besingen schien, noch einen Moment lang in den Morgen tragen:
Ich weiß, dass mein Erlöser lebet und dass er erscheint am Jüngsten Tag auf dieser Erde.
2
Rückblick
Sehr schön, Lena, du bist wirklich außergewöhnlich begabt«, sagte Frau Wüsthoff, als Lena das Lied zu Ende gesungen hatte. »Komm doch nach der Stunde noch einmal kurz zu mir.« Dem Tumult, der einsetzte, während sie Lenas Note in ihr Notizbuch eintrug, schenkte sie keine Beachtung. Die Aufmerksamkeitsspanne dieser Kinder war kurz, damit musste man sich als Lehrer heutzutage abfinden. Es war schon viel wert, wenn man sie wieder einfangen und ihre Konzentration für einen kurzen Moment auf den Unterrichtsstoff richten konnte. So bemerkte sie nicht, wie die Klasse Lena nachäffte, als sie zu ihrem Platz zurückging. »So begabt ist sie, nein wirklich, sooo außergewöhnlich begabt.«
Lena tat so, als hörte sie die anderen gar nicht. Die Hänseleien trafen sie mehr, als sie sich eingestehen wollte. Sie hatte sich über das Lob der Lehrerin gefreut, und die machten das jetzt runter. Als Jenny, neben der sie saß, ihr zuraunte, »die sind doch nur eifersüchtig, weil sie nicht so gut singen können«, und ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm legte, wehrte sie die Geste unwirsch ab. »Lass mich in Ruhe.«
Jenny wandte sich gekränkt ab. Lena machte sich darüber keinen Kopf. Sie hatte längst wieder ihren Panzer angelegt. Sie war es gewohnt, die ganze Welt gegen sich zu haben. Und sie hatte es nicht nötig, sich trösten zu lassen, von niemandem, auch nicht von Jenny.
Als sie am Nachmittag mit der U-Bahn nach Hause fuhr, ließ sie das Gespräch, das sie nach der Musikstunde mit der Lehrerin geführt hatte, noch einmal Revue passieren. Sie sei außergewöhnlich musikalisch, hatte Frau Wüsthoff gesagt, und sie solle etwas daraus machen. Sie empfehle ihr, ein Musikinstrument zu lernen. Auch wenn sie Sängerin werden wolle, wäre ein Musikinstrument hilfreich. Sie solle das unbedingt mit ihren Eltern besprechen und sich vielleicht bei einer Musikschule anmelden. Das sei nicht so teuer wie Privatstunden. Ob sie sich denn für ein Instrument besonders interessiere? Frau Wüsthoff könne sie gerne bei der Instrumentenauswahl beraten. Die Musikschulen böten auch Schnupperkurse für verschiedene Instrumente an. Und Gesangsunterricht könne man da natürlich auch bekommen. Lena hatte nur den Kopf geschüttelt und nichts gesagt.
»Soll ich mal mit deiner Mutter darüber sprechen?« Frau Wüsthoff hatte Lenas Zögern bemerkt.
»Nein, das mache ich schon selbst, aber vielen Dank«, hatte Lena rasch geantwortet.
Während die U-Bahn durch die Berliner Unterwelt raste, stellte sich Lena vor, wie sie diesen Wunsch zu Hause vorbringen würde. Ihr Gesicht verzerrte sich zu einem kurzen, sarkastischen Grinsen. In diesem Moment sah sie deutlich älter aus, als sie war, und in der Geste, mit der sie dann den Gedanken beiseiteschob, sich stattdessen ihre Kopfhörer in die Ohren steckte, um sich Justin Bieber zuzuwenden, lag tieftraurige Resignation, wie sie einer Vierzehnjährigen nicht gut zu Gesicht stand.
Zu Hause erwartete sie das übliche Chaos. Ihre Mutter sah kaum auf, als sie die Wohnung betrat. Sie lag auf der Couch, die Haare strähnig, das Gesicht aufgedunsen, eine Zigarette in der Hand. Sie war wieder einmal betrunken, vielleicht verarbeitete sie auch noch den Restalkohol der letzten Nacht. Auf dem Couchtisch quoll der Aschenbecher über, leere Cognac- und Colaflaschen zeugten von einem feuchtfröhlichen Gelage. Mehrmals war Lena in der Nacht von lautem Lachen und dem Fernseher wach geworden.
Wie ein junges Reh, das die Witterung aufnimmt, um zu schauen, ob Gefahr droht, horchte Lena in die Wohnung hinein. Von Holger war nichts zu sehen oder zu hören. Der derzeitige Freund ihrer Mutter schlief noch, oder er war schon gegangen. Seit Lenas Vater die Familie vor drei Jahren verlassen hatte, gaben sich die Lebenspartner ihrer Mutter die Türklinke in die Hand, doch für Lena hatte sich dadurch nichts verbessert, im Gegenteil.
Sie ging in die Küche, um sich etwas zu essen zu holen. Ob der Moment günstig war, der Mutter vom Lob der Lehrerin und deren Idee zu erzählen? Sie öffnete den Kühlschrank, der bis auf eine halb volle Ketchupflasche leer war. Im Hängeschrank fand sie eine angebrochene Packung Nudeln. Sie setzte einen Topf mit Wasser auf und gab Salz hinein.
»Wat kochtse denn da Feines?«, flüsterte Holger ihr ins Ohr. Er war hinter sie getreten, ohne dass sie es bemerkt hatte, weil in diesem Moment ein Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene auf der Straße vorbeigefahren war. Der Lärm hatte ihre Aufmerksamkeit für einen kurzen Moment abgelenkt. Das hatte Holger ausgenutzt. Unvermittelt legte er seine Hand in ihren Schritt und drückte sein Becken an ihren Hintern. Der Gestank von Alkohol, Rauch und schlechten Zähnen raubte ihr den Atem. »Lass mich in Ruhe«, zischte Lena und stieß ihn unsanft weg. »Holger? Was ist los?«, fragte Frau Kaufmann. Lenas Mutter stand in der Tür.
»Nix, deine Madame is nur mal wieder schlecht gelaunt«, schimpfte Holger und trat einen Schritt von Lena weg. Er war kein guter Schauspieler, und man sah ihm an, dass er sich ertappt fühlte. »Ick wollte nur freundlich sein, habse nur jefragt, wattse für uns kocht, aber dat war ooch mal wieder zuville für unsere Madame hier.«
Als keine der beiden Frauen reagierte, hob er abwehrend die Hand, wandte sich ab und murmelte: »Ick habe allmählich jenuch von euch beeden Schlampen, ihr könnt mich mal kreuzweise.« Er griff mit weit ausholender Geste, die seine Empörung über die ungerechte Behandlung unterstreichen sollte, nach seiner Jacke und wandte sich zum Gehen.
»Das kannst du doch nicht machen«, jammerte Frau Kaufmann. »Bleib doch hier.« Aber Holger drehte sich nicht mehr um und warf die Tür hinter sich ins Schloss.
»Der kommt schon wieder«, versuchte Lena ihre Mutter zu trösten. »Das tut er doch immer.« Doch der war nicht nach Trost zumute.
»Musst du denn zu Holger immer so unfreundlich sein? Der hat dir doch gar nichts getan.«
»Ach nein? Und wieso grapscht der mich immer an? Warum kann der mich nicht einfach in Ruhe lassen?«
»Schau dich doch mal an, wie du wieder rumläufst, wie ein Flittchen«, fauchte die Mutter zurück. Doch schon verließ sie die Kraft, und sie sackte weinerlich in sich zusammen. Die Hand, mit der sie sich am Türrahmen festhielt, zitterte. Die dünnen, ausgemergelten Beine schienen den voluminösen Körper nicht mehr tragen zu können. »Du musst mir auch jeden Mann ausspannen, du kleines Miststück«, flüsterte sie lallend. In einem Anflug von erneuter Wut schien sie sich auf Lena stürzen zu wollen, aber sie war zu betrunken, glitt aus und fiel zu Boden.
Lena weinte, vor Wut, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Wie konnte ihre Mutter so ungerecht zu ihr sein? Rasch griff sie nach ihrem Rucksack und nach ihrer Jacke, die sie auf einem Küchenstuhl abgelegt hatte, stieg über die am Boden liegende Mutter hinweg und verließ fluchtartig die Wohnung. In der Küche kochten die Spaghetti über. Der Geruch von verbranntem Mehl, das aus dem Nudelwasser auf die heiße Herdplatte schwappte, erreichte sie, bevor sie die Haustür hinter sich zuzog. Sollte doch die Küche abfackeln! Ihr doch egal!
3
Eine Stunde nachdem er von der Musik geweckt worden war, saß Kammowski mit Brötchen, Honig, Frühstücksei und Milchkaffee auf seinem Balkon. Die Zeitung hatte er gelesen, den ersten Kaffee getrunken. Kater Churchill war satt und forderte eine Krauleinheit. Hungrig starrte Kammowski die Brötchen an. Die Eier waren sicher schon kalt, obwohl er sie in die dicken, mit Teflon beschichteten Topflappenhandschuhe gesteckt hatte. Charlotte, seine Tochter, die aus Köln zu Besuch war, schlief noch. Der tiefe Schlaf eines jungen Mädchens, das die Nacht zum Tag gemacht hatte, ließ sich nicht von ein bisschen Musik und Gesang im Hause stören. Charlotte lebte bei ihrer Mutter, Kammowskis Ex-Frau Elly, hatte gerade Abitur gemacht und wollte sich nun auf den Mediziner-Test an der Berliner Charité vorbereiten. Bisher hatte Kammowski allerdings noch nichts beobachtet, was auf Aktivitäten in dieser Richtung hätte schließen lassen. Charlotte war die ganze Woche auf Achse gewesen, oft bis tief in die Nacht, und Kammowski war hin- und hergerissen zwischen dem Wunsch, immer wissen zu wollen, wo und mit wem sie unterwegs war, und der Erkenntnis, dass man sie machen lassen musste. Sie war schließlich erwachsen. Doch eine Portion Ärger mischte sich unterschwellig auch ein. Er hatte sich für seine Tochter zwei Wochen Urlaub genommen, sie aber bisher kaum zu Gesicht bekommen. Wie war es überhaupt möglich, dass sie, die erst eine Woche in Berlin war, schon so viele Kontakte geknüpft hatte?
Wenn sie heute etwas gemeinsam unternehmen wollten, sollte sie bald mal aufstehen. Aber sicher war es gestern wieder spät geworden. Kammowski hatte sie nicht nach Hause kommen hören. Dass sie da war, war allerdings nicht zu übersehen. Schuhe, Jacke und Handtasche hatte sie im Flur fallen lassen. Eine halb volle Colaflasche hatte ohne Deckel neben einem benutzten Glas auf dem Küchentisch gestanden.
Immerhin hat sie nicht aus der Flasche getrunken, dachte Kammowski mit einem Anflug von Sarkasmus, schüttete den Rest der abgestandenen Cola ins Waschbecken, spülte und ärgerte sich anschließend, dass er wieder in alte Rollenmuster verfallen war. Die Ordnung im Haushalt war eines der Themen gewesen, die in der Ehe mit Elly dauernd zu Streit geführt hatten. Kammowski dachte an Christine, die gerade in der Mongolei herumreiste. Als Journalistin war sie häufiger auf Auslandsreisen. Auch sie lebte Kammowskis Ansicht nach in einem ziemlichen Chaos. Aber bei ihnen eskalierte der Konflikt nicht so wie damals mit Elly. Das lag sicher vornehmlich daran, dass sie beide eigene Wohnungen und keine gemeinsamen Kinder hatten. Und weder Christine noch er hatten das Thema Zusammenziehen bisher angesprochen.
Kammowski und Christine kannten sich schon seit der Schulzeit, aber erst im Frühjahr waren sie ein Paar geworden. Wenn man das so nennen konnte. Sie hatten ungeplant gemeinsam einen Kriminalfall im Berliner Gesundheitswesen aufgedeckt. Christine war selbst zeitweilig verdächtigt worden, und beide hatten sich anfangs nicht gerade das Vertrauen geschenkt, das Kammowski als Voraussetzung für eine Beziehung ansah. Das hatte sich zwar geändert, doch wenn Kammowski ehrlich war, und heute Morgen neigte er zu Ehrlichkeit und Selbsterkenntnis, dann hatten sie doch wenig gemeinsam. Christine war so gradlinig, so hart in allem. Sie war der Typ Mensch, der mit Selbstverständlichkeit annahm, dass ihm die Welt zu Füßen lag, dass er alles steuern konnte. Der erst bemerkte, dass er andere dabei zurückließ, wenn es schon zu spät war.
Na ja, Kammowski landete immer bei solchen Frauen, da machte er sich wenig Illusionen: selbstbewusst, unabhängig, unkonventionell – und ihm immer einen Schritt voraus. Elly, seine Ex, war auch so gewesen. Sicher, in ihrer Beziehung hatte es schon lange gekriselt. Aber den Ausschlag zur Trennung hatte am Ende gegeben, dass Elly die Leitung eines Gymnasiums in Köln angeboten bekommen und diese angenommen hatte.
Bei einem Mann würde man gar nicht erst lange diskutieren, wenn sich eine berufliche Chance bot, sondern die Familie richtete sich danach, hatte Elly ihm damals an den Kopf geworfen. Er hatte ihr innerlich recht gegeben. Wenn zwei Menschen beruflich engagiert waren, dann musste eben einer auch mal zurückstecken, aber er sah nicht ein, warum er für die Ungerechtigkeit zurückliegender Jahrhunderte, in denen die Frauen den Männern zu gehorchen hatten, büßen sollte. Und er hatte nicht von Berlin weggewollt. Er war nicht so der Typ, der überall sofort Kontakt schloss. Er hatte einfach Angst davor gehabt, wegzuziehen, sein Umfeld aufzugeben, und das für eine Ehe, an deren Bestand er damals schon stark zweifelte. Über seine Ängste hatten sie nicht gesprochen. Dafür waren die Fronten viel zu verhärtet gewesen.
Natürlich war es jetzt auch Christines Recht, ihre berufliche Karriere in den Vordergrund zu stellen. Aber Kammowski hatte sich von ihr Unterstützung gewünscht, denn die Begegnung mit seiner jetzt erwachsenen Tochter, die er seit Jahren nur sporadisch gesehen hatte, hatte ihn mehr beunruhigt, als er sich jemals eingestanden hätte.
Er war sich damals mit Elly einig gewesen, dass man den Kindern, Charlotte hatte noch einen jüngeren Bruder, Anian, die langen Fahrten nicht jedes zweite Wochenende zumuten wollte. Sooft es ging, war er nach Köln gefahren, aber in den letzten Jahren war das seltener geworden. Die Kinder waren älter geworden, hatten ihre eigenen Interessen entwickelt und waren auch in den Ferien nicht mehr regelmäßig nach Berlin gekommen. Kammowski gestand sich ein, dass er all diese Überlegungen Christine nicht vermittelt hatte. Es konnte sein, dass sie sogar gedacht hatte, dass es besser war, Vater und Tochter Raum und Zeit für ihr Wiedersehen zu geben.
Kammowski beschloss, nicht länger auf Charlotte zu warten, und schmierte sich ein Brötchen mit viel Butter und Honig, biss hinein und genoss den Geschmack von warmer Süße auf kaltem Fett und das Knacken der frischen Brötchenkruste. So musste ein Wochenend-Frühstück sein! Die Schrippen von der Tankstelle waren kurioserweise heutzutage besser als die vom Bäcker.
Wie war das noch mit der Achtsamkeit? Klaus, sein bester Freund, der in einem Berliner Gymnasium als Lehrer arbeitete, versorgte ihn immer mit Lesestoff. Und zurzeit war Klaus auf der Psycho- und Selbstmanagement-Schiene. Kammowski versuchte, sich auf den Moment zu konzentrieren. Hier auf dem Balkon in der Sonne mit Churchill auf dem Schoß ging es ihm doch gut. Berlin war im Sommer so schön. Die Straßen frei, man konnte so viel unternehmen, in Biergärten sitzen, durch Galerien schlendern, an einem der vielen Gewässer liegen oder ins Berliner Umland fahren. Er könnte Charlotte eine Motorradtour durch die Uckermark vorschlagen. Den Gedanken verwarf er rasch wieder. Er hatte seiner Ex in die Hand versprochen, nicht mit Charlotte Motorrad zu fahren. Die Hände klebten vom Honig. Er stand auf, um sie sich zu waschen. Churchill gab Laute des Protestes von sich.
4
Sie liehen schließlich ein Motorboot in Friedrichshagen am Müggelsee, eines von denen, für das man keinen Bootsführerschein brauchte, und verbrachten einen unbeschwerten Nachmittag mit Schwimmen und Sonnen. Kammowski hatte kurz entschlossen Svenja Hansen, seine junge Kollegin, eingeladen, und die hatte zugesagt. Allerdings hatte Svenja ihn sofort durchschaut. »Ist dir wohl nicht so ganz geheuer, einen ganzen Nachmittag mit deiner Tochter in einem Boot?«
»Wie kommst du denn da drauf?«
»Nur ein Scherz, Kammowski, ich freu mich, ist ja tolles Wetter, und ich war schon so lange nicht mehr auf dem Wasser.«
Das schätzte Kammowski so an Svenja. Dass sie nicht jeder Schwingung nachgehen musste, dass sie auch mal etwas stehen lassen, Interpretationsspielraum in beide Richtungen lassen konnte, sodass jeder sein Gesicht wahren konnte. Aber natürlich hatte sie recht gehabt mit ihrer Vermutung.
Charlotte und Svenja verstanden sich auf Anhieb. Da hatte er genau den richtigen Riecher gehabt. Svenja war nur wenig älter als Charlotte. Sie war im Frühjahr frisch von der Polizeischule in sein Team beim LKA gestoßen. Nach anfänglichem »Fremdeln« hatten sie – ganz entgegen Kammowskis beruflichen Prinzipien, die da hießen, Beruf und Freizeit werden strikt getrennt – inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis. Als Mädchen von der Waterkant konnte Svenja natürlich segeln, hatte aber auch nichts gegen einen Tag auf einem Motorboot einzuwenden, allerdings nicht, ohne die Vorzüge des Segelns immer wieder anzumerken. Am Ende des Tages fand Charlotte Segeln theoretisch auch besser als Motorbootfahren. Kammowski sollte es recht sein. Er war froh, dass er das Motorboot mit Anstand wieder an Land gebracht bekam und dass es ein so gelungener Tag gewesen war. Sie brachten Svenja nach Hause und fuhren dann in die Bergmannstraße. Charlotte wollte zwar abends noch weggehen, aber es war noch früh, und sie wollte noch duschen und sich umziehen.
Im Hausflur begegneten sie einem jungen Mädchen. Sehr viel Schminke, ein Boxershirt mit überweiten Arm- und Halsausschnitten, das mehr Einblick bot, als es verdeckte, kein BH, sehr kurze, ausgefranste Jeans-Shorts, so kurz geschnitten, dass man die Ansätze des Pos sehen konnte. Die Arme hatte sie bis zu den Ellbogen mit unzähligen bunten Bändern umwickelt. Merkwürdige Mode. Sah aus wie langärmelige Handschuhe ohne Hände. »Gott, bin ich froh, dass du nicht so rumläufst«, sagte Kammowski unbedacht, als er die Wohnungstür hinter ihnen geschlossen hatte, und setzte damit eine längere Diskussion in Gang. Charlotte bestand darauf, dass man es jedem selbst überlassen sollte, wie er oder sie sich anzog.
»Aber das zieht die falschen Männer an«, argumentierte er.
»Okay, dann muss ich, wenn ich jetzt mal deiner Logik folge, in Neukölln einen Schleier tragen, und wenn ich das nicht mache, dann bin ich selbst schuld, wenn ich begrapscht werde?«
»Nein, natürlich nicht, sei doch nicht so extrem. Selbstverständlich hat jeder das Recht, sich anzuziehen, wie er will, und niemandem ist gestattet, deswegen übergriffig zu werden. Aber ein bisschen muss man sich auch schützen. Wenn wir jetzt eine Reise in den Iran machen würden, würdest du doch auch nicht so herumlaufen, sondern dich etwas anpassen, oder nicht?«
»Aber wir sind hier nicht im Iran. Und so extrem war die doch gar nicht angezogen«, maulte Charlotte, der die Argumente ausgingen. »Eigentlich ganz normal, sommerlich eben, bei diesem Wetter.«
»Sorry«, setzte Kammowski unvorsichtigerweise nach, »du hast sie nicht mit den Augen eines Mannes angesehen.«
»Ich glaub es nicht! Mein Vater gafft jungen Mädchen hinterher, starrt ihnen auf die Titten und den Hintern und beschwert sich dann über ihr Aussehen?«
Kammowski ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Aha, na bitte, du hast selbst auch genau hingesehen. Und du bist alt genug, um zu wissen, dass ich nicht nur ein Vater, sondern auch ein Mann bin. Außerdem gaffe ich nicht. Aber wenn eine hübsche Frau ihren Busen so eindeutig darbietet, dann schaue ich als Mann automatisch hin. Das heißt noch lange nicht, dass ich mich nicht unter Kontrolle habe. Gleichzeitig habe ich in meinem Beruf mehr als einmal erlebt, dass das nicht für alle Männer gilt.«
»Paps. Sie bietet ihren Busen nicht dar, sie hat einfach einen. Ich finde es nicht richtig, dass Frauen immer zum Objekt degradiert werden. Entweder sie werden angebetet, oder sie sind Schlampen. Dazwischen gibt es nichts, und egal, was sie sind, sie sind immer Teil einer von anderen definierten Gruppe, nie handelnde Individuen.«
»Wow, übertreibst du jetzt nicht etwas? Und meinst du nicht auch, dass eine Frau, die halb nackt durch Berlin läuft, sich bewusst oder unbewusst als Objekt anbietet?«
»Paps, diese Diskussion dreht sich im Kreis. Ich gehe jetzt duschen.«
»Sag nicht immer Paps zu mir. Sag Papa oder Vater. Mit wem triffst du dich denn?«
»Kennst du nicht, Papon.«
»Wäre ich jetzt nicht draufgekommen«, murmelte Kammowski, aber Charlotte war schon ins Bad abgezogen.
Eines war jedenfalls klar. Sein kleines »Charlottchen« war dieses Mädchen nicht mehr.
5
Rückblick
Der innere Druck hatte sich in ihr aufgebaut wie Treibgas, das in einen Hohlkörper eingedrungen war und nun keinen Weg nach außen fand. Alles in ihr schrie nach Entlastung. Die verspürte sie aber nur, wenn das Messer in ihr Fleisch drang und der Schmerz von ihrer Seele Besitz ergriff. Das war wie ein Zwang, der sich in ihr über Wochen, manchmal aber auch über Tage oder Stunden hinweg aufbaute und dem sie nur eine Zeit lang widerstehen konnte. Irgendwann musste dann einfach alles raus. Danach ging es ihr immer eine kurzzeitig besser. Aber wie bescheuert musste man sein, so etwas in der Dusche der Turnhalle zu tun? Diese Bitch von Inka hatte sie gesehen und natürlich der Sportlehrerin verpetzt. Die hasste sie sowieso. Weil sie nie die richtige Sportkleidung dabeihatte, weil sie keinen Sinn darin sah, mit Anlauf über diese blöden Böcke zu springen, und weil sie sich geweigert hatte, ihre Bänder im Sport abzunehmen. Und natürlich hatte sie die Lehrerin, nachdem sie die Wunde verbunden hatte, zur Direktorin geschleppt. Lena war der triumphierende Blick der Sportlehrerin nicht entgangen. Endlich hatte sie sie gestellt. Sie hatte doch schon immer gewusst, dass mit diesem Mädchen etwas nicht stimmte. Lena war es von frühester Kindheit gewohnt, in den Gesichtern der Erwachsenen zu lesen, noch bevor ihnen ihre Gedanken selbst bewusst wurden, das war für sie ein Überlebensgarant.
Die Direktorin hatte vergebens versucht, Lenas Mutter zu erreichen, und dann den Sanitätswagen gerufen. Welch ein Theater für so einen kleinen Schnitt. In der Notaufnahme des Krankenhauses hatten sie ihre Unterarme angesehen, die Wunde versorgt und sie dann sofort in die Klapse weitergeschickt. Suizidversuch! So ein Schwachsinn. Sie hatte sich nicht das Leben nehmen wollen. Sie musste nur den Druck loswerden. Diese Loser hatten ja alle keine Ahnung. Und jetzt saß sie hier zwischen total gestörten Kindern, die mit Essen warfen und herumschrien, und konnte nicht raus. Sie spürte, wie der Druck wieder anwuchs. Sie begann zu laufen, drehte Runden vom Stationszimmer der Schwestern zum verschlossenen Eingang, durch den Aufenthaltsraum, in dem man nicht einmal die Fenster weit öffnen konnte, weil von außen Plexiglasscheiben davor montiert waren, zurück zu ihrem Zimmer, das sie mit einem kleinen Fettmops teilen musste, einem Mädchen mit stierem Blick, das selbst dann nicht mit Essen aufhörte, wenn sie sprach. Wieder zurück zum Stationszimmer, wo sie der sorgenvolle Blick der Schwester traf.
»Setz dich doch mal zu uns, Lena.« Die Schwester war nicht unfreundlich. »Hast du Hunger? Möchtest du vielleicht etwas Kuchen essen?« Lena schüttelte nur den Kopf und zog weiter ihre Runden. Essen half nicht gegen den Druck. Hatte es noch nie. Stunden vergingen, quälten sich voran, sie fühlte sich wie ein Hamster im Laufrad.
Ein türkischer Junge stellte sich ihr in den Weg. Er war vielleicht neun Jahre alt, oder jünger, und zwei Köpfe kleiner als sie. An seiner raumgreifenden Art, der aufreizenden Pose, wie er das Becken vorschob und die Hände an der Hüfte abstützte, erkannte sie sofort, dass er auf Krawall gebürstet war. »Ey, Aishe, hast du Problem? Hör mal auf, hier rumzulaufen, bist du Nazi, oder was?«
Sie ließ ihm einen verachtungsvollen Blick zukommen. »Lass mich in Ruhe.« Sie versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen.
Er stellte ihr einen Stuhl in den Weg. »Setz disch, du nervst mit deinem Gerenne, isch schwör, isch mach disch Krankenhaus.«
Sie stieß den Stuhl beiseite, der daraufhin mit Geschepper zu Boden fiel. Wieder versuchte sie, ihren Weg fortzusetzen, doch der Junge packte sie am Arm.
»Fass mich nicht an, du Assi!« Sie schüttelte seinen Arm ab und stieß den Jungen mit all ihrer Kraft von sich, woraufhin er, überrascht von der Gegenwehr, wütend aufschrie. Er stolperte, konnte sich nicht mehr abfangen und krachte gegen die Wand. Autsch, das musste schmerzhaft gewesen sein, er jaulte auf wie eine Heulboje. Sie bückte sich, hob den Stuhl auf und machte Anstalten, ihn mit Schwung auf den Jungen, der immer noch jammernd am Boden lag, niedergehen zu lassen. Der schrie entsetzt auf und rollte sich instinktiv in Embryostellung ein. Von allen Seiten kamen sie nun auf sie zu, und dann fühlte sie, wie sie von mehreren kräftigen Armen zurückgerissen wurde.
An die nächsten Stunden konnte sie sich nicht genau erinnern. Sie hatte um sich getreten, gebissen und gekratzt, wurde niedergerungen und mit Gurten verschnürt wie ein Paket, und dann verabreichten sie ihr eine Spritze, die sie in einen Dämmerschlaf versetzte. Als sie erwachte, war sie in einer anderen Umgebung.
6
Während Kammowski Abendbrot machte, hing Charlotte mal wieder vor dem Fernseher. Sie hatte sich in einer amerikanischen Serie festgebissen, sah eine Folge nach der anderen, manchmal schon mittags, wie Kammowski argwöhnte. Sie schlief sehr lange. Und wenn er abends nach Hause kam, war sie meist schon weg. Aber er fand nicht selten ihre leeren Chipstüten und Colaflaschen vor dem Fernseher vor. Sie lebten irgendwie aneinander vorbei. Woher sie nur diese Stapel von Serien-DVDs hatte? Charlotte war enttäuscht gewesen, dass Kammowski kein Netflix abonniert hatte. In Köln hatte sich Elly bisher auch nicht erweichen lassen.
»Papa, Netflix brauchen wir. Fernsehen ist total out, ist doch besser, wenn man ganz gezielt einen Film streamt, als das Fernsehprogramm zu konsumieren.«
»Ich sehe kaum fern. Und wenn ich ganz gezielt einen Film sehen will, gehe ich ins Kino«, hatte Kammowski geantwortet, obwohl er selbst tatsächlich schon darüber nachgedacht hatte, Netflix oder Amazon Prime zu abonnieren.
Kammowski betrachtete Charlotte, wie sie da so auf der Couch lag, im weißen Bademantel mit roten Herzen darauf, das Handtuch als Turban um den Kopf gewickelt, und gebannt dieser dämlichen Anwaltsserie folgte. Eine große Zärtlichkeit machte sich in ihm breit. So war es früher oft gewesen. Er hatte ihnen Abendbrot gemacht, und die Kinder, Charlotte und Anian, durften nach dem abendlichen Bad noch eine halbe Stunde Sandmann schauen. Anian machte in zwei Jahren sein Abitur, und auch Charlotte ging nicht mehr um 19 Uhr ins Bett. Sie vertrieb sich nur die Zeit, das Berliner Klubleben startete nicht vor 23 Uhr.
Nach dem Abendbrot räumte Kammowski auf und brachte den Müll in den Hof. Bei den Mülltonnen traf er Frau Beckmann, eine nette Frau, mit der er immer gerne ein paar Worte wechselte. Kennengelernt hatten sie sich nicht als Nachbarn. So ein Berliner Mietshaus konnte recht anonym sein, Kammowski pflegte zu niemandem engeren Kontakt. Frau Beckmann hatte er kennengelernt, als sie noch in der Wäscherei und Reinigung arbeitete, zu der Kammowski seine Bügelwäsche brachte. Als die Reinigung schloss, hatte sich die Nachbarin angeboten, weiterhin für Kammowski zu arbeiten. Sie war ja schon berentet, und er konnte sie unkompliziert als Haushaltshilfe über das Haushaltsscheckverfahren melden. Das war sehr praktisch, weil sie im selben Haus wohnte und auch bereit war, Kater Churchill zu versorgen, wenn Kammowski verreist war.
Kammowski mochte Frau Beckmann inzwischen sehr gerne. Sie war eine freundliche kleine Frau mit kurzen, blond gefärbten Haaren mit roten Strähnen, die Lebensfreude, Zuversicht und Tatkraft ausstrahlte. Sie gehörte zu den seltenen Menschen, die von einer Aura der Wärme und Zuversicht umgeben schienen und freizügig davon abgaben. Obwohl sie es, wie Kammowski wusste, nicht immer einfach gehabt hatte. Sie hatte ihm einmal erzählt, dass sich ihr Mann schon vor Jahren das Leben genommen hatte. Er sei psychisch krank gewesen. Sie selbst hatte ihr Leben lang gearbeitet, zwei Kinder großgezogen und bezog jetzt eine sehr kleine Rente. Um sich ein Auskommen zu sichern, arbeitete sie nebenher in verschiedenen Jobs. Kammowski fand, es sei nicht richtig, dass man neben seiner Rente noch arbeiten musste, um über die Runden zu kommen. Aber sie lachte dann immer und sagte, sie arbeite doch gerne, und nicht selten verkündete sie, sie habe gerade Kuchen fürs Wochenende gebacken, und weil man mit zwei Kuchen nicht mehr Arbeit hätte als mit einem, hätte sie für Kammowski gleich einen mit gemacht. Er müsse ihn sich nur abholen.
Heute hatte Frau Beckmann keinen Kuchen, und sie war auch nicht auf Schwätzen aus. Sie wirkte bedrückt. Während sie gemeinsam die Treppen hinaufstiegen, erzählte sie Kammowski, dass ihr Sohn vor einigen Wochen wieder bei ihr eingezogen sei. Kammowski erinnerte sich vage an einen jungen Mann, den er im Treppenhaus getroffen hatte und nicht hatte zuordnen können. Aber das Haus war groß, und viele Menschen gingen hier ein und aus.
»Herr Kommissar, wollen Sie vielleicht noch auf einen Tee hereinkommen?«
Kammowski zögerte. Frau Beckmann schien etwas auf der Seele zu liegen, das war offensichtlich, aber er war sich nicht sicher, ob er davon wissen wollte, so sympathisch ihm die Frau auch war. Er hielt eine freundliche Distanz nach wie vor für die beste Form guter Nachbarschaft.
»Gerne«, sagte er und folgte ihr in die Wohnung. »Aber sagen Sie doch einfach Herr Kammowski zu mir.«
Und dann, während Frau Beckmann den Tee kochte, berichtete sie erst stockend, dann immer gelöster von ihren Sorgen. Sie war so dankbar, einen Zuhörer gefunden zu haben. »Oliver ist krank. Er hat paranoide Schizophrenie. Die ersten Symptome stellten sich bei ihm mit achtzehn Jahren ein. Das war ein großer Schock für uns, und doch haben wir noch lange die Augen davor verschlossen. Wir hatten immer gedacht, er brauche eben noch Zeit, um erwachsen zu werden. Jungen sind doch manchmal Spätzünder. Wie das dann so ist. Man findet immer wieder Entschuldigungen und Erklärungen für auffälliges Verhalten. Aber irgendwann, da war er so Mitte zwanzig, kam der Tag, an dem wir uns vor der Wahrheit nicht mehr verstecken konnten.« Sie zögerte einen Moment und sann vor sich hin. »Wissen Sie, Herr Kommissar, Oliver hat eine große musikalische und künstlerische Begabung, er hätte Pianist oder Maler werden können. Das hat er von seinem Vater, der hat auch so schön Klavier spielen können.«
Daher kam also neuerdings die Musik im Haus, dachte Kammowski
»Er hat das Musikstudium noch angefangen, aber mit Beginn der Erkrankung war seine berufliche Karriere vorbei.« Sie suchte nach einem Taschentuch und schnäuzte sich. »Entschuldigen Sie bitte, Herr Kommissar.«
Kammowski wusste nicht, was er erwidern sollte. Er nahm einen Schluck von seinem Tee und verbrannte sich die Zunge.
Frau Beckmann fuhr mit ihrer Erzählung fort. »Mein Mann wollte nie Kinder. Wir waren beide nicht mehr so ganz jung, als wir heirateten. In meinem Alter bekam man damals eigentlich keine Kinder mehr. Und mein Mann hat sich, wie gesagt, gegen Kinder gesträubt. Nicht, weil er keine mochte oder die Verantwortung scheute. Nein, aber er hatte ja selbst diese Krankheit und große Angst, dass die Kinder das auch bekommen könnten.«
Sie schwieg eine Weile, und wieder durchzog ein leiser Seufzer ihren Körper. »Aber ich habe mir so sehr Kinder gewünscht, und die Ärzte haben auch gesagt, dass es nicht unbedingt heißt, dass auch die Kinder eine Psychose bekommen werden. Da müssten viele Dinge zusammenkommen, haben sie gesagt. Die Vererbung sei nur ein Faktor unter vielen. Also habe ich das einfach verdrängt. Ich bin vielleicht egoistisch gewesen, aber ich wollte doch so gerne eine richtige Familie haben.«
Sie schwieg und rührte in ihrem Tee herum. Tränen ließen ihre Augen unnatürlich glänzen. Sie tupfte sie mit einem Taschentuch energisch weg und richtete sich auf. Einer Schwäche nachzugeben gehörte nicht zu Frau Beckmanns Eigenschaften. Sie hat etwas Aristokratisches an sich, dachte Kammowski und meinte damit nicht ein Herkunftsprivileg, sondern die Haltung, sich von den Widrigkeiten des Alltags nicht runterziehen zu lassen. Das mochte er so an ihr.
»Als klar war, dass Oliver wie sein Vater an einer paranoiden Schizophrenie erkrankt war, hat sich mein Mann das Leben genommen.«
»Oh!« Kammowski war schockiert. Das war wirklich eine tragische Geschichte. Aber er fühlte sich auch unwohl in seiner Haut. Er war kein Psychotherapeut. Frau Beckmann hatte wohl seinen irritierten Gesichtsausdruck gesehen.
»Nein, nein, das war natürlich nicht der einzige Grund. Er war einfach selbst sehr krank und konnte die Belastung nicht aushalten. Der Ausbruch von Olivers Psychose hat nur das Fass zum Überlaufen gebracht. Er hat sich die Schuld gegeben, und ich habe mir immer gedacht, wenn ich nicht auf Kindern bestanden hätte, dann hätte es mit meinem Mann vielleicht auch nicht so ein schlimmes Ende nehmen müssen.«
»Das ist jetzt schon einige Jahre her?«, fragte Kammowski in der vagen Hoffnung, dass der Hinweis auf die lange Zeitspanne, die seit dem Ereignis inzwischen vergangen war, etwas von der emotionalen Spannung dieses Moments nehmen konnte.
»Ja, mehr als zehn Jahre. Oliver ist jetzt vierunddreißig Jahre alt. Und eigentlich ging es mit seiner Krankheit eine ganze Weile lang gut. Es gab zwar immer wieder Rückfälle, aber er konnte arbeiten, hatte eine eigene Wohnung. Doch jetzt will er sich auf einmal nicht mehr behandeln lassen. Behauptet, dass die Medikamente an allem schuld sind. Er hat die Arbeit verloren und inzwischen auch die Wohnung. Deshalb wohnt er jetzt wieder bei mir.«
»Das ist ja furchtbar. Was sagen denn seine Ärzte dazu?« Kammowski hätte sich am liebsten auf die Zunge gebissen, seine Erwiderung kam ihm so abgeschmackt, so nichtssagend, so wenig empathisch und so unecht vor. Ihm fehlten einfach die richtigen Worte. Aber Frau Beckmann schien nicht dieser Ansicht zu sein, sondern fuhr mit ihrer Erzählung fort.
»Nichts, stellen Sie sich das vor. Die sagen einfach, wenn er sich nicht behandeln lassen will, dann ist das seine Entscheidung. Der Junge kann doch gar nicht entscheiden. Dazu ist er doch gar nicht in der Lage. In den letzten Monaten war er oft in der Klinik. Die nehmen ihn zwar immer wieder auf, aber wenn er dann sagt, dass er keine Behandlung will, entlassen sie ihn einige Tage später wieder. Und dann stehe ich wieder allein da mit dem Problem, kann sehen, wie ich mit ihm klarkomme.«
Ein Anflug von Aufbegehren hatte sich jetzt in ihre sonst so sanfte Stimme geschlichen. Kammowski wusste immer noch nicht, was er sagen sollte.
»Das ist nicht einfach für Sie, nehme ich an.«
Frau Beckmann liefen die Tränen inzwischen ungehemmt über die Wangen. Sie hatte den Versuch aufgegeben, sie zu verbergen. »Herr Kommissar, es tut mir wirklich leid, dass ich Sie jetzt damit belästige. Aber ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Ich kann ihn doch nicht zwingen, die Medikamente zu nehmen. Und ich fürchte, er nimmt auch Drogen. Schauen Sie sich bitte einmal sein Zimmer an.«
Kammowski zögerte, aber sie war schon aufgesprungen und vorausgelaufen. Jetzt winkte sie ihn energisch heran. »Keine Sorge, er ist nicht da, abends verschwindet er immer, tagsüber schläft er.«
Olivers Zimmer war in der Tat ungewöhnlich. Der Kontrast zu der sorgsam gepflegten Wohnung hätte nicht größer sein können. Es herrschte das totale Chaos. Doch das war nicht das eigentlich Ungewöhnliche. Charlottes Zimmer sah ähnlich aus. Aber in Olivers Zimmer standen überall Kerzen herum, an den Wänden hingen Heiligenbilder, Kreuze und andere Devotionalien.
»Ihr Sohn ist sehr religiös.«
»Ach, Quatsch.« Sie machte eine unwillige Bewegung mit der Hand. »Jahrelang hat er mir Vorträge darüber gehalten, dass er Agnostiker sei, das ist so was Ähnliches wie Atheist.« Sie hielt inne, schien zu erwägen, ob sie dem Kommissar den Unterschied erklären sollte, überlegte es sich aber anders. »Ist ja auch egal, religiös wird er jedenfalls immer nur im Schub seiner Erkrankung. Dann spricht die Muttergottes mit ihm und gibt ihm Anweisungen.«
Kammowski folgte ihrem Blick in die Mitte eines altarartig geschmückten Wandabschnitts. Eine offensichtlich selbst gemalte Madonnendarstellung bildete das Zentrum des Arrangements. Das Bild berührte Kammowski. Es zeigte eine sehr junge Frau. Sie lächelte, aber in ihrem Blick schien sich das Leid der Welt zu spiegeln. Eine Mater dolorosa. Eine Pietà.
»Das hat Ihr Sohn gemalt?« Frau Beckmann nickte.
»Er ist wirklich begabt.«
»Ja, begabt ist er, aber was nützt ihm das, wenn die Krankheit alles kaputt macht. Schauen Sie sich das da an.«
Sie wies auf die Wandfläche, die an die Nachbarwohnung angrenzte. Sie war von oben bis unten mit Alufolie abgeklebt. »Das soll gegen die NSA helfen. Er wird nämlich abgehört, müssen Sie wissen. Deswegen benutzt er auch kein Handy und zieht mir immer den Telefonstecker aus der Dose.«
Sie gingen zurück ins Wohnzimmer. Kammowski war peinlich berührt. Er war jetzt sehr weit vorgedrungen in das Leben seiner Nachbarin und die Gedankenwelt ihres Sohnes. Er fühlte sich immer hilfloser.
»Haben Sie denn sonst keine Familie, die Sie unterstützt?«
»Ich habe noch eine Tochter, Helena, sie ist zwei Jahre jünger als Oliver und zum Glück gesund. Aber sie ist mir keine Hilfe. Im Gegenteil. Sie sagt, es sei ein Fehler gewesen, ihn wieder bei mir aufzunehmen. Sie sagt, er würde mich zugrunde richten. Sie hat ja nicht ganz unrecht. Es ist schon ziemlich anstrengend mit Oliver. Aber er ist doch mein Sohn, und der eigentliche Beweggrund von Helena ist wohl, dass sie das Gefühl hat, immer zu kurz zu kommen. Und da ist ja auch etwas Wahres dran. Oliver hat sich mit seiner Erkrankung immer in den Vordergrund gedrängt. Natürlich nicht mit Absicht. Verstehen Sie mich jetzt nicht falsch. Aber sagen Sie das einmal einem Kind, dessen Hochzeitsfeier von den Eskapaden seines Bruders überschattet wird.«
Frau Beckmann seufzte. »Ich mache noch einmal frischen Tee«, sagte sie und stand auf. Kammowski wollte keinen Tee mehr. Aber er brachte es nicht übers Herz, das zu sagen. Während Frau Beckmann in der Küche werkelte, stand er auf und ließ seinen Blick durch das Wohnzimmer wandern. Ein altes schwarzes Klavier, übersät mit Noten und anderen Gegenständen. Hier herrschte dasselbe Chaos wie in Olivers Zimmer. Der Rest des Zimmers war sauber und geordnet. Vor den Fernsehmöbeln blieb er stehen und nahm eine DVD von einem der sorgfältig aufgereihten Stapel.
»Das ist mein kleines Laster«, lächelte Frau Beckmann, als sie mit dem Tee zurückkam. »Ich mag amerikanische Serien. Und wenn man einmal eine angefangen hat, dann ist das fast wie eine Sucht, man muss immer weitersehen.«
»Das haben Sie mit meiner Tochter gemeinsam.« Sie nahmen wieder an dem Esszimmertisch Platz.
»Ja, ich weiß, ein nettes Mädchen, ich habe sie schon kennengelernt.«
»Sie kennen Charlotte?«
»Ja, wir haben uns ein paarmal im Flur unterhalten. Sie hat mir erzählt, dass sie an die Charité will. Herr Kommissar, ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie mir zugehört haben. Es tut gut, sich das einmal von der Seele reden zu können. So ist das eben, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen.«
Kammowski lächelte und drückte ihre Hand. Es gab nichts mehr zu sagen. Seine Gedanken wanderten wieder zu Charlotte. Wie wenig er sie kannte. Es war jetzt schon fast sechs Jahre her, dass Elly und er sich getrennt hatten. Sie war mit den beiden Kindern nach Köln gezogen. Obwohl er sich bemüht hatte, den Anschluss nicht zu verlieren, hatte er doch wesentliche Jahre seiner Kinder verpasst. Das war ihm in der letzten Woche schmerzlich bewusst geworden. Wo war nur sein unkompliziertes kleines Mädchen geblieben? Und was wusste er eigentlich von seinem Sohn? Wie glücklich konnte er andererseits sein, dass sie gesund waren.
7
Rückblick
In der geschlossenen Akutstation für Erwachsene, wohin man Lena gebracht hatte, weil sie in der Kinderpsychiatrie nicht mehr »führbar« gewesen war, nahm Lena am nächsten Tag ihren Rundlauf wieder auf, sobald man sie aus der Fixierung gelassen hatte. Niemand störte sich an ihrer Wanderung. Hier war jeder mit sich selbst beschäftigt. Sie war noch wackelig auf den Beinen, alles tat ihr weh, die waren nicht zimperlich mit ihr umgegangen. Aber sie konnte nicht im Bett liegen bleiben, sie musste laufen. Die Station war größer als die Kinderstation, ihre Runden dadurch länger. Also passierte sie wieder die Eckpunkte der Station ab, wie ein eingesperrtes Wildtier im Zoo die Gitterfläche seines Käfigs ablief: bereit, jede sich bietende Möglichkeit zur Flucht zu nutzen. Aber es bot sich keine Möglichkeit zu entkommen. Lena hatte den Eingang zur Station im Blick. Die Tür öffnete sich nach außen, und wenn jemand vom Personal die Station verließ, hätte man sich nur direkt dahinter gegen die Tür werfen müssen, und schon wäre man weg. Aber die passten gut auf und öffneten die Tür nur, wenn keiner der Patienten in der Nähe war. Lena spürte in ihrem Inneren den Druck wieder ansteigen.
Die Gerüche und Geräusche der Station, das Klappern der Teller, des Stationswagens, jeder Schritt, jedes Gespräch, jeder Ton hallten über den langen, kalten Flur und wurden von den funktionalen glatten Wänden und der Decke tausendfach wiedergegeben und verstärkt. Aus dem Stationszimmer dudelte den ganzen Tag das Radio, Popmusik im Wechsel mit Reklame und Eigenwerbung des Senders. Wenn sich gerade niemand vom Personal im Zimmer aufhielt, war die Tür sorgfältig verschlossen. Keine Chance, an Medikamente oder gar den Schlüsselschrank zu kommen. Wahrscheinlich gab es so einen Schrank gar nicht. Lena hatte beobachtet, dass das Personal einen Transponder am Körper trug, mit dem die Türen geöffnet wurden.
Plötzlich hielt sie inne. Aus dem Aufenthaltsraum, den sie bisher gemieden hatte, weil dort meistens der Fernseher seinen Beitrag zur Kakofonie der Geräuschkulisse beitrug und sie mit den Irren dort nicht in Kontakt treten wollte, klang plötzlich Klaviermusik. Sie hatte bei ihren Runden schon das Klavier bemerkt, aber es war abgeschlossen gewesen. Jetzt spielte jemand. Und was sie hörte, war das erste erträgliche Geräusch in dieser Umgebung.
8
A