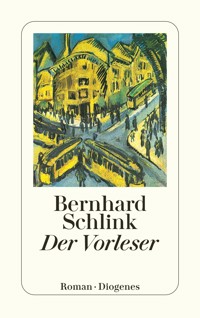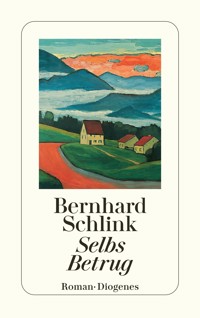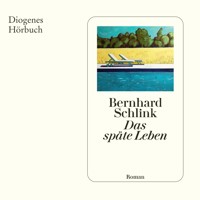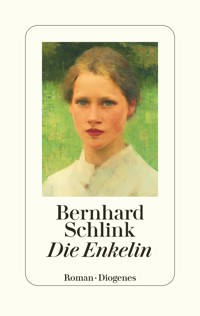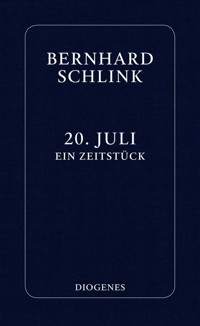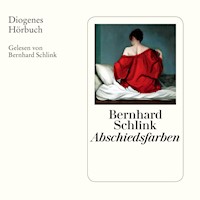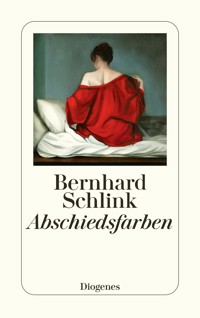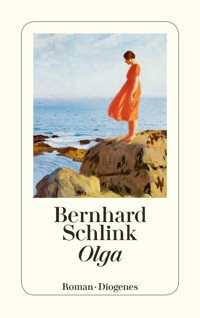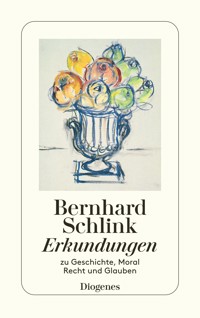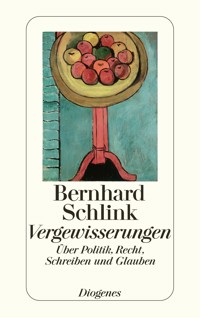
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wer an der Entwicklung der Gesellschaft manchmal verzweifeln möchte, dem sei dieses Buch empfohlen: Kompetent und in klarer, schöner Prosa zeigt es, was alles nicht zwangsläufig und unaufhaltsam ist und dass es Werte und Hoffnungen gibt, auf die zu setzen lohnt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bernhard Schlink
Vergewisserungen
Über Politik,Recht, Schreibenund Glauben
Editorische Nachweise am Ende des Bandes
Die Erstausgabe erschien 2005
im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Henri Matisse, ݀pfel auf dem Tuch
vor grünem Hintergrund‹, 1916
Copyright © Succession H. Matisse /
2013, ProLitteris, Zürich
Foto: Chrysler Museum of Art, Norfolk VA
Gift of Walter P. Chrysler, Jr.
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2013
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 06483 4 (2.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60389 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5] Inhalt
Vorwort [7]
POLITISCHE HOFFNUNGEN
Heimat als Utopie [11]
Rousseau in Amerika [37]
Frauen und Macht [61]
Zum Ende des Amtes von Jutta Limbach als Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts
Wirtschaft und Vertrauen [66]
Die erschöpfte Generation [77]
RECHTLICHE ECKPUNKTE
Zwischen Säkularisation und Multikulturalität [89]
Das Dilemma der Kunstfreiheit [112]
Über den Prozeß um »Christus am Kreuz mit Gasmaske« von George Grosz (gemeinsam mit Wilhelm Schlink)
Die überforderte Menschenwürde [125]
Der Preis der Gerechtigkeit [137]
An der Grenze des Rechts [167]
BEGEGNUNGEN BEIM SCHREIBEN
Schlage die Trommel und fürchte dich nicht! [181]
Rede anläßlich der Verleihung der Ehrengabe der Heinrich-Heine-Gesellschaft
Ein Teil der Welt [194]
Rede anläßlich der Verleihung des Hans-Fallada-Preises
Der Geist der Erzählung [200]
Laudatio auf Imre Kertész
[6] Verschüttete Vergangenheit [207]
Laudatio auf Pat Barker
Rückkehr und Wiederholung [215]
Laudatio auf Jeffrey Eugenides
Gotthold Ephraim Lessing: Bürgerliches Denken über Recht, Staat und Politik am Vorabend der bürgerlichen Gesellschaft [225]
Das Duell im 19.Jahrhundert: Realität und literarisches Bild einer adeligen Institution in der bürgerlichen Gesellschaft [248]
Am Ende war er nur noch er selbst [276]
Über »Die Erschießung Kaiser Maximilians« von Edouard Manet
ERFAHRUNGEN MIT INSTITUTIONEN
Literatur als Bilderbuch der Rechts- und Staatsphilosophie [283]
Zu Peter Schneider, »…ein einzig Volk von Brüdern«. Recht und Staat in der Literatur
Literatur als Institution [297]
Zur zwanzigjährigen Wiederkehr des Erscheinens von Richard H. Weisberg, The Failure of the Word. The Protagonist as Lawyer in Modern Fiction
Jakobs Kampf am Jabbok [310]
Bibelarbeit über 1. Mose 32, 23–33
Gotteskindschaft [331]
Predigt über Philipper 2, 12–13
Die Kirche [338]
Predigt über Apostelgeschichte 2, 1–18
Den Glauben gestalten [350]
[7] Vorwort
Neben den Bereichen, in denen wir zu Hause sind und Bescheid wissen, gibt es das große Feld der Themen und Probleme, die uns betreffen und beschäftigen, ohne daß wir je auf Expertenschaft hoffen könnten. Wir müssen uns mit weniger bescheiden. Bei manchen Themen und Problemen machen wir unseren Frieden damit, daß wir ihr Geheimnis nie lüften, ihr Rätsel nie lösen werden. Bei vielen genügt uns ein Alltagswissen. Bei anderen wollen wir mehr – weil sie ein Erbteil sind, das uns von früh an begleitet, weil sie unserem Beruf so nah und so wichtig für ihn sind, daß wir sie nicht im Ungefähren lassen können, weil wir an einem Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens mit ihnen konfrontiert werden. Sie sind uns nicht unzugänglich – das wissen wir. Wir wissen aber auch, daß wir ihrer nie so sicher sein werden, wie wir uns anderer Themen und der Lösung anderer Probleme sind.
Wir können uns ihrer immerhin vergewissern. Vergewisserung – unter diesen Begriff fallen für mich die Überlegungen, die ich jenseits meiner rechtswissenschaftlichen Überlegungen anstelle, weil ich’s wissen will, auch wenn ich weiß, daß ich es nie so wissen werde wie in der Rechtswissenschaft, in der ich zu Hause bin und Bescheid weiß. Die Sehnsucht nach Heimat und der Wunsch nach Alternativen, die Situation meiner Generation, der Preis der Gerechtigkeit und die Grenzen des Rechts, die politische Verantwortung [8] des Schriftstellers und das Verhältnis zwischen Literatur und Recht, der Glaube und die Institution der Kirche – es sind Themen, die mich seit langem begleiten: von Kindheit an, seit meine Generation ihren Zenit erreicht hat, seit ich die Unzulänglichkeiten meiner Wissenschaft sehe, seit ich aufgefordert werde, Auskunft zur Aufgabe des Schriftstellers und der Literatur zu geben. Da ich weder Soziologe noch Philosoph, kein Literaturkritiker und -wissenschaftler und kein Theologe bin, geben die Vergewisserungen keine soziologische oder philosophische, literaturwissenschaftliche oder theologische Auskunft. Daß ich selbst schreibe, gibt mir auch keine Kompetenz, was die Aufgabe des Schriftstellers und der Literatur angeht; ich schreibe, weil es mich glücklich macht, und sehe mich unter keiner anderen Aufgabe als der, Geschichten zu erzählen, die für mich stimmen. Was das genau bedeutet, weiß ich nicht – ein Nichtwissen, das mich anders als bei meiner Wissenschaft beim Schreiben nicht beunruhigt.
Fast alle Beiträge des Bands sind als Vorträge entstanden: akademische und essayistische Vorträge, Tagungsbeiträge, Dankesreden, Laudationes und Predigten. Die Gestaltungen sind so verschieden wie die Kontexte meines Lebens.
Den Mut, die Vorträge in einem Band zusammenzutragen und zu veröffentlichen, machen mir außer der freundlichen Anregung meines Verlegers Daniel Keel die Vergewisserungen anderer, die mir manchmal hilfreicher waren als die Auskünfte von Experten. Ich freue mich, wenn es anderen mit meinen Vergewisserungen ähnlich geht.
Bernhard Schlink
[9] Politische Hoffnungen
[11] Heimat als Utopie
I.
Immer wieder treffe ich Deutsche aus den neuen Ländern, die mir sagen, sie fühlten sich im Exil, obwohl sie leben, wo sie immer schon lebten, wohnen, wo sie immer schon wohnten, und vielleicht sogar in derselben Fabrik, Behörde, Schule oder Zeitung arbeiten, in der sie schon vor der Wende arbeiteten. Alles habe sich verändert und sei ihnen fremd geworden. Mehr noch, es habe sich nicht einfach verändert, sondern sei von anderen verändert worden, ohne ihr Zutun und gegen ihren Willen, sei ihnen von anderen entfremdet worden. Deshalb lebten sie im Exil – in der Fremde, in der man nach Gesetzen leben muß, die man nicht selbst gemacht hat und über deren Auslegung und Anwendung man nicht selbst entscheidet.
Im selben Sinn äußern sich, auch und gerade in den USA, Angehörige von Minderheiten; sie fühlen sich unter der Mehrheit, unter der sie leben, als lebten sie im Exil. Es gibt Frauen, die sich im Exil fühlen, weil sie die Gesellschaft, in der sie leben, als von Männern geschaffen und von Männern dominiert erfahren. Es gibt Alte, die das gleiche Gefühl in unserer der Jugend und ihrer Schönheit, ihrer Kultur und ihrem Konsum huldigenden Gesellschaft haben.
Bei allen, von den Deutschen in den neuen Ländern bis [12] zu den Alten in unserer Jugendlichkeitsgesellschaft, kann ich das Gefühl verstehen und auch, warum es sich mit dem Begriff des Exils verbindet. Und doch bleibt die Verbindung seltsam. Denn ursprünglich und eigentlich ist der Begriff des Exils der Gegenbegriff zum Begriff der Heimat, die man verlassen mußte. Man wurde aus ihr vertrieben, durch Gewalt oder durch Not; sie liegt irgendwo jenseits der Grenze; man sehnt sich nach ihr zurück und kehrt auch in sie zurück, wenn es die Verhältnisse dort erlauben, wenn die politische Unterdrückung endet oder die Hungersnot oder das Wüten der Seuche. Das Gesetz der Fremde, unter dem man im Exil lebt, ist zuallererst das Gesetz der fremden Sprache. Gerade Schriftsteller haben die Härte dieses Gesetzes beschrieben und beklagt. Czes¥aw Mi¥osz sagt über den Schriftsteller im Exil: »In the country he comes from he was aware of his task and people were waiting for his words, but he was forbidden to speak. Now where he lives he is free to speak, but nobody listens and, moreover, he forgot what he had to say.« Ähnlich sagt Joseph Brodsky: »To be an exiled writer is like being a dog hurtled into outer space in a capsule. And your capsule is your language and before long you discover that the capsule gravitates not earthward but outward in space.«
Gewiß, es gibt positive Beschreibungen des Exils und auch dessen, was das Exil für den Schriftsteller bedeutet. Mi¥osz fragt, ob es als Zustand legitimierter Fremdheit nicht sogar privilegiert sei gegenüber der Fremdheit, unter der letztlich jeder Schriftsteller in seiner Gesellschaft leide; Brodsky beschreibt ebenso wie den Schrecken auch die Chance der Freiheit im Exil; und Marina Zwetajewa meint, [13] Schriftsteller, »far-sighted by the very nature of their craft«, könnten sogar ihre Heimat besser aus der Fremde sehen. Entscheidend beim ursprünglichen und eigentlichen Begriff des Exils ist nicht die negative und ist auch nicht eine positive Konnotation – es gibt beide. Entscheidend ist die Korrespondenz zum Begriff der Heimat, in der man zu Hause war, in der man zu Hause wäre, wenn man könnte, und in die man wieder zurückkehrt, wenn sie einen wieder aufnimmt.
Wo ist diese Heimat für die Deutschen, die aus den neuen Ländern stammen und sich in den neuen Ländern doch im Exil fühlen? Hinter welcher Grenze liegt sie? Hinter welcher Grenze liegt die Heimat der Minderheit, die unter einer Mehrheit lebt und schon immer lebte, sich unter ihr aber im Exil fühlt? Aus welcher Gesellschaft sind die Frauen in die Männergesellschaft vertrieben worden und die Alten in die Jugendlichkeitsgesellschaft? In welcher Gesellschaft spricht man die Sprache der Frauen oder die Sprache der Alten, die man in der Männer- bzw. Jugendlichkeitsgesellschaft nicht versteht?
II.
Was für törichte Fragen, mögen Sie denken. Exil ist eine Metapher, und die Frage, wo die zum Exil gehörige Heimat ist, geht ebenso fehl, wie die nach dem Vater fehlginge, mit dem die Philosophie, die Mutter der Wissenschaften, ihre Kinder hat. Exil ist das Leben in der Fremde, das nicht selbst-, sondern fremdbestimmte, das entfremdete Leben. Exil ist eine [14] Metapher für die Erfahrung der Entfremdung, die so existentiell und universell ist, daß sie keinen Ort braucht und auch keine Heimat als Gegenort.
In der Tat finden sich in heutigen Äußerungen über das Exil und das Leiden im Exil Wendungen wieder, in denen immer schon marxistische und existentialistische Entfremdungserfahrungen beschrieben wurden. Daß, wie für die unterdrückte Klasse, auch für das unterdrückte Geschlecht und die unterdrückten Völker das Verhältnis zur eigenen Tätigkeit »das Verhältnis zur eignen Tätigkeit als einer fremden« und das Verhältnis zur Außenwelt »das Verhältnis zur Außenwelt als einer fremden« ist, steht zwischen dem frühen Karl Marx der ökonomisch-philosophischen Manuskripte und dem späten Jean-Paul Sartre außer Frage. Daß die Verhältnisse die menschlichen Bande, auch die, die in der Arbeitswelt den Menschen an seinen Kollegen und Vorgesetzten knüpften, »unbarmherzig zerrissen und kein anderes Band zwischen Mensch und Mensch übriggelassen als das nackte Interesse, als die gefühllose ›bare Zahlung‹« – mit diesen Worten von Marx und Friedrich Engels aus dem Kommunistischen Manifest könnte heute auch ein Deutscher aus den neuen Ländern die Veränderungen seiner Arbeitswelt beschreiben.
Ja, Exil ist eine Metapher für die Erfahrung der Entfremdung. Aber das erledigt die Frage nach der dem Exil korrespondierenden Heimat nicht. Warum findet die Erfahrung der Entfremdung am Ende dieses Jahrhunderts wieder eine Metapher, die sich auf Orte bezieht, explizit auf den Ort des Exils, an dem die Erfahrung gemacht wird, und implizit auf den Ort, an dem man nicht im Exil, sondern zu Hause wäre? [15] Die marxistische und die existentialistische Entfremdungserfahrung war ohne Ortsbezug, war Erfahrung der Ortlosigkeit. Das Proletariat hat in der bürgerlichen Gesellschaft keinen Ort und braucht keinen in der kommunistischen, es ist nach der Vorstellung von Marx und Engels die Klasse, in deren Partikularität als Klasse die Universalität der Menschheit angelegt ist, über alle Länder, alle Grenzen, alle Orte hinausgreifend. Und von Søren Kierkegaard bis Sartre ist die existentialistische Erfahrung die des ex-sistere, des Heraustretens aus allen vorgegebenen Zusammenhängen, Ordnungen und Ortungen des Seins, die Erfahrung der ortlosen Vereinzelung und Einsamkeit vor Gott oder dem Nichts. Den Ort, die Heimat, die die bürgerliche Gesellschaft, die Nation, die kirchlichen oder kulturellen Institutionen, die Familie und die Ehe versprechen, als Illusion zu erkennen, stiftet denn auch die Berührungen zwischen marxistischer und existentialistischer Erfahrung. Von ihr geprägt war Ortlosigkeit in diesem Jahrhundert und besonders auch nach dem Zweiten Weltkrieg lange die intellektuelle Erfahrung schlechthin.
III.
Es war die intellektuelle Erfahrung, mit der meine Generation aufwuchs. Das Exil während des Dritten Reichs vertriebener Deutscher, oft jüdischer deutscher Künstler, Schriftsteller und Wissenschaftler, fand in der Bundesrepublik nicht nur deshalb lange wenig Aufmerksamkeit, weil der nationalsozialistische Blick der Elterngeneration, der [16] die Exilanten als vaterlands- und treulose Gesellen wahrgenommen und ausgegrenzt hatte, erst langsam überwunden wurde. Auch in den Augen meiner Generation bedurften die Exilanten keiner besonderen bundesrepublikanischen Aufmerksamkeit. Sie waren im wörtlichen Sinn »gut raus«; sie waren raus aus Deutschland, und sie hatten es gut getroffen. Es verstand sich für uns von selbst, daß das Exil, besonders das amerikanische, Weite, Offenheit und Universalität assoziieren ließ und positiver besetzt war als die deutsche Heimat, die für nationalstaatliche Beschränkung und Beschränktheit stand. Exil war Freiheit, Heimat war der Muff der Vertriebenen und ihrer Verbände. Wir wuchsen mit der Vorstellung auf, nach den um den »Platz an der Sonne«, den »Lebensraum« geführten Weltkriegen sei Nationalismus historisch erledigt, der Nationalstaat löse sich in europäische oder atlantische politische Zusammenhänge auf, Heimat sei überall und nirgends, und wer sich da, wo er war, nicht zurechtfinde und wohl fühle, sondern nach einer verlorenen Heimat in Pommern, Schlesien oder Böhmen verlange, sei ein Revanchist. Wir mochten mehr oder weniger intellektuell interessiert sein. Das intellektuelle Lebensgefühl der Ortlosigkeit, der nationalen Unbezogenheit und Ungebundenheit teilten wir allemal. Wir teilten es gerade als Deutsche; als Kinder der diskreditierten Nation waren wir mit besonderem Engagement Europäer oder Atlantiker und wollten am liebsten Weltbürger sein.
Das änderte sich in den siebziger Jahren. Ich erinnere mich nicht mehr an den Namen, aber noch gut an den Artikel des amerikanischen Journalisten, der damals durch Deutschland reiste und beschrieb, wie ihm die Badener von der [17] Verbundenheit der badisch-elsässisch-Schweizer Region am Oberrhein und davon erzählten, sie seien eher oberrheinische europäische Regionalisten als Deutsche, die Hamburger, sie seien als Hanseaten schon immer eher maritim und britisch als deutsch orientiert, und die Bayern von der alten Distanz Bayerns zu Preußen und seiner Nähe zu Österreich und Italien. Der Ortsbezug, den das deutsche Lebensgefühl allmählich wieder zuließ, war zunächst ein regionaler, der die nationalen Grenzen bewußt vernachlässigte. Edgar Reitz’ Fernsehchronik Heimat ging dann einen Schritt weiter; in ihr spiegelte das Schicksal einer Region das Schicksal der Nation. Auch sonst begann im Deutschland der achtziger Jahre die Nation zum Thema zu werden, konnten wieder nationale Interessen benannt und nationale Gefühle bekannt und die nationale Identität diskutiert werden; ein Buch mit der Titelfrage »Lieben Sie Deutschland?« vereinigte parteien- und generationenübergreifend die Antworten prominenter Linker, Rechter und Grüner. Seit dem Ende der Teilung ist die Nation wieder eine Realität, mit der wir uns zwar noch schwertun, der wir uns aber nicht mehr in europäische oder atlantische Zugehörigkeiten oder auch das intellektuelle Lebensgefühl der Ortlosigkeit entziehen können.
Die Rückkehr des Nationalen in den intellektuellen Diskurs ist nicht auf Deutschland beschränkt. In den neunziger Jahren erlebten die USA eine lebhafte Debatte, in der Patriotismus und Nationalismus gegen Kosmopolitismus und die Internationalisierung und Globalisierung der Welt verteidigt wurden und in der Martha C. Nussbaum mit ihrer These kosmopolitischer Zugehörigkeit und Verantwortung, wenn ihre kommunitaristischen, verfassungspatriotischen [18] und nationalistischen Gegenpositionen zusammengenommen werden, mehr Ablehnung als Zustimmung gefunden hat.
Wie sollte das Nationale für die Intellektuellen auch keine neue Relevanz gewinnen! Es hat in der Welt eine neue Relevanz gewonnen, vom Zerfall der übernationalen politischen Einheiten Sowjetunion und Jugoslawien über die Spannungen und Verwerfungen in den multiethnischen Staaten Afrikas und in Indonesien bis zu den Eruptionen von Fremdenfeindlichkeit in den Staaten Europas. Die Welt, die, jedenfalls in der Wahrnehmung der Intellektuellen, das Nationale, weil durch die Weltkriege diskreditiert und im Ost-West-Gegensatz obsolet geworden, hinter sich gelassen hatte, ist ihm wieder überall konfrontiert.
IV.
Nun sind die Exilgefühle der Deutschen in den neuen Ländern und der Angehörigen von Minderheiten in den USA nicht eigentlich nationale Gefühle, und die der Frauen und der Alten sind es ohnehin nicht. Die Metapher zeigt nur an, daß die Entfremdungserfahrung, die, geprägt von der existentialistischen und marxistischen Sicht des ungeborgenen, unbehausten oder des an die Produktions- und Eigentumsverhältnisse verlorenen Menschen, universalistisch war, nun konkret geworden ist. Man ist nicht mehr entfremdet, weil man das Schicksal aller Menschen oder aller Proletarier aller Länder teilt, sondern weil man da ist, wo man konkret ist – als Ossi in den von Wessis regierten neuen [19] Ländern, als Schwarzer im weißen Suburb, als Frau in einer männerdominierten Berufs- und als Alter in einer jugenddominierten Freizeitwelt. Es geht um den konkreten Ort, und daß er wieder ins Bewußtsein getreten ist und die Metapher des Exils trägt, liegt nicht allein an der Rückkehr des Nationalen in den intellektuellen Diskurs. Gewiß, die Nation, in der man beheimatet ist, ist ein konkreter Ort, und ebenso konkret ist der Ort des Exils, wenn man aus der Nation vertrieben oder geflohen ist. Aber konkreter sind die Orte, an denen wir wohnen und arbeiten, die Kieze, Städte und Landschaften, in denen wir leben. Daß die Deutschen in den siebziger Jahren die Region entdeckten, war nicht nur ein Schritt auf dem Weg zur Wiederentdeckung und -aneignung der Nation.
Die neue Liebe zu Region, Stadt und Kiez war und ist auch eine Reaktion auf eine neue, keineswegs ausschließlich deutsche Entfremdungserfahrung. Früher war die konkrete Lebenswelt durch die Verschiedenheit der Städte und Landschaften, Berufe und Stände, kulturellen, religiösen und politischen Milieus so vielgestaltig und verschiedenartig, daß das Gefühl der Entfremdung, der Uniformität und Anonymität, der Verlorenheit, Ungeborgenheit oder Unbehaustheit seinen Anhalt und seine Erklärung nicht in Konkretem, sondern in Abstraktem fand, in den Produktions- und Eigentumsverhältnissen, der Stellung des Menschen vor Gott oder gegenüber dem Sein und dem Nichts. Heute droht die Lebenswelt so gleichförmig und gesichtslos zu werden, daß die Entfremdung in ihr selbst erfahrbar und aus ihr selbst erklärbar wird. Wenn das Leben auf dem Land wie das in der Stadt ist, nur kleinräumiger, wenn sich die Städte nur [20] noch durch die Größe ihrer mit den gleichen Steinen gepflasterten und mit den gleichen Lampen, Bänken und Pollern bestückten Fußgängerzonen unterscheiden, wenn die Geschäfte die gleichen Filialen derselben Ketten sind, wenn die Parteien wie die Kirchen immer ähnlicher in Erscheinung treten, werden Uniformität und Anonymität zur alltäglichen Erfahrung. In der Uniformisierung und Anonymisierung der Lebenswelt wird Entfremdung konkret vor Ort erfahren. Entsprechend richtet sich auch die Sehnsucht nach nichtentfremdetem Leben nicht mehr auf abstrakte Mächte und Kräfte, neue Produktions- und Eigentumsverhältnisse oder den Stand vor Gott, Sein und Nichts, sondern auf konkrete Orte, auf die Region, die Stadt, den Kiez; diese sollen Individualität besitzen und ausstrahlen und Geborgenheit und Behaustheit vermitteln.
Schließlich war und ist die neue Liebe zu Region, Stadt und Kiez eine Reaktion auf die Zunahme von Mobilität und Flexibilität. Mobilität, das Leben an immer wieder neuen, fremden Orten, und Flexibilität, das Leben nicht mehr im Betrieb, mit fester Arbeitsaufgabe und Arbeitszeit, Mitbestimmung und Lebensperspektive, nicht mehr in der Daimler- oder Siemens-Familie, sondern mit wechselnden Arbeitsaufgaben, -orten und -zeiten und in vereinzelnder und vereinsamender Scheinselbständigkeit – beides verlangt immer wieder Abschiednehmen, Unterwegs-Sein, Sich-Umstellen. Auch das ist eine konkrete Erfahrung von Entfremdung der Lebenswelt und weckt die Sehnsucht, sich jeweils am konkreten Ort heimisch zu machen.
So ist der konkrete Ort nicht nur als Nation, sondern auch als Region, Stadt und Kiez wieder ins Bewußtsein [21] getreten. Auch dies trägt die Metapher des Exils. Aber das beantwortet noch nicht die Frage nach dem Ort der Heimat, der dem Ort des Exils korrespondiert. Wo haben die Menschen ihre Heimat?
V.
Eine Statistik des Spiegel liefert Antworten. Statistisch ist Heimat für 31Prozent der Wohnort, für 27Prozent der Geburtsort, für 25Prozent die Familie, für sechs Prozent die Freunde und für elf Prozent das Land. Das sind deutsche Zahlen; ich vermute, europäische und amerikanische Zahlen wären ähnlich. Dabei haben die für die Statistik Befragten geäußert, daß Heimat im Zeitalter der Internationalisierung und Globalisierung durchaus an Bedeutung gewinnt. Daß das Land nur für elf Prozent die Heimat ist, deutet also nicht auf einen geringen individuellen Stellenwert der Heimat hin, sondern darauf, daß das Land als Nation nach wie vor historisch hinreichend diskreditiert ist, um den Platz der Heimat unverfänglicheren und außerdem näheren, überschaubareren, ausfüllbareren Orten zu überlassen.
Die statistisch ermittelte Heimat hat also viele Orte: den Wohn- und den Geburtsort, den Ort, an dem die Familie lebt, die Orte, an denen die Freunde leben. Jeder hat einen oder mehrere dieser Orte, und wenn man einen verliert, kann man an seiner Stelle einen anderen suchen: einen neuen Wohnort, neue Freunde, eine neue Familie. Auch das Exil ist ein Ort, an dem gewohnt wird und es Familie und Freunde gibt. Entscheidend ist nach der Statistik weniger, wo der Ort [22] ist, an dem man wohnt, Familie und Freunde hat, als vielmehr: daß man einen solchen Ort hat, einen Ort, an dem man einer Gemeinschaft zugehört, in ihr anerkannt und mit ihr durch Geburt oder Wohnung, Familie oder Freunde verbunden ist.
Die statistisch ermittelten elementaren Erfahrungen des Wohn- und Geburtsorts, des Orts der Familie und der Freunde als Heimat werden aus der Distanz gemacht. Erst aus der Distanz wird das Selbstverständliche erfahrbar – die Atemluft erst in der Atemnot und der Stand und Halt, den die Festigkeit der Erde gibt, erst auf dem Schiff, im Flugzeug oder wenn die Erde bebt. Die Heimaterfahrungen werden gemacht, wenn das, was Heimat jeweils ist, fehlt oder für etwas steht, das fehlt. Der Geburtsort steht für die Kindheit; der Wohnort wird Heimat, wenn man anderswo ist, auf Geschäfts- oder Ferienreise; was man an der Familie hat, weiß man, wenn man von ihr getrennt ist, und was an den Freunden, wenn man sie vermißt. Auf eine Umfrage zur Statistik wurde auf die Frage nach der Heimat mehrfach auch von Orten des Arbeitens in diesem Sinn erzählt, vom Theater, nach dem sich eine Schauspielerin sehnt, oder vom Tonstudio, dessen »elektronischer Geruch« einem Techniker lieb geworden ist und auf Reisen fehlt. Oft wurden auf die Frage nach der Heimat Erinnerungen genannt und dazu etwa der Ort beschrieben, an dem die Großmutter noch lebt, oder der am früh verlassenen Geburtsort in der Türkei gerochene »Duft von Zimt, Ingwer und Pfeffer« oder der vom Geburts- und Wohnort vertraute »Geruch von trockenem Straßenstaub nach einem Sommergewitter, wenn die Amseln zwitschern«. Immer wieder ist Heimat ein Geruch, [23] diese flüchtigste aller Sensationen. Immer wieder ist sie die Erinnerung an die unwiederbringliche Kindheit oder an andere Lebensabschnitte unwiederbringlichen Glücks. Und immer wieder klingt, was die Befragten über ihre Heimat sagen, als sagten sie es voller Heimweh.
Nicht anders klingt es in der deutschen Dichtung, die im letzten und in diesem Jahrhundert noch unbefangen das Vaterland als die Heimat besang. Für Friedrich Hölderlin ist das Vaterland eine Ahnung und Hoffnung, für August Wilhelm von Schlegel ist es Sprache und Natur, die er in der Fremde vermißt und ersehnt, für Ernst Moritz Arndt und Hoffmann von Fallersleben ist es das Ganze und Einige, das erst noch werden soll, für Joseph von Eichendorff liegt es hinter den Bergen, beinahe wie Schneewittchen, für Theodor Storm ist es die Erinnerung an Husum, die Stadt der Kindheit, »die graue Stadt am Meer«, und für Hermann Hesse die an den Schwarzwald. Für Heinrich Heine ist das Vaterland der Eichenbaum und die Veilchen und das Mädchen.
Das küßte mich auf deutsch, und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum
Wie gut es klang) das Wort: »Ich liebe dich!«
Es war ein Traum.
So begegnen Vaterland und Heimat in der Dichtung vor allem als Hoffnung, Sehnsucht und Traum. Zwar haben sie ihren Platz auf dieser Erde, und man kann ihn aufsuchen, dort leben, wohnen, arbeiten, Familie und Freunde haben. Man kann dort seinen Alltag haben. Aber was den Zauber [24] der Heimat in den Gedichten und auch in den erwähnten Antworten auf die Umfrage ausmacht, ist nicht diese Zugänglichkeit und Alltäglichkeit, sondern etwas Unerfülltes, etwas Unerfüllbares. Oft ist es die Kindheit, deren Hoffnungen und Sehnsüchte, weil sie in der Kindheit erfüllt werden wollten, aber nicht konnten, uns ein Leben lang als unerfüllbare begleiten. Manchmal ist es ein anderes Stück unwiederbringlicher Vergangenheit. Für Storm und Heine war die Heimat, die sie besingen, tatsächlich un- oder schwer erreichbar. Storm wurde vertrieben, und Heine hätte jedenfalls nur schwer statt in Paris in Hamburg, Berlin oder München leben können. Aber diese tatsächliche Unmöglichkeit oder Schwierigkeit, die Heimat zu erreichen und in ihr zu leben, ist nur eine Variante der Unerfülltheit und Unerfüllbarkeit, die den Zauber von Heimat stets ausmacht.
VI.
Der Zauber kann sich als trügerisch erweisen. Während Storm gerne nach Husum zurückgekehrt und dort geblieben ist, war Heine von seiner deutschen Heimat regelmäßig enttäuscht, freilich ohne aufzuhören, sie aufzusuchen und sich nach ihr zu sehnen. Heines Sehnsucht konnte mit seiner Enttäuschung zusammengehen, weil sie nicht der wirklichen, sondern einer geträumten Heimat galt, die besser war als die wirkliche. Nicht daß seine Sehnsucht die Wirklichkeit völlig vernachlässigt hätte; in ironischer Brechung konnte sie sich dem Traum und der Wirklichkeit zugleich verpflichten.
Ohne ironische Brechung ist die Verarbeitung von [25] Enttäuschung über die entzauberte Heimat schwieriger. Lehrstück hierfür ist die Wiedervereinigung. In den Wochen und Monaten um und nach dem Fall der Mauer kam zum Ausdruck, daß es bei aller Bereitschaft der Deutschen, die Teilung der Welt, die Teilung Deutschlands und die staatliche Existenz der beiden Teile Deutschlands zu akzeptieren, doch eine große Sehnsucht nach dem jeweils anderen Teil und den Deutschen dort gegeben hatte. Es wurde sichtbar an der Neugier aufeinander, der Freude, mit der man einander in die Arme fiel und in die Arme nahm, der Lust auf die Städte und Landschaften der anderen, der Bereitschaft, miteinander zu reden und voneinander zu lernen. Willy Brandts Worte, jetzt wachse zusammen, was zusammengehöre, traf ein verbreitetes Gefühl. Ich selbst, in einem protestantischen Pfarrhaus gewissermaßen mit Martin Luther und Johann Sebastian Bach, Jochen Klepper und Dietrich Bonhoeffer aufgewachsen, hatte immer das Gefühl gehabt, daß deren Land, der andere Teil Deutschlands, auch mein Land sei und daß mir dessen Schätze fehlten. Das war ein Traum, bei dem die Vorstellung von dem kulturellen, mentalen, protestantischen oder auch protestantisch-preußischen Erbe und seinen Schätzen traumhaft nebelhaft blieb. Ich träumte ihn selbst dann, als ich in den anderen Teil Deutschlands reiste und hätte sehen können, wie wenig von diesem Erbe tatsächlich lebendig war. Aber nicht nur ich träumte ihn. In den siebziger und achtziger Jahren mehrten sich im Westen Äußerungen, die im Osten Preußisches wiedererkannten, vom Stechschritt der Soldaten über die Pedanterie der Bürokraten bis zur Bescheidenheit der Wohnverhältnisse. Ein anderer Traum, ähnlich realitätsfern und [26] -blind, ähnlicher Ausdruck der westlichen Sehnsucht nach intakter Heimat im Osten, war die Vorstellung von der wirtschaftlichen Stärke der DDR. Umgekehrt kam in der Vorstellung von der Bundesrepublik als dem Land, in dem Milch und Honig fließen, die östliche Sehnsucht nach intakter Heimat im Westen zum Ausdruck.
Die Enttäuschung war unvermeidlich. Was sehnsuchtsvoll als intakt und heimatlich-zugehörig phantasiert worden war, entpuppte sich als schwierig und fremd. Diese Realität konnte nicht geleugnet, konnte aber auch nicht in das Bild der Heimat integriert werden. Also wurde das Bild der Heimat in einem Gemisch von Erinnerung und Sehnsucht festgehalten und entrückt; statt in ihr lebt der Ostdeutsche im Exil. Übrigens gibt es auch Westdeutsche, die in den neuen Ländern leben und sich im Exil fühlen; für sie sind die entrückte Heimat schlicht die alten Länder, aus denen sie kommen.
VII.
So sehr Heimat auf Orte bezogen ist, Geburts- und Kindheitsorte, Orte des Glücks, Orte, an denen man lebt, wohnt, arbeitet, Familie und Freunde hat – letztlich hat sie weder einen Ort noch ist sie einer. Heimat ist Nichtort, oυ τoπoς. Heimat ist Utopie. Am intensivsten wird sie erlebt, wenn man weg ist und sie einem fehlt; das eigentliche Heimatgefühl ist das Heimweh. Aber auch wenn man nicht weg ist, nährt sich das Heimatgefühl aus Fehlendem, aus dem, was nicht mehr oder auch noch nicht ist. Denn die Erinnerungen und Sehnsüchte machen die Orte zur Heimat. Dank [27] der Erinnerungen bewahrt die langweiligste Provinz- und die häßlichste Industriestadt, in der wir aufgewachsen sind, etwas vom Glück der ersten Schritte an der Hand der Eltern, von dem guten Gefühl nach dem Fußballspiel mit den Freunden, von der wohligen Trägheit der Sommertage im Schwimmbad und vom Zauber des ersten Kusses. Ebenso ist die Stadt, in der wir jetzt wohnen und arbeiten, nicht einfach die gegenwärtige, sondern eine vergangene und erinnerte Stadt: Mit dieser Straßenbahn fuhren wir ein paar Jahre ins Büro, auf diesem Platz trafen wir uns zum ersten Rendezvous, an dieser Kreuzung hatten wir einen Unfall, und da, wo jetzt der Drogeriemarkt ist, war früher das kleine Kino, in dem wir oft und gerne saßen. Die Erinnerungen machen den Ort zur Heimat, die Erinnerungen an Vergangenes und Verlorenes, oder auch die Sehnsucht nach dem, was vergangen und verloren ist, auch nach den vergangenen und verlorenen Sehnsüchten. Heimat ist ein Ort nicht als der, der er ist, sondern als der, der er nicht ist.
Dabei kann das Bild der Heimat phantastischer oder realistischer sein und den Ort mehr erfassen, wie er heute ist, und mehr, wie er gestern war. Es kann mehr aus der Erinnerung und mehr aus der Sehnsucht leben. Es kann sogar das Bild eines künftigen Ortes sein: des erst noch zu bauenden Hauses, der noch zu gründenden Kolonie, des noch zu erreichenden Gelobten Landes und des Paradieses, in das wir nach Tod und Gericht gelangen. Aber die utopische Qualität dieser Heimaten unterscheidet sich nur graduell. Eine Utopie ist die Heimat selbst für den, der sein ganzes Leben lang am selben Ort gelebt hat. Für ihn birgt der eine Ort die Erinnerungen an das tatsächlich Vergangene wie auch an die [28] vergangenen Träume, Hoffnungen und Sehnsüchte. Der eine Ort trägt die Utopien seines ganzen Lebens.
Vielleicht möchten Sie einwenden, daß Ihre Heimat da ist, wo Sie Ihre Wurzeln haben, und daß Wurzeln nichts Utopisches, sondern etwas Gewachsenes sind. Aber wir schlagen Wurzeln. Erst wenn wir sie schlagen, wachsen sie. Eine Familie mag über noch so viele Generationen am selben Ort wohnen – kein Glied, keine Generation bleibt wohnen, ohne sich dafür zu entscheiden, und in fast jeder Generation gibt es Glieder, die sich dagegen entscheiden. Nein, Heimat als Utopie sollte Sie nur auf den ersten Blick stutzig machen. Das Verständnis der utopischen als der eigentlichen Qualität von Heimat nimmt Heimat nichts. Es erlaubt die individuelle Mischung von Nähe und Distanz zum Ort, Erinnerung und Sehnsucht, Realität und Phantasie, die dem notwendig individuellen Begriff der Heimat entspricht.
Es läßt auch besser verstehen, warum von Exil geredet werden kann, ohne daß der Ort der Heimat, die dem Exil korrespondiert, benannt werden könnte. Er ist eben utopisch. Für die Deutschen aus den neuen Ländern ist er die neuen Länder selbst, aber anders und besser, mit allem, was an der DDR gefiel und an der Bundesrepublik Deutschland gefällt. Für die Angehörigen einer Minderheit ist es die Gesellschaft, in der sie leben, aber ohne daß die Mehrheit als Mehrheit und die Minderheit als Minderheit kenntlich ist. Für die Frauen ist ihre Gesellschaft erst dann wirklich ihre Heimat, wenn sie sich nicht mehr gegen Diskriminierung wehren müssen, und für die Alten, wenn sie nicht ausgegrenzt, sondern einbezogen werden. So ist das Reden vom Exil nicht nur Metapher für Entfremdung, sondern auch Ausdruck utopischer Sehnsucht.
[29] VIII.
Entsprechend seiner utopischen Qualität wird der Begriff der Heimat denaturiert, wenn Heimat vom Nichtort zum Ort gemacht wird. Wenn Phantasie und Realität aneinander festgezurrt werden. Wenn eine bestimmte Gestalt von Heimat verlangt und durchgesetzt wird. Wenn die Heimat heim ins Reich geholt oder selbständig gemacht oder von den Ungläubigen befreit oder von denen gereinigt werden muß, die einem anderen Volk oder Stamm angehören. Wenn Erinnerung und Sehnsucht nicht aushalten, bloß Erinnerung und Sehnsucht zu sein, sondern Ideologie werden müssen. Wenn die Heimatideologie politische und rechtliche Gestalt annimmt.
Wie die universalistische Sehnsucht nach Erlösung, die der universalistischen Erfahrung der Entfremdung korrespondiert, in Ideologie umschlagen und furchtbar werden kann, kann auch die Sehnsucht nach Heimat, die der Erfahrung des Exils, des Heimatverlusts und der Heimatlosigkeit korrespondiert, in Ideologie umschlagen und furchtbar werden. Beispiele bietet die Vergangenheit reichlich. Der deutsche Nationalismus war schön, solange seine Sehnsucht unerfüllt blieb. Mit der Schaffung des Deutschen Reichs wurde er auftrumpfend, anmaßend und gierig. Schon als die nationale Einigung in der Revolution von 1848 greifbar schien, schlug der deutsche Nationalismus, der 1830 noch einladend statt ausgrenzend, franzosen- und polenfreundlich statt -feindlich gewesen war, um und wollte um deutscher Interessen willen den Polen die Freiheit und die Einheit verweigern. Als die Völker des österreich-ungarischen [30] Reichs bei dessen Auflösung ihre staatliche Selbständigkeit und Unabhängigkeit gewannen, wurden auch ihre Nationalismen schrill, und nach dem Abzug der Engländer wurden der indische und der pakistanische Nationalismus mörderisch. Aber Beispiele bietet nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart. Die alten menschheitserlösenden Ideologien haben sich verbraucht, und die nächste Generation von Ideologien wird eher auf die nationale, ethnische oder religiöse Heimat bezogen sein als auf die Erlösung der Menschheit. Die Rückkehr des Nationalen, von der oben die Rede war, bedeutet auch die Rückkehr der ideologischen Nationalismen.
IX.
Sind wir dagegen gefeit? Ich meine, ja. Trotz der Metapher vom Exil, der Diskussion um die nationale Identität der Berliner statt Bonner Republik in Deutschland und um Patriotismus und Kosmopolitismus in den USA sind die Intellektuellen da, wo einst der Westen war, von nationalistischer Ideologieproduktion weit entfernt. Gewiß, seit Julien Benda ist geläufig, daß Intellektuelle Entfremdung, ob als universalistische Erfahrung oder als Erfahrung der Ort- und Heimatlosigkeit, genau so schlecht aushalten wie alle anderen. Obwohl ihnen die Nichtzugehörigkeit die Chance des freien und klaren Blicks bietet und obwohl sie eigentlich nur in der Nichtzugehörigkeit ihre Rolle und ihre Ehre finden, sind sie versucht, ihre Sehnsüchte zu Ideologien zu machen. Aber die Erfahrung der Ort- und Heimatlosigkeit ist [31] derzeit nicht so schlimm, die Sehnsüchte sind derzeit nicht so stark.
Freilich gibt es außer der eigenen Ideologieproduktion die Verstrickung in fremde, und die Frage ist, ob wir gegen diese so gefeit sind wie gegen jene. Der Punkt, an dem die Verstrickung droht, ist das Recht auf Heimat. Es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, und richtig verstanden ist es auch eine. Falsch verstanden ist es dagegen Ideologie und eine Triebkraft für die neuen nationalen und ethnischen Konflikte.
Richtig verstanden ist das Recht auf Heimat das Recht auf einen Ort, an dem man wohnt und arbeitet, Familie und Freunde hat. Dieses Recht ist alles andere als Ideologie. Es ist, wie Hannah Arendt überzeugend dargelegt hat, das Menschenrecht schlechthin. Es geht allen Rechten auf Freiheit, Gleichheit und Glück voraus. Es ist das Recht auf anerkannte Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft, ohne das die anderen Rechte nichts wert sind und das Leben in der Wohnung und bei der Arbeit, mit der Familie und den Freunden prekär bleibt. Staatenlose Flüchtlinge, Vertriebene, displaced persons, Insassen von Internierungs- und Konzentrationslagern sind dieses Rechts regelmäßig beraubt. Diese Rechtlosigkeit ist die eigentliche, die letzte, die zerstörerische Heimatlosigkeit.
Auch hier wird das Entscheidende an seinem Fehlen deutlich. Daß Heimat mit der Anerkennung und der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft beginnt, wird sichtbar, wo die Anerkennung fehlt. An den staatenlosen Flüchtlingen, den Vertriebenen, den displaced persons, den Insassen von Internierungs- und Konzentrationslagern wird bewußt, [32] was sonst alltäglich, wenig beachtet und wenig geschätzt ist. Denn in ihrer Situation ist sogar das elementare Heimatrecht utopisch, das Recht, an einem Ort in anerkannter Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft zu leben, an irgendeinem Ort, einem Ort zu Hause, einem Ort in der Fremde oder einem Ort im Exil.
Um dieses Recht auf Heimat geht es in den neuen nationalen und ethnischen Konflikten nicht. Es geht um etwas anderes. Auf dem Balkan wollen die streitenden Serben, Kroaten, Bosnier und Albaner zum einen da leben, wo ihre Vorfahren gelebt haben. Zum anderen wollen sie unter ihresgleichen leben und das Land nicht mit Angehörigen anderer Ethnien teilen. Schließlich und erst recht wollen sie nicht von Angehörigen anderer Ethnien majorisiert und dominiert werden. Andere nationale, ethnische und auch religiöse Konflikte in Afrika und Asien stehen unter demselben Dreigestirn von Wünschen: dem Wunsch, am Land festzuhalten, dem, die anderen vom Land auszuschließen, und dem nach Selbstbestimmung. Aber die drei Wünsche können da, wo verschiedene Ethnien in ein und demselben Land leben, nicht zugleich erfüllt werden. Nicht einmal der dritte und einleuchtendste Wunsch ist erfüllbar; wenn sich die Provinz, in der mehrheitlich Angehörige der einen Ethnie leben, von dem von der anderen Ethnie majorisierten und dominierten Land abspaltet, bleiben doch in der Provinz Regionen, die mehrheitlich von Angehörigen dieser anderen Ethnie besiedelt sind, und in den Regionen Städte, die mehrheitlich von Angehörigen der einen Ethnie bewohnt werden. Daß auch der erste und zweite Wunsch nicht zugleich erfüllbar sind, daß man da, wo man mit- oder besser neben- und [33] durcheinander lebt, nicht zugleich bleiben und ohne die anderen leben kann, liegt ohnehin auf der Hand. Die drei Wünsche müssen zum Konflikt führen.
Die gängige Antwort von UNO und NATO auf den Konflikt ist die Ermahnung, die Beteiligten sollten sich vertragen. Wenn sie einander vertreiben, werden sie ermahnt, davon abzulassen und das Recht des anderen, im Land seiner Väter, in seiner Heimat zu leben, zu achten. Wenn die Ermahnung nicht fruchtet, wird die militärische Intervention zunächst angedroht und dann durchgeführt. Die Logik hinter dieser Antwort auf den Konflikt ist, daß der Wunsch, von der anderen Ethnie nicht majorisiert und dominiert zu werden, legitim sei und in einem Zusammenleben nach demokratischen Spielregeln mit Grundrechts- und Minderheitenschutz erfüllt werden könne. Der Wunsch, die anderen vom Land auszuschließen, sei dagegen illegitim. Legitim sei der Wunsch, am Land festzuhalten.
Das Recht auf Heimat wird dabei nicht als das elementare Heimatrecht im Sinne Arendts, sondern als das Recht, da zu leben und zu sterben, wo schon die Vorfahren gelebt haben und gestorben sind, anerkannt. Aber gibt es dieses Recht? Warum soll der Wunsch, auf der Erde zu leben, unter der die Vorfahren liegen, vernünftiger und berechtigter sein als der Wunsch, unter seinesgleichen zu leben? Der eine Wunsch ist so atavistisch wie der andere. Der eine wie der andere Wunsch geht auch daran vorbei, daß Angehörige der beteiligten Ethnien längst an den globalen Wanderungen teilnehmen und ihr und ihrer Familie Auskommen überall suchen. Der Wunsch nach Heimat ist auch und gerade hier eine Utopie, die als Erinnerung und Sehnsucht so legitim [34] wie jede andere Heimatutopie ist, als Ideologie, Politik und Recht dagegen ein Programm für den Konflikt.
Das heißt nicht, die neuen nationalen und ethnischen Konflikte sich selbst zu überlassen. Aber statt die Beteiligten zusammenzuzwingen, mag es ein besserer Weg für die Lösung der Konflikte sein, ihnen zu helfen, sich anders als durch ein grausames ethnical cleansing auseinanderzudividieren. Ob das eine oder das andere ansteht, ist eine pragmatische Frage. Das Auseinanderdividieren ist ebensowenig einem Recht der Beteiligten, unter ihresgleichen zu leben, geschuldet wie das Zusammenzwingen ihrem Recht auf das Land der Väter. Die Anerkennung des einen wie des anderen Rechts wäre die Verstrickung in die Ideologien der Beteiligten. Geschuldet ist nur die Hilfe dabei, daß die Beteiligten ihr elementares Heimatrecht verwirklichen können – irgendwo.
X.
Meine Überlegungen sind, obwohl sie nicht darauf gezielt haben, in ein rechtliches Ergebnis gemündet. Weil das Recht mein Beruf ist? Weil ich in meinem Leben so oft nach dem juristischen Dreh- und Angelpunkt eines Sachverhalts gesucht habe, daß ich es auch hier nicht lassen kann, obwohl mein Interesse am Sachverhalt Heimat eigentlich ein literarisches ist?
Der Zusammenhang zwischen Heimat und Recht ist tiefer, als daß meine Person ihn stiften könnte. Mit dem Menschenrecht auf Heimat wird nicht ein außer- oder vorrechtlicher [35] Befund in den Rang eines Rechts erhoben, wie in den Rechten auf das Leben, auf einen Beruf, auf die freie Meinungsäußerung und auf die freie Religionsausübung. Anders als Leben und Beruf, Meinungsäußerung und Religionsausübung ist die Heimat, die das elementare Menschenrecht meint, selbst etwas Rechtliches. Die Anerkennung der Zugehörigkeit zu einer politischen Gemeinschaft, mit der Heimat beginnt und die vor Staatenlosigkeit, zielloser Flucht und Vertreibung, Internierungs- und Konzentrationslagern schützt, ist eine rechtliche Anerkennung, die rechtlichen Schutz bietet. Die Zugehörigkeit muß keine staatsbürgerliche sein und nicht die politischen Rechte einschließen, aber einen gesicherten Status gewährleisten. Das Recht auf Heimat als elementares Menschenrecht ist das Recht darauf, an einem Ort rechtlich anerkannt und rechtlich geschützt zu leben und nicht nur zu leben, sondern zu wohnen und zu arbeiten, Familie und Freunde, Erinnerungen und Sehnsüchte zu haben und vielleicht den »Geruch von trockenem Straßenstaub… nach einem Sommergewitter« zu riechen und zu genießen.
Noch einmal: an irgendeinem Ort, in der Fremde ebenso wie zu Hause, im Exil ebenso wie in der Heimat, in der wir geboren und aufgewachsen sind und kürzer oder länger gelebt haben. Im Menschenrecht auf Heimat sind sowohl die elementare Bedeutung als auch die utopische Qualität von Heimat aufgehoben. Darum ist das Recht, um das es hier geht, das Recht der Heimat, das einen Ort zur Heimat macht, weil es rechtliche Anerkennung und rechtlichen Schutz bietet, und das Recht auf Heimat, das als Menschenrecht jedem Menschen einen Ort zuspricht, nicht etwa selbst utopisch. Gewiß, die Wirklichkeit lehrt uns, daß das Recht [36] oft und oft verletzt wird. Aber das ist das Schicksal des Rechts. Utopisch wären das Recht der Heimat und das Recht auf Heimat nur, wenn es für sie in der Welt des Rechts keinen Ort gäbe.
XI.
Ich bin an das Ende meiner Überlegungen gekommen. Der Ort der Heimat – ich habe ihn in unserer Zeit und Welt gesucht, in unserer heutigen Lebenswelt und am Ende auch in unserer Welt des Rechts. Manchmal heißt es, es habe vor unserer Zeit andere Zeiten gegeben, in denen die Orte des Lebens unverrückbar waren und Gemeinschaft und Zugehörigkeit, Anerkennung und Schutz sich von selbst verstanden. Ich glaube es nicht; die Erfahrung, in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt zu sein, ist so alt wie das Christentum, und die Erfahrung von Heimatverlust, Heimatsuche und Heimatlosigkeit so alt wie das Judentum. Aber selbst wenn die unverrückbare und selbstverständliche Heimat der Vergangenheit keine Projektion, sondern historischer Befund ist – sie ist unwiederbringlich. In der Zukunft, in der die Dimensionen des Lebens immer globaler werden, wird jeder Ort des Lebens verrückt werden können und sich kein Ort des Lebens von selbst verstehen. Bis auf den Ort der Geburt und den Ort der Kindheit. Sie werden die Orte bleiben, denen sich Heimatgefühl, Heimaterinnerung und Heimatsehnsucht vor allem verbinden.
[37] Rousseau in Amerika
I.
Bevor Ost und West wieder Himmelsrichtungen wurden, ließ uns ihr Gegensatz nie vergessen, daß die Welt auch anders sein kann. Daß sie statt auf Freiheit auf Gleichheit, statt auf Autonomie auf Paternalismus, statt auf den Markt auf den Plan gegründet sein kann. Im geteilten Deutschland war diese Erfahrung besonders gegenwärtig; viele Deutsche hatten im Osten gelebt, ehe sie in den Westen flohen, und noch mehr hatten mit Verwandten im Osten Kontakt. Zugleich war es eine europäische Erfahrung; wie Deutschland ein geteiltes Land war Europa ein geteilter Kontinent, dessen Gemeinsamkeiten und Zerrissenheit durch die Flüchtlingswellen aus Ungarn in den 50er, der Tschechoslowakei in den späten 60er und Polen in den frühen 80er Jahren bewußt blieb.
Daß es neben der eigenen Welt noch eine andere gibt, zeigt an, daß auch die eigene Welt anders sein könnte und vielleicht sollte. So lebten viele politische Themen in Deutschland und Europa von der Alternative des Ostens. Ein bißchen mehr Plan im Bereich der schulischen und universitären Ausbildung? Ein bißchen mehr vormundschaftliche Betreuung im Gesundheits- und Wohlfahrtswesen? Ein bißchen mehr Gleichheit und ein bißchen weniger Freiheit [38] bei der Verteilung von Reichtum und Armut? Der innenpolitische Gegensatz von links und rechts spiegelte den außenpolitischen von Ost und West.
Daß Alternativen Veränderungen provozieren, gilt nicht erst für die Alternative des Ostens. Seit Jahrhunderten lebt Europa mit Alternativen. Vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es neben der demokratischen nicht nur die kommunistische, sondern auch eine faschistische Alternative, vor dem Ende des Ersten Weltkriegs gab es seit der Französischen Revolution Demokratien und Monarchien, davor gab es den Gegensatz katholischer und reformierter Herrschaft und noch davor die Alternativen der res publica christiana unter der Hoheit des Kaisers und der des Papstes. Immer resultierte aus dem Gegensatz der Alternativen das Bewußtsein, daß die eigene Welt auch anders sein könnte und vielleicht sollte. Die katholische Kirche veränderte sich unter der Herausforderung der Reformation, die Monarchien wandelten sich unter dem Druck der Demokratien, und die Entwicklung der Sozialpolitik und des Sozialrechts in kapitalistischen Staaten war auch eine Antwort auf die Verheißungen sozialistischer Staaten.
Die Suche nach einer Zeit ohne Alternativen wird erst im Mittelalter fündig – und wieder in der Gegenwart. Mit dem Ende des Ost-/West-Gegensatzes ist unsere Welt nach Jahrhunderten wieder eine Welt ohne Alternativen. Gewiß, es gibt neben der Welt kapitalistischer, einigermaßen demokratischer, einigermaßen freiheitlicher Staaten eine Reihe von Ländern, die nicht in diese Welt passen. Aber die meisten von ihnen sind immerhin dabei, sich an- und einzupassen. Die anderen, die dies nicht tun, sind keine Alternativen, [39] deren Anderssein Veränderungen provozieren würde. Unsere Welt fragt sich nicht, ob sie ein bißchen vom islamischen Fundamentalismus Afghanistans oder vom mafiosen Feudalismus Albaniens übernehmen soll.
Woher werden in Zukunft die Alternativen kommen, die die Veränderungen in unserer Welt provozieren? Oder braucht unsere Welt keine Veränderungen mehr? Ist sie am Ende der Geschichte angelangt?
Ich glaube, es ist kein Zufall, daß unser junges Jahrhundert, wie nicht zuletzt die Utopia-Ausstellung kürzlich in der Bibliothèque nationale de France und der New York Public Library belegt, ein frisches Interesse an Utopien verzeichnet. Das Interesse an Utopien ist das Interesse daran, ob beziehungsweise wie die Welt anders sein könnte und vielleicht sollte. Nachdem es nicht mehr durch die Gegenwelt des sozialistischen Ostens gebunden ist, richtet es sich auf erträumte und erdachte Alternativen und auf utopische Gemeinschaften, kleine Gegenwelten inmitten der großen Mainstream-Welt. Und es richtet sich auf Amerika, für das der Gegensatz von Ost und West und die erwähnten historischen Gegensätze nie so wichtig und herausfordernd waren wie für Europa, das aber, wie es selbst in Massachusetts als Stadt auf dem Berg angetreten ist, zahllose utopische Gemeinschaften sowohl anerzogen als auch hervorgebracht hat. Dabei verstehe ich unter einer utopischen Gemeinschaft eine Gemeinschaft, die eine andere, bessere Welt schaffen und leben will und dies nicht nur für sich, wie klösterliche Gemeinschaften oder Gemeinschaften von Kolonisatoren es immer schon wollten, sondern auch als Vorbild für den Rest der Welt.
[40] Die folgenden Überlegungen gelten der Frage, was utopische Gemeinschaften blühen und was sie scheitern läßt und welchen Inhalt der Gesellschaftsvertrag hat, den Menschen schließen müssen, damit ihre utopischen Gemeinschaften blühen. In der Antwort auf diese Frage liegt auch die Antwort auf die Frage beschlossen, ob utopische Gemeinschaften in unserer Welt die Rolle Veränderungen provozierender Alternativen spielen können.