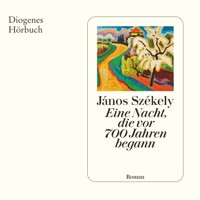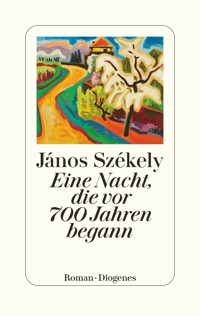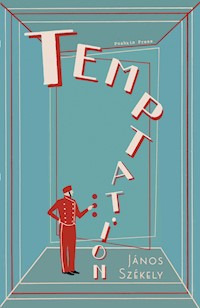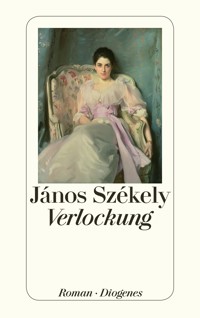
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Welterfolg des ungarischen Autors und das Lieblingsbuch vieler begeisterter Leser und Buchhändler neu aufgelegt. Die Geschichte des Bauernjungen Béla, der als Liftboy in einem Budapester Grandhotel eine vom nahen Untergang gezeichnete Welt kennenlernt, ist ein ebenso düsteres wie schillerndes Tableau des Ungarn der Zwischenkriegszeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1123
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
János Székely
Verlockung
Roman
Aus dem Ungarischen von Ita Szent-Iványi
Diogenes
Erster TeilIch und der hübsche junge Herr
1
Mein Leben begann wie ein Kriminalschmöker: Man wollte mich ermorden. Glücklicherweise wurde dieser Plan fünf Monate vor meiner Geburt gefasst, und so hat er mich kaum sonderlich erschüttert. Dabei hätte ich, falls es zutrifft, was man sich im Dorf erzählt, guten Grund zur Aufregung gehabt. Es war wirklich reiner Zufall, dass ich nicht umgebracht wurde, noch bevor sich diese fünf Finger, mit denen ich jetzt die Feder halte, zu Fingern auswachsen konnten.
Meine Mutter war damals sechzehn Jahre alt, und wenn mich nicht alles täuscht, verlangten weder ihr Körper noch ihre Seele danach, dass ich sie einmal Mutter nannte. Zugegeben, kein sechzehnjähriges lediges Mädchen sehnt sich gemeinhin nach dieser Würde, aber was meine Mutter anstellte, das war, nach allem, was mir zu Ohren gekommen ist, ausgesprochen krankhaft. Als wäre der Teufel in sie gefahren, so sträubte und wehrte sie sich gegen die Mutterschaft. Sie griff zu den schimpflichsten Mitteln, lief unterdessen jedoch eifrig von einer Kirche zur anderen; bald lag sie auf den Knien und betete, bald wünschte sie alle Heiligen des Himmels zur Hölle; sie tobte und wütete, sie wollte mich nicht zur Welt bringen, bei Gott, nein, sie wollte es nicht.
»Wenn ich den Vater, diesen Lumpen, wenigstens lieben würde«, sagte sie immer wieder. »Aber ich hab ihn nur ein einziges Mal in meinem Leben gesehen, ich weiß nicht mal, wo in der Welt ihn der Teufel holt.«
Und so war es in der Tat. Sie hatte Mihály T. am Peter-und-Pauls-Tag kennengelernt, war ihm vorher nie begegnet und danach auch nicht mehr; trotzdem geschah das Malheur. Dabei gehörte meine Mutter durchaus nicht zu jenen mannstollen Frauenzimmern, die sich mit jedem einlassen, wenn er nur Hosen trägt. Ich will die Sache nicht etwa beschönigen, vielmehr halte ich mich an den Bericht einer Frau aus unserem Dorf, einer gewissen Tante Rozika, von der noch die Rede sein wird.
Nach ihren Worten war die »arme Anna« um nichts schlechter als die anderen jungen Dinger im Dorf. Sie war ein stilles, blitzsauberes, hübsches Mädchen mit weißer Haut und schwarzem Haar. Ich selbst erinnere mich am deutlichsten an ihre Augen. Es waren kleine, eigenartig tiefliegende schwarze Augen, misstrauische, immer ein wenig demütige Bauernaugen, die stechend und doch mit einer uralten Schwermut in die Welt blickten. Sie wohnte bei ihrer Stiefmutter; der Vater war früh gestorben, die Mutter hatte sie überhaupt nicht gekannt. Die Familie war bettelarm. Anna arbeitete als Magd und musste schon mit fünfzehn Jahren vom frühen Morgen bis in die späte Nacht auf den Feldern des Grafen schuften. Kurzum, das bisschen Gratisvergnügen war ihr zu gönnen, das den Bauern am Peter-und-Pauls-Tag zuteilwurde, und dabei lernte sie dann auch Mihály T. kennen.
Dieser Mihály war ein berühmter Mann, die Mädchen nannten ihn unter sich nur den schönen Miska. Er stammte aus dem Dorf, lebte jedoch seit mehr als zehn Jahren in der Fremde. Heißblütig und abenteuerlustig, wie er war, hatte er schon als Halbwüchsiger das Weite gesucht, und seither waren die sonderbarsten Gerüchte über ihn im Umlauf. Es hieß, er sei Schiffskapitän geworden, dann wieder, er mache als Pirat die Meere unsicher. In Wirklichkeit war er weder Kapitän noch Pirat, sondern Matrose auf einem Frachter, aber damit hatte er es in den Augen der Bauern schon sehr weit gebracht. Nun hatte sich der schöne Miska also nach zehnjähriger Abwesenheit eingefunden, um dem Dorf vorzuführen, was aus ihm geworden war. Er hatte sich piekfein gemacht, zwischen seinen starken weißen Zähnen steckte eine echte englische Pfeife, und den verwegen aufs Ohr gedrückten grünen Hut hatte er, wie er jedermann gern zeigte, in Buenos Aires erstanden. Er war ein großmäuliger, bullenstarker Bursche, ein Prahlhans, Raufbold und Herzensbrecher. Wie ein Pfau stolzierte er durchs Dorf, und fast jeden Abend sah man ihn mit einem anderen Mädchen auf einen Heuschober zusteuern.
Anna kannte den schönen Miska nicht, hatte jedoch umso mehr von ihm gehört. Als sie ihn an jenem denkwürdigen Abend des Peter-und-Pauls-Tages endlich sah, war sie tief enttäuscht. »Was, nach dem da seid ihr alle so verrückt?«, sagte sie laut, dass jeder es hören konnte. »Hol der Teufel euren Geschmack!«
Ihre besten Freundinnen beeilten sich, dem schönen Miska diese Worte brühwarm zu hinterbringen, erreichten aber, wie das meist der Fall ist, genau das Gegenteil dessen, was sie offensichtlich bezweckt hatten. Denn plötzlich stand der schöne Miska vor Anna, fasste sie mir nichts, dir nichts um die Taille und tanzte mit ihr einen endlosen Csárdás. Was eigentlich während dieses Tanzes geschah, lässt sich heute nicht mehr genau feststellen. Meine Mutter hat später geschworen, sie sei aus reinem Mutwillen mit ihm in den Kreis getreten, damit die Klatschbasen vor Neid platzen sollten. Tatsache ist jedoch, dass sie bis zum Morgengrauen ausschließlich mit dem schönen Miska tanzte, ohne auch nur einen anderen anzuschauen.
Man schrieb das Jahr 1912; es war ein schöner, an Früchten reicher Sommer, und der Peter-und-Pauls-Tag wurde in der herkömmlichen Weise begangen. Die Dorfbewohner konnten sich auf Kosten der Gutsherrschaft den Bauch mit Gulaschsuppe vollschlagen, die auf der Wiese in großen Kesseln über einem Holzfeuer gekocht wurde; der Gratiswein floss in Strömen; die Zigeuner spielten unermüdlich Csárdásweisen. Die Nacht war so schwül, dass die Leute noch gegen Morgen in Schweiß gebadet waren, obwohl sie unter freiem Himmel tanzten. Nach Mitternacht erhob sich zwar ein leichter Wind, aber er setzte nur die Lampions in den Nationalfarben in Brand und brachte keine Abkühlung, denn er war warm, als käme er aus einem Schornstein. Die in Flammen stehenden Papierlaternen wurden auf dem Boden ausgetreten, und nun leuchteten nur noch der Mond und die Sterne. Dieses Licht genügte der Jugend vollauf, ja, offenbar war es sogar noch zu hell, denn ein Paar nach dem anderen verschwand vom Tanzplatz.
»Haben Sie eigentlich ein Lieblingslied?«, fragte der schöne Miska auf einmal meine Mutter.
»Natürlich! Warum nicht?«
»Und wie heißt es?«
»Ach, es ist ein sehr altes Lied, die Zigeuner spielen es kaum noch.«
»Wirklich nicht?«, meinte der schöne Miska übermütig. »Na, heute werden sie jedenfalls nichts anderes mehr spielen. Passen Sie mal auf!«
Damit zog er eine Zehnpengőnote aus der Tasche, spuckte darauf und klebte sie wie ein ausgelassener großer Herr dem Primas an die Stirn. Natürlich stimmten die Zigeuner auf der Stelle das Lied an, das meine Mutter genannt hatte. Es war eine schwermütige alte Weise:
»Im grünen Wald ging ich fürbass
und freute an den Vöglein mich;
sie bauten ihr Nest aus Halmen und Gras …
Hei, wie herzinniglich lieb ich dich!«
Und es kam, wie der schöne Miska gesagt hatte: Bis zum Morgen spielten die Zigeuner nur noch diese Melodie. Ab und zu fasste sich der Primas zwar ein Herz und ging in eine schnellere Weise über, aber sofort pflanzte sich der schöne Miska vor den Musikanten auf, bereit, wie ein tollwütiger Hund über sie herzufallen. Was blieb ihnen also übrig, als bis zum Tagesanbruch ohne Unterlass diesen getragenen Csárdás zu strapazieren?
Der schöne Miska aber sang meiner Mutter ins Gesicht, so dass die anderen Mädchen vor Wut beinahe barsten: »Hei, wie herzinniglich lieb ich dich!«
Es war eine tolle Nacht, im Dorf gab es kaum einen nüchternen Menschen. Der Wein, die immerfort tönende weiche Csárdásweise, vielleicht auch die zahllosen Sterne am Himmel – all das ging ins Blut, und so geschah, was so oft in solchen Nächten geschieht. Ehe Anna sich’s versah, lag sie mit dem schönen Miska im Heu. Nur ein paar Minuten lang, erzählte die Ärmste später. Sie hatte noch gar nicht recht begriffen, was ihr widerfahren war, da riss er auch schon seine Uhr heraus und schrie auf, als habe man ihm einen Dolch in den Rücken gejagt: »Au verflucht, ich verpasse meinen Zug!«
Das hieß also: Hopp, hopp, und bevor sie ihre Kleider in Ordnung bringen konnte, war er bereits über Stock und Stein. Vom Eisenbahndamm aus sprang er auf den letzten Wagen und ward nicht mehr gesehen.
Ja, so hatte es sich zugetragen. Es war keine Liebe, gewiss nicht. Es war einfach eine Torheit, so etwas konnte vorkommen – immerhin hatten andere am Peter-und-Pauls-Tag schon größere Torheiten begangen. Am nächsten Tag zuckte meine Mutter, wie Tante Rozika erzählte, nur die Achseln. Sie hatte Kopfschmerzen, der ungewohnte Wein machte ihr zu schaffen, schlecht gelaunt und einsilbig schlich sie umher. An den schönen Miska dachte sie weder mit Groll noch mit Wärme im Herzen. Sie nahm das Ganze, wie man solche Dummheiten zu nehmen pflegt. Es war nun mal passiert! Schließlich hatte der Bursche ihr nichts abgebissen.
Vielleicht erinnerte sie sich kaum noch an die berühmten schönen Augen von Mihály T., als sie eines Tages bemerkte, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Natürlich rannte sie sofort zu den Frauen, die für solche Fälle zuständig waren, aber sie rannte vergebens. Tante Rozika, die auf diesem Gebiet Bescheid wusste, stellte fest, dass schon vorher gewisse Unregelmäßigkeiten aufgetreten waren, und darum, so erklärte sie, habe meine Mutter so spät erkannt, wie es um sie bestellt war. Außerdem sei sie offensichtlich auch noch zu unerfahren in diesen Dingen. Kurz und gut, ich war damals bereits über drei Monate alt.
Im Allgemeinen schreckten die Hebammen im Dorf vor einer solchen Dreimonatssache kaum zurück, und wenn sie diesmal nichts davon wissen wollten, so hatte das seine Gründe. Ungefähr ein halbes Jahr zuvor war die Magd des Apothekers unter den Händen einer alten Kurpfuscherin in einer Nachbargemeinde verblutet. Dieser Vorfall löste einen Riesenskandal aus, auch aus unserem Dorf holten die Gendarmen zwölf Frauen ab. Es gab Jammern und Wehklagen, Untersuchungen und eine Gerichtsverhandlung, sogar die Zeitungen waren voll davon. Nach diesem Ereignis war die im Dunkeln blühende Zunft der Engelmacherinnen zum Leidwesen Annas ungemein vorsichtig geworden.
Meine Mutter raste wie eine Besessene umher, sie bat jeden Wagen, der in ein Nachbardorf fuhr, sie mitzunehmen, lief der Reihe nach zu allen Hebammen, Kurpfuscherinnen und sachverständigen alten Frauen der Umgegend. Keine von ihnen half ihr, man führte sie nur mit guten Ratschlägen an der Nase herum. Die einen gaben ihr geheimnisvolle Salben, Tees oder Pillen, die anderen verordneten ihr so heiße Bäder, dass ihr Körper wochenlang mit Blasen bedeckt war. Es nützte alles nichts. Die honigsüßen Weibspersonen entlockten der armen Dienstmagd lediglich die paar Kreuzer, die sie sich mit saurem Schweiß verdient hatte, und erklärten dann mit scheinheiliger Miene und großem Bedauern, dass sie ihr leider, leider nicht helfen könnten. »Du bist zu spät gekommen, liebes Kind.«
Das »liebe Kind« nahm daraufhin sein großes Tuch um, denn inzwischen war es Dezember geworden, und sprang in den Fluss. Es herrschte heftiges Schneegestöber, auf dem Wasser trieben dicke Eisschollen, dennoch wollte es der kleinen Dienstmagd nicht gelingen zu sterben. Man zog sie heraus, das kalte Bad blieb ohne Folgen für sie, nicht einmal einen lächerlichen Schnupfen holte sie sich.
Offenbar war ich schon als Embryo eine zähe Natur. Weder erfror ich in der eiskalten Flut, noch wurde ich in den heißen Bädern tödlich verbrüht, und auch die verschiedenen Salben, Pillen und Tees vermochten nicht, mir den Garaus zu machen. Ich kam zur Welt, ich lebte und war gesund und munter. Ich wog fünfeinhalb Kilo; ein so schweres Neugeborenes hatte es im Dorf noch nie gegeben. Aus meiner funkelnagelneuen Kehle schmetterte ich Töne in die Welt, die jedes Hirtenhorn in den Schatten stellten.
»Wie hässlich!«, stellte meine Mutter kurz und bündig fest, als ich ihr nach der Geburt gezeigt wurde. Damit drehte sie sich zur Wand, ohne mich noch eines Blickes zu würdigen.
Nun, dachte ich wahrscheinlich, wenn ich den eisigen Fluss und die heißen Bäder überlebt habe, werde ich auch diese Missachtung irgendwie überleben. Und ich überlebte sie wirklich. Ich wuchs, nahm zu, wurde stark, ich weiß selbst nicht, wie und wovon. Um einen streunenden Hund kümmerte man sich mehr als um mich. Ich wuchs heran wie das Unkraut, war aber auch, das darf ich wohl sagen, ebenso widerstandsfähig.
Das erste Wort, das aus meinem Munde kam, war Teufel. Das Wort Mutter lernte ich erst viel später. Leider ist diese Abweichung von der Regel weniger auf meine muntere Natur zurückzuführen als auf die traurige Tatsache, dass man mich schon als Säugling wieder und wieder mit Schimpfreden bedachte, die diesen deftigen Fluch enthielten, wohingegen ich sehr selten Gelegenheit hatte, das zärtliche Wörtchen Mutter auszusprechen, obwohl es im Dialekt unserer Grafschaft besonders innig klingt.
Bereits zwei Wochen nach meiner Geburt verdingte sich meine Mutter in Budapest als Amme; sie kam höchstens vier- oder fünfmal im Jahr ins Dorf, um mich zu besuchen. Warum sie sich so selten blicken ließ, weiß ich nicht. Vielleicht gab man ihr nicht öfter frei, oder sie konnte das Fahrgeld nicht aufbringen, es ist aber auch möglich, dass sie mich nach wie vor abschreckend hässlich fand. Höchstwahrscheinlich wurde ihr Verhalten durch alle drei Gründe bestimmt. So hatte ich also eine Mutter und hatte doch keine. Und all die gute süße Milch, die nach den uralten Naturgesetzen mir hätte zukommen müssen, trank mir das Söhnchen eines Budapester Tuchhändlers weg, ein Siebenmonatskind, das in Watte gepackt war wie eine verletzte Seidenraupe.
Es scheint eben doch, dass die Gesetze, selbst die Naturgesetze, nur bestehen, um von den Menschen umgangen zu werden.
2
Ich blieb also im Dorf bei Tante Rozika. Trotz ihres süß klingenden Namens war sie das schändlichste alte Weib in der ganzen Gemeinde. Seit sie für ihr ursprüngliches Gewerbe zu alt geworden war, befasste sie sich mit der Erziehung von Jungen anstößiger Herkunft, wie ich einer war – wenn man das, was sie mit uns anstellte, überhaupt Erziehung nennen konnte.
Sie war eine Slowakin, und es hieß, sie sei in ihrer Jugend ein sehr schönes Mädchen mit flachsblondem Haar und blauen Augen gewesen. Mit fünfzehn Jahren trat sie in Dienst bei einem Gutsherrn, der sie aus dem Norden hatte kommen lassen. Sie arbeitete drei Jahre lang, dann brachte sie einen gesunden Jungen zur Welt. Der Vater des Kleinen war selbst noch ein halbes Kind: der sechzehnjährige Sohn der Gutsherrschaft. Seine Eltern hatten Rozika zwar unverzüglich an die Luft gesetzt, als sie bemerkten, dass ihr die Schürze zu kurz wurde, aber es gelang ihnen nicht, sie loszuwerden. Dieses schöne slowakische Mädchen war pfiffig; sie wusste genau, was sie tat. Sie kreischte, schimpfte und lärmte, sie drohte so lange mit Anwälten und Skandalen, bis der Gutsherr den Beutel aus der Tasche zog. Von diesem Geld kaufte sie sich das kleine Haus am Ende des Dorfs, in dem ich dann aufwuchs.
Kaum ein halbes Jahr, nachdem sie die Abfindungssumme kassiert hatte, starb ihr Kind. Es starb ganz unerwartet. Heute noch munkelt man im Dorf, der Sensenmann habe den Jungen aufgrund einer persönlichen Einmischung der Mutter geholt. Das mag freilich nur Gerede sein, doch da ich Tante Rozika kenne, möchte ich es nicht ausschließen.
Damals empfing sie bereits die Besuche eines »besseren Herrn« aus einem Nachbardorf. Er fuhr immer im Wagen vor, war verheiratet und konnte nur sonnabends kommen. Nun besteht aber die Woche nicht nur aus Sonnabenden, und so sorgte Rozika im Laufe der Zeit dafür, dass sie auch an den anderen Tagen Gäste hatte. Schließlich verkaufte sie Liebe, wie andere Gerste verkaufen.
Rozika war eine sparsame Natur, und jeder Fillér, den sie sich erliebte, wurde unverdrossen auf die hohe Kante gelegt. Bald ließ sie das baufällige Haus renovieren und einen neuen Zaun um den Hof ziehen; später kaufte sie sogar noch ein schönes Stück Land hinzu. Sie hatte in kurzer Frist ihr Nest so warm ausgefiedert, dass die Dorfbewohner vor Neid platzten.
Eines schönen Tages aber brach auch über sie das Verhängnis herein, dem kein Frauenzimmer entgeht, das von den Männern nichts als Geld will. Sie vergaffte sich in einen Burschen, der wiederum von ihr nichts als Geld wollte.
Er war ein stumpfer, grobschlächtiger Kerl, und ich habe nie verstehen können, dass sie, die mit so vielen Männern zu tun hatte, sich gerade in ihn verknallte. Als ich das letzte Mal zu Hause war, fragte ich sie sogar danach. Sie konnte es mir auch nicht erklären. »Er war nie eine schöne Mann«, sagte sie in ihrer komischen slowakischen Redeweise, »aber alle Mädel sind gewesen verrückt nach ihm.«
Demnach hat er also nicht mal gut ausgesehen, dieser Liebling der Frauen, und dass er nicht sehr gescheit war, davon konnte ich mich später selbst gründlich überzeugen. Obendrein war er arm wie eine Kirchenmaus, als er im Dorf auftauchte, das Hinterteil blitzte ihm unter dem Hosenboden hervor. Er war einer jener zerlumpten Vagabunden, an die ein Mädchen normalerweise keinen Blick verschwendet.
»Hat mich geplagt die Neugier«, gestand Tante Rozika. »Wollte ich wissen, was ist Geheimnis von eine solche Niemand.«
Nun, das Geheimnis »von eine solche Niemand« blieb bis zum Ende aller Tage ein Geheimnis. Da kam ein schäbiger Landstreicher, war weder schön noch klug, weder anziehend noch reich, und doch flog die ganze Weiblichkeit auf ihn! Dabei hatte er, wenn man Rozika glauben durfte, wenig Interesse an Frauen: Sie waren es, die ihm nachliefen wie die Besessenen.
Er hatte nur eine Leidenschaft – das Angeln. Eine wunderschöne selbstgefertigte Angelrute in der Hand, saß er tagaus, tagein schweigend am Flussufer. Er war fest überzeugt, dass die Fische die Sprache der Menschen verstehen und sofort die Flucht ergreifen, wenn sie nur einen menschlichen Laut hören. Wehe dem, der es wagte, den Mund aufzutun, während er auf einen Fisch wartete!
Rozika wurde so lange von der Neugier geplagt, bis sie sich eines Tages ein Herz fasste und zum Fluss ging, um den einsamen Angler in Augenschein zu nehmen. Sie spazierte ein paarmal an ihm vorbei, aber: »Hat er überhaupt nicht hochgeguckt. War ich Luft für ihn!«
Offensichtlich nahm Rozika ihm das nicht übel. Unbeirrt wiederholte sie ihre Spaziergänge zu seinem Angelplatz, und eines Tages hatte er endlich Erbarmen mit ihr. Nicht dass er sie angesprochen hätte, aber er winkte ihr mit dem Kopf, sie solle sich an seine Seite setzen. Und Rozika ließ sich nicht lange bitten. Sie wagte nicht, sich zu mucksen, schaute nur ins Wasser, still und stumm. Auch der Bursche sagte nichts, umspannte jedoch, ohne dass sich die Angel in seiner Rechten bewegt hätte, mit der linken Hand gleichmütig ihre Brust. Rozika glaubte – um ihre eigenen Worte zu gebrauchen –, »eine Hitzschlag« solle sie treffen, als er endlich gnädigst geruhte, sie in den Ufersand zu werfen, nachdem er seine Angelrute an einem Schilfrohr befestigt hatte.
»Aber dass du den Mund hältst«, flüsterte er ihr ins Ohr. »Sonst verjagst du mir die Fische!«
Es hört sich an wie eine erfundene Anekdote, doch das Verhalten des Burschen machte auf Rozika einen so tiefen Eindruck, dass sie ihn von diesem Tag an nicht mehr aus den Fängen ließ. Sie holte ihn in ihr Haus am Dorfende, und alles, was sie anderen Männern abnahm, stopfte sie nun in ihn hinein.
Der Bursche aber behielt auch weiterhin seine unerschütterliche Gelassenheit bei. Ihn vermochte nichts aus der Ruhe zu bringen, am wenigsten Rozikas Gewerbe. Solange er ungestört angeln durfte und abends zum Fischgulasch ein, zwei Liter Wein bekam, hätte sie seinetwegen kopfstehen können. Wie eine ausgehaltene träge Frau lebte er von dem Geld, das sie sich durch Liebesdienste verschaffte. Im Dorf hatte man ihn Onkel Rozika getauft; auch wir Kinder nannten ihn unter uns so.
Rozika war zu dieser Zeit nicht mehr die Jüngste. Sie mochte dreißig Jahre zählen, und das ist für ein Bauernmädchen ein bedenkliches Alter. Nach und nach stellten die besseren Herren ihre Besuche ein; sie sah sich genötigt, die Preise zu senken und den Verlust durch gesteigerten Umsatz wettzumachen.
Onkel Rozika hingegen fuhr frisch-fröhlich fort, ein Bauernmädchen nach dem anderen zu nehmen. Nicht dass er eine Frau so dringend nötig gehabt hätte – eine leidenschaftliche Natur war er ja nie gewesen. Nur um die Zeit totzuschlagen, wenn die Fische nicht anbeißen wollten, winkte er dieser oder jener, sich neben ihn zu setzen. Und die meisten kamen seiner Aufforderung nach.
Rozika wusste, wie er es trieb, spielte jedoch die Ahnungslose. Sie hatte ohnehin nicht das Recht, ihm Vorwürfe zu machen, also schwieg sie und grämte sich nur im Stillen. In so mancher Nacht lag sie mit offenen Augen an der Seite des schnarchenden Mannes; sie warf sich ruhelos hin und her, verspürte Stiche in der Herzgegend, und der kalte Schweiß brach ihr aus. Diese liederliche Person, die seit ihrem fünfzehnten Lebensjahr Liebe verkaufte und nicht wusste, was Treue hieß, wurde plötzlich von der Eifersucht wie von einer unheilbaren Krankheit befallen.
Eines Tages konnte sie es nicht mehr aushalten. Nachdem sie lange hin und her überlegt hatte, ließ sie den Dorfschneider kommen und bestellte bei ihm einen neuen Anzug für ihren Geliebten. »Wozu denn?«, fragte Onkel Rozika, der keine Spur eitel war.
»Wozu? Weil du nicht gehen kannst in dem alten zur Hochzeit.«
»Zur Hochzeit? Wer zum Teufel will denn hier Hochzeit machen?«
»Wer? Na du und ich.«
Der Mann schwieg eine Weile, weil er nicht gleich begriff. Als ihm endlich ein Licht aufging, grinste er nur still. »Man merkt doch gleich, dass du eine Slowakin bist«, war alles, was er sagte. »Du hast wirklich ein kluges Köpfchen.«
Aber er erhob keine Einwände gegen ihren Plan. Heiraten? Na schön, immer hinein ins Vergnügen! Schließlich verdiente sie das Geld. Glücklicherweise goss es an ihrem Hochzeitstag in Strömen, er hätte also sowieso nicht angeln können.
Rozika dagegen nahm die Ehe verteufelt ernst. Der Ring, die Heiratsurkunde und die Rede des Priesters hatten in ihrem Leben revolutionäre Veränderungen hervorgerufen. Von jenem Tag an wies sie alle ihre Besucher erbarmungslos ab.
»Mann meiniges erlaubt es nicht«, erklärte sie würdevoll. Dabei wäre »Mann meiniges« vor Lachen vom Stuhl gefallen, wenn er das gehört hätte.
Zwei Wochen nach ihrer Heirat setzte sie sich in die Bahn und fuhr in die Bezirkshauptstadt. Sie sagte, sie wolle dort »Hebamme lernen«. Die Leute im Dorf lachten sich halb tot. Wer wird denn so gottlos sein, eine Hure zu rufen, damit sie einem unschuldigen Kind in die Welt hilft?, fragte man sich.
Doch Rozika wusste, was sie tat. Sie hatte gar nicht die Absicht, Kindern in die Welt zu helfen. Ganz im Gegenteil! Von nun an lebte sie davon, dass sie das Auf-die-Welt-Kommen von Kindern vereitelte.
Sie hatte sich nicht verrechnet. Die anderen Engelmacherinnen im Dorf waren unwissende, schmutzige alte Weiber; die Frauen gingen daher lieber zu Rozika, wenn sie in der Patsche saßen. Und sie saßen oft in der Patsche, vor allem im Winter, wenn die Männer Zeit hatten.
Daneben aber betrieb Rozika ein noch einträglicheres Unternehmen. Unglückselige Bauernmädchen, denen – wie meiner Mutter – »nicht mehr zu helfen« war, durften in ihrem Haus auf Kredit ihre Kinder zur Welt bringen und bekamen sogar zu essen und zu trinken, bis sie so weit gekräftigt waren, dass sie sich in der Stadt als Amme verdingen konnten. Die Säuglinge blieben bei Tante Rozika. Wenn sich eine arme kleine Dienstmagd auf diese Weise mit einem Schlag von allen unmittelbaren Sorgen befreit sah, so fand sie nicht genug Worte des Dankes. Danach allerdings durfte sie zeit ihres Lebens der lieben, guten Tante Rozika den größten Teil ihres erbärmlichen Lohns schicken.
Wie eine Katze war diese unverwüstliche Slowakin, immer wieder fiel sie auf die Beine. Jetzt lebte sie also von den Liebesgeschichten anderer, und zwar recht gut, ja sogar besser als früher von ihren eigenen. Über das Haus am Ende des Dorfs brach eine zweite Blütezeit herein. Rozika kaufte Schweine, Kühe, Geflügel, hatte Pferd und Wagen und beschäftigte Dienstboten.
Wenn sie es nur irgendwie einrichten konnte, ging sie mit ihrem Mann angeln. Sie ließ ihn kaum noch aus den Augen, hütete ihn wie einen kostbaren Schatz. Dabei war Onkel Rozika auch schon bei Jahren. Er war ungefähr so alt wie seine Frau, und die näherte sich der vierzig.
Zu jener Zeit wuchsen in Rozikas Haus acht uneheliche Kinder auf, und so konnte sie sich getrost zur Ruhe setzen. Acht kleine Dienstmädchen in den verschiedensten Städten Ungarns arbeiteten ja für sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Sie sammelte nur die Gelder ein, und eines schönen Tages zählte sie zu den wohlhabendsten Bauern dieses bettelarmen Dorfs. Es fiel kaum noch ein Wort über ihre Vergangenheit; denn wie man so sagt: »Fürs Gewesene gibt der Jude nichts.«
Allmählich wurde Rozika fett. Sonntags trug sie ein hochgeschlossenes schwarzes Seidenkleid, und auf der Brust baumelte ein Kreuz, groß wie das eines Bischofs. Sie hatte ihre scherzende, muntere Redeweise abgelegt und sprach zu den ins Unglück geratenen Bauernmägden mit der salbungsvollen Herablassung einer tugendhaften Frau, die diese gefallenen Dinger zwar verachtete, ihnen aber im Namen des allmächtigen Gottes verzieh. Mit armen Leuten war sie kurz angebunden, sie duldete keinerlei Vertraulichkeiten. Ihre Dienstboten beschimpfte sie und holte das Letzte aus ihnen heraus. Dagegen troff ihr der Honig nur so von den Lippen, wenn ein reicher Landwirt sie auf dem Markt ansprach. Kurz und gut, sie benahm sich, wie es einer sittenstrengen Frau zukommt.
Sie wurde fromm. Früher war sie nie in die Kirche gegangen, nun aber kniete sie stundenlang in ihrer Bank. Über der gemarterten alten Chaiselongue, auf der sie sich einst mit ihren Besuchern gewälzt hatte, hing jetzt ein großes Marienbild, und in einer goldgerandeten roten Ampel brannte ein Ewiges Licht.
»Hast du schon einmal gedacht an Tod?«, fragte sie eines Tages ihren Mann.
»Den Teufel hab ich!«
»Fluche nicht! Ich spreche ernst. Sollen Hunde kriegen unsere schöne Geld?«
Onkel Rozika zuckte die Achseln. Ihn hatte das Wohlleben nicht verändert, er nahm nach wie vor alles mit unerschütterlicher Gelassenheit hin, solange er seine Ruhe hatte und sein Bauch voll war. Nicht so Tante Rozika. Sie strebte nach Unsterblichkeit.
»Wir müssen machen ein Kind«, sagte sie streng.
»Jetzt gleich?«, fragte Onkel Rozika grinsend, denn das Gespräch fand auf der Straße statt.
Aber auch diesmal erhob er keine Einwände. Ein Kind? Na schön, wenn sie ihren Spaß daran hatte, sollte sie eins haben. Schließlich verdiente sie das Geld. Den kleinen Gefallen musste man ihr schon tun. Nachts konnte man sowieso nicht angeln.
»Zu Weihnachten es möchte schon da sein«, rechnete sich Rozika an den Fingern aus.
Doch das Kind kam nicht zu Weihnachten. Und es kam auch nicht zu Ostern, es kam überhaupt nicht. Diese Frau, die Gott weiß wie oft in anderen Umständen gewesen war, als sie es nicht wollte, konnte nun, da sie sich so glühend ein Kind wünschte, nicht empfangen. Sie lief von einem Arzt zum anderen, sie fuhr sogar nach Budapest. Sie nahm Thermalbäder, schluckte Arzneien, probierte es mit den verschiedensten Hausmitteln. Es half alles nichts.
Sie dachte, dass es an ihrem Mann liegen könnte. Also betrog sie ihn. Auch das nützte nichts.
Zum ersten Mal in ihrem Leben verlor sie den Kopf. Sie ging umher wie eine Irre. Sie konnte, sie wollte sich nicht damit abfinden, dass ihr ein Kind versagt war; der Gedanke, dass die Hunde einmal ihr Geld bekämen, wurde zur fixen Idee.
Eines Tages riss sie das Marienbild von der Wand und schleuderte es mitsamt dem Ewigen Licht in die Ecke. Kein wütender Schweinehirt hätte so lästerlich fluchen können wie sie. Manchmal raste und tobte sie tagelang und schlug hemmungslos auf uns Kinder ein. Und dann wurde sie unvermittelt beängstigend still. Sie verkroch sich in einen Winkel der »guten Stube« und hockte stundenlang regungslos hinter geschlossenen Fensterläden. Von Zeit zu Zeit murmelte sie etwas vor sich hin, ihre Lippen bewegten sich tonlos, wie ein ausgeleiertes Räderwerk.
Sie nahm zusehends ab, verdorrte, alterte sozusagen über Nacht; sie wurde ein böses, zänkisches altes Weib.
Zeit ihres Lebens war sie gemein gewesen, aber bisher hatte ihre Gemeinheit doch wenigstens einen Zweck erfüllt, hatte ihr Geld, goldene Ketten, seidene Kleider, Schweine und Kühe eingebracht. Jetzt zog sie nicht einmal mehr Nutzen daraus; ihre Gemeinheit war so unfruchtbar wie ihr Schoß. Rozika war boshaft um der Boshaftigkeit willen. Es verschaffte ihr ein widernatürliches Vergnügen, eine krankhafte Befriedigung, wenn sie andere quälen konnte. Allerdings kam es mitunter vor – was sich früher nicht einmal zufällig ereignet hatte –, dass sie plötzlich von Wohlwollen überfloss. Dann bedachte sie Hinz und Kunz mit Geschenken, war liebenswürdig zu aller Welt, küsste irgendein Kind und drückte es wild an sich. Es war eine gespenstische, gefährliche Güte, die sie packte wie einen Hund die Tollwut, und nach einem solchen Anfall war sie noch hundertmal gemeiner als zuvor.
3
Mich hasste sie vom Tag meiner Geburt an.
Ich weiß, dass diese Behauptung unglaublich klingt. Eine Frau mag an dem ihr anvertrauten Kind nicht sonderlich hängen, sie mag sich sogar in einem Augenblick der Erregung zu einem Wutausbruch hinreißen lassen – aber dass sie ein so kleines Geschöpf hasst? Es klingt unwahrscheinlich, und doch traf es zu: Sie hasste mich. Und es war keineswegs ein gelegentlicher Funke, der durch eine zufällige Reibung überreizter Nerven aufglimmt und sogleich wieder erlischt, sondern ein todernster, zäher, ich möchte fast sagen, männlicher Hass. Wir lebten in einem ständigen Kampf. In den vierzehn Jahren, die ich in ihrem Haus verbrachte, herrschte an keinem einzigen Tag Waffenstillstand.
Dieser Hass muss erschreckend tiefe Wurzeln gehabt haben. Ich wurde zu der Zeit geboren, als sie erfuhr, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Ob sie mich deshalb hasste? Ich weiß es nicht. Es ist nur eine Vermutung. »Denn welcher Mensch weiß, was im Menschen ist«, schreibt Paulus an die Korinther, »ohne den Geist des Menschen, der in ihm ist?«
Ich war kein liebenswertes Kind; um der historischen Treue willen muss das festgehalten werden. Ich war ungewöhnlich verschlossen, fast unnahbar, argwöhnisch, eigensinnig, immer in Abwehrstellung. Selbst mit sieben Jahren fehlte mir das, was man kindliche Anmut nennt.
Ich besitze eine Fotografie aus jener Zeit, eine Gruppenaufnahme, die eine der Mütter von uns acht Kindern hatte machen lassen. Selten ist mir ein Kind begegnet, das so unsympathisch aussah wie ich auf diesem Bild. Alles an mir ist grob. Die Schultern scheine ich mir von einem um fünf Jahre älteren Jungen ausgeliehen zu haben; meine Miene ist hart, düster, bösartig. Auf der Fotografie bin ich ausgesprochen hässlich, obwohl mein Gesicht bei näherer Betrachtung ganz erträglich ist: auffallend große Augen, eine starke, gerade Nase, ein schöngeschwungener, energischer Mund, in die Stirn fallendes schwarzes Haar. Meine Züge haben sich seither kaum verändert, sie waren schon damals völlig ausgeprägt, und das ist vielleicht auch der Grund, dass ich auf diesem Bild so abstoßend wirke. Jene Merkmale, die das Gesicht eines Mannes anziehend erscheinen lassen, können das eines Kindes entstellen.
Man sagt, dass ich schon im Alter von fünf, sechs Jahren mit den Erwachsenen meiner Umgebung auf dem Kriegsfuß lebte. Ich tat den Mund nicht auf, wenn ich nicht angeredet wurde, und richtete man das Wort an mich, so gab ich kurze, bissige Antworten. Mit gespreizten Beinen, die Hände in den Hosentaschen, stand ich vor den Erwachsenen und sah sie von unten herauf an wie ein sprungbereiter Bulle.
»Was ziehst du wieder für Grimasse?«, zeterte Tante Rozika wohl zehnmal am Tag. »Siehst aus wie Raubmörder!«
Nein, ich war kein liebenswertes Kind, aber wie hätte ich das auch sein können? Ist es unvernünftig, wenn sich mir manchmal der Gedanke aufdrängt, der tiefe Hass, der meine Mutter erfüllte, als sie mich unter dem Herzen trug, habe sich auf meinen Charakter ausgewirkt? Ich weiß es nicht. Dagegen erinnere ich mich genau, dass ich mir bereits mit sieben Jahren über meine Lage völlig im Klaren war. Ich wusste, dass keine Menschenseele an meinem elenden kleinen Schicksal aufrichtig Anteil nahm, ich wusste auch, dass es auf der Welt nur Jäger und Gejagte gab und dass ich nicht zu den Jägern gehörte.
Allerdings hielt ich diesen Zustand für natürlich. Ich war fest davon überzeugt, dass nur jene gut waren, denen keine andere Wahl blieb. Ein Bankert musste gut sein, ein reicher Mensch nicht. Ich war neidisch auf Tante Rozika, weil sie schlecht sein durfte. Wer es sich leisten konnte, schlecht zu sein, der hatte es schon zu etwas gebracht.
Es überraschte mich immer, wenn jemand gut zu mir war. Einem solchen Menschen misstraute ich. Was will er?, fragte ich mich argwöhnisch. Stellte sich dann – selten genug – heraus, dass der andere nichts wollte, so sah ich ihn an, als hätte er zwei Nasen. So etwas war doch widernatürlich. Der Himmel war blau, das Gras grün, der Mensch niederträchtig. Jeder war es, der Grips im Kopf hatte. Nur die Idioten-Vilma war gut, aber über die lachte das ganze Dorf.
Wenn ich zurückblicke, wird mir klar, dass ich damals überhaupt nicht wusste, was die Erwachsenen unter dem Wort Güte verstanden. Ich hielt es für ein Wort, das dazu diente, die Kinder hinters Licht zu führen. Sie hatten eine Menge solcher Worte. Eines hieß Religion. Es gab eine Sonntagsreligion, zu der sich die Leute in der Kirche bekannten, und eine Alltagsreligion, die im Dorf ausgeübt wurde, und ich kam nie dahinter, was die beiden miteinander zu tun hatten. Tante Rozika zum Beispiel galt als religiös. Stundenlang kniete sie vor dem Marienbild, und wenn sie ihren Güteanfall hatte, redete sie von »christlicher Nächstenliebe«. Nun, ich hatte reichlich Gelegenheit zu erfahren, wie ihre christliche Nächstenliebe sich äußerte. Mich hätte man jedenfalls eimerweise mit schönen, salbungsvollen Worten überschütten können – ich glaubte an sie so wenig wie an den schwarzen Mann.
Sooft die Erwachsenen solche Worte flöteten, hatte ich das Gefühl, ein freches Eichhörnchen hüpfe in meinem Innern herum. Aber ich zuckte nicht mit der Wimper, sondern setzte eine sture, einfältige Miene auf wie ein wiederkäuendes Kalb. Ich war nicht gewillt, mich mit den Erwachsenen in einen Wortwechsel einzulassen. Ich stand nur da, die Hände in den Hosentaschen, und sah von unten hinauf in ihre scheinheiligen Gesichter.
Du sollst Vater und Mutter ehren, predigten sie. Na gut, dachte ich bei mir, ehrt sie doch! Das Eichhörnchen machte einen Sprung, streckte die Zunge heraus und kicherte. Meinen Vater hatte ich nie gesehen, von meiner Mutter wusste ich nur, dass ihr mein Wohl und Wehe keine übermäßigen Kopfschmerzen verursachte. Vier- oder fünfmal im Jahr kam ein fremdes Bauernmädchen, verbrachte einen Nachmittag mit mir und verschwand dann wieder. Von dieser Frau behauptete man, sie sei meine Mutter.
Insgeheim zitterte ich vor ihren Besuchen. Eine quälende Beklemmung erfasste mich jedes Mal, wenn es so weit war; ich erinnere mich, dass ich einen bitteren Geschmack im Mund hatte, als hätte ich mir den Magen verdorben. Noch heute finde ich keine Erklärung dafür. Meine Mutter war immer nett zu mir, sie schlug mich nicht und nörgelte auch nicht an mir herum, sie brachte mir sogar für zehn Fillér Kartoffelzucker mit, den ich für mein Leben gern aß. Ein weiterer Vorteil ihres Besuchs war der, dass ich an solchen Tagen ein gutes Mittagessen bekam. »Zufällig« gab es dann auch immer meine Lieblingsgerichte: Szegediner Gulasch oder Nudeln mit Weißkäse, saurer Sahne und ausgelassenen Speckgrieben. Aber ich hätte gern auf das Szegediner Gulasch, das Nudelgericht und den Kartoffelzucker verzichtet, wenn dieses fremde Bauernmädchen zu Hause geblieben wäre.
Sie schrieb stets eine Postkarte, um sich anzumelden, und ich war schon Tage vorher voller Unruhe. Für gewöhnlich kam sie sonntags mit dem Mittagszug. Ich verdrückte mich nach dem Essen und schloss mich in die kleine hölzerne Abtrittbude an der rückwärtigen Hauswand ein; wenn man mich nicht störte, hockte ich lange auf dem feiertäglich weißgescheuerten Brett und starrte auf die dicken grünen Fliegen, die in der Senkgrube Festschmaus hielten. Um diese Zeit hielten Tante und Onkel Rozika ihren Nachmittagsschlaf, die Dienstboten hatten Ausgang, die Jungen trieben sich irgendwo herum. Die Sommersonne brannte auf die Holzbude, die Luft war erdrückend heiß und übel riechend. Der Schweiß brach mir aus allen Poren, die Lider wurden mir schwer. So kauerte ich, den Kopf auf der Brust, und döste, bis die Glocke am Tor das sonntägliche Schweigen unterbrach.
»Bé-é-éla!«, erklang die Stimme meiner Mutter. »Tante Rozika!« Ich stand auf, spuckte in hohem Bogen aus und ging dann mit dem würdevollen Schritt eines alten Bauern meiner Mutter entgegen.
Sie verlangte nicht, dass ich ihr, wie es Brauch war, die Hand küsste. Sie gab mir einen Kuss auf die Wange, den ich nie erwiderte. Ich weiß nicht, ob ihr das auffiel; fest steht, dass sie nie ein Wort darüber verlor. Ihrer harten Natur war jedes Getue zuwider. Die anderen Mütter machten immer viel Aufhebens von ihren Sprösslingen, herzten und küssten sie geräuschvoll und rührselig. Sie dagegen saß ganz ruhig neben mir, und man konnte ihr vom Gesicht ablesen, was sie von diesen Frauen dachte.
»Was gibt’s Neues, Béla?«, fragte sie ernsthaft, als spräche sie mit einem Erwachsenen.
»Nichts«, antwortete ich im gleichen Ton und dachte an den Kartoffelzucker.
Da griff sie auch schon in ihre abgewetzte kleine Tasche und holte die erhoffte Süßigkeit heraus.
In diesem Augenblick wurde die Küchentür in einer sichtlich auf Effekt abzielenden Weise aufgestoßen, und Tante Rozika erschien in ihrem rauschenden schwarzen Seidenkleid, das große Kreuz auf der Brust, hoheitsvoll wie eine Dorfkönigin.
»Grüß Gott, grüß Gott«, schnatterte sie schon von weitem. »Lange her, dass ich dich habe gesehen. Wie geht’s, Annuska?«
»Ich danke für die gütige Nachfrage«, antwortete meine Mutter bescheiden, fast demütig. »Immer dasselbe, man schlägt sich so durch.«
Die Alte klopfte meiner Mutter mit honigsüßem Lächeln und herablassender Liebenswürdigkeit auf die Schulter, musterte sie aber zugleich scharf und missgünstig von Kopf bis Fuß.
»Was für hübsches, feines Kleid«, sagte sie in einem unnachahmlich hämischen Ton; sie spielte ohne Zweifel auf das längst fällige Pflegegeld an, hörte jedoch nicht auf zu lächeln.
»Ach, das habe ich schon seit drei Jahren, Tante Rozika«, erwiderte meine Mutter verlegen und wechselte rasch das Thema.
Wie ein sorgfältig einstudiertes Theaterstück wiederholte sich dieses Gespräch fast wortwörtlich von Besuch zu Besuch, von Jahr zu Jahr. Dann folgte der zweite Akt: die Klagen über mich.
»Dein Sohn, Seelchen mein«, krächzte die Alte, »dein Sohn, das ist Taugenichts, größter auf ganze Welt! Dein Sohn wird enden an Galgen, das möchte ich sagen schon heute! Dein Sohn …«
Und so weiter, eine geschlagene halbe Stunde lang. Alle Sünden, die ich im letzten Vierteljahr begangen hatte, zählte sie mit größter Gewissenhaftigkeit auf. Ihr Gedächtnis war bewundernswert. Was sie sagte, das stimmte, nur berichtete sie nie, warum ich dies oder jenes verbrochen hatte. Fast alle meine Missetaten waren nämlich darauf zurückzuführen, dass sie mir nicht genug zu essen gab.
Aber ich hatte früh gelernt, dass Reden Silber und Schweigen Gold ist. Ich klagte weder an, noch verteidigte ich mich. Ich stand nur da, mit gespreizten Beinen, die Hände in den Hosentaschen, und spähte zu ihrem plappernden, zahnlosen Mund hinauf, der unaufhörlich sein Gift verspritzte.
Auch meine Mutter schwieg. Sie schüttelte nur den Kopf, als wäre sie zutiefst empört, und warf mir hin und wieder einen wütenden Blick zu. Wenn die Alte ihre Litanei beendet hatte, war die Reihe an ihr, mir die Leviten zu lesen.
»Dass du dir nicht die Augen aus dem Kopf schämst! Wie kannst du Tante Rozikas Güte so missbrauchen? Oh, es ist eine Schmach und Schande!«
Bei jedem Besuch hielt sie mir diese Strafpredigt, Wort für Wort. Na, dachte ich, du hast gut reden! Probier du doch mal, wie Tante Rozikas Güte schmeckt! Hoppla, das Eichhörnchen machte einen Satz und streckte die Zunge heraus. Ich aber stand da und zuckte nicht mit der Wimper.
»Ich werde dir Taugenichts schon die Flötentöne beibringen«, drohte sie. »Los, komm jetzt, du Kreuz deiner Mutter!«
Ich folgte ihr würdevoll, mit schwerem Schritt. Am Ende des Gartens stand unter einem alten Pfirsichbaum eine verwitterte Bank ohne Rückenlehne, und dort setzten wir uns nieder. Meine Mutter war wie umgewandelt, sobald wir dem Blickfeld der Alten entronnen waren. Statt mir weiter Vorhaltungen zu machen, vergewisserte sie sich hastig, dass uns niemand belauschte, und fragte dann leise: »Gibt sie dir genug zu essen?«
»Den Teufel tut sie!«, antwortete ich. »Nur wenn du kommst, kann ich mich satt essen.«
Auch das war eine Szene, die sich jedes Mal wiederholte. Meine Mutter runzelte die Stirn und sah eine Weile wortlos vor sich hin. Dann sagte sie: »Ich werde mit ihr reden.«
Schon mit fünf Jahren wusste ich, dass dieses Versprechen eine glatte Lüge war. Das Eichhörnchen kicherte leise. Einen Dreck wird sie tun, dachte ich bei mir. Heute weiß ich, dass die Ärmste dauernd mit dem Pflegegeld im Rückstand war und in ewiger Angst lebte, Tante Rozika werde mich auf die Straße setzen oder zu ihr nach Budapest schicken. Damals hatte ich natürlich von alledem keine Ahnung. Ich wusste nur, dass meine Mutter log. Statt die Alte zur Verantwortung zu ziehen, schmeichelte sie ihr so kriecherisch, dass sich mir der Magen umdrehte.
Aber auch hierüber verlor ich kein Wort. Ich saß auf der wackligen Bank unter dem alten Pfirsichbaum und schwieg. Die Sonne schien auf das Blätterdach über uns, wellige gelbe Lichttupfen zitterten im Schatten. Meine Mutter starrte mit ihren sonderbar tiefliegenden schwarzen Augen stumm ins Leere oder zeichnete mit der Schuhspitze Figuren in den Sand.
Auf dem Hof ging es lärmend und munter zu. Die jungen Mütter zwitscherten mit ihren Sprösslingen, herzten und küssten sie oder tollten so laut mit ihnen herum, dass die Äußerungen ihres übermütigen Mutterstolzes bis auf die Straße drangen.
Ich merkte, dass meine Mutter nicht recht wusste, was sie mit mir anfangen sollte. Weder ihr Mund noch ihre Hand neigten zum Liebkosen, und außerdem war ihr meist nicht nach Scherzen und Spielen zumute. So saß sie also neben mir wie neben einem Erwachsenen, mit dem sie nicht viel gemein hatte.
Aber es war auch meine Schuld, dass wir einander nicht näherkamen. Hin und wieder, allerdings sehr selten, bemächtigte sich meiner Mutter eine unbeholfene Zärtlichkeit; ich jedoch – ohne dass ich es wollte – zertrat jedes Mal diese aufkeimenden Gefühle. Ich erinnere mich, dass sie mich einmal fragte, warum ich immer so finster dreinschaue. »Nun lach doch mal!«, rief sie fröhlich und kitzelte mich.
Da ich sehr kitzlig war, ergriff ich die Flucht, und sie rannte mir nach. Als sie mich eingeholt hatte, packte sie mich plötzlich, drückte mich an sich und küsste mich stürmisch ab. In diesem Augenblick befiel mich ein unerklärlich peinvolles Gefühl, eine nicht zu beschreibende Regung der Scham, und fast mit Abscheu entzog ich mich ihr. Sie musste meinen Widerwillen gespürt haben, denn sie ließ mich sofort los. Ohne ein Wort zu sagen, band sie ihr Kopftuch fester und ging dann ins Haus, um mit Tante Rozika »abzurechnen«.
Diese Abrechnungen vollzogen sich selten reibungslos. Auch an jenem Tag drängte die Alte offenbar auf Zahlung der Rückstände, denn man hörte ihre keifende Stimme über den Hof schallen. Als meine Mutter schließlich herauskam, hatte sie verweinte Augen.
»Na, gehen wir!«, sagte sie kurz, mit unterdrückter Erregung. »Gute Nacht!«
Beim Abschied sagte sie immer gute Nacht, obwohl die Sonne noch ziemlich hoch am Himmel stand. Der Zug fuhr einige Minuten nach sieben, aber wir waren bereits gegen sechs Uhr auf dem Bahnhof. Die Zeit bis zur Abfahrt wurde mir unerträglich lang. Auf dem Bahnsteig wimmelte es von Menschen, da es zu den weltlichen Vergnügungen der Dorfbewohner gehörte, am Sonntag die Ankunft und Abfahrt des Abendzugs zu beobachten. Kaum einer reiste selbst; sie schlenderten, feiertäglich gekleidet, vor den Schienen auf und ab, grüßten einander im Vorbeigehen oder standen plaudernd in Gruppen zusammen. Die goldene Jugend war vollzählig erschienen; die Burschen zappelten vor unbändiger Unternehmungslust, und die Mädchen in ihren bunten leichten Kleidern kicherten und kreischten, als würden sie gekitzelt. Wir beide aber schauten mit dem Gleichmut eines alten Ehepaars dem fröhlichen Treiben zu und schwiegen wie zuvor unter dem Pfirsichbaum. Nur war unser Schweigen jetzt von anderer Art. Ich wusste nicht, warum meine Mutter verweinte Augen hatte – offen gestanden bedrückte mich das auch nicht sonderlich –, und doch empfand ich nun, da wir Seite an Seite auf einer Bahnhofsbank saßen, ein herzzerreißendes Mitleid mit ihr.
Wer vermag sich schon in dem unwegsamen Dschungel einer Kinderseele zurechtzufinden. Selbst auf die Gefahr hin, als unmenschlich zu gelten, gestehe ich, dass ich so etwas wie Sohnesliebe damals nicht kannte. Dagegen hatte ich fast immer Mitleid mit meiner Mutter. Sie tat mir so unendlich leid, dass ich in der Herzgegend einen physischen Schmerz fühlte. Obwohl ich ein so kleiner, elender Wicht war, hielt ich mich doch für den Stärkeren, Gescheiteren und Gewandteren von uns beiden. Schon mit sechs Jahren war ich überzeugt, lebenstüchtiger zu sein als meine Mutter. Von alledem hatte sie natürlich keine blasse Ahnung. Ich saß artig neben ihr und bemühte mich, so einfältig auszusehen wie ein wiederkäuendes Kalb.
Endlich fuhr der Zug ein. Aus der fauchenden Lokomotive quoll dichter Rauch, und die kleine Station füllte sich mit dem erregenden Geruch des Abschieds, der Ferne und des Abenteuers. Ich atmete erleichtert auf, als meine Mutter einstieg, und doch wurde es mir eigentümlich schwer ums Herz.
»Gott segne dich«, sagte sie.
»Gott segne dich«, grüßte auch ich.
Dann ruckte der Zug an. Meine Mutter winkte mir nicht zu, sondern trat sofort vom Fenster zurück.
Eines Tages, als ich abermals dem ausfahrenden Zug nachsah, überwältigte mich ein erschreckendes Gefühl, eine herzbeklemmende fiebrige Verzückung, die mich dann jahrelang überkam, sobald mir der erregende Geruch des Rauchs einer Lokomotive entgegenschlug.
Ich möchte dieses Erlebnis so genau beschreiben, wie ein Arzt die Krankengeschichte eines Patienten aufzeichnet. Sechs Jahre alt bin ich wohl damals gewesen. Es war am frühen Abend eines schwülen Hochsommertags; ich stand barfuß auf dem Bahnsteig, dachte an nichts, sah nur den roten Schlusslichtern des Zugs nach, die allmählich in der Ferne verschwanden. Plötzlich, ohne jeden erkennbaren Grund, fühlte ich einen schweren Druck auf der Brust, die Kehle war mir wie zugeschnürt, ich konnte kaum atmen. Es dauerte nur ein paar Minuten, aber diese Minuten waren so voller Angst und Hoffnungslosigkeit, dass mir Tränen aus den Augen stürzten. Mich befiel das schmerzliche, fast könnte man sagen, körperliche Verlangen wegzugehen. Weg von meiner Mutter, weg von Tante Rozika, weg vom Dorf! Wohin? Ich wusste es nicht. Warum? Ich wusste es nicht. Ich hatte kein Ziel, keine klare Vorstellung. Ich wollte nur weg von hier, weg, weg!
Als nüchterner Dorfjunge, der ich nun einmal war, sagte ich mir allerdings schon nach wenigen Minuten: »Quatsch!«
Das gleiche Gefühl mochte meinen Vater übermannt haben, als er, noch ein halbes Kind, von zu Hause durchbrannte. Vielleicht war es an einem ebenso schwülen Hochsommerabend, dass ihn dieser unwiderstehliche Drang packte und er aufbrechen musste, ohne zu wissen, warum und wohin, um wie ein Schlafwandler seinen nicht zu bezwingenden verschwommenen Sehnsüchten nachzueilen.
Wenn ich mich in diesem Gemütszustand befand, machte ich auf dem Rückweg vom Bahnhof einen Bogen um die Hauptstraße, auf der es an Sommersonntagen um die Abendzeit stets von Menschen wimmelte. Die Dorfleute, sofern sie keine Wirtshausgänger waren, wussten nicht recht, was sie am Sonntagabend mit sich anfangen sollten. Ein Tag ohne Arbeit lag hinter ihnen, sie hatten sich ausgeruht, und nun langweilte sie das Nichtstun bereits.
4
Ich trottete auf Umwegen, die über Wiesen und Felder führten, nach Hause. Solange ich durch das Dorf ging, war ich immer peinlich darauf bedacht, mein Gesicht zu wahren. Die Hände in den Hosentaschen, das Kinn auf die Brust gepresst, stapfte ich mit dem schweren, würdevollen Schritt eines alten Bauern dahin. Ab und zu spuckte ich in hohem Bogen aus dem Mundwinkel auf die Straße, denn ich war fest davon überzeugt, dass Spucken das Ansehen eines Mannes erhöhe. Kaum aber hatte ich die letzten Häuser hinter mir gelassen, da rannte ich wie ein Irrer los. Ich rannte über Äcker und Weiden, solange die Beine mich trugen. Dann warf ich mich bäuchlings ins Gras und blieb lange keuchend liegen. Plötzlich fühlte ich mich wie verwandelt. Vergessen war alles, was an diesem Tag auf mich eingestürmt war, die unbegreifliche Spannung meiner Nerven ließ nach. Es war, als sei ich aus gefährlichen fremden Ländern heimgekehrt.
Es dämmerte, aber die Dunkelheit wuchs nur langsam; es war, als schaute man durch ein Fenster, dessen Scheiben allmählich mit dem Hauch des Atems beschlagen, in die Landschaft hinaus. Ein warmer Erdgeruch verbreitete sich, am Horizont hing der blutrote Sonnenball. Der Abendhimmel war bunt wie ein wunderbares großes Bauerntuch, und irgendwo in der Ferne läuteten die Kuhglocken einer heimkehrenden Herde.
Ich war zu Hause.
Leise vor mich hin summend, wanderte ich dem Dorf zu. Es lag in meiner Natur, dass ich an der schmutzigsten Kuh, dem klapprigsten Gaul, dem räudigsten Hund nicht vorbeigehen konnte, ohne diese Kreaturen innig und mitfühlend zu tätscheln. Mit einer verräterisch überströmenden Liebe zog es mich zu den Tieren. Ich liebte keinen Menschen, nicht einmal meine eigene Mutter, aber offenbar muss der Mensch lieben, und es war nicht meine Schuld, dass ich nur Tiere lieben konnte. Sogar die hochmütigen Windspiele der Gutsherrschaft sprangen und tänzelten um mich herum, obwohl ich ihnen wahrhaftig kein Futter vorwerfen konnte, um mich bei ihnen beliebt zu machen.
Wenigen Hunden ging es so schlecht wie mir. Fast immer stand ich hungrig vom Tisch auf. Tante Rozika war keine Anhängerin des Prinzips der Gleichheit. Die Kost eines Jungen richtete sich stets nach der Summe, die seine Mutter dafür bezahlte. Bei den anderen Kindern traten die Unterschiede aber nicht so krass in Erscheinung, da die Mütter oft zu Besuch kamen und sofort erfuhren, wenn ihren Kindern Unrecht geschehen war. Péter beklagte sich, dass Pal besseres Essen habe als er; Pal wiederum greinte, dass Istváns Portionen größer seien als seine. Diese Jammertiraden machten den kleinen Dienstmägden das Herz so schwer, dass sie das erforderliche Geld stets irgendwie zusammenkratzten; eine Woche später konnte dann Péter das Gleiche essen wie Pal, und Pal erhielt ebenso viel wie István. Wer aber kümmerte sich um mich?
Meine Mutter besuchte mich höchstens vier-, fünfmal im Jahr und musste dann unweigerlich vor Tante Rozika zu Kreuze kriechen, weil sie mit dem Pflegegeld im Rückstand war. Wie hätte sie es also wagen können, auch nur ein Wort der Beschwerde über meine Kost fallenzulassen?
Es gab Augenblicke in meiner Kindheit, da ich für eine gute warme Mahlzeit zu allem fähig gewesen wäre.
Ich stahl, ich gestehe es, ich stahl wie eine Elster. Vergeblich verschloss die Alte alles Essbare vor mir; der bittere Zwang und die Übung steigerten meine Gewandtheit im Stehlen zu geradezu künstlerischer Vollendung. Natürlich war der Teufel los, wenn sie dahinterkam, aber Reue, ich erinnere mich genau, Reue verspürte ich nicht ein einziges Mal. Hätte ich vielleicht meine körperliche Entwicklung gefährden oder mir die Schwindsucht holen sollen, nur damit das auf so ekelhafte Weise erworbene Vermögen dieser alten Hure unangetastet blieb? O nein! Schließlich war ich nicht auf den Kopf gefallen!
Nach und nach wurde ich so verwegen wie ein Fuchs auf seinen Raubzügen. Ich entdeckte auch bald, dass man aus der menschlichen Rachgier Nutzen ziehen konnte. Unter Kindern regiert bekanntlich die Faust, das heißt, der Stärkere hat recht, und ein Kind möchte nun einmal recht haben. Ich wollte das nicht. Ich hatte Hunger und pfiff auf platonische Gerechtigkeit. Ein hungriger Mensch strebt nur nach einem: nach Brot. Für mich war das Prügeln ein ernster Broterwerb. Wenn zwischen zwei Jungen ein Streit ausbrach, ging ich zu dem Schwächeren und fragte in trockenem Geschäftston: »Was kriege ich, wenn ich dem Wicht da das Fell gerbe?«
Im Allgemeinen verlangte ich zehn Fillér, war jedoch, wenn es sein musste, auch schon für zwei bereit, einen anderen zu verprügeln.
Dabei waren diese Schlägereien keineswegs gefahrlos. Die Jungen hatten sich zu Banden zusammengetan, und ich stand daher meist einer ganzen Bande gegenüber. Mehr als einmal verließ ich den Kampfplatz mit blutigem Kopf. Aber was machte ich mir daraus! In meiner Tasche klimperten die Kreuzer, und das war das trostreichste Klimpern der Welt: Ich konnte zum Bäcker gehen und mir Brot kaufen.
Der Räuber Sándor Rózsa war mein Ideal. Andere Jungen wollten Priester oder Feldherr werden, mein Wunschtraum dagegen war, Räuber zu sein wie Sándor Rózsa, der den Reichen das Geld stahl, um es den Armen zu geben. Freilich, ich verteilte mein schwerverdientes Geld nicht, aber ich konnte mich mit dem Gedanken trösten, dass ich von allen Armen im Dorf der ärmste war.
5
Im Herbst 1919 – ich war damals sechs Jahre alt – verlor meine Mutter ihre Stellung. Statt Geldanweisungen schickte sie nun einen Bittbrief nach dem anderen und beschwor die Alte, um Christi willen wenigstens bis zum nächsten Ersten zu warten, bis dahin werde sie gewiss Arbeit gefunden haben. Aber sie fand keine.
Eines Tages, als ich mich ahnungslos mit den anderen Jungen auf dem Hof zu Tisch setzen wollte, stürzte die Alte aus der Küche heraus und kreischte, dass es für mich kein Essen mehr gebe, denn meine Mutter habe ihr schon seit einem Vierteljahr keinen Kreuzer bezahlt.
»Und du bist keine so herzige Kind, dass ich dich möchte ernähren aus Liebe.«
Zuerst verstand ich gar nichts. Ich stand nur da, mit gespreizten Beinen, die Hände in den Hosentaschen, das Kinn auf die Brust gepresst, und sah die keifende Hexe an. Sie fuchtelte mit einem Brief in der Luft herum, den sie gerade von meiner Mutter erhalten hatte.
»Wenn deine Mutter elendige mir nicht schulden würde so viel Geld, ich möchte dir schon längst gezeigt haben, wo Zimmermann Loch gelassen hat, du Galgenstrick, du Rabenaas, du!«
Ich schwieg noch immer. Die anderen hatten sich bereits über das Essen hergemacht, und bei diesem Anblick lief mir das Wasser im Mund zusammen. Es gab Paprikakartoffeln mit Knackwurst, und noch heute spüre ich den würzigen, appetitanregenden Duft in der Nase. Ich war entsetzlich hungrig. Tränen würgten mich in der Kehle, doch um nichts in der Welt hätte ich geweint. Ich sah, dass die Jungen, tief über ihre Teller gebeugt, einander unter dem Tisch anstießen und mit hämischem Grinsen der Dinge harrten, die da kommen sollten. Krampfhaft bemüht, mein Gesicht zu wahren, versuchte ich, die Alte zu besänftigen.
»Meine Mutter wird Ihnen das Geld schon noch schicken«, sagte ich so ruhig wie möglich. »Bitte, geben Sie mir doch was zu essen, ich habe solchen Hunger!«
»Nichts da«, zeterte sie und schüttelte den Kopf. »Schreib deiner Mutter, dass Hure wie sie nicht kriegen soll Kinder, wenn sie nicht will zahlen dafür!«
Ich bemerkte, dass sich die Jungen vor Lachen kaum noch halten konnten. Eine entsetzliche Wut überkam mich, ich zitterte am ganzen Leib. »Selber Hure!«, schrie ich der Alten ins Gesicht und ergriff dann schleunigst die Flucht.
Tante Rozika war keine freigebige Natur, aber kaum hatte ich diese Worte ausgesprochen, da packte sie die Kartoffelschüssel und schleuderte sie mir nach. Zum Glück traf das Wurfgeschoss nur mein Hinterteil; ich kam mit heiler Haut davon, während die Schüssel in tausend Scherben zersprang. Ich rannte weiter, und noch auf der Straße fühlte ich, wie mir die guten Paprikakartoffeln an der Hose hinunterliefen.
Ich kochte vor ohnmächtigem Zorn. Zuerst wollte ich mich ans Küchenfenster schleichen und der Alten mit der Schleuder die Augen ausschießen. Aber ich hatte bereits gelernt, dass Hass und Rachsucht den Magen nicht füllen, und so wandte ich mich praktischeren Plänen zu. Ich hielt im Dorf Umschau, ob es nicht irgendwo etwas zum Stehlen gäbe. An diesem Tag hatte ich jedoch Pech, ich konnte nichts ergattern, nicht einmal ein bisschen Obst. Meine Freunde, die Hunde, brachen bei meinem Anblick in ein solches Freudengekläff aus, dass ihre Herrinnen umgehend an der Küchentür erschienen.
Als ich auf meinem Streifzug an der Schule vorbeikam, war gerade Vesperpause, und die Kinder tollten auf dem Hof. Die meisten hatten eine dicke Stulle mit Schmalz oder Marmelade in der Hand, ohne auch nur die geringste Notiz davon zu nehmen, so sehr waren sie in ihr Spiel vertieft. Sie kreischten und rannten wie die Irren und blieben nur hin und wieder kurz stehen, um ganz nebenbei einen Happen von ihrem Brot abzubeißen.
Was würde Sándor Rózsa in dieser Lage tun?, fragte ich mich, und auf einmal wusste ich die Antwort.
Ich spuckte in hohem Bogen auf die Erde, um den Kindern zu zeigen, was für ein Kerl ich war, und schlenderte dann mit schwerem, würdevollem Schritt über den Hof.
Damals ging ich noch nicht zur Schule. Die Kinder glaubten vermutlich, dass ich jemanden suchte, und im Grunde war es ja auch so. Ich suchte ein Opfer. Nicht ohne eine gewisse Angst, wie ich gestehen muss, denn die Jungen waren alle älter als ich. Doch ein hungriger Mensch darf nicht zimperlich sein, und so traf ich schließlich meine Wahl. Das ahnungslose Opfer lehnte in der hinteren Ecke des Hofs an einer Akazie und verdrückte ein Marmeladenbrot. Er mochte mir ein oder zwei Jahre voraus haben, aber er war ziemlich klein. Koste es, was es wolle, sagte ich mir und schlich mich an ihn heran. Als ich hinter ihm stand, riss ich ihm blitzschnell das Brot aus der Hand, und, heidi, weg war ich.
Bevor der Junge wusste, wie ihm geschah, war ich über alle Berge, und sein Jammern und Plärren nützte ihm gar nichts.
Ich rannte aufs Feld hinaus, und im Schatten eines Weißdornbuschs machte ich mich über meine Beute her. Das Marmeladenbrot schmeckte mir, das Abenteuer auch. Das war ein richtiger Sándor-Rózsa-Überfall! Ich war höchst zufrieden mit mir.
Dann fasste ich den Entschluss, nicht mehr nach Hause zu gehen. Ich fürchtete, die Alte würde eine zweite Schüssel nach mir werfen. Als es jedoch zu dunkeln begann, verdüsterte sich auch mein Gemüt. Es half nichts, dass ich ein Anhänger und Nachahmer Sándor Rózsas war – die Dunkelheit flößte mir nun einmal Angst ein. So machte ich mich denn auf den Heimweg.
Im Haus brannte kein Licht mehr. Mit dem Hund hatte ich leichtes Spiel, dem brauchte ich nur zu winken, und sofort zog er den Schwanz ein, duckte sich wie ein Kanzleisekretär. Es war eine stockfinstere Nacht, nichts regte sich. Lautlos kletterte ich über den Zaun. Zum Glück war das Zimmer, in dem wir Jungen schliefen, nachträglich angebaut worden, und die Alte hatte – zweifellos aus Gründen der Sparsamkeit – keine Verbindungstür einfügen lassen. Man konnte diesen Raum nur vom Hof aus erreichen. Langsam und vorsichtig drückte ich die Klinke herunter. Die Tür öffnete sich geräuschlos, und ich stand im Zimmer.
Die Kinder lagen in tiefem Schlaf. Wir waren alle acht in diesem Raum untergebracht, der höchstens fünf Meter lang und vier Meter breit war. Jedes Mal, wenn ich von draußen hereinkam, schlug mir eine Übelkeit erregende Luft entgegen, und in den vierzehn Jahren, die ich bei Tante Rozika lebte, dauerte es Abend für Abend lange, bis ich mich daran gewöhnt hatte. Noch heute spüre ich dieses eigenartige Gemisch aus menschlichen Ausdünstungen und schalen Küchendüften, aus dem Mief der schimmligen Wände und dem Gestank des Abtritts an der Außenmauer des Zimmers.
Betten gab es bei uns nicht. Wir schliefen auf Stroh, das nachlässig auf den Lehmboden geworfen war. Mit meinen Schuhen brauchte ich mich nicht abzumühen, denn ich ging barfuß. Also kroch ich ins Stroh und zog die Pferdedecke über mich, die Sommer und Winter unser einziger Schutz gegen Kälte war. Nun fühlte ich mich in Sicherheit, aber dafür begann mich von neuem der Hunger zu quälen, den die Angst und die Aufregungen des Herumstreunens bisher unterdrückt hatten. Ich konnte nicht einschlafen.
Plötzlich raschelte es neben mir: »Béla«, flüsterte eine Stimme, »schläfst du?«
Es war Gergely, der bereits in die zweite Klasse ging. »Was ist?«, fragte ich.
»Nichts«, erwiderte er leise. »Hier hast du!«
Er drückte mir eine dicke Scheibe Brot und ein Stückchen Wurst in die Hand. Mein Magen machte einen Freudensprung, aber ich heuchelte Gleichmut. Ich nahm sein Geschenk in Empfang wie ein Finanzbeamter Steuergelder. Nicht einmal Dankeschön sagte ich. Wortlos vertilgte ich alles, legte mich dann bequem zurück und fragte in trockenem Geschäftston: »Wen soll ich verwalken?«
Denn dass mir jemand aus reiner Nächstenliebe ein Stück Brot und Wurst geben könnte, daran dachte ich nicht einmal im Traum.
Dieser Gergely war fast zwei Jahre älter als ich, ließ aber seine »Feinde« trotzdem durch mich verprügeln. Er war unser Kapitalist. Seine Mutter diente in einem Nachbardorf; sie besuchte ihn jeden Sonntag und steckte ihm regelmäßig ein paar Fillér zu. Gergely hatte also Geld wie Heu und konnte sich eine Hilfskraft leisten. Er war ein mageres hellblondes Bürschchen mit mädchenhaften Zügen, ein berüchtigter Schwindler. Unter den Augen hatte er immer dunkle Ringe, und ich wusste auch, warum.
Er antwortete nicht gleich auf meine Frage. Offenbar hatte er mit weitschweifigeren Verhandlungen gerechnet. Schließlich aber rückte er doch mit der Sprache heraus. »Den Adam«, knurrte er. »Dieser rothaarige Hund hat mich wieder von hinten angefallen.«
»Der hat’s gerade nötig, von hinten zu kommen«, sagte ich, »so ein baumlanger Kerl.«
»Lang schon, aber nicht stark.«
»Sieh mal an! Warum hast du denn Angst vor ihm?«
»Na ja, stark ist er wohl, aber nicht sehr.«
»Sehr oder nicht sehr«, erklärte ich entschieden, »für so ein Zipfelchen Wurst werde ich ihn jedenfalls nicht verprügeln.«
»Morgen bekommst du wieder was. Und Sonntag kriege ich auch Geld.«