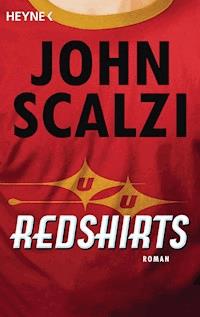10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Das Imperium der Ströme
- Sprache: Deutsch
Der zweite Band der neuen, großen Science-Fiction-Serie »Das Imperium der Ströme«: Die epische Space Opera »Verrat« ist der New-York-Times-Bestseller des preisgekrönten Autors John Scalzi. Im Sternenreich der Menschen rumort es: Der Thron der Imperatox wackelt. Die großen Handelshäuser wollen Grayland lieber früher als später beseitigt sehen, und auch die Kirche steht nicht mehr fraglos hinter ihrem Oberhaupt. Gleichzeitig schreitet der Zerfall des Imperiums weiter voran. Der erste Planet ist bereits von den interstellaren Strömen abgeschnitten, und bald droht auch allen anderen menschlichen Zivilisationen die Isolation – und damit ihr Untergang. Grayland versucht mit allen Mitteln, das Imperium auf die bevorstehende Katastrophe vorzubereiten, doch die Zahl ihrer Verbündeten schrumpft ... Für Leser von Adrian Tchaikovsky, Andreas Brandhorst und Fans von »Dune – Der Wüstenplanet« und »The Expanse«. »Derb, brutal, brillant.« Booklist über »Kollaps. Das Imperium der Ströme I«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
John Scalzi
Verrat - Das Imperium der Ströme 2
Roman
Über dieses Buch
Der zweite Band der neuen, großen Science-Fiction-Serie »Das Imperium der Ströme«: Die epische Space Opera »Verrat« ist der New-York-Times-Bestseller des preisgekrönten Autors John Scalzi.
Im Sternenreich der Menschen rumort es: Der Thron der Imperatox wackelt. Die großen Handelshäuser wollen Grayland lieber früher als später beseitigt sehen, und auch die Kirche steht nicht mehr fraglos hinter ihrem Oberhaupt. Gleichzeitig schreitet der Zerfall des Imperiums weiter voran. Der erste Planet ist bereits von den interstellaren Strömen abgeschnitten, und bald droht auch allen anderen menschlichen Zivilisationen die Isolation – und damit ihr Untergang. Grayland versucht mit allen Mitteln, das Imperium auf die bevorstehende Katastrophe vorzubereiten, doch die Zahl ihrer Verbündeten schrumpft ...
»Derb, brutal, brillant.« Booklist über »Kollaps. Das Imperium der Ströme I«
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
John Scalzi (* 1969) gehört zu den weltweit erfolgreichsten SF-Autoren, seine Bücher wurden in über zwanzig Sprachen übersetzt. Er wurde, unter anderem, mit dem Hugo Award (USA), dem Seiun-Preis (Japan), dem Geffen Award (Israel) und dem Kurd-Laßwitz-Preis (Deutschland) ausgezeichnet.
Weitere Informationen finden Sie auf www.tor-online.de und www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Frankfurt am Main, September 2019
Copyright © 2019 by John Scalzi
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »The Consuming Fire« bei Tor Books, New York.
Published by Arrangement with John Scalzi
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Covergestaltung: Nele Schütz Design, München unter Verwendung eines Motivs von shutterstock/Willyam Bradberry
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490550-1
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Für Meg Frank und Jesi Lipp
Prolog
Jahre später würde Lenson Ornill über die Ironie nachgrübeln, dass es ein ganz bestimmter Ausdruck war, der Anfang und Ende seiner Zeit als religiöser Mensch bezeichnete.
»Ach du Scheiße«, sagte Gonre Ornill zu ihrem Ehemann Tans auf der Brücke ihres Raumschiffs, der We Never Agreed to This.
Tans blickte von seiner Station auf, wo er ihren Sohn Lenson, elf Jahre alt, in einige Feinheiten des Schiffsenergiemanagements einwies. »Was gibt es?«, fragte er.
»Du erinnerst dich an dieses imperiale Schiff, das uns nicht gefolgt ist?«
»Ja.«
»Jetzt folgt es uns.«
Lenson beobachtete, wie sein Vater die Stirn runzelte, das Energiemanagementprogramm von seiner Konsole wischte und den Navigationsbildschirm aufrief. Er zeigte eine komplette Darstellung des Schiffsverkehrs zwischen dem Außenposten Kumasi und der Strommündung, die die Agreed nach Yogyakarta bringen würde, ihr nächstes Ziel nach einer fünfwöchigen Reise. Die meisten Schiffe waren wie die Agreed gewerblich und in Handelsgeschäften unterwegs. Zwei gehörten der Imperialen Flotte an. Eins von diesen, die Oliveer Bransid, hatte soeben einen Kurs eingeschlagen, auf dem sie die Agreed in ungefähr sechs Stunden abfangen würde, kurz bevor sie die Mündung erreichte.
»Ich dachte, wir hätten alles abbezahlt«, sagte Tans zu seiner Frau.
»Wir haben alles abbezahlt«, erwiderte Gonre.
Tans deutete auf seine Konsole, als wollte er sagen: Nun, offensichtlich nicht.
Gonre schüttelte den Kopf. »Wir haben alles abbezahlt«, wiederholte sie.
»Es gibt einen neuen Flottenkommandanten«, warf Genaro Partridge ein, die Kommunikationsoffizierin der Agreed. »Ich habe gehört, wie Samhir in der Messe darüber sprach. Er sagte, er wäre vor ihm gewarnt worden, als wir unsere Fracht luden.«
»Und das erzählen Sie uns erst jetzt?«, sagte Tans zu Partridge.
»Entschuldigung. Es war ein Gespräch in der Messe. Ich dachte, Samhir hätte es Ihnen bereits gesagt.«
»Ich wollte es Ihnen sagen«, antwortete Samhir Ghan, der Zahlmeister des Schiffs, drei Minuten später, als er abgehetzt auf der Brücke erschien. Lenson, der Ghans leicht atemlose Erscheinung betrachtete, wusste, dass sein Vater den Ruf eines umgänglichen Kapitäns hatte, bis er es irgendwann nicht mehr war. Ghan schwebte in Gefahr, aus seinem Vater einen weniger umgänglichen Kapitän zu machen. »Entschuldigung. Wir hatten im Frachtraum zu tun.«
»Dann sagen Sie es mir jetzt.«
»Der neue Flottenkommandant heißt Witt. Allem Anschein nach ein ziemlich übergriffiges Arschloch. Wurde von einem Job auf Nabe abgezogen, weil er mit dem Ehepartner der falschen Person schlief, und versucht nun, dorthin zurückzukehren, indem er hier ›ausputzt‹. Was bedeutet, dass er bewährte Gepflogenheiten über den Haufen wirft, um den Anschein von Effektivität zu erwecken.«
Tans runzelte erneut die Stirn. Als Elfjähriger kannte sich Lenson nicht mit den Details der Geschäfte seiner Eltern aus, aber er wusste zumindest, dass ein großer Teil davon auf ›gute Beziehungen‹ zu den verschiedenen einheimischen und imperialen Gesetzeshütern der Systeme beruhte, zu denen die Agreed reiste. Dies war mit ›bewährten Gepflogenheiten‹ verbunden, was, wie Lenson erst vor kurzem herausgefunden hatte, bedeutete, bestimmten Personen Geld und andere begehrenswerte Dinge zu geben, auf eine Weise, die offenkundig nicht ganz legal war.
Lenson stand all dem neutral gegenüber. Er war zwar jung genug, um zu glauben, dass alles, was seine Eltern taten, grundsätzlich korrekt war, und all die kniffligen Details ihres Metiers langweilten ihn nur, aber er hatte den Eindruck, dass es eine ziemlich komplizierte Vorgehensweise war, um etwas zu erledigen.
»Wer hat Ihnen das erzählt?«, wollte Gonre von Ghan wissen.
»Cybel Takkat«, sagte Ghan. »Mein Pendant an Bord der Phenom. Lenson wusste, dass Ghan sich auf das Schiff That’s a Phenomenal View bezog, mit dem sie sich einen Frachthangar in der Handelsstation von Kumasi teilten. Kleinere Schiffe wie die Agreed und die Phenom mieteten häufig einen gemeinsamen Frachtraum in solchen Stationen, um Geld zu sparen. Gelegentlich ging es während des Verladens recht hektisch zu, und einige Teile des Lagerbestandes des einen Schiffs landeten versehentlich im anderen. Als Lenson jetzt darüber nachdachte, vermutete er, dass auch damit gewisse ›bewährte Gepflogenheiten‹ verbunden waren. »Sie erwähnte, dass einer ihrer Kontakte bei der Flotte die übliche Vergütung ablehnte. Wohl, weil er jetzt zu genau von Witts Leuten beobachtet würde.«
»Diese Information hätten wir schon früher gebrauchen können«, sagte Gonre.
»Entschuldigung«, wiederholte Ghan. »Ich wollte es Ihnen sagen. Ich dachte, Cybel hätte nur gemeint, dass jetzt härter gegen Bestechung durchgegriffen wird und wir es künftig weniger offensichtlich angehen müssen. Nicht, dass die Flotte uns bis zur Strommündung jagen würde.«
Tans blickte zu Partridge hinüber. »Irgendeine Nachricht von diesem Flottenschiff?«
»Sie rufen uns nicht«, sagte Partridge. »Sie sind lediglich auf Abfangkurs gegangen.«
»Wir fliegen nicht mit Vollschub«, sagte Gonre zu ihrem Ehemann. »Wir könnten die Beine in die Hand nehmen.«
Tans schüttelte den Kopf. »Noch nicht.« Er tippte auf seinen Bildschirm, der die Bransid zeigte. »Das ist ein großes Schiff. Sehr viel Masse. Es beschleunigt langsamer, ist aber grundsätzlich schneller als wir. Wenn wir jetzt losrasen, werden sie uns erwischen, bevor wir es bis zur Mündung geschafft haben.«
»Wenn sie uns mit dieser speziellen Fracht erwischen, sind wir alle im Arsch«, sagte Ghan und erinnerte sich dann, wem gegenüber er diese Tatsache äußerte. »Äh, Sir.«
Tans nickte geistesabwesend und ließ die Finger über die Tastatur seiner Konsole tanzen. Lenson erkannte, dass sein Vater Berechnungen für die Agreed und die Bransid anstellte. Den Einzelheiten konnte er nicht folgen, aber er hörte, wie Tans zufrieden brummte und zu ihm aufblickte. »Weißt du, was ich hier mache?«, fragte er Lenson.
»Nein«, sagte Lenson.
»Rate.«
»Du versuchst, dem anderen Schiff zu entkommen.«
»Richtig«, sagte Tans. »Aber weißt du auch, wie? Ich sagte bereits, dass sie uns erwischen werden, wenn wir jetzt beschleunigen.«
»Ich weiß es nicht«, sagte Lenson.
»Komm schon, gib dir Mühe, Len.«
Lenson dachte darüber nach. »Du willst noch warten«, antwortete er schließlich und hoffte, dass sein Vater nicht nach weiteren Details fragte, weil Lenson offen gesagt keine Ahnung hatte, was danach kommen sollte.
»Ja!«, bestätigte Tans. »Wenn wir erst ab einem bestimmten Zeitpunkt mit Vollschub beschleunigen, kann uns das Flottenschiff nicht mehr vor der Strommündung einholen. Und bis zu diesem Zeitpunkt sind es noch …« Er warf einen Blick zu Gonre. »… vier Stunden und sechzehn Minuten.«
»Solange die Bransid nicht vorher schneller wird«, sagte Gonre.
»Genau.«
»Und solange unsere Triebwerke die Belastung eines Vollschubs über drei Stunden aushalten, die wir dann brauchen werden, um die Mündung zu erreichen.«
»Genau.«
»Und solange unsere Stoßfelder aktiv bleiben, damit wir von der konstanten Höchstbeschleunigung nicht zu Brei zerquetscht werden.«
»Genau«, sagte Tans gereizt.
»Und solange sie nicht versuchen, uns eine Rakete ins Auspuffrohr zu rammen.«
»Um Himmels willen, Gonre!«, sagte Tans.
»Wir sollten nicht zu sehr von uns selbst beeindruckt sein, will ich damit sagen«, fasste Gonre zusammen und wandte sich dann an ihren Sohn. »Und du gehst jetzt zurück in deine Kabine. Wir werden hier sehr beschäftigt sein, bis wir die Mündung erreichen.«
»In meiner Kabine gibt es nichts zu tun«, beschwerte sich Lenson.
»Aber sicher. Es heißt: lernen.«
Lenson stöhnte und trottete in Richtung seiner Kabine, die zwar nur die ungefähre Größe einer Besenkammer hatte, aber die zweitluxuriöseste Unterkunft im Schiff war, gleich nach der seiner Eltern, die so groß war wie zwei Besenkammern. In seiner Kabine aktivierte Lenson sein Tablet, doch statt zu lernen, schaute er ein paar Stunden lang Zeichentrickfilme, bis das Programm plötzlich vom Bildschirm verschwand und durch Unterrichtsmaterial ersetzt wurde. Lenson stöhnte erneut und ärgerte sich über seine Mutter, die angeblich beschäftigt war, aber trotzdem die Zeit fand nachzuschauen, was er machte. Widerstrebend begann er damit, seine Religionslektion zu lesen, in der es um Rachela ging, die Prophetin, das erste Oberhaupt und die erste Imperatox der Interdependenz.
Lenson war im Allgemeinen kein toller Schüler, aber Religionslektionen fand er besonders langweilig. Weder er noch seine Eltern waren auf irgendeine Weise religiös, und sie hielten sich genauso wenig an die Grundsätze der Interdependenten Kirche wie an die irgendeiner anderen Konfession. Sie waren keineswegs gegen die Kirche oder irgendwelche anderen Religionen. Lenson wusste, dass einige Besatzungsmitglieder der Agreed ihrem persönlichen Glauben folgten, was seinen Eltern völlig gleichgültig war. Doch die Ornills selbst hatten daran kein Interesse, und sie hatten ihre recht neutrale Apathie in dieser Angelegenheit an ihren Sohn weitergegeben.
Über den Mangel an Religiosität in der Familie Ornill konnte man bestenfalls sagen, dass es in erster Linie die Kirche der Interdependenz war, an der sie nicht teilhatten. Lenson wusste zwar, dass es auch andere Religionen gab, aber er wusste so wenig über sie, dass sich nicht behaupten ließ, er würde sie ablehnen oder ignorieren. Für ihn standen sie gar nicht zur Debatte.
Über die Kirche der Interdependenz hingegen wusste er zumindest ein wenig. Da es die offizielle Religion der Interdependenz war, hatte die Kirche den Vorteil, dass Informationen darüber zur Pflichtlektüre im Unterrichtsmaterial gehörten, das jedes Kind im Imperium während der Schulbildung verwenden musste. Man lernte etwas über die KdI und die Prophetin-Imperatox Rachela, ob man nun daran glaubte oder nicht und ob es einen interessierte oder nicht.
Zum einen das, und außerdem feierten die Ornills den Imperatox-Tag, der auf Rachelas Geburtstag im Standardkalender fiel, genauso wie alle anderen, und zwar als Vorwand, um länger zu schlafen, Geschenke auszutauschen und sich vollzufressen.
In Lensons derzeitigem Unterrichtsmaterial ging es nicht um den Imperatox-Tag oder um Geschenke oder Völlerei, was er bedauerlich fand. Vielmehr ging es um Rachelas Prophezeiungen, ihre Verkündigungen der Zukunft, die für die Verschmelzung der verschiedenen Sternensysteme mit menschlichen Ansiedlungen zu einem einzigen Imperium sorgten, das als die Interdependenz bekannt war, und die dazu beitrugen, die wirtschaftlichen, rechtlichen und sozialen Systeme zu etablieren, auf denen die Interdependenz bis heute basierte, mehr als ein Jahrtausend später.
Lauter Sachen, die stinklangweilig waren, fand Lenson. Nicht nur, weil das Unterrichtsmaterial, das auf Leser im Standardalter von zehn bis zwölf Jahren zugeschnitten war, nicht genauer auf die Prophezeiungen oder ihre Auswirkungen einging, sondern simple Aussagesätze bevorzugte, die das Thema in Form pädagogischer Tatsachen präsentierte, statt als Ausgangspunkt für Interpretationen und Diskussionen (an denen sich Lenson, da er, wie erwähnt, kein allzu toller Schüler war, ohnehin nicht weiter beteiligt hätte). Es lag auch an einem unklaren Gefühl, das Lenson überkam, während er von den Prophezeiungen las, etwas, das er gar nicht in Worte hätte fassen können, selbst wenn er es versucht hätte.
Hätte er es jedoch versucht, wäre es ungefähr auf Folgendes hinausgelaufen: He, weißt du, wenn ein komplettes System sozialer, politischer und wirtschaftlicher Herrschaft auf den vagen, allzu leicht falsch interpretierbaren Worten einer einzigen Person basiert, die göttliche Inspiration für sich beansprucht, ist das wahrscheinlich keine so gute Idee, oder?
Der Grund dafür war, dass Lenson genauso wie seine Eltern vor ihm eher praktisch veranlagt war und sich persönlich kaum mit spirituellen, theologischen oder eschatologischen Angelegenheiten befasste. Und all das hatte in der Tat ein dumpfes Gefühl der Beunruhigung zur Folge, die intellektuelle Version der Erfahrung, in ein Stück Kuchen zu beißen und einen bestimmten Geschmack wahrzunehmen, den man nicht zuordnen konnte, von dem man aber wusste, dass er eigentlich nicht für diesen bestimmten Kuchen gedacht war, worauf das Ganze von einem leckeren Erlebnis in etwas umkippte, das man im Mund hatte und von dem man sich nicht ganz sicher war, ob man es dort haben wollte, während es unanständig gewesen wäre, es auszuspucken, so dass man es einfach schluckte, eine Serviette über den Rest des Kuchens legte und danach irgendwie versuchte, zur Tagesordnung überzugehen.
Als Lenson von den Prophezeiungen las, vermittelte es ihm denselben unangenehmen, nicht näher bestimmbaren Eindruck intellektueller Unzufriedenheit, die sich zu seiner Langeweile gesellte. Also reagierte er auf die einzige logische Weise, zu der er imstande war: Er schlief ein, mit dem Tablet in der Hand. Das war eine ausgezeichnete Lösung, bis die Agreed plötzlich heftig durchgeschüttelt und Lenson von seiner Koje geworfen wurde. Ein tosender Wind rauschte durch seine Kabine und saugte einige Sekunden lang die Luft ab, bis die Kabinentür zuschlug.
Lenson lag auf dem Boden, rang verwirrt um Atem, fragte sich, was gerade geschehen war, und horchte auf mehrere helle Pfeifgeräusche in seiner Kabine. Die Tür war zu, aber die Versiegelung war nicht perfekt. Zeitgleich hatte sich die Lüftung seiner Kabine geschlossen, als die Atmosphäre in die falsche Richtung hindurchgeströmt war, doch auch dort gab es ein paar winzige Stellen, wo die Luft die Versiegelung umging.
Als Kind, das sein ganzes Leben in einem Raumschiff verbracht hatte, musste man Lenson nicht mehr erklären, was diese Pfeifgeräusche bedeuteten. Er ging zur Tür und drückte sie vollständig zu. Damit konnte die Luft in seiner Kabine jetzt nur noch durch die Lüftungsschlitze entweichen, die sich jedoch bedauerlicherweise innerhalb der Schiffswände und somit außerhalb seiner Reichweite befanden.
Sein Tablet pingte, und als Lenson antwortete, war seine Mutter am anderen Ende. Nachdem sie ein paar Sekunden lang erleichtert geweint hatte, weil ihr Sohn noch lebte, teilte sie ihm mit, was geschehen war.
»Diese Arschlöcher haben auf uns geschossen«, sagte sie, und es war das erste Mal, dass Lenson dieses spezielle Schimpfwort aus dem Mund seiner Mutter hörte. »Sie konnten uns nicht einholen, und wir haben nicht auf ihre Funksprüche reagiert. Also haben sie drei Raketen auf uns abgefeuert, kurz bevor wir in den Strom eintraten. Unsere Abwehr konnte sie stoppen, aber eine detonierte zu nahe am Schiff, und Teile der Rakete rissen in deiner Nähe den Rumpf auf. Wir haben diese Bereiche abgeschottet, aber nun haben wir ein Problem.«
»Was für eins?«, fragte Lenson.
»Wir sind jetzt im Strom«, sagte Gonre. »Das bedeutet, dass wir mit der Blase aus Raumzeit rund um das Schiff vorsichtig sein müssen. Wenn wir nicht aufpassen und sie zerreißt, könnte das ganze Schiff in Schwierigkeiten geraten.«
Lenson war klar, dass seine Mutter die Gefahr untertrieb. Der Strom war wie ein Fluss, auf dem ein Raumschiff von einem Sternensystem zum nächsten fuhr, und darin bewegte es sich viel schneller hin und her, als es im Normalraum möglich wäre, wo die Lichtgeschwindigkeit die Höchstgrenze darstellte. Andererseits war der Strom gar nicht wie ein Fluss, sondern ein außerdimensionales Irgendwas, und wenn man ihm direkt ausgesetzt war, würde man einfach verschwinden. Raumschiffe, die im Strom unterwegs waren, mussten eine Energieblase generieren, die ein Stück Raumzeit mitnahm, damit sie innerhalb des Stroms weiterexistieren konnten, und wenn die Blase platzte, löste sich auch alles andere auf, was sich darin befand.
»Also müssen wir auf dem Weg zu dir und bei der Reparatur des Schiffs einfach etwas vorsichtig sein«, sagte Gonre.
»Mom, ich verliere Luft«, sagte Lenson.
Lenson beobachtete, wie sich seine Mutter sehr erfolgreich bemühte, nicht die Beherrschung zu verlieren. »Wie viel?«, fragte sie.
»Jetzt nur noch wenig. Zuerst habe ich eine ganze Menge verloren, aber dann schloss sich die Tür, und ich konnte sie zusätzlich versiegeln. Trotzdem geht immer noch etwas durch die Lüftung raus.«
Gonre wandte sich für einen Moment von ihrem Tablet ab, um jemanden auf der Brücke anzubrüllen. Dann widmete sie sich wieder ihrem Sohn. »Das werden wir zuerst in Ordnung bringen«, sagte sie, »und etwas mehr Luft zu dir umleiten.«
»Wie lange wird das dauern?«, fragte Lenson.
»Nicht lange«, versprach Gonre. »Kannst du bis dahin tapfer sein?«
»Klar«, sagte Lenson.
Doch als die Luft nach zwei Stunden merklich dünner wurde, hörte Lenson auf, tapfer zu sein, und weinte ein wenig. Nach drei Stunden bekam er eine ausgewachsene Panikattacke, und Tans Ornill musste sich alle Mühe geben, seinen Sohn über die Tablet-Verbindung davon abzuhalten, seinen schwindenden Sauerstoffvorrat wegzuhyperventilieren.
Nach vier Stunden geschah es, dass Lenson zum ersten Mal in seinem Leben zur Prophetin Rachela betete.
Nach fünf Stunden kam sie zu Besuch.
Lenson blickte zum Gesicht der Prophetin auf, die ihn mit einem abgeklärten und stillen Lächeln ansah, das jedoch nicht ganz ihre Augen erreichte, in der besten Tradition der religiösen Ikonographie in allen Zeitaltern, der zufolge die Götter und Göttinnen, die Propheten und Prophetinnen bestenfalls ein desinteressiertes Hochziehen der Lippen zustande bringen. Dennoch fühlte sich Lenson davon beruhigt und erwärmt.
»Ich habe Angst«, gestand Lenson der Prophetin. Sie lächelte ihm nur ein wenig mehr zu, was ihn jedoch viel mehr tröstete, als es irgendwelche Worte von ihr vermocht hätten. Damit sagte sie ihm (oder zumindest glaubte er das, und warum sollte er in diesem besonderen Moment daran zweifeln?), dass sie gekommen war, weil er zu ihr gebetet hatte, dass sie nur seinetwegen gekommen war und dass ihre Anwesenheit der Beweis war, dass er, Lenson Ornill, überleben würde, und nicht nur das, sondern dass er zudem für große Dinge bestimmt war.
Es war in diesem Moment, als er still in seiner Kabine lag, zur Prophetin aufschaute und sehr langsam blinzelte, dass Lenson Ornill sein Leben der Kirche der Interdependenz weihte.
Die Prophetin lächelte noch etwas länger auf ihn hinab, als würde sie seine Hingabe an ihre Kirche annehmen.
Genau da klapperte die Lüftung, öffnete sich und flutete die Kabine mit Luft. Lenson Ornill saugte den köstlichen Sauerstoff ein, und auf dem Höhepunkt religiöser Ekstase fiel er in Ohnmacht.
»Das hört sich für mich nach einer lehrbuchmäßigen Hypoxie an«, sagte Tans Ornill später an diesem Abend in der kleinen Krankenstation des Schiffes zu seinem Sohn. Tans war der Erste gewesen, der Lensons Kabine betreten hatte, und sein unmittelbares Entsetzen hatte sich gelegt, als er das Schnarchen seines Sohnes hörte. Nachdem Lenson in der Krankenstation aufgewacht war, hatte er seinen Eltern sofort von seiner wundersamen Besucherin erzählt. »Du hast an Sauerstoffmangel gelitten, und kurz vor dem Angriff hast du etwas über die Prophetin gelesen. Also ist es nachvollziehbar, dass du sie halluziniert hast.«
Lenson blickte zu seinem Vater und seiner Mutter auf, die sich gemeinsam über sein Krankenbett beugten, beide so überaus erleichtert, dass ihr Sohn am Leben war, und erkannte, dass sie die Offenbarung, die er erlebt hatte, niemals anerkennen oder verstehen würden. Also traf er die, wie er in diesem Moment dachte, äußerst reife Entscheidung, seine Eltern aus der Sache herauszuhalten, nickte in scheinbarem Einverständnis mit seinem Vater und ließ zu, dass die beiden das Thema wechselten. Nun ging es um diesen Drecksack Witt, dem sie bittere Rache schworen und der sich, wie Lenson sehr viel später erfuhr, ungefähr ein Jahr nach dem Angriff auf die Agreed unvermutet auf der falschen Seite einer Luftschleuse wiederfand. Gerüchten zufolge hatte Witt erneut mit dem Ehepartner der falschen Person geschlafen, aber Lenson glaubte, es könnten noch andere Faktoren im Spiel gewesen sein, in die seine Eltern auf irgendeine Weise involviert gewesen sein mochten.
Zu dem Zeitpunkt, als Lenson schließlich von Witts unzeitiger Begegnung mit dem kalten, dunklen Vakuum des Weltraums hörte, befand er sich gar nicht mehr an Bord der Agreed, sondern war Student am theologischen Seminar der Universität von Xi’an, der angesehensten Schule der Kirche der Interdependenz. Lensons unkonventionelle Kindheit an Bord eines Raumschiffs erweckte einiges Interesse bei den anderen Seminaristen, aber nur zu Anfang. Was ihn auch später immer wieder zu einem Kuriosum machte, war seine Vision der Prophetin.
»Klingt nach Hypoxie«, erklärte ihm Ned Khlee, einer seiner Mitbewohner im ersten Studienjahr, während einer informellen spätabendlichen Gesprächsrunde und nahm einen Schluck Frado, ein leicht psychotroper Likör, bevor er ihn an Lenson weiterreichte.
»Das war keine Hypoxie«, sagte Lenson, nahm den Frado entgegen und reichte ihn unverzüglich nach rechts weiter.
»Ich meine, du hattest mit Hypoxie zu tun, richtig?«, sagte Sura Jimn, sein anderer Mitbewohner, als die Flasche ihn erreichte. »Dein Schiff hatte ein Leck. Luft ist in den Weltraum entwichen. Deine Kabine hat über Stunden Sauerstoff verloren.«
»Ja«, räumte Lenson ein. »Aber ich glaube nicht, dass ich sie deswegen gesehen habe.«
»Mit ziemlicher Sicherheit«, sagte Khlee und griff an Lenson vorbei, um sich den Frado von Jimn zurückzuholen.
»Also hatte keiner von euch je eine Vision von Rachela? Niemals?«, fragte Lenson verunsichert.
»Nie«, sagte Khlee. »Ich hatte einmal die Halluzination einer Eidechse, aber damals war ich ziemlich high.«
»Das ist nicht dasselbe«, sagte Lenson.
»Es ist ungefähr dasselbe«, sagte Khlee und trank einen weiteren Schluck aus der Flasche. »Noch etwas mehr hiervon, und ich sehe sie vielleicht ein weiteres Mal.«
Lenson entschied, dass es wahrscheinlich keine so gute Idee war, sich seinen Mitbewohnern in dieser speziellen Angelegenheit anzuvertrauen. Und wie sich herausstellte, galt das gleichermaßen für die meisten seiner Kommilitonen am Seminar. Alle waren fast durchweg freundliche, nette, bescheidene und mitfühlende Individuen, und alle zeichneten sich durch praktische und realistische Wesenszüge aus, und keiner von ihnen hatte jemals ekstatische oder religiöse Inbrunst erlebt, weder in Bezug auf Rachela noch auf irgendetwas anderes.
»Die Kirche der Interdependenz ist im Wesentlichen eine praktische Religion«, erklärte ihm Reverend Huna Prin, Lensons Studienbetreuerin, während einer frühen Zusammenkunft, als Lenson entschieden hatte, dass er Rat in dieser Sache benötigte und Prin die einzige Person zu sein schien, die verpflichtet war, seine Probleme ohne unangemessene Vorurteile anzugehen. »An sich neigt sie nicht zum Mystizismus, weder in ihren Glaubensgrundsätzen noch in der täglichen Praxis. Sie steht beispielsweise dem Konfuzianismus viel näher als dem ursprünglichen Christentum.«
»Aber auch Rachela hatte Visionen«, warf Lenson ein und hielt die Taschenbuchausgabe von Kowals Die kommentierten Prophezeiungen von Rachela I. hoch, die er zufällig bei sich hatte und mit der er nun vor seiner Betreuerin herumwedelte.
»In der Tat«, stimmte Prin zu. »Und natürlich geht es bei einer der wichtigsten Diskussionen innerhalb der Kirche um die Natur dieser Visionen. Waren es Visionen, eine tatsächliche Kommunikation mit dem Göttlichen, oder ›Visionen‹« – Lenson spürte die Anführungszeichen vor und hinter dem Wort – »als Parabeln gemeint, die einer geteilten Menschheit helfen sollten, die Notwendigkeit eines neuen ethischen Systems zu verstehen, das sich in einem wesentlich größeren Ausmaß auf Kooperation und Interdependenz konzentriert als je zuvor.«
»Diese Debatten wüten durch die ganze Geschichte der Kirche«, sagte Lenson zustimmend und zitierte einen Primärtext, den er in jüngeren Jahren gelesen hatte. Damals hatte er sich die geistreichen frühen Theologen vorgestellt, wie sie sich im brisanten Kampf um die Seele der Kirche gegenseitig angriffen.
»Nun, wüten ist vermutlich übertrieben«, sagte Prin. »Ich glaube, während des Fünften Kirchentages warf Bischöfin Chen eine Tasse Tee nach Bischof Gianni, aber dabei ging es weniger um die fundamentale Natur der Visionen, sondern eher um die Tatsache, dass Chen ständig von Gianni unterbrochen wurde und sie irgendwann genug davon hatte. Im Großen und Ganzen liefen diese frühen Debatten geordnet ab und befassten sich mit den praktischen Aspekten, wie diese Visionen präsentiert werden sollten. Den frühen Bischöfen war sehr wohl bewusst, dass charismatische Religionen die Neigung zu Schismen und Spaltungen entwickeln, was der grundsätzlichen Idee der Interdependenz entgegensteht.«
»Es gibt doch bestimmt andere, die ähnliche Visionen hatten wie ich«, sagte Lenson zu Prin, und wenn er später an das Gespräch zurückdachte, erinnerte er sich an den flehenden Tonfall der Frage.
»In der Geschichte der Kirche sind hin und wieder Priester und Bischöfe verzeichnet, die behaupteten, religiöse Visionen gehabt zu haben, und die sie als Rechtfertigung für Spaltungsversuche benutzten«, räumte Prin ein. »Die Kirche hat ein Prüfungsverfahren eingerichtet, dem sich jeder Priester oder Bischof, der eine Vision geltend machen will, unterziehen muss.«
»Was passiert dann?«
»Wenn ich mich recht entsinne, werden Priester mit angeblichen Visionen üblicherweise wegen undiagnostizierter psychischer Erkrankungen in medizinische Behandlung überwiesen, um therapiert und in den Dienst zurückgeschickt oder in den Ruhestand versetzt zu werden, falls die Priester weiterhin darauf bestehen.«
Lenson runzelte die Stirn. »Also werden sie von der Kirche für verrückt erklärt.«
»›Verrückt‹ ist ein sehr belasteter Begriff. Man sollte eher davon sprechen, dass die Kirche das praktische Problem erkannt hat, dass Visionen üblicherweise nicht göttlich inspiriert, sondern das Resultat anderer, weniger dramatischer Phänomene sind. Eine solche Erklärung ist besser, als zuzulassen, dass der Zustand fortbesteht, und möglicherweise die Gefahr eines Schismas einzugehen.«
»Aber ich hatte eine Vision, und ich bin psychisch gesund.«
Prin zuckte mit den Schultern. »Klingt für mich nach Hypoxie.«
Lenson wischte das beiseite. »Was passiert, wenn ein Imperatox behauptet, Visionen zu haben?«, wollte er wissen. »Die Imperatoxe sind die faktischen Oberhäupter der Kirche. Müssten auch sie sich einem Prüfungsverfahren unterziehen?«
»Das weiß ich nicht«, räumte Prim ein. »So etwas hat es seit Rachela nicht gegeben.«
»Niemals?«, fragte Lenson skeptisch nach.
»Nach ihrer Amtseinsetzung kümmern sich die Imperatoxe üblicherweise nicht mehr allzu viel um die Kirche«, sagte Prin. »Sie haben ganz andere Sorgen. Genauso wie du, Lenson.«
»Also finden Sie, ich sollte meine Vision einfach auf den Sauerstoffmangel schieben.«
»Ich finde, du solltest deine Vision als Geschenk betrachten«, sagte Prin und hob eine Hand, um ihren Studenten zu beschwichtigen. »Wie auch immer sie zu dir kam, sie inspirierte dich zu einem Leben im Dienst der Kirche, und das ist ein Segen für dich, und es hat das Potential, zu einem Segen für die Kirche zu werden. Sie hat bereits dein Leben verändert, Lenson. Bist du glücklich mit dem Weg, auf den sie dich gebracht hat?«
»Ja«, sagte Lenson und meinte es auch so.
»Na also«, sagte Prin. »Insofern spielt es keine Rolle, ob die Vision göttlich inspiriert oder die Folge einer vorübergehenden Sauerstoffunterversorgung war. Was jedoch eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass du im Anschluss daran – und während du ausreichend mit Sauerstoff versorgt warst – entschieden hast, die Kirche zu deiner Berufung zu erwählen. Also wollen wir beide das Beste daraus machen, ja?«
Lenson beschloss, das Beste daraus zu machen, und stürzte sich in sein Seminarstudium. Einige seiner frühen Wahlfächer befassten sich mit dem Mystizismus der Kirche der Interdependenz, doch paradoxerweise wurde das Thema auf sehr trockene und unspannende Art unterrichtet. Die Herangehensweise an Schriften, die andernfalls vielleicht verboten wären oder als häretisch eingestuft würden, bestand darin, sie nicht zu meiden, sondern die Romantik darin durch Bände voller Kommentare zu ersticken, die offenbar dazu gedacht waren, den Leser einzuschläfern. Lenson las so viel davon, wie er ertragen konnte, und stellte fest, dass sein Interesse schwand, zunächst langsam und mit der Zeit immer schneller.
Zwei Dinge passierten mit Lenson. Das Erste war ganz einfach, dass die alltäglichen Anforderungen seiner theologischen und priesterlichen Ausbildung die Oberhand gewannen. Die Zeit und das Interesse, die er auf die esoterischeren Aspekte der Kirche verwenden konnte – auch wenn sie sich letztlich als recht geringfügig erwiesen –, schrumpften, während er die eher prosaischen Inhalte des Dienstes und des Engagements in der Gemeinschaft bewältigte. In Xi’an und Nabe beobachtete er Priester und Kirchenangestellte und half ihnen bei der Verrichtung ihrer Pflichten, die auch er eines Tages übernehmen würde. Es war schwieriger, sich weiter für die Esoterik der eigenen Religion zu interessieren, wenn man für die Kerzenausstattung eines Gottesdienstes zuständig war.
Das Zweite war, dass sich Lensons grundsätzlich praktisches Wesen, das er durch Natur und Umwelt von seinen Eltern übernommen hatte und das selbst auf dem Höhepunkt seiner religiösen Bekehrung nie ganz unterdrückt worden war, langsam und sicher wieder durchsetzte, befördert durch die weltlicheren Aspekte der Kirche der Interdependenz. Lenson stellte fest, dass ihm die Routinen und die stillen Überwachungsmethoden der Kirche zusagten und er gut damit zurechtkam. Im Laufe seiner Jahre am Seminar verwandelte er sich in den Augen seiner Professoren und Mitstudenten von einem Kuriosum zu einem vorbildlichen Seminaristen, der sich durch sein Potential für einen Aufstieg in der Kirche auszeichnete.
Lenson ließ sich von dieser Welle der Anerkennung und Zuneigung mittragen, auch nach seiner Weihe während seiner ersten Versetzungen nach Bremen (wo seine Eltern sich, nachdem sie gewissenhaft bestimmte Verjährungsfristen abgewartet hatten, praktischerweise zur Ruhe gesetzt hatten), später wieder zurück nach Nabe und schließlich nach Xi’an. Dort wurde er zu gegebener Zeit zum Bischof ernannt und übernahm die Aufgabe, den ärmsten Bürgern der Interdependenz Gottesdienstbesuche zu ermöglichen – eine Arbeit, die mehr Wert auf die praktische als die rein spirituelle Seite der Kirche legte.
Als sich Lenson, nun Bischof Ornill, in der Kirche der Interdependenz weiter hinauf- und tiefer hineinbewegte, wurde das Ereignis, das ihn zum Kircheneintritt angestiftet hatte, die Vision der Prophetin Rachela, in seinen Erinnerungen immer unbedeutender. Aus einem inspirierenden Moment der Bekehrung wurde irgendwann eine stille Quelle seines Glaubens, dann ein seltsames Ereignis, das zu einer Lebensentscheidung geführt hatte, dann eine Geschichte für enge Freunde innerhalb der Kirche, dann eine Anekdote für Gemeindemitglieder und schließlich eine Pointe für Cocktailpartys, wo die Sache pflichtschuldig neuen Bekanntschaften aufgetischt wurde, wenn ein anderer Bischof ihn bat, davon zu erzählen.
»Aber es klingt nach einem wunderschönen Augenblick«, sagte einmal eine junge Frau bei einer solchen Party zu ihm.
»Wahrscheinlich war es nur Hypoxie«, erwiderte er auf charmant bescheidene Art.
In einem kleinen Winkel seines Geistes war sich Lenson bewusst, dass es eine Schande war, dass sein einziger Moment der religiösen Ekstase mit der Zeit als Nebenwirkung eines gestörten Stoffwechselprozesses wegerklärt worden war, nicht weniger durch ihn selbst als durch andere. Doch seine Reaktion auf diesen kleinen Winkel war eine gute, wie er glaubte: Aus einem einzigen fehleingeschätzten Moment des Mystizismus war ein ganzes Leben des praktischen Dienstes in einer Kirche erwachsen, die einen der Grundpfeiler der erfolgreichsten und in vielerlei Hinsicht dauerhaftesten aller menschlichen Zivilisationen bildete. Zyniker würden erwidern, dass die Kirche, die so gut ins imperiale System integriert war, nur ein weiteres Mittel der Herrschaft war, doch Lenson war sich ebenso bewusst, dass sich die Zyniker den Luxus ihres Zynismus gerade wegen der Stabilität des Systems leisten konnten, das sie verspotteten.
Kurz gesagt, es war fast gar nichts Mystisches an Lensons Religion oder später an seinem Glauben. Sein Glaube war sogar stärker als je zuvor. Allerdings war es kein Glaube an die Prophetin Rachela. Es war ein Glaube an die Kirche, die sich von der Prophetin herleitete, eine praktische Kirche, dazu gedacht, durch die Jahrhunderte fortzudauern und dem Imperium zu helfen, das zusammen mit ihr aufwuchs, ebenfalls fortzudauern. Er glaubte an die Kirche der Interdependenz, an ihre Mission, an seine eigene Mission, innerhalb der warmen und soliden und grundsätzlich weltlichen Grenzen ihrer Herrschaft. Er war im Reinen mit seinem praktischen Glauben.
Dieser Bischof Lenson Ornill war es, der gemeinsam mit all den anderen Bischöfen der Kirche der Interdependenz, die sich in der verfügbaren Zeit versammeln ließen, auf dem Gestühl der Kathedrale von Xi’an saß und auf Imperatox Grayland II. wartete, die ungewöhnlicherweise beschlossen hatte, vor der Führungsebene ihrer Kirche zu sprechen, und zwar als Kardinälin von Xi’an und Nabe und somit als tatsächliches Oberhaupt der Kirche der Interdependenz, statt in ihrer etwas prosaischeren Rolle als Imperatox.
Das sorgte für Stirnrunzeln, da seit Menschengedenken kein anderer Imperatox einen solchen Entschluss gefasst hatte. Der letzte, der es getan hatte, war Erint III. gewesen, und zwar vor über dreihundert Standardjahren, und dabei war es um das eher trockene Thema gegangen, die Grenzen der Kirchenbezirke neu zu ziehen, damit die Bistümer besser den jeweiligen Bevölkerungsanteilen entsprachen. Die derzeitigen Diözesen waren in dieser Hinsicht völlig angemessen, darum konnte es sich also nicht handeln.
Gleichermaßen hatte Grayland II., die von den Bischöfen in der Rolle der Imperatox als angenehm untauglich betrachtet wurde, bis zu diesem Zeitpunkt keine besondere Affinität für die Kirche als Instanz an den Tag gelegt. Sie war in letzter Zeit mit einer versuchten Rebellion durch die Familie Nohamapetan und einem theoretischen Problem bezüglich der Stabilität der Ströme innerhalb der Interdependenz beschäftigt gewesen, und nichts davon hatte in direktem Zusammenhang mit der Kirche, ihren Tätigkeiten oder ihrer Mission gestanden.
Die Vorstellung, dass sich die Imperatox in einer kirchlichen Angelegenheit an die Bischöfe wenden könnte, war erstaunlich und, wie manche sagen würden, sogar empörend. Das allgemeine Empfinden der versammelten Bischöfe ging dahin, dass sie bereit waren, sich nachsichtig anzuhören, welchen Träumereien auch immer ihre junge Imperatox anhängen mochte, um anschließend zum formellen Empfang überzugehen, ein paar Häppchen zu sich zu nehmen und sich mit ihr fotografieren zu lassen, worauf man die Veranstaltung dann als kurioses Ereignis und interessantes Gesprächsthema verbuchen würde. Auf jeden Fall erwartete Lenson, dass es so ablaufen würde.
Insofern wurde Bischof Lenson Ornill genauso wie die übrigen Bischöfe der Kirche völlig überrumpelt, als Grayland II., im gewöhnlichen Priestergewand statt in ihrer Kardinalstracht, an die Kanzel trat und ihre Rede folgendermaßen begann: »Vor vielen Jahren hatte unsere Vorfahrin und Vorgängerin Rachela Visionen. Diese wundersamen Visionen brachten unsere Kirche hervor, diese Kirche, dieses Fundament, auf dem unsere gesamte Zivilisation ruht. Meine Brüder und Schwestern, wir haben gute Neuigkeiten. Auch wir hatten Visionen. Wundersame Visionen. Übernatürliche Visionen. Visionen, die über die Mission unserer Kirche sprechen sowie über ihre Rolle in den turbulenten Zeiten, an deren Abgrund wir stehen. Freut euch, Brüder und Schwestern. Unsere Kirche wird zu einer neuen spirituellen Erweckung aufgerufen, zur Rettung der Menschheit in dieser Welt und der nächsten.«
Lenson Ornill nahm die Worte von Grayland II. in sich auf, ihre Intention und ihren Sinn – was sie für die Kirche bedeuteten, wie er sie verstand, für seinen Glauben, wie er ihn entwickelt hatte, und für den Ursprung seiner Hingabe an beide Dinge, in jener kleinen Kabine eingesperrt, um Atem ringend, vor langer, langer Zeit. Und dann, ohne dass er es wollte, äußerte er die Worte, die auf den Punkt brachten, was er in diesem epochalen Augenblick empfand.
»Ach du Scheiße!«, sagte er.
Erster Teil
1
Am Anfang war die Lüge.
Die Lüge bestand darin, dass die Prophetin Rachela, die Gründerin des Heiligen Imperiums der Interdependenten Staaten und der Merkantilen Gilden, Visionen hatte. In diesen Visionen wurde sowohl die Schöpfung als auch die Notwendigkeit jenes weitreichenden Imperiums menschlicher Ansiedlungen prophezeit, das sich über viele Lichtjahre Weltraum erstreckte, lediglich durch das Netz der Ströme verbunden, die metakosmologische Struktur, die Menschen mit Flüssen verglichen. Sie stellten sich einen Strom hauptsächlich deswegen als Fluss vor, weil menschliche Gehirne ursprünglich dazu entwickelt worden waren, ihren Hintern durch die afrikanische Savanne zu schleppen, und sich seitdem kaum verbessert hatten, und deshalb konnten sie buchstäblich nicht begreifen, was es tatsächlich war, also waren es einfach »Flüsse«.
In den sogenannten Prophezeiungen von Rachela war keinerlei mystisches Element enthalten. Die Familie Wu hatte sie frei erfunden. Die Wus, die eine Unternehmensgruppe besaßen und betrieben, darunter Firmen, die Raumschiffe bauten, und andere, die Söldner vermieteten, schauten sich das damalige politische Klima an und beschlossen, dass der Zeitpunkt günstig war, die Kontrolle über die Strommündungen zu erlangen, die Orte, an denen sich die von Menschen begreifliche Raumzeit mit den Strömen verband und es Raumschiffen ermöglichte, in die metaphorischen Flüsse zwischen den Sternen einzutreten und sie wieder zu verlassen. Die Wus verstanden sehr genau, dass die Monopolisierung des Eintreibens von Gebühren ein wesentlich stabileres Geschäftsmodell war, als Dinge zu bauen oder in die Luft zu jagen, je nachdem, welches Unternehmen der Wus man beauftragte. Sie mussten nur eine sinnvolle Begründung finden, warum ausgerechnet sie die Gebühren eintreiben sollten.
Während der Besprechungen der Wus wurden die Prophezeiungen vorgeschlagen, akzeptiert, geschrieben, strukturiert, A/B-getestet und verbessert, bevor man sie Rachela Wu zuschrieb, einem jungen Sprössling der Familie, bereits als wohltätiges Gesicht der Familie Wu öffentlich bekannt und mit einem präzisen Verständnis für Marketing und Publicity ausgestattet. Die Prophezeiungen waren ein Familienprojekt (zumindest das Projekt einiger bedeutender Familienmitglieder – schließlich konnte man nicht jeden einweihen, und zu viele Cousins und Cousinen waren indiskret und taugten lediglich als Trinker und regionale Geschäftsführer), doch es war Rachela, die sie verkaufte.
Die sie wem verkaufte? Der breiten Öffentlichkeit, die von der Idee überzeugt werden musste, dass die entlegenen und unterschiedlichen menschlichen Ansiedlungen unter einem einheitlichen staatlichen Dach zusammengeführt wurden, das im Übrigen von den Wus geleitet werden sollte, die zufällig die Gebühren für interstellare Reisen verwalteten.
Doch selbstverständlich nicht nur Rachela. In jedem Sternensystem stellten die Wus einheimische Politiker und anerkannte Gelehrte ein oder bestachen sie, um die Idee mit politischen und sozialen Argumenten zu bewerben und jene Menschen zu überzeugen, die einen stichhaltigen und logischen Grund brauchten, um auf lokale Eigenständigkeit und Selbstbestimmung zu verzichten und die Herrschaft an eine entstehende politische Vereinigung abzugeben, die bereits als Imperium aufgebaut wurde. Doch für all jene, die entweder nicht so intellektuell eingeschränkt waren oder es schlicht vorzogen, die Idee einer interdependenten Union von einer attraktiven jungen Frau präsentiert zu bekommen, deren harmlose Botschaft von Einigkeit und Frieden sich einfach gut anfühlte – für all jene war die frisch ernannte Prophetin Rachela da.
(Die Wus machten sich nicht die Mühe, die mystische Idee der Interdependenz auch den anderen Familien und großen Konzernen zu verkaufen, zwischen denen sie sich mit ihrer Unternehmensgruppe bewegten. Für jene hatten sie einen anderen Anreiz: Unterstützen Sie den Profitplan der Wus, der sich als altruistische Bemühung um eine Staatsgründung tarnt, und erhalten Sie im Gegenzug ein Monopol auf eine bestimmte langlebige Ware oder Dienstleistung. Faktisch sollten sie ihr gegenwärtiges Geschäftsmodell mit den ärgerlich instabilen Auf-und-ab-Zyklen gegen einen stabilen, vorhersehbaren Ertragsstrom eintauschen, und das für alle Zeiten. Plus einen Rabatt auf die Gebühren, die die Wus auf Reisen durch die Ströme erheben würden. Tatsächlich war es überhaupt kein Rabatt, weil die Wus beabsichtigen, Geld für etwas zu verlangen, das bislang für jeden kostenfrei gewesen war. Doch die Wus gingen zu Recht davon aus, dass diese Familien und Firmen so sehr vom Angebot eines unanfechtbaren Monopols geblendet waren, dass sie nicht protestieren würden. Was sich größtenteils als zutreffend erwies.)
Schließlich benötigten die Wus weniger Zeit als erwartet, um ihren Plan einer Interdependenz durchzuziehen. Innerhalb von zehn Jahren waren die anderen Familien und Unternehmen mit ihren Monopolen und versprochenen Adelstiteln auf Linie, die bezahlten Politiker und Intellektuellen hatten die Argumente geliefert, und die Prophetin Rachela und ihre zügig expandierende Interdependente Kirche versorgten den Rest der Öffentlichkeit. Es gab Verweigerer und Abtrünnige und Rebellionen, die über Jahrzehnte anhielten, aber im Großen und Ganzen hatten die Wus den richtigen Zeitpunkt und das richtige Ziel gewählt. Und was die Querulanten betraf, hatten sie bereits entschieden, dass der Planet Ende, der Außenposten in der neuentworfenen Interdependenz, der am weitesten von allem anderen entfernt war und nur eine einzige Strommündung hatte, die hinein- und hinausging, der offizielle Abladeplatz für alle sein sollte, die sich ihnen in den Weg stellten.
Rachela, die längst das öffentliche und spirituelle Gesicht der Interdependenz war, wurde unter (sorgsam inszeniertem) Beifall zur ersten »Imperatox« gewählt. Dieser geschlechtsneutrale Titel wurde ausgesucht, weil sich in Tests erwiesen hatte, dass er bei fast allen Marktsegmenten als frische, neue und freundliche Variante des »Imperators« Anklang fand.
Diese kompakte und stark gekürzte Geschichte der Gründung der Interdependenz mag den Eindruck erwecken, dass niemand die Lüge in Frage gestellt hätte – dass Milliarden von Menschen unkritisch die Fiktion der Prophezeiungen Rachelas schluckten. Das war keineswegs der Fall. Die Menschen stellten die Lüge durchaus in Frage, genauso wie sie es mit jeder Pop-Spiritualität tun würden, die sich in eine tatsächliche Religion zu verwandeln drohte, und reagierten beunruhigt, als sie immer mehr Zuspruch, Anhänger und Anerkennung fand. Auch waren die zeitgenössischen Beobachter keinesfalls blind für die Machenschaften der Familie Wu, während diese nach imperialer Macht strebte. All das stand im Zentrum händeringender Leitartikel, Nachrichtensendungen und gelegentlich eingebrachter Gesetzentwürfe.
Was die Familie Wu ihnen voraushatte, war Organisation, Geld und Verbündete in Gestalt der anderen nunmehr adligen Familien. Die Errichtung des Heiligen Imperiums der Interdependenten Staaten und der Merkantilen Gilden war ein heranstürmender Moschusochse, und die skeptischen Beobachter waren ein Mückenschwarm. Keiner fügte dem anderen nennenswerten Schaden zu, und am Ende gab es ein Imperium.
Ein anderer Grund, warum die Lüge funktionierte, war der Umstand, dass die Prophetin-Imperatox Rachela unmittelbar nach der Gründung der Interdependenz erklärte, ihre Visionen und Prophezeiungen wären im Wesentlichen und fürs Erste vorbei. Sie übertrug alle amtliche Macht über die Verwaltung der Interdependenten Kirche dem Erzbischof von Xi’an und einem Komitee aus Bischöfen, die einen guten Deal erkannten, wenn sie einen sahen. Sie bauten schnell eine Organisation auf, die den explizit spirituellen Aspekt der Kirche beiseiteschob, der nunmehr das Gewürz der neuen Religion und nicht ihr Hauptgericht war.
Mit anderen Worten, weder Rachela noch die Kirche reizten das spirituelle Blatt während der kritischen frühen Jahre der Interdependenz, als sich das Imperium zwangsläufig im fragilsten Zustand befand, allzu sehr aus. Rachelas imperiale Nachfolger, von denen keiner den »prophetischen« Teil ihres Titels übernahm, folgten größtenteils ihrem Vorbild und hielten sich aus Kirchenangelegenheiten heraus, abgesehen von ausschließlich zeremoniellen Auftritten – zur großen Erleichterung der Kirche, bis diese, während die Jahrhunderte vergingen, gar nichts anderes mehr erwartete.
Selbstverständlich gestand die Kirche niemals die Lüge von Rachelas Visionen und Prophezeiungen ein. Warum hätte sie das auch tun sollen? Zum einen hatten weder Rachela noch die Familie Wu außerhalb von Familienkonferenzen jemals ausdrücklich darüber gesprochen, dass die spirituelle Seite der Interdependenten Kirche komplett erfunden war. Niemand würde von Rachelas Nachfolgern erwarten, ob als Imperatox oder Kirchenoberhaupt, dass sie es zugaben oder auch nur öffentlich ihren Argwohn äußerten und damit ihre eigene Autorität untergruben. Danach ging es nur noch darum, abzuwarten, bis die Visionen und Prophezeiungen zur Doktrin wurden.
Zum anderen gingen Rachelas Vorhersagen größtenteils in Erfüllung. Das war ein Beleg für die Tatsache, dass die »Prophezeiung« der Interdependenz zwar umfangreich, aber auch praktisch umsetzbar war, wenn man den Ehrgeiz, das Geld und ein gewisses Maß an Rücksichtslosigkeit mitbrachte, worüber die Familie Wu hinreichend verfügte. Rachelas Prophezeiungen verlangten von niemandem, seine Lebensweise in den kleinen Dingen des Alltags zu ändern. Sie forderte einen lediglich dazu auf, das Regierungssystem zu wechseln, damit jene, die ganz oben standen, noch mehr Macht und Kontrolle und Geld erhielten als zuvor. Und wie sich herausstellte, war das gar nicht allzu viel verlangt.
Und schließlich ergab es sich, dass die Familie Wu damit keineswegs falschgelegen hatte. Die Menschheit war weit verstreut, und von allen Sternensystemen, die von den Strömen berührt wurden, hatte, soweit bekannt war, nur eines einen Planeten, auf dem menschliches Leben im Freien existieren konnte, und das war Ende. Alle Menschen in all den anderen Systemen lebten in Habitaten auf Planeten oder Monden oder im Weltraum schwebend, alle waren in ihrer Isolation schrecklich verwundbar, keins war in der Lage, sämtliche Rohstoffe zu gewinnen, die zum Überleben notwendig waren, oder alle Dinge zu produzieren, die sie zum Leben benötigten. Die Menschheit brauchte die Interdependenz, um zu überleben.
Ob sie die Interdependenz als politische, soziale und religiöse Struktur brauchte, um diese Interdependenz zu verwirklichen, war äußerst fraglich, doch ein Jahrtausend später war es zu einer müßigen Frage geworden. Die Familie Wu hatte sich einen Weg ausgedacht, langfristig und nachhaltig politische und gesellschaftliche Macht für sich zu gewinnen, ihn dann eingeschlagen und dabei eine Lüge als Werkzeug benutzt, um alle anderen auf diesem Weg mitzunehmen. Zufällig hatten die Wus gleichzeitig ein System erschaffen, in dem die meisten Menschen ein angenehmes Leben führen konnten, ohne dass die existentielle Furcht vor der Isolation, der Entropie, dem unvermeidlichen schrecklichen Kollaps der Gesellschaft und dem Tod von allen, die ihnen lieb waren, in jeder Sekunde jedes Tages über ihren Köpfen hing.
Die Lüge funktionierte für alle sehr gut – mehr oder weniger. Das Ganze war phantastisch für die Wus, ziemlich toll für den Rest der adligen Klasse und im Allgemeinen durchaus in Ordnung für die meisten anderen Leute. Wenn eine Lüge negative Konsequenzen hat, stößt sie auf Ablehnung. Aber wenn nicht? Dann machen die Leute weiter, und irgendwann ist die Lüge als Lüge vergessen oder in diesem Fall als Grundlage der Religion kodifiziert und zu etwas Hübscherem und Netterem geschliffen und poliert.
Rachelas Visionen und Prophezeiungen waren eine Lüge, die exakt so funktionierte, wie sie geplant war. Was bedeutete, dass Visionen und Prophezeiungen als Doktrin weiterhin ein Grundpfeiler der Interdependenten Kirche waren – allerdings nur solche, die von Propheten stammten. Es hatte eine Prophetin gegeben, und diese war zur ersten Imperatox geworden. Es gab keine Kirchendoktrin, die es anderen Imperatoxen untersagte, prophetische Gaben für sich zu beanspruchen. Die Kirchendoktrin legte sogar nahe, dass die visionäre Macht der Prophezeiung ein Geburtsrecht der Imperatoxe war. Schließlich konnten alle achtundachtzig ihre Herkunft auf die Prophetin-Imperatox Rachela höchstpersönlich zurückführen, die nicht nur die Mutter der Interdependenz, sondern auch von sieben Kindern gewesen war, einschließlich Drillingen.
Jede und jeder Imperatox war laut Doktrin in der Lage, Visionen zu haben und Prophezeiungen auszusprechen. Nur dass mit Ausnahme von Rachela selbst keine oder keiner von ihnen es jemals tat.
Zumindest bis jetzt.
Im Vorzimmer des Konferenzraums des Exekutivkomitees, dem Raum, der im Imperialen Palast jener Gruppe überlassen worden war, von der sie die Vorsitzende war, hielt Erzbischöfin Gunda Korbijn abrupt inne, womit sie ihren Assistenten überraschte, und senkte den Kopf.
»Euer Eminenz?«, sagte ihr Assistent, ein junger Priester namens Ubes Ici.
Korbijn hob eine Hand, um die Frage abzuwehren, und stand einen Moment lang da, während sie ihre Gedanken sammelte.
»Früher war es einfacher«, sagte sie leise.
Dann lächelte sie wehmütig. Sie hatte beabsichtigt, ein kleines Gebet zu sprechen, in dem sie um Geduld und Gelassenheit angesichts dessen bitten wollte, was voraussichtlich ein langer Tag und Monat wurde und möglicherweise sogar der Rest ihrer Karriere. Doch am Ende kam etwas völlig anderes heraus.
Tja, eigentlich musste man dieser Tage ständig mit so was rechnen.
»Haben Sie etwas gesagt, Euer Eminenz?«, fragte Ici.
»Nur zu mir selbst, Ubes«, antwortete Korbijn.
Der junge Priester nickte und wies dann auf die Tür des Konferenzraums. »Die übrigen Mitglieder des Exekutivkomitees sind bereits da. Abgesehen von der Imperatox, versteht sich. Sie wird zum vereinbarten Zeitpunkt eintreffen.«
»Vielen Dank«, sagte Korbijn und schaute zur Tür.
»Alles in Ordnung?«, fragte Ici, als er dem Blick seiner Chefin folgte. Ici war respektvoll, aber Korbijn wusste, dass er nicht dumm war. Er war sich der jüngsten Ereignisse sehr wohl bewusst. Sie konnten ihm nicht entgangen sein. Weder ihm noch sonst jemandem. Sie hatten die Kirche erschüttert.
»Mir geht es gut«, versicherte ihm Korbijn. Sie machte sich auf den Weg zur Tür, und Ici begleitete sie, doch dann hob Korbijn erneut die Hand. »Ausschließlich Komiteemitglieder bei dieser Konferenz«, sagte sie und sah die ungestellte Frage in Icis Gesicht. »Bei dieser Besprechung dürfte es zu einem offenen Austausch von Ansichten kommen, und es ist das Beste, wenn das alles in diesem Raum bleibt.«
»Ein offener Austausch von Ansichten«, wiederholte Ici skeptisch.
»Ja«, bestätigte Korbijn. »Das ist der Euphemismus, mit dem ich mich im Moment begnügen werde.«
Ici runzelte die Stirn, dann verbeugte er sich und trat zur Seite.
Korbijn blickte auf, brachte ein Gebet dar, diesmal wirklich, und drängte sich dann durch die Türhälften in den Konferenzraum.
Der Raum war groß und übertrieben verziert, wie es nur ein Zimmer im Imperialen Palast sein konnte, vollgestopft mit Krempel, der sich im Laufe von Jahrhunderten durch Kunstgeschenke, Mäzenatentum und Erwerbungen von Imperatoxen mit mehr Geld als Geschmack angesammelt hatte. Entlang der gegenüberliegenden Wand floss ein Wandbild, das einige der großen historischen Gestalten darstellte, die im Laufe der Jahre dem Exekutivkomitee angehört hatten. Es stammte von dem Künstler Lambert, der den Hintergrund im Stil der italienischen Renaissance und die Personen davor im frühen Realismus der Interdependenz gemalt hatte. Seit ihren ersten Tagen im Komitee hatte Korbijn das Werk als entsetzliches Sammelsurium und die heldenhafte Zeichnung der Figuren als fast schon amüsante Übertreibung der Bedeutung des Exekutivkomitees empfunden, wenn man bedachte, wie es im Alltag arbeitete.
Niemand wird dieses Komitee zum Motiv eines Wandbildes machen