
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dressler Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Grit Poppes gefeierter Jugendroman Verraten. Ost-Berlin 1986, wenige Jahre vor dem Fall der Berliner Mauer: Nach dem Tod seiner Mutter sperrt man Sebastian in das Jugendheim Bad Freienwalde, das einem Gefängnis gleicht. Ausgerechnet sein Vater, der die Familie vor Jahren verlassen hat, holt ihn dort raus. Doch dann taucht ein Mann in Sebastians Schule auf. Der Fremde ist ein Mitarbeiter der Stasi, der Geheimpolizei der DDR. Er behauptet, sein Vater sei ein Staatsfeind und fordert Sebastian auf, für ihn zu arbeiten. Sebastian hat keine Wahl. Entweder er bespitzelt seinen Vater oder er riskiert, dass die Stasi auch ihn in die Mangel nimmt, ihn zurück ins Heim schickt – und womöglich Katja findet. Katja, in die sich Sebastian ein bisschen verliebt hat und die er versteckt hält, weil sie aus einem Jugendwerkhof geflüchtet ist. Wenn sie auffliegt, ist auch er geliefert. Nach Weggesperrt schreibt Grit Poppe erneut über Jugend und Umerziehung in der DDR. - Authentischer, packender Roman über ein fast vergessenes Kapitel der DDR-Geschichte – eindrücklich, schonungslos und informativ. - Hinten im Buch findest du Auszüge aus original Stasi-Akten und ein Zeitzeugen-Interview, das unter die Haut geht. - Verraten wurde 2021 mit dem Deutsch-Französischen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet und war im gleichen Jahr für den Deutschen Jugendliteraturpreis nominiert. - Als Schullektüre ab Klasse 8 empfohlen. - Auch von der Presse gefeiert: großartig geschrieben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Ost-Berlin 1986: Nach dem Tod seiner Mutter sperrt man Sebastian in ein Heim, das einem Gefängnis gleicht. Ausgerechnet sein Vater, der die Familie vor Jahren verlassen hat, holt ihn dort raus. Doch irgendetwas stimmt nicht mit ihm. Als plötzlich ein Mann in Sebastians Schule auftaucht, erfährt er es: Sein Vater ist ein Staatsfeind. Und der Fremde ein Mitarbeiter der Stasi, der Geheimpolizei der DDR. Er will, dass Sebastian für ihn arbeitet. Sebastian bleibt keine Wahl. Entweder er bespitzelt seinen Vater oder er riskiert, dass die Stasi auch ihn in die Mangel nimmt – und Katja findet. Katja, die Sebastian versteckt, weil sie aus dem Heim geflüchtet ist. Wenn sie auffliegt, ist er geliefert.
Verloren
Sebastian
Er sah die Frau, die ihm in dem nichtssagenden Büro gegenübersaß, ungläubig an.
»In ein Heim? Ich geh in kein Heim!«
Sebastians Hände ballten sich, beinahe hätte er auf den Tisch geschlagen. Aber er biss sich auf die Unterlippe, versuchte, ruhig zu bleiben. Er konnte keinen Ärger mit dieser komischen Tante, die jetzt offenbar über sein Schicksal bestimmte, gebrauchen.
Frau Pfeifer hob die Augenbrauen und wirkte erstaunt wie eine Eule, der die beinahe gefangene Maus davonlief.
»Tut mir leid, Sebastian. Es ist alles entschieden. Du bist sechzehn und damit minderjährig. Die Organe der Jugendhilfe haben die Heimunterbringung für dich festgelegt.« Sie seufzte und sah ihn bedauernd an. Aber ihre Stimme klang falsch. Alles kam ihm hier falsch vor. Auf dem Tisch stand eine hässliche braune Vase mit Plastikblumen. Falsch. An der Wand hing ein ausgeblichener Druck: eine junge Frau und ein junger Mann, die am Strand blöde vor sich hin glotzten. Falsch. Das gequälte Lächeln dieser Fürsorgerin. Falsch! Und irgendwie unheimlich.
»Selbstverständlich werde ich dich zu der Einrichtung begleiten. Es ist eine Durchgangsstation. Nicht weit weg von hier. Dort bleibst du nur so lange, bis man einen geeigneten Heimplatz für dich gefunden hat.«
Sebastian schluckte. Irgendetwas steckte in seiner Kehle, er hustete. Japste nach Luft – wie vor ein paar Tagen im Schwimmbad, als er sich am Chlorwasser verschluckt hatte. Ein kleiner, unangenehmer Augenblick. Danach war er einfach weiter die Bahnen geschwommen, ruhig, schnell, gleichmäßig, so als wäre nichts gewesen. Das schien ihm plötzlich ewig lange her. »Ich hab doch gar nichts mit. Keine Sachen, meine ich … Schultasche … Bücher … Nicht mal ’ne Zahnbürste«, stammelte er.
Die Fürsorgerin, die er erst vor einer halben Stunde kennengelernt hatte, redete weiter auf ihn ein, als wäre er einfach nur ein bisschen begriffsstutzig, als wäre er fünf und nicht sechzehn. »Alles Notwendige bekommst du vor Ort. Um den Rest kümmere ich mich. Und du kannst mir schreiben, wenn du ein Problem hast«, verstand er, als er in der Hustenattacke versuchte, Luft zu holen.
Die Alte hatte doch wohl einen Sprung in der Schüssel! Warum sollte er ins Heim? Wieso sollte er jemandem schreiben, den er nicht kannte?
»Was ist mit meiner Oma?«, krächzte er und griff sich an den Hals. »Sie wird damit nicht einverstanden sein.«
»Wie du weißt, lebt deine Großmutter jetzt in einem Feierabendheim. Auch für sie wird gesorgt.«
»Ich hab mich um sie gesorgt und sie sich um mich! Es war alles in Ordnung!«, brachte er heraus.
»Seit dem Tod deiner Mutter hat deine Großmutter Probleme mit dem Herzen, steht in deiner Akte. Vor Kurzem hatte sie sogar einen Herzinfarkt. Du kannst für sie nicht die Verantwortung übernehmen und sie schon gar nicht für dich. Es geht ihr gut, wo sie jetzt ist. Wir lassen niemanden allein, der Hilfe benötigt. Und du benötigst eine Unterbringung und Menschen, die sich um dich kümmern. Das ist dir doch klar?«
Automatisch schüttelte er den Kopf. »Ich kann mich um mich selbst kümmern«, murmelte er. Aber die Frau achtete gar nicht mehr auf ihn. Hastig kritzelte sie etwas auf ein Stück Papier, heftete das Blatt ab und schlug die Akte zu.
Wieso war seine Akte eigentlich so dick? Woher kannte die Fürsorgerin ihn überhaupt? Hatte er sie nicht schon einmal gesehen? Bloß wo?
Er schielte auf den grauen Aktendeckel, auf dem nicht viel zu lesen war: Sebastian Haberkamp. Sein Name. Sonst nichts.
Frau Pfeifer blickte auf ihre Armbanduhr. »Es ist Zeit«, sagte sie und schob das Dokument in ihre Tasche. »Gehen wir.«
Abrupt erhob sie sich und blickte auf ihn herab. Wieder hatte Sebastian das Gefühl, dass da ein eulenartiger Greifvogel über ihm schwebte.
»Worauf wartest du?« Sie klang ehrlich verblüfft. Als wäre jetzt alles klar. Und er nur zu blöd, es zu begreifen.
»Warum soll ich in ein Heim?«, fragte er. »Was ist mit meiner Schule?«
»Das wirst du dann schon sehen.« Ungeduldig klimperte sie mit dem Autoschlüssel in der Hand herum. »Wir müssen jetzt wirklich los. Sie warten bereits auf dich. Außerdem hab ich seit fünf Minuten Feierabend. Heute ist Freitag.« Es klang wie ein Vorwurf. Als wäre das irgendwie alles seine Schuld.
Sebastian verschränkte die Arme. Er blieb sitzen. »Was ist, wenn ich mich weigere?«
»Du kannst dich nicht weigern. Du bist minderjährig«, antwortete Frau Pfeifer. »Und Waise.«
»Waise?« Wie kam sie denn darauf? Irgendwie musste er sofort an Oliver Twist denken. Den Roman hatte ihm seine Mutter einmal zu Weihnachten geschenkt. Ein Buch aus dem Antiquariat, mit verblasster goldener Schrift auf dem Einband. Wenn er die Seiten aufschlug, strömte ihm ein Geruch von Walnüssen entgegen.
»Bin ich nicht!«, schoss es aus ihm heraus. »Ich bin keine Waise! Ich habe einen Vater! Steht das nicht in Ihrer schlauen Akte?«
Die Fürsorgerin seufzte. »Doch. Aber … Junge! … Mal ehrlich: Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen?«
Sebastian schwieg. Er konnte sich nicht daran erinnern.
»Er war doch noch nicht einmal bei der Beerdigung gewesen.«
Einen Moment lang war es still in dem Raum. Dann fiel Sebastian ein, wo er die Alte schon einmal wahrgenommen hatte: Auf dem Friedhof! Beim Begräbnis seiner Mutter.
Also stand er schon seit diesem Tag unter ihrer Beobachtung?
»Na gut.« Frau Pfeifer setzte sich noch einmal hin, zerrte die Akte aus ihrer Tasche, schlug sie auf und notierte etwas. »Ich werde schauen, was sich machen lässt. Vielleicht gibt es ja eine Chance, dass du zu deinem Vater kannst. Gleich am Montag schreibe ich an das Fachorgan Volksbildung, Referat Jugendhilfe, versprochen. Aber in das Durchgangsheim musst du trotzdem. Und zwar sofort!«
Katja
Ich war wieder mal auf der Flucht, stand am Rand der Straße und streckte den Daumen in den Wind. Er klebte noch vom Eis, das ich in der Kaufhalle geklaut hatte. Der winzige, mit einem Vornamen bedruckte Plastiklöffel, den ich mit dem Becher mitgehen ließ, klemmte zwischen meinen Lippen, und ich lutschte darauf herum. Dabei war der letzte Hauch von Vanille längst verflogen. »Gabi« stand auf dem Löffelstiel. Noch nie hatte ich in einem Laden einen Löffel entdeckt, auf dem mein Name stand: Katja.
Normalerweise unterließ ich das Klauen im Konsum, in Kaufhallen oder Drogerien. Es war viel zu gefährlich und außerdem albern und peinlich beim Diebstahl eines Lollis, einer Bambina oder einer Tüte Knusperflocken – meiner Lieblingssüßigkeit, die es sowieso selten gab – erwischt zu werden. Aber es ließ sich nicht immer vermeiden, wenn man nicht verhungern wollte.
Ich kaute auf dem Löffel herum, bis er zerbrach. Die Spitze bohrte sich in meine Zunge, ich schmeckte Blut und spuckte aus. Spuckte die beiden Plastikteilchen samt Gabi in den Straßengraben. Gab mir Mühe, sofort wieder zu lächeln und so harmlos wie möglich auszusehen. Niemand durfte auch nur ahnen, dass ich ausgerissen war.
Entwichen – wie das dämliche Wort der Erzieher dafür lautete.
Vielleicht war der Begriff aber auch gar nicht so dämlich. Ich fühlte mich wie ein Flaschengeist, der sich endlich, nach Tausenden von Jahren, aus seinem gläsernen Gefängnis befreien konnte. Entwichen traf meinen Zustand also eigentlich ganz gut.
Ich stieg in das erstbeste Auto, das hielt. Ein grauer Trabant. Er ratterte wie aus dem letzten Loch. Es qualmte und stank aus dem Auspuffrohr. Egal. Hauptsache weg.
Kaum hatte ich mich auf die Rückbank gequetscht, zog ich die Tür des Wagens auch schon mit einem Rums zu.
Der Fahrer zuckte zusammen. »He, sachte, Mädel.«
Ich lächelte unschuldig in seine missbilligende Miene hinein. Er tat ja gerade so, als wäre sein Schrottauto eine Luxuskarre.
»’tschuldigung!«
Nervös warf ich einen Blick zurück. Die Scheibe war mit Dreck beschmiert, ich konnte kaum durchgucken. Perfekt! Niemand würde mich sehen.
Trotzdem zog ich vorsichtshalber die Schultern ein, duckte mich hinter die Ablage, auf der eine Rolle Klopapier stand – nicht besonders glaubwürdig verborgen unter einer gehäkelten Mütze. Ich würde wohl nie verstehen, warum Autobesitzer das machten. Warum sie sich Toilettenpapier mit Hut in ihr Fahrzeug stellten. Aber egal, das bunte Bommelding gab mir zusätzlichen Sichtschutz. Hoffte ich jedenfalls. Das Gefühl, verfolgt zu werden, blieb. Die Angst, dass sie mich sofort wieder erwischten. Ich war eben kein Geist.
Der Fahrer, ein hutloser Mann um die fünfzig, mit Schnurrbart und Halbglatze, warf mir einen misstrauischen Blick zu. Sah er mir etwa an, dass ich gerade aus dem Jugendwerkhof türmte? Ich war nachts aus dem Fenster gestiegen, kurz vor Tagesanbruch, im Nachthemd; war im Halbdunkel auf Zehenspitzen davongeschlichen.
Die Klamotten, die ich jetzt trug, stammten von einer Wäscheleine und sahen sicher mehr als merkwürdig aus: ein kariertes Männerhemd, eine rote Oma-Strickjacke und eine schlabbrige Trainingshose. Wenigstens roch alles frisch gewaschen.
»Warum setzt du dich nicht neben mich, Mädel?«, brummte er. »Ich beiße nicht.«
Aber ich beiße vielleicht, dachte ich. Wenn du weiter blöde Fragen stellst.
»Danke, dass Sie mich mitnehmen«, sagte ich höflich und gab mir noch mehr Mühe, harmlos auszusehen.
»Du hast da was …«, sagte er und fasste sich an seine unrasierte Wange. Dann streckte er seine Wurstfinger nach mir aus.
Instinktiv zuckte ich zurück, rieb hastig in meinem Gesicht herum. »Nur ein bisschen Eis«, murmelte ich. »Vanilleeis.«
»Zum Frühstück?« Er lachte. »Wie heißt du eigentlich?«
»Gabi. Gabi Müller.«
»Und wo soll’s hingehen, Gabi Müller?«
»Ich will nach Berlin. Verwandte besuchen«, behauptete ich. »Oma und Opa.«
»Ich kann dich bis Oranienburg mitnehmen.«
»Super! Von da aus kann ich ja die S-Bahn nehmen, stimmt’s?«
»So ist es, Gabi Müller.« Seine Stimme klang spöttisch, leicht gereizt, als würde er mir meinen Namen und meine fade Story nicht glauben. Aber wir fuhren, bewegten uns immer weiter weg. Nur darauf kam es an.
»Darf ich?«, fragte ich, und ohne eine Antwort abzuwarten, fummelte ich an dem Autoradio herum, bis ich einen Westsender fand. RIAS Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Es knackste und rauschte und nach einer Weile hörte ich den Sonderzug nach Pankow. Ich sang leise mit.
Der Fahrer grinste. »Udo fetzt, was?«
Ich nickte und traute mich, das Radio lauter zu stellen. Mal eben nach Ost-Berlin, echote es in mir.
Mein Plan war tatsächlich, in Berlin unterzutauchen. Schließlich war die Stadt riesig, man fiel nicht so schnell auf, wenn man sich herumtrieb. Andererseits gab es wohl kaum eine Stadt in der DDR mit mehr Polizei.
Zum Abschied winkte ich dem Fahrer zu, und der davonzuckelnde verdreckte Trabi kam mir plötzlich vor wie ein kleiner, altersschwacher grauer Drache, der sich in seinen eigenen Dampf hüllte.
Als ich am nächsten Morgen in meinem Unterschlupf in der Nähe des Oranienburger Bahnhofs aufwachte, fiel ein staubiger Streifen Licht durch das Dachbodenfenster. Es war ruhig, nur der Krach der Straße war zu hören. Es musste Sonnabend sein. Ich schloss noch einmal die Augen, lauschte dem Verkehrslärm, der sich in den Straßen verteilte. Autos rumpelten auf dem Kopfsteinpflaster. Die S-Bahn ratterte über die Gleise.
Ich richtete mich auf und ließ das Ding los, das ich im Arm gehalten hatte: einen zerlumpten Teddy, der nur noch ein Auge besaß. Anstelle des anderen hing ein schwarzer Faden aus seinem Gesicht. Er sah traurig zu mir hoch. Der Anblick machte mich wütend. Ich konnte es mir nicht leisten, Kind zu sein.
Das Davonlaufen war Arbeit. Das Sich-Verstecken war Arbeit. Das Untertauchen und Niemandem-Auffallen.
Mein Magen knurrte vor Hunger. Früher oder später musste ich raus, um nach Essen zu suchen. Musste wie ein wildes Tier auf Beutefang gehen. Oder sollte ich gleich in die S-Bahn Richtung Berlin steigen und nach Pankow oder zur Schönhauser oder Prenzlauer Allee fahren?
Meine Mutter wohnte in Bernau, nur ein paar Kilometer von Oranienburg entfernt. Sie lebte ihr Leben ohne mich. Die S-Bahn hielt sogar in der Kleinstadt. Endhaltestelle. Im Grunde ein Katzensprung. Doch selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht zu ihr, oder? Bei meiner Mutter suchten sie immer zuerst. Aber eigentlich wollte ich sie auch nicht wiedersehen. Seit dem letzten Streit war ich für sie gestorben und sie für mich. Keine gute Basis für ein fröhliches Familientreffen. Was suchte ich also hier? So nah an meinem Zuhause?
Ich sah zum Fenster. Der Regen hatte den Dreck nur noch mehr verschmiert.
Die Scheibe schob ich mit der rostigen Stange hoch, die an der Luke befestigt war. Bei dem Quietschgeräusch zuckte ich zusammen. Wartete einen Moment. Lauschte. Es blieb alles ruhig. Ich angelte nach den Porzellanschälchen, die ich gestern in einem alten Koffer gefunden hatte. Sie waren bis obenhin mit Regenwasser gefüllt.
»Wusst’ ich’s doch«, murmelte ich zufrieden.
Ich deckte den Tisch. Sechs Schälchen Wasser ganz allein für mich und ein Rest Brot aus der Werkhofküche. Es knirschte zwischen meinen Zähnen, als ich davon abbiss.
Es schmeckte scheiße. Doch es war besser als nichts.
Die Schälchen sahen aus wie Puppengeschirr. Meine kleine Schwester würde sich bestimmt darüber freuen.
Sebastian
Frau Pfeifer saß stumm am Steuer ihres Skodas. Sie fuhren aus der Stadt, ließen Eberswalde, den Ort, in dem er nach dem Tod seiner Mutter mit seiner Oma gelebt hatte, hinter sich. Während der Fahrt blickte die Fürsorgerin nicht einmal zu ihm, richtete kein einziges Wort an ihn. Ihr Schweigen kam ihm zunehmend bedrohlich vor. Was ging hier vor sich?
»Wo fahren wir hin?«, fragte er schließlich.
Frau Pfeifer antwortete nicht. Sie starrte durch die Scheibe auf die Straße. Ihr Gesicht wirkte wie eingefroren.
Sebastian fühlte allmählich Panik in sich aufsteigen. Was bedeutete Durchgangs-Heim? Durchgang wohin? Und wieso redete die Frau nicht mehr mit ihm?
Was er sah, als der Wagen nach etwa einer halben Stunde stoppte, war die Farbe Grau. Ein graues Tor versperrte ihm die Sicht. Ein Gefängnistor. Aus Metall, eingerahmt von einer hohen Mauer. Das Licht reflektierte in komischen Zacken, die wie Zähne aus der Mauer ragten. Waren das Glasscherben?
»Was soll das?«, entfuhr es ihm. Es fühlte sich unwirklich an, in diesem Auto zu sitzen. Mit dieser komischen Frau. Vor einem Eisentormonster, das jetzt sein Maul aufriss und ihm plötzlich wahnsinnige Angst machte. Das musste doch ein Irrtum sein?
»Wir sind da.« Ihre Stimme klang matt. Ausdruckslos. Sie sah ihn nicht an. »Durchgangsheim Bad Freienwalde. Wenn du Glück hast, bleibst du nicht lange.«
»Wenn ich Glück habe?«
Der Wagen fuhr auf den Hof. Er saß in der Falle. Das ist doch nie im Leben ein Heim!, schrie etwas in ihm. Doch er brachte keinen Ton heraus.
Als er aus dem Auto stieg, wurde ihm schwindlig. Wieso waren die Fenster alle vergittert? Wo war er hier bloß gelandet? Und wieso?
Langsam hob er den Kopf.
Hinter den Metallstäben eines der Fenster nahm er blasse Gesichter wahr. Täuschte er sich oder waren das … Kindergesichter?
Er konnte sie nicht genau erkennen, aber es kam ihm vor, als wären sie nicht älter als neun oder zehn. Weshalb … warum sperrte man sie ein?
Was zum Teufel blühte ihm hier?
Katja
Mein Mund war ganz trocken, als ich vor ihrer Wohnungstür stand.
Eine Klingel gab es immer noch nicht. Also hob ich die Faust und zögerte. Und wenn die Polizei schon drinnen auf mich wartete? Es wäre nicht das erste Mal.
Die Tür öffnete sich wie von selbst. Sie war nur angelehnt.
Meine Mutter wohnte in einem maroden Altbau, der seit Jahren abgerissen werden sollte. Die Fachwerkhäuser in der Nachbarschaft hatte man einst dem Erdboden gleichgemacht und Neubauten errichtet. Aus irgendeinem Grund war dieses Haus vergessen worden.
Ich hörte Stimmen, Musik – kam das von den Nachbarn? Oder hatte sie Besuch?
Automatisch lief ich in die Küche, in der es verführerisch nach Gewürzen und Kaffee roch. Kein Rondo oder Mocca Fix Gold. Es duftete nach frisch gebrühtem West-Kaffee.
»Mama?«, fragte ich leise. »Hier ist deine Tochter. Katja. Kennst du mich noch?«
Dann rief ich sie. Meine Stimme klang heiser, halb erstickt. Ich räusperte mich, nahm mich zusammen, versuchte es noch einmal. Doch es blieb ein halb garer, beschissener Hilferuf.
Ich war siebzehn. Wieso jaulte ich wie ein Kleinkind nach Mama?
Eine fette Fliege surrte um meine Nase, als wollte sie mich verspotten.
Auf dem Tisch lagen ein paar verschrumpelte Äpfel. Ich dachte daran, wieder zu verschwinden. Wieso war ich überhaupt hergekommen?
Ich wollte an den Äpfeln vorbeigehen, aber schon hielt ich zwei in den Händen; schnupperte an ihnen. Ich aß hastig, nur die Stiele blieben übrig.
Dann nahm ich die Geräusche deutlicher wahr. Sie kamen aus dem Wohnzimmer. Irgendwer unterhielt sich da, eine Frau lachte, Bässe wummerten. Was sollte ich tun? Gleich kehrtmachen und verschwinden? Die Küchentür öffnete sich.
Meine Mutter blieb kurz stehen, als sie mich entdeckte, fixierte mich mit ihrem Wildkatzenblick. In ihrem Gesicht lagen Mascara-Schatten, ihre Augen blitzten auf. Sie schien nicht sonderlich überrascht.
Ihre knallrot geschminkten Lippen verzogen sich wie in Zeitlupe zu einem Lächeln. Ich war einigermaßen erleichtert, dass sie nicht versuchte, mich sofort wieder loszuwerden, mich rausschmiss. Unseren Krach schien sie vergessen zu haben.
Als wäre ich noch klein, nahm sie mich an die Hand und zog mich mit sich.
Die Leute in dem verqualmten Raum kannte ich nicht. Sie machten für uns Platz auf dem durchgesessenen Sofa. Wir versanken wie in einer staubigen Wolke. Mir war es recht und ich lehnte mich erschöpft an meine Mutter und trank von ihrem West-Kaffee. Im Jugendwerkhof gab es nur Muckefuck, eine braune Plörre, die nie richtig warm war und nach nichts schmeckte.
Sandra tauchte von irgendwoher auf. Meine kleine Schwester. Sie fiel mir um den Hals, umarmte mich heftig, schob sich ein Kissen unter den Hintern, damit sie besser an mich heranreichte. »Wohnst du jetzt wieder hier?«
Mir dämmerte, dass ich wegen ihr hergekommen war. Wegen ihrer stürmisch klebrigen Küsse auf meine verschwitzte Wange.
»Endlich bist du wieder da! Du bleibst doch, oder?«
»Ich hab was für dich, Süße«, sagte ich und zauberte die Porzellanschälchen aus meinem Beutel. Meine Schwester küsste mich, und ich spürte ihre Schnoddernase warm und feucht an meiner Wange, und es war das Beste, was ich seit Langem gefühlt hatte.
Meine Mutter ging in die Küche und machte Stullen für uns – mit Salami, Zwiebeln, Ketchup, überbacken mit Käse. Auch lauwarme Würstchen brachte sie mit. Wir aßen, ich trank Wein wie die Erwachsenen, rauchte von ihren Zigaretten. Sandra kauerte neben mir, sie hatte Ketchup im Haar, das wie Blut aussah. Sie rülpste und es roch nach Wiener.
»Klar kannst du bleiben«, sagte meine Mutter endlich. »Zumindest bis morgen. Aber … auf Dauer verstecken geht nicht. Du kannst dir ja denken, wieso.«
Sie machte ein ernstes Gesicht, und ich nickte ihr genauso ernst zu, obwohl ich mir gar nichts denken konnte. Außer, dass ich für die nächsten paar Stunden gerettet war. Vielleicht.
»Danke.«
»Ich kann dir nicht garantieren, dass … na, du weißt schon: Horch und Guck, die Bullen …« Sie blickte mir so tief in die Augen, dass mir schwindlig davon wurde. »Hast du eigentlich meine Briefe bekommen?«, fragte sie.
»Einen«, antwortete ich. »Zu Weihnachten. Zwei Wochen danach.«
»Es war nicht einfach, herauszufinden, wo du überhaupt steckst.«
Sie erzählte mir eine umständliche Geschichte von einer Bekannten, die eine Bekannte hatte, die bei der Jugendhilfe arbeitete.
»Du warst so mir nichts, dir nichts weg. Von einem Tag auf den anderen verschwunden. Ich fragte nach, wo du abgeblieben bist. Aber sie sagten mir nur, dass ich das schon noch erfahren würde. Ein Brief von offizieller Stelle sei unterwegs. Warst du die ganze Zeit im Jugendwerkhof?«
Ich nickte, zitterte, trank schnell den Rotwein, verplemperte die Hälfte, goss mir neuen ein.
»Wieso bist du von da abgehauen?«
Ich holte tief Luft. »Willst du das wirklich wissen?«
Sie nickte. Und sah dabei aus, als hätte sie sich den Magen verdorben.
Also schön. Wo sollte ich anfangen? Was sollte ich ihr erzählen, von dem, was im Jugendwerkhof normal war – und draußen so unglaublich klang?
»Die haben mich ans Bett gebunden, wegen ’nem Ekzem angeblich, damit ich mich nicht kratze. An Händen und an Füßen, tagelang, nächtelang … Und später dann: Bunker, immer wieder Bunker, für nichts und wieder nichts. Nur weil ich am Fließband nicht die Norm schaffte, mir die Schrauben aus der Hand rutschten und einfach weg waren, spurlos verschwanden. Diebstahl von Volkseigentum, Sabotage, nennen sie das. Oder weil ich mal weggelaufen bin. Und wenn die mich jetzt erwischen, geht’s auch wieder ab in die Arrestzelle.«
Meine Mutter starrte mich eine Weile sprachlos an. Glaubte sie mir? Oder dachte sie, ich spinne?
»Wie können die nur so mit dir umgehen?«, fragte sie schließlich entsetzt.
Ich sah Tränen in ihren Augen schimmern und war verwundert. Was gab es da zu heulen? Es war nur eine Geschichte, wenn auch eine wahre. Ein Arrestraum war nur ein Raum, in dem man in sich selbst schlüpfte – oder auch aus sich heraus –, je nachdem. Die Seele konnte sich klein machen in dir drin oder auch den Körper verlassen und weit über dir schweben.
Meine Mutter wischte sich über ihr Gesicht. Offenbar waren ihr die Tränen peinlich.
Ich hatte im Werkhof kaum an sie gedacht. Und wenn, fiel mir nur unser dämlicher Streit wieder ein. Worum war es gegangen? Dass ich kam und ging, wie es mir passte? Dass ich die Schule schwänzte? Keine Ahnung. Es war mir egal.
»Lernt ihr im Jugendwerkhof auch irgendwas?«, wollte ein pickliger Typ wissen und legte seinen dürren nackten Arm um die Schulter meiner Mutter.
»Ja, na klar, wie man Gitter auseinanderbiegt und Zäune durchtrennt«, behauptete ich und lachte.
»Ich meinte eigentlich was Berufliches. Eine Ausbildung oder so.«
Ich lachte lauter. War das etwa ihr Neuer? Vor lauter Lachen verschüttete ich etwas Wein. Schade drum. Ich stellte das Glas vorsichtig ab und leckte meine Hand wie eine Katze.
Der picklige Typ guckte komisch, irgendwie angeekelt. Sein Schweißgeruch stieg mir in die Nase.
Ich hielt seinem Blick stand. Verpasste ihm eine Ohrfeige nur mit Augenkontakt. So etwas lernte man im Jugendwerkhof.
Kleine Warnung an dich: Solltest du mich verpfeifen, wirst du es bereuen.
Er senkte die Lider, wurde sogar rot.
Gewonnen. Jedenfalls für den Moment.
»Sie wird schon noch eine vernünftige Ausbildung machen«, sagte meine Mutter, sprang auf, lief zum Fenster und kam zurück, fummelte nervös in ihren Haaren herum. »Wir helfen dir, was zu finden. Wirst sehen …«
Es klopfte an der Tür.
Ich sah, wie sie zusammenzuckte, sah die Frage, die ihr ins Gesicht geschrieben stand: Wann würden sie kommen? Wann würden die Herren von der Volkspolizei mich abholen?
Vermutlich jeden Augenblick.
Sebastian
»Ich wünsche dir viel Glück auf deinem weiteren Lebensweg«, sagte Frau Pfeifer hölzern mit gesenktem Blick. »Setz dich einfach und warte, bis dich jemand holen kommt.«
Sie wandte sich von ihm ab, ohne ihm die Hand zu geben, und zog die Tür hinter sich zu.
Sebastian befand sich auf einmal allein in dem schmucklosen Aufenthaltsraum, in den ihn die Fürsorgerin gebracht hatte. Einfache Holzstühle standen an Sprelacarttischen, auf denen sich nichts befand und die nach altem modrigem Putzlappen rochen. Neben dem üblichen Porträt des Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker hing ein kleines Regal mit zwei leeren Brettern an der Wand. Die braun gelb gemusterten Gardinen waren zugezogen. Abgesehen von einem Kachelofen, der ein wenig Gemütlichkeit verströmte, wirkte alles billig und schäbig – als wäre das Nichts hier zu Hause und hätte sich in jedem Winkel, in jeder Ritze ausgebreitet.
Sebastian lief unruhig in dem Raum auf und ab. Er wollte sich nicht setzen. Er wollte hier nicht sein!
Entschlossen ging er Richtung Ausgang und drückte die Klinke hinunter. Aber die Tür blieb zu. Sie hatten ihn also eingeschlossen.
»Verdammt! So ein Mist!« Suchend blickte er sich um, lief nervös umher und zog die Gardinen auf.
Das Fenster war vergittert. Du willst abhauen? Denk gar nicht erst drüber nach. Keine Chance, schien es ihm zu sagen.
Was sollte er hier? Wieso wurde er hierherverfrachtet? In einen Knast? Man sperrte doch keine Kinder in ein Gefängnis?
Es war niemand da, den er fragen konnte.
Er versuchte es mit Klopfen: erst vorsichtig, zaghaft, dann so kräftig, dass ihm seine Knöchel wehtaten.
Nichts passierte.
Ein eigenartiges Zittern schüttelte ihn. Sebastian lief zum Ofen und legte eine Hand auf eine Kachel. Sie strahlte etwas Wärme aus. Er schob sich so dicht wie möglich an die Kacheln heran. Tastete nach der wärmsten Stelle, behielt die Tür dabei im Auge. Es war fast so, als würde er den Ofen umarmen.
Das Bibbern hörte allmählich auf. Doch dafür musste er jetzt pinkeln.
Wieder klopfte er an die Tür. »Hallo? Hört mich jemand? Es ist … so langsam … dringend! Ich … ich muss mal!«
Er kam sich etwas dämlich vor, als er sich so reden hörte. Aber anscheinend nahm ihn ja sowieso niemand wahr.
Sebastian beugte sich zum Schlüsselloch hinunter und versuchte hindurchzuspähen. Doch er konnte nichts erkennen. Wahrscheinlich steckte der Schlüssel von der anderen Seite. Frau Pfeifer musste sehr leise zugeschlossen haben. Er sah sie auf Zehenspitzen davonschleichen wie ein Dieb.
Wieso tauchte niemand auf? »Haben Sie vor lauter Fürsorge vergessen, jemandem Bescheid zu sagen?«, murmelte er vor sich hin.
Was wenn keiner kam?
In einer Ecke des Zimmers stand ein weißer Metallkübel mit Deckel. Bisher hatte er den übersehen. Immerhin – das Ding wäre vielleicht eine Lösung für sein Problem.
Aber er konnte doch nicht einfach in den Mülleimer pinkeln.
Wenn ihn jemand dabei erwischte, würde das sicher Ärger geben. Mal abgesehen davon, dass die Tür aufgehen könnte, während er gerade …
Er wollte sich das lieber nicht so genau vorstellen.
Ratlos lief er ein paar Runden um die Tische herum, klopfte an die Tür, lauschte. Von irgendwo erklangen Kinderstimmen. Schließlich lehnte er sich erneut an den Ofen, als wäre der ein Verbündeter. Unwillkürlich dachte er an seine Großmutter, die abends immer in einem Ohrensessel neben dem grünen Kachelofen gesessen, gelesen, Kreuzworträtsel gelöst oder ihre Lieblingssendung in dem alten, vor sich hin knarrenden Radio gehört hatte. Wie ging es ihr jetzt? Hockte sie auch in einem hässlichen Raum? In einem Wartezimmer, in dem sie warten musste, ohne zu wissen, worauf?
War sie allein?
Gab es da jemanden, der sich um sie kümmerte?
Sebastian seufzte tief. Mehr als nach allem anderen sehnte er sich nach einer Toilette.
Im nächsten Moment stand er vor dem Kübel und nahm den Deckel ab. Bis auf eine Pfütze war der Eimer leer. Der Geruch, der ihm entgegenschlug, ließ ihn ein Stück zurückweichen. Uringestank mischte sich mit etwas anderem, Chemischem. Er musste an das Schwimmbad denken, in dem er vor ein paar Tagen unbekümmert seine Bahnen gezogen hatte. Aus dem Kübel roch es beißend nach Chlor. Das Ding hier war eindeutig ein etwas zu groß geratener Pisspott. Seine Oma besaß eine kleine Variante davon, die allerdings eher wie eine Suppenschüssel aussah und die sie nur nachts benutzte, wenn der Weg zum Gemeinschaftsklo, das sich ein Stockwerk tiefer befand, zu weit war.
Sebastian warf einen schnellen Blick zur Tür und beeilte sich jetzt. Den Deckel hielt er wie einen Schild als Sichtschutz vor sich, während er pinkelte. Hoffentlich ging nichts daneben. Gerade als er fertig war, drehte sich der Schlüssel im Schloss.
Der Deckel schepperte, als er ihn auf den Eimer legte. Scheiße, war das peinlich!
Automatisch sah er sich nach einem Waschbecken um. Es gab keins.
»Du bist also der Neue«, brummte ein Mann, der einen braunen Armee-Trainingsanzug mit gelb-roten Seitenstreifen trug. Er schob sich ein Stück in den Raum herein und betrachtete ihn griesgrämig. »Mitkommen!«
Einen Moment spürte Sebastian seinen Widerwillen in sich aufflackern. Wie redete der Typ denn mit ihm?
Doch nach kurzem Zögern folgte er dem Fremden.
Bei jedem Schritt des Mannes klirrte der Schlüsselbund, den er in der Hand trug. Als machte er das mit Absicht. Eine kleine Willkommensmelodie für den Neuzugang.
Dabei blickte er sich kaum nach Sebastian um und brummte etwas Unverständliches vor sich hin.
Sebastian glaubte, die Wörter Freitag und Feierabend zu verstehen, und atmete den Geruch von kaltem Zigarettenrauch ein, der den Mann umgab.
Sie gingen eine Treppe hinauf, bis sie ein Gitter erreichten, das die eine Etage von der anderen trennte. Mit einer ungeduldig zackigen Bewegung schloss der Erwachsene auf, schob Sebastian vor sich her, schloss wieder zu. Was wurde das hier?
Er sah einen Gang mit Zellentüren, erblickte ein Mädchen in einem blauen Arbeitsanzug und mit Kopftuch, das auf den Knien hockend den Gang wischte. Sebastian hätte ihr gern einen Blick zugeworfen, doch sie hob den Kopf nicht.
Wieder standen sie vor einem Gitter, wieder wurde erst auf- und dann zugeschlossen. Wieder wurde er weitergeschoben – wie ein Paket, das irgendwo abgeliefert werden musste. Die nächste Etage, die nächsten wuchtigen Metalltüren, ausgestattet mit dicken Riegeln und Türspion.
Sebastian bewegte sich mechanisch, als würde er durch seinen eigenen Albtraum laufen, stumm, mit schwitzenden Händen, klopfendem Herzen.
Wieso war er hier? Wo führte der Typ ihn hin?
»Ausziehen!«, sagte der Fremde barsch, als sie einen Dachboden betraten.
»Was?« Sebastian starrte ihn verdattert an.
»Das heißt: Wie bitte, Herr Schuhmacher!«
»Wie bitte … Herr …«
»Nun los, Bursche! Mach! Ein bisschen dalli! Sonst lernst du mich gleich mal nicht so freundlich kennen!«
Nicht so freundlich? Sebastian hätte beinahe losgelacht. Der Kerl war die Unfreundlichkeit in Person. Langsam fragte er sich, ob das eine Verwechslung war. Vielleicht hatte die Jugendfürsorgerin ihn in das falsche Haus gebracht?
»Beeil dich, ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Deine persönlichen Dinge bleiben hier oben. Du bekommst Heimkleidung. So wie alle anderen auch.«
Langsam, mit steifen Fingern, knöpfte er seine Jacke auf, streifte sie von den Schultern, schlüpfte aus der Jeans, zerrte sich den Pullover über den Kopf. Nach kurzem Zögern entledigte er sich der Unterwäsche. Hilflos versuchte er, sich zu bedecken, blickte auf seine nackten Füße hinab und zog die Zehen ein. Es war kalt in dem Raum, aber er fühlte, dass ihm die Hitze ins Gesicht stieg.
»Uhr ab! Hast du was mit den Ohren? Ich sagte: alle persönlichen Dinge!«, brummte der Mann in einem Ton, als würde er Sebastian für etwas zurückgeblieben halten.
Das Zittern schüttelte ihn wieder. Zitternd kam er auch dieser Aufforderung nach.
»Gib her!«
Sebastian legte die Uhr in die ausgestreckte Hand, ohne den Blick zu heben. Die Unterwäsche, die er erhielt, war grau und lapprig. Aber wenigstens war er nicht mehr ganz nackt. Der Stoff des Arbeitsanzuges, den er in rasendem Tempo anzog, kratzte auf seiner Haut. Die Schuhe waren zu groß und es fehlten die Schnürsenkel.
»Wie soll ich in den Dingern laufen?«, fragte er oder fragte die Wut in ihm, die sich Luft verschaffen musste.
»Klappe halten, mitkommen!«, blaffte Herr Schuhmacher.
Wieder liefen sie durch das gesamte Gebäude, von Gitter zu Gitter.
Metall klapperte auf Metall, der Schlüssel klimperte, es krachte, wenn die Tür zuflog.
Diesmal ging es abwärts, bis ganz nach unten.
In einem finster feuchten Raum ragten ein paar Duschköpfe aus der Decke.
Schon wieder musste er sich ausziehen. Er erhielt ein Stück Kernseife, dann verpasste ihm der Mann einen leichten Stoß. Sebastian stolperte ein Stück weiter und einen Moment später spürte er die Wassertropfen wie kleine harte Schläge, wie Hagelkörner, die auf ihn einprasselten.
Seifte sich auf Befehl ein. Hielt den Kopf gesenkt. Ließ die Prozedur über sich ergehen.
Als Sebastian in eine Zelle gesperrt wurde, dachte er das erste Mal seit langer Zeit an seine Mutter.
Er saß bewegungslos auf einem Holzschemel, starrte die Wand an und sah nach einer Weile Bilder aufflackern – wie von einem Super-Acht-Amateurfilm. Die Aufnahmen wirkten erst unscharf, verwackelt, doch im nächsten Moment blickte er in die klaren Augen seiner Mutter, sah, wie sie sich ihr wuschelig lockiges Haar aus dem Gesicht strich. Sie lächelte ihm zu, winkte kurz, als käme er gerade nach Hause, erschöpft vom Fußballtraining, hungrig, durstig – wie in der Zeit, in der sie noch gesund gewesen war. Sie würde sich um ihn kümmern, schnell ein paar gekochte Kartoffeln von gestern in die Pfanne werfen, ein paar Eier und Zwiebeln dazu. Es kam ihm vor, als könnte er das Brutzeln hören, das Gebratene riechen. Seine Mutter blickte ihn an und wollte wissen, wie das Training gewesen sei. Er versuchte zu antworten, sie etwas zu fragen. Es gab da eine wichtige Frage, die er ihr stellen musste. Doch er brachte keinen Ton heraus.
Das Bild verblasste. Schnell. Zu schnell. Der Film riss.
Jemand schob eine Matratze in den Raum und warf einen Schlafanzug und eine Decke hinterher.
»Hocker!«, brüllte eine Stimme.
»Wie bitte?«
»Den Hocker raus! Der kommt nachts vor die Tür. Da legst du deine Sachen drauf. Aber ordentlich! Schlafanzug anziehen, Nachtruhe!«
Zum dritten Mal an diesem Tag musste er sich ausziehen. Vor einem Fremden.
Mit zitternden Fingern legte er die Kleidung auf den Hocker.
»Ordentlich hab ich gesagt! Das heißt: Päckchen bauen. Na, das üben wir noch.«
Die Tür donnerte zu, das Licht wurde gelöscht.
Sebastian stand wie erstarrt lange in der Finsternis und hörte seinen Atem, der wie etwas Schweres aus ihm herauskam.
Er war allein.
Mutterseelenallein.
So allein war er noch nie gewesen.
Katja
Meine Mutter wollte mir diesmal wirklich helfen. Das beteuerte sie jedenfalls immer wieder. Und wirkte so hilflos, dass es wehtat. Dauernd redete sie von der Lehrstelle, die sie mir besorgen wollte. Dabei war klar, dass ich mit dem Stempel Jugendwerkhof im SV-Ausweis kaum eine Chance auf eine Ausbildung hatte. Und als eine, die sich der Umerziehung zur sozialistischen Persönlichkeit immer wieder entzog, konnte ich das sowieso vergessen. Außerdem wollte ich Kapitänin werden und zur See fahren, die Welt sehen, Abenteuer erleben.
Meine Mutter ließ mich ausschlafen und ihren Kühlschrank plündern. Nicht dass es da viel zu plündern gab. Zu Mittag aßen wir gemeinsam kaltes Knoblauchbrot, das noch von ihrer Party übrig war, und tranken starken schwarzen Kaffee, der sich wie eine raue Schicht auf meine Zunge legte.
»Erzähl mir, was passiert ist, wie es dir in den letzten Monaten ergangen ist, erzähl mir alles«, sagte meine Mutter. Aber ich redete wenig, und Sandra, die sich an mich gekuschelt hatte und meinen Arm ganz fest hielt, sprach gar nicht.
Wir hockten einfach nur da.
Auf dem Tisch saßen Sandras Puppen, und zwischen ihren Beinen standen die Porzellanschälchen, die mit angebrannten, gezuckerten Haferflocken gefüllt waren.
Mir fiel auf, dass meine kleine Schwester sehr dünn war, noch dünner als früher.
»Du musst mehr essen«, flüsterte ich in ihr Ohr. »Du magst doch Eierkuchen?«
»Wenn du rauskommst, werde ich dir eine ordentliche Lehrstelle besorgen«, sagte meine Mutter wieder. »Du wirst schon sehen, wir kriegen das alles wieder auf die Reihe. Ich habe Kontakte und Peri hat sogar Beziehungen.«
»Wer?«
Meine Mutter kicherte plötzlich. »Peri. Also eigentlich Peter.« Sie zeigte stolz auf ihren pickligen Freund, der mit einer Flasche Bier vor dem Fernseher hockte und auf den leeren Bildschirm glotzte. »Du wirst schon sehen, wenn du entlassen wirst, kümmern wir uns um dich. Er hat einen Trabi, er kann dich rumfahren zu den Bewerbungsgesprächen und so.«
Ich nickte – jedenfalls wippte ich mit dem Kopf, obwohl es mir vorkam, als hätte ich Watte in den Ohren. Ihre Stimme kam als Gesäusel bei mir an.
Das Einzige, was ich deutlich hörte, war: Wenn du rauskommst, wenn du entlassen wirst …
Sie wollte mich also nicht hierbehalten. Das war viel zu riskant. Ihr musste klar sein, dass ich nicht freiwillig zurückgehen würde. Sie rechnete also damit, dass ich wieder geschnappt wurde. Das konnte ich ihr kaum verübeln. Ich rechnete ja selbst damit.
Als ich die Nase voll hatte, erhob ich mich, zog Sandra in die Küche, rührte hastig einen Teig zusammen und machte mir nicht die Mühe, die Splitter der Eierschale herauszufischen. Ich entzündete das Gas mit einem Streichholz, ließ die Schachtel in meiner Hosentasche verschwinden und klatschte etwas Margarine und schließlich den Teig in die Pfanne. »Siehst du? Es ist nicht schwer. Das schaffst du auch selbst.«
Als der erste Eierkuchen fertig war, griff Sandra in eine Dose und schaufelte Zucker auf ihn – als würde sie im Buddelkasten mit Sand spielen. Dann ließ sie sich von mir füttern, albern kichernd, immer wieder den Mund weit aufreißend, ein hungriges Vögelchen. In ihrem Gesicht klebten die Zuckerkörnchen wie Schnee.
Zum Abschied schenkte meine Mutter mir einen Fünf-Mark-Schein, ein paar schrumplige Äpfel und zwei trockene Brötchen, die schon etwas ledrig waren.
»Was willst du eigentlich mal werden?«, fragte sie noch, irgendwie verlegen. »Damit wir schon mal nach einer Lehrstelle für dich suchen können, mein ich.«
»Kosmonautin«, sagte ich spontan, ohne jede Erklärung.
Sie nickte, als wäre das ein normaler Berufswunsch, gab mir die Hand, wie jemandem, den sie nur flüchtig kannte.
Sandra fiel mir wieder um den Hals und drückte zu. Sie weinte ein bisschen und Rotz lief aus ihrer Nase.
»Wir sehen uns wieder«, sagte ich ihr und kämpfte gegen die Tränen an, die plötzlich in meine Augen schossen. »Wir sehen uns bestimmt bald wieder.«
Sandra heulte jetzt richtig. Ich war wohl eine schlechte Lügnerin.
Gerade als ich schluchzend die Treppe hinunterlief und einen Blick aus dem Etagenfenster warf, sah ich sie kommen: Der Streifenwagen in Grün-Weiß bog beinahe gemächlich um die Ecke. Wie es schien, hielten die Volkspolizisten direkt vor dem Haus. Viel Mühe gaben sie sich ja nicht gerade.
Wenn ich wollte, könnte ich zu ihnen gehen, mir Handschellen anlegen und mich gemütlich ins nächstgelegene Durchgangsheim verfrachten lassen. Ruck, zuck wäre ich da, müsste mir keine Sorgen machen, wo ich die kommende Nacht schlief.
Aber ich wollte nicht. Jede Minute in Freiheit war ein verdammt kostbares Geschenk. Und das nächste D-Heim von hier war in Bad Freienwalde, das kannte ich schon zur Genüge. Man konnte von dort nicht entkommen, es gab so gut wie keine Chance. Beim Gedanken an die Gitter, die Mauer und die finsteren Zellen wurde mir übel.
Es tat mir nur leid, dass die Polizisten jetzt bei meiner Mutter klingeln und ihr dumme Fragen stellen würden. Wie kam das wohl bei Sandra an? Hoffentlich verplapperte sie sich nicht.
Ich hätte nicht herkommen sollen. Es war dumm von mir.
So schnell ich konnte, rannte ich die Stufen hinab. Zum Glück war die Kellertür nicht abgeschlossen. Ich drückte sie hinter mir zu, lauschte eine Sekunde. Mit einem gewagten Sprung tauchte ich in das Dunkel. Schlich den Gang entlang. Setzte über einen Haufen Kohlen hinweg, zog vorbei an den Holzbretterpforten, stolperte über einen Bierkasten, sodass die leeren Flaschen mir in die Nerven klirrten. Schob einen Augenblick später das Tor zum Hinterhof auf.
Ich blickte mich kurz um. Der Hof sah aus wie immer. Ein kleiner Junge spielte Ball mit sich selbst.
Ich stieg auf eine Mülltonne, aus der Rauch von noch glühender Asche quoll. Die verbeulte Tonne wackelte unter mir, und ich jonglierte einen Moment auf ihr, drehte mich zu dem Kind um und machte »Pscht« und legte den Zeigefinger auf meine Lippen.
Der Junge grinste mich verständnislos an.
Ich kletterte auf die Mauer und sprang ohne Rücksicht auf Verluste auf die andere Seite.
Davonzulaufen war nicht schwer. Nur wusste ich wieder mal nicht, wohin.
Also rannte ich Richtung Bahnhof.
Der nächste Fehler, wie sich bald herausstellen sollte.
Sebastian
Als er erwachte, fühlte er ein Kratzen in der Kehle. Seine Zunge kam ihm trocken vor, seine Lippe war aufgesprungen und brannte. Seine Mundwinkel waren eingerissen. Durst. Er hatte unglaublichen Durst!
Zum Abendbrot hatte es zwei halbe versalzene Schmalzstullen gegeben und einen Becher Tee, der lauwarm und süß war und ansonsten nach nichts schmeckte.
Es gab nicht einmal ein Waschbecken hier, keinen Wasserhahn, aus dem er einen Schluck trinken konnte.
Mühsam rappelte er sich auf, die Pritsche unter ihm knarrte leise, als würde auch sie allmählich wach werden.
Er fühlte sich müde, ausgelaugt, erschöpft. Ein paarmal war das Licht in der Zelle von außen angeschaltet worden. Immer wenn er gerade eingeschlafen war, wurde er wieder geweckt. Er hatte Geräusche an der Tür gehört. Wurde er beobachtet? Sicher wurde er beobachtet. Jemand schaute zu ihm herein, kontrollierte … ja, was? Ob er noch lebte?
Spärlich fiel das Tageslicht durch das Fenster, das mit einer Art Brett von außen halb verdeckt war. Er konnte es nicht so genau erkennen. Der Schein, der durch die Gitter zu ihm drang, wirkte blass, kränklich, schwach, als hätte das Licht Mühe, zu ihm durchzudringen.
Sebastian ging zu dem Eimer, den es auch hier, in dieser engen dunklen Zelle gab, und pinkelte hinein. Er hörte dem Geräusch zu, und ehe er sich dessen bewusst wurde, fing er an zu summen. Eine Melodie aus seinem alten Leben. Der Lieblingssong seiner Mutter. Er hörte die näselnde Stimme von Bob Dylan, den sie so gemocht hatte.
Wie von selbst kamen erst Töne und dann Worte aus seinem Mund. Erstaunt nahm er seine Stimme wahr, die erst leise klang, heiser, und dann lauter wurde.
Sebastian brach ab, lauschte auf den Gang hinaus, räusperte sich und begann von Neuem.
Wie oft hatte er dieses Lied mit seiner Mutter gesungen? Sie spielte Gitarre, und sie sangen es gemeinsam – meist am Wochenende, wenn sie ein paar ruhige Augenblicke hatten: nach der Flimmerstunde am Samstag oder nach dem Frühstück mit aufgebackenen Brötchen und gekochten Eiern am Sonntag. Seine Mutter spielte nicht perfekt, und seine Stimme kippte manchmal, als hätte er den Stimmbruch noch nicht ganz überwunden. Aber das war egal.
Sie sangen zusammen: nicht nur den Tambourine Man, auch andere Songs von Bob Dylan und von Janis Joplin, von Joan Baez.
Warum hatte er nie Gitarre gelernt? Sie stand doch stets griffbereit im Wohnzimmer? Jetzt schien es ihm zu spät. Er hockte – warum auch immer – in einer Zelle, seine Hände waren Eisklumpen, seine Füße waren Eisklumpen, sein Herz war dabei, sich in einen Eisklumpen zu verwandeln, wenn er nicht aufpasste. Also sang er jetzt weiter – so weit, wie er sich an den Text erinnern konnte, den Refrain wiederholte er wieder und wieder.
Sebastian kam sich verloren vor. Er stand in der Mitte des Raumes und starrte die verschlossene Tür an. Wie spät mochte es sein? Wie lange musste er noch in diesem Drecksloch bleiben?
Und wozu?
Es kam ihm vor, als würde er am Ende einer Straße stehen: vor ihm nur Leere und hinter ihm tote Träume.
»Hey? … Mister … Tambourine … Man?« Er dachte an die Dylan-Amiga-LP, die ganz oben in dem Schrank mit den Schallplatten gelegen hatte. Er sah seine Mutter, die die Scheibe andächtig aus der Hülle zog und auf den Plattenspieler legte. Er sah, wie die LP sich drehte, wie seine Mutter ihm zuzwinkerte, wie sie leise mitsang.
Er musste hier raus. Er würde sonst noch durchdrehen!
Sebastian schlug mit der Faust gegen die Tür, die Schläge klangen dumpf an dem schweren Metall, vollkommen wirkungslos. Er gab nicht auf, hämmerte mit beiden Fäusten.
»He! Hallo? Ist da jemand?«
Nach einer Weile – er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war –nahm er das Schlüsselgeräusch wahr. Und das Scharren – Metall zog über Metall, das mussten die Riegel sein. Bekam er jetzt Frühstück? Etwas zu trinken? Er musste seinem Aufseher sagen, dass er es in diesem Loch nicht mehr aushielt. Was hatte er denn verbrochen?
Den Mann, der eintrat, kannte er noch nicht. Er trug ganz normale Kleidung, Jeans und ein dunkles Hemd, keinen Trainingsanzug von der Armee. »Wer bist du denn?«, fragte er verblüfft.
Sebastian nannte seinen Namen.
»Tut mir leid, ich wusste nicht, dass hier unten ein Neuzugang, also … Sonst wärest du längst … Mein Name ist Herr Kettler, Rainer Kettler.« Er kam auf Sebastian zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Macht man ja so, wenn man sich vorstellt.«
Sebastian sah ihn ungläubig an. »Ich hab keine Ahnung, was ich hier soll!«, entschlüpfte ihm. Zögernd erwiderte er den Händedruck.
Herr Kettler lachte rau auf. »Wem sagst du das?«
Täuschte sich Sebastian oder roch er tatsächlich einen Hauch von Alkohol? Einen ganz gewaltigen Hauch sogar.
»Nein, ehrlich. Ich gehöre hier nicht hin!«
»Was meinst du damit? Bist du was Besseres? Dies ist eine Übergangsstation. Die meisten, die hier sind, wurden irgendwo aufgegriffen. Es gibt immer einen Grund, warum man hier landet. Also: Wo gehörst du nicht hin?«
Der seltsame Unterton machte Sebastian stutzig. Vielleicht sollte er besser die Klappe halten?
»In ein Gefängnis«, hörte er sich sagen.
Herr Kettler seufzte. »Junge. Nun komm erst mal hoch zu den anderen. Die werden sich freuen, ein neues Gesicht zu sehen.«
Sebastian wusch sich im Waschraum, an einem Waschbecken mit kaltem Wasser, und löschte seinen Durst unter dem Wasserhahn.
Herr Kettler ließ ihn in Ruhe und wartete im Erzieherzimmer auf ihn.
Er wirkte beinahe nett. Vielleicht konnte Sebastian ja mit ihm reden und seine Lage erläutern? Seine Mutter war vor einem Jahr an Krebs gestorben. Seine Oma hatte man kürzlich in ein Altersheim gesteckt. Aber deswegen gehörte er in kein Heim. Und erst recht nicht hierher. Das musste ein Irrtum sein!
»Tja, Junge. Ich kann verstehen, dass du dich in diesem Durchgangsheim unwohl fühlst«, sagte Herr Kettler und seufzte tief.
Unwohl? Sebastian, der dem Erzieher jetzt gegenübersaß, hätte beinahe aufgelacht. Doch er musste aufpassen, dass er sich seine vielleicht einzige Chance, Gehör zu finden, nicht versaute. »Ich bin hier falsch«, sagte er mit einem leisen Anflug von Trotz.
»Na ja … Ich sehe im Moment leider keine Alternative. Die Jugendhilfe ist jetzt für dich verantwortlich und die haben dich hier eingewiesen. Deiner Großmutter wurde aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters das Erziehungsrecht aberkannt. Natürlich bleibst du nur vorübergehend in dieser Einrichtung. Für dich wird nach einem Platz in einem Normalheim gesucht. Sobald der gefunden wurde …« Herr Kettler blätterte in der Akte und hielt plötzlich inne. »Moment mal …« Er beugte sich dichter über das Papier. »Es gibt hier noch einen handschriftlichen Vermerk … Was ist mit deinem Vater? Hier steht, der wohnt in Berlin?«
Sebastian nickte, obwohl er das nicht gewusst hatte. In Berlin also. Wieso hatte sein Vater ihn nie besucht? »Ich hab keinen Kontakt im Moment. Aber … Vielleicht …« Ihm versagte die Stimme. »Vielleicht kann er ja …«, flüsterte er.
Herr Kettler tauchte plötzlich hinter dem Schreibtisch ab. Sebastian hörte, wie ein Schraubverschluss geöffnet wurde und es leise gluckerte.
»Meine Medizin«, murmelte Herr Kettler, als er wieder auftauchte.
Sebastian roch den Alkohol und schwieg.
»Ich werde mal mit Frau Pfeifer sprechen. Ich rufe sie heute noch an. Und dann sehen wir weiter.« Herr Kettler schob ihm in seiner geschlossenen Faust etwas über den Tisch.
Verwundert nahm Sebastian einen klebrigen Drops entgegen, der giftgrün leuchtete und nach Eukalyptus duftete. Der Mann schenkte ihm einen Bonbon? Sollte das etwa ein Trost sein?
»Ist besser, wenn du den noch hier lutscht. Bevor du zu den anderen kommst.«
Der Gruppenraum, in den Herr Kettler ihn schob, war auch nur eine Zelle, in der zwei Doppelstockbetten standen und wieder mal so ein komischer Pinkeleimer. Es roch, als wäre der Kübel schon bis oben hin voll.
Sebastian hörte, wie er eingeschlossen wurde, und sah in müde, blasse Gesichter. Drei Jungen saßen teilnahmslos auf Hockern herum. Niemand lächelte ihm zu. Keine Spur von Freude, dass ein Neuer kam. Ihm lag noch der Geschmack von Eukalyptus auf der Zunge, und er hoffte plötzlich, dass die Jungs den Duft nicht bemerkten. Sie sahen alle aus, als hätten sie schon ewig lang keine Süßigkeit mehr bekommen.
»Ich bin Sebastian«, sagte er.
»Schön für dich«, antwortete ein Blondschopf, der nicht älter als zwölf oder dreizehn war, und verschränkte die Arme.
»Wen interessiert’s?«, fragte ein Hagerer mit einem langen schmalen Gesicht.
Sebastian zuckte mit den Achseln.
»Wo kommst du her?«, fragte der Dritte, der rötliches Haar und eine Narbe über dem rechten Auge hatte.
»Eberswalde. Na ja, eigentlich aus Berlin. Nur das letzte Jahr habe ich in Eberswalde gewohnt.«
Der mit der Narbe nickte ihm zu. »Ich bin Nico. Du kannst da oben pennen, Sebastian.« Er zeigte auf die obere Etage eines der Metallbetten.
»Unser Küken hier im Stall heißt Jossi. Der Dürre da heißt Dog. Also nicht wie der Doktor, sondern wie der Dorfköter.«
Sebastian musterte den Hageren. Hatte Nico ihn nicht eben beleidigt? Aber Dog blickte immer noch gleichgültig vor sich hin. Nur die Stirn runzelte er ein wenig.
»Wie lange seid ihr hier schon drin?«
»Zwei Monate«, sagte Jossi.
»Halbes Jahr etwa«, brummte Dog.
»Bei mir sind’s sieben Wochen«, antwortete Nico. »Genauer gesagt, siebeneinhalb.«
Sebastian biss sich auf die Unterlippe. »Ich dachte, man bleibt im Durchgangsheim nicht so lange. Ein paar Tage hat die Jugendfürsorgerin gesagt.«
Die drei Jungen sahen sich an, dann lachten sie gleichzeitig los. »Du bist ein richtiger Frischling, was?«, fragte Nico.
Sebastian zuckte mit den Achseln.
»Dann bist du kein Entweicher?«, fragte der Hagere.
»Entweicher?«
»Na, aus dem Werkhof abgehauen?«
»Nee. Man hat mich hierhergebracht, weil meine Oma ins Altersheim musste. Und weil meine Mutter … an Krebs gestorben ist.«
»Scheiße«, sagte Nico mitfühlend. »Ist ja übel.«
»Danke.«
»Und dein Alter?«
»Keine Ahnung. Weiß nicht, was mit dem ist. Er soll in Berlin wohnen …« Kurz blitzte eine Erinnerung in ihm auf: ein Mann, der auf ihn zuging, ihn hochhob und in die Höhe warf – bis in die Wolken, so war es ihm wohl damals vorgekommen. Vielleicht träumte er deshalb heute noch manchmal davon, dass er fliegen konnte.
»Na, mach dir mal keine Sorgen. Hier wird man sich gut um dich kümmern.« Nico grinste merkwürdig übertrieben, irgendwie gespenstisch. »Du wirst rund um die Uhr betreut und darfst, damit dir nicht langweilig wird, Lampenfassungen für den VEB Leuchtenbau zusammenschrauben, bis dir die Finger bluten. Mit der guten Küche und dem gemütlichen Bunker im Keller hast du ja schon Bekanntschaft gemacht. Beim sogenannten Freigang auf dem Hof wirst du mit Sport gedrillt. Hoffe, du hast Spaß an Liegestützen und Hockstrecksprüngen in Dauerschleife? Und jetzt würde ich dir raten, dein Bett zu bauen. Wenn der Schuhmacher sieht, dass du hier einfach so rumstehst, statt deine Pflichten zu erledigen, watschelst du als Ente die Treppe hoch und runter.«
Sebastian starrte Nico entgeistert an.
Wie kam er wieder raus aus diesem … diesem Kinderknast?
Katja
Ein kühler, kräftiger Wind wehte, und ich schielte zu den Wolken hinauf, die schnell davontrieben wie eine Herde Schafe, die ein Wolf verfolgt. Ich lief über einen Platz, tauchte zielstrebig durch das Steintor hindurch. Bis zum Bernauer Bahnhof war es nicht mehr weit.
Kaum war ich auf der anderen Seite des Tores angelangt, sah ich sie: Zwei Polizisten saßen im Streifenwagen und starrten mich an. Sofort wollte ich kehrtmachen, da bemerkte ich einen dritten Uniformierten, der auf mich zumarschierte. Ohne nachzudenken, wich ich zur Seite aus, rannte blindlings los, doch da versperrte mir die Stadtmauer den Weg. So ein Mist! Wie blöd! Ich war zwar eine geübte Kletterin, aber diese Mauer war einfach zu hoch.
»Kommen Sie mit!«, befahl der Polizist auch schon und packte mich am Arm.
Ich wandte mich halb nach ihm um. Es war ein junger, sportlicher Typ, und mal abgesehen von der Uniform sah er nicht übel aus.
Mit einem Ruck versuchte ich, mich zu befreien, doch sein Griff war fest und hart.
»Mach hier keine Sperenzchen«, knurrte er und drückte noch fieser zu. »Sonst setzt es was und das willst du nicht erleben!« Vielleicht hatten seine Kollegen ihn vor mir gewarnt: Bei der musst du aufpassen. Eine, die immer wieder abhaut. Die Ausreißerqueen wird sie genannt.
Er führte mich ab, der Streifenwagen kam uns ein Stück entgegen, als könnten wir nicht so weit laufen.
»Einsteigen!« Der junge Polizist schob mich routiniert in die grüne Minna.
Eine dicke Passantin schaute zu, blickte mich missbilligend an und schwenkte nervös ihren Dederon-Einkaufsbeutel hin und her. Freundlich warf ich ihr eine Kusshand zum Abschied zu und sie schüttelte empört ihren Dauerwellenkopf.



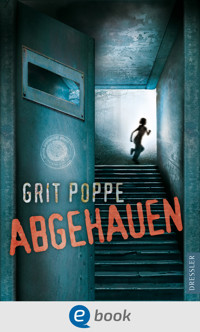















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









