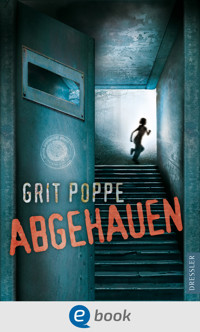Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: mdv Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Angstfresser, der (lat. Hirudo Timor), blutegelähnlicher Parasit, der in der traditionellen chinesischen Medizin als Therapie gegen Angst- und Panikzustände sowie Traumata eingesetzt wird. Auf anfängliche Nebenwirkungen wie Albträume, Halluzinationen, Wiedererleben früherer Gefühlszustände folgen rapide, kontinuierliche Therapieerfolge. Scheinbar. Kyra, eine labile junge Frau, die an den Gespenstern ihrer Vergangenheit zu zerbrechen droht, sieht die Therapie mithilfe eines Hirudo Timors als ihre letzte Chance, sich von ihren Ängsten zu befreien. Doch was ist Schreckliches passiert, dass jedwede Erinnerung an ihre Kindheit aus ihrem Gedächtnis wie ausgelöscht erscheint? Nach und nach kann sie sich von ihren posttraumatischen Belastungsstörungen befreien. Doch plötzlich kehren die Erinnerungen zurück und die Vergangenheit holt sie wieder ein … Wortgewaltig, aber auch sensibel reißt Grit Poppe die Leser in einen Strudel aus Angst, Schuld und Surrealität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 469
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
VIERTER TEIL
FÜNFTER TEIL
DANKSAGUNG
ZUR AUTORIN
ERSTER TEIL
(HANS, 1986)
Durch den dünnen Stoff seines Hemdes spürte er das Gemäuer, an dem er lehnte, und einen Moment stellt e er sich vor, an einem Felsen zu stehen, irgendwo auf einer fernen Insel. Putz bröckelte hinter ihm, als er sich bewegte, prasselte leise auf die staubige Erde, doch in seinen Ohren klang es, als würde Eis hageln, kleine harte Körner, die kein Erbarmen kannten. Wie Schüsse, dachte er und wischte den Gedanken beiseite. Schließlich war es ein milder, feucht-warmer Abend. Kein Eis, kein Hagel, und verdammt noch mal keine Schüsse. Er besaß ihn doch, den Passierschein zum vorübergehenden Aufenthalt im Schutzstreifen, alles in Ordnung, kein Grund zur Sorge. Und er würde nur vorübergehend hierbleiben, soviel stand fest. Es kam ihm vor, als sei es die schwüle Luft, die das Gemäuer brüchig machte und die seinen Körper ermattete, die eigene Trägheit, die ihn noch hielt … Er war nur ein Gast … Gast einer läppischen Geburtstagsparty. Er konnte sich ein bisschen betrinken; beim Verlassen des Sperrgebietes die Grenzer mit einem blöden Winken grüßen – als wäre er ein harmloser Bürger, der nur ein bisschen Spaß haben wollte. Die Vorstellung erzeugte einen Brechreiz in ihm, stieg ihm in die Kehle, und er kämpfte dagegen an, schluckte ein paarmal, als könnte sich der Widerwille so vertreiben lassen. Doch der Ekel hatte sich in ihm festgesetzt wie ein Parasit und zerrte an ihm. War es genaugenommen nicht dieses Gefühl des Abscheus, das ihn aus dem Land trieb?
»Küss mich«, sagte das Mädchen, das plötzlich neben ihm stand.
Ein Zucken lief durch seinen Körper, wie ein kurzer leichter Stromschlag.
Sie wollte ihn zurückholen von seiner Insel. Wegen ihr war er heute hier – jedenfalls aus ihrer Sicht. Der Sicht einer Fünfzehnjährigen, die sich irgendetwas einbildete, eine Verliebtheit in einen Mann, den sie kaum kannte, einen wesentlich älteren Mann. Er ahnte, nein wusste eigentlich, dass sie sich verirrt hatte, im Labyrinth ihrer Tagträume. Doch diese eine Chance war auch seine einzige.
Schwerfällig wandte er sich ihr zu. Ein paar Minuten lang hatte er sie fast vergessen. Dabei folgte sie ihm wie ein Schatten. Irgendwie rührend und irgendwie albern.
Er betrachtete sie, als würde er sie eben das erste Mal sehen.
Sie trug eine Jeans, keine Boxer oder Wisent, sondern eine Westjeans. Eine Levis oder wenigstens eine Wrangler – himmelblau, hauteng. War das denn hier erlaubt? In Klein Glienicke, in dieser beschissenen eingemauerten Idylle? Hatte ihr Papa, der Genosse, der heute seinen Vierzigsten feierte, denn Kontakte zum Klassenfeind?
Sie lächelte ihn an, so glücklich, dass es ihm wehtat. Durch das weiße T-Shirt schimmerten ihre Brustwarzen.
»Hast du ihn dabei?«
Er sah zu, wie sie errötete, als hätte er etwas Unanständiges von ihr verlangt.
Und in gewisser Weise tat er das ja.
Sie war einfach zu jung. Ein kleines Püppchen mit Kindergesicht, dem man erst Eis und dann Rotwein spendierte. Zu verliebt, um zu kapieren, worauf sie sich einließ.
Sie hielt ihm ihre Hand hin, offen und spröde, mit abgeknabberten Fingernägeln. Wahrscheinlich raste ihr Herz in diesem Augenblick.
Als er nach dem Schlüssel greifen wollte, schlossen sich ihre Finger um ihn. Sie starrte ihn an. »Das kostet mindestens fünf Mark.«
»Was?«
»Eine nicht angeschlossene Leiter. Der ABV kassiert hier regelmäßig.« Sie seufzte. »Manchmal kostet das auch zehn Mark.«
Jetzt glaubte er zu verstehen, nickte und deutete ein säuerliches Lächeln an. Falls das ein Scherz sein sollte, war das der falsche Zeitpunkt. »Gib schon her.«
»Erst ein Kuss«, sagte sie mit ihrem hauchdünnen Stimmchen. »Sonst …«
»Sonst?« Er lachte.
War ihr klar, dass sie ihn verraten konnte? Dass sie die Macht besaß, sein Leben zu zerstören?
Doch sie legte nur den Kopf schief, sah zu ihm auf, mit diesem leeren saugenden Blick. Sie bettelte erneut um einen Kuss.
Mit sanfter Gewalt bog er ihre Finger auf. Sie fühlten sich wie aus Gummi an und er begriff, dass sie nur berührt werden wollte von ihm, sie leistete kaum Widerstand, als wäre alles ein Spiel. Endlich nahm er den Schlüssel an sich – er war klein, wie ein Kinderspielzeug –, steckte ihn in die Hosentasche.
»Geh jetzt«, sagte er leise. Er drückte seine Lippen leicht auf ihre Stirn. »Geh nach Hause.«
Sie schmiegte sich an ihn. Er spürte ihre kleinen harten Brüste.
»Mira, geh«, sagte er streng. Er hatte sich noch nicht an ihren seltsamen Namen gewöhnt. So heißen Katzen oder Papageien, dachte er müde. Ein weiblicher Papagei. Er lächelte sie an.
»Wann …«
Sie lächelte nicht zurück. Wirkte ernst, besorgt, beinahe erwachsen.
»Ich weiß nicht«, log er.
Dabei lag es auf der Hand. Wannwennnichtjetzt.
Sie verzog schmollend den Mund und er taxierte sie, betrachtete sie amüsiert.
Er hatte sie in sein Leben gelassen, wie sie ihn in ihres: einfach so, weil es sich ergab, aus einer Laune heraus. An einem Samstag vor ein paar Wochen war sie an ihm vorbeigehuscht, verlegen, mit gesenktem Blick, als er am Pissoir stand und pinkelte.
Was sollte sie sonst auch tun? Es gab nun mal kein Frauenklo neben dem Fußballfeld; jedenfalls nicht bei einem Auswärtsspiel mitten in der Pampa.
Später sah er sie mit ihrem Vater, der in seiner Mannschaft spielte und mit dem er gelegentlich ein Bier trinken ging. Sie kamen die Treppe hinauf, als er hinunterstieg, das Abendlicht brachte ihr Gesicht zum Leuchten, sodass er sie ansehen musste und als er sie grüßte, schummelte sich ein leicht spöttischer Ton in seine Stimme. Er hatte an ihren geröteten Wangen gesehen, dass sie immer noch verlegen war, und hatte zu seinem eigenen Erstaunen bemerkt, dass er das genoss.
»Meine Tochter kennst du ja«, murmelte es von der Seite. Qualm kam aus dem Mund des Mannes, Zigarettenrauch.
»Na klar«, hatte er gesagt, ohne sich zu erinnern. Vielleicht hatte sie noch vor einem halben Jahr wie ein Kind ausgesehen? Wie eines von den vielen Kindern, die in der Nähe des Spielrandes herumturnten, auf Bänken balancierten oder auf den Zaun kletterten und denen er keine Beachtung schenkte.
Es war nicht schwer, sie zu beobachten, nach diesem Match und nach dem nächsten: Sie versteckte sich nicht. Und auch alles andere war nicht schwer: Sie fiel ihm in den Schoß wie ein reifer Apfel.
Jetzt schnurrte sie an seinem Hals. Sie roch süß und saftig, als könnte man tatsächlich in sie hineinbeißen wie in eine Frucht.
»Dein Vater hat Geburtstag«, sagte er. »Du musst nach Hause.«
Du wirst noch alles verderben, wenn du nicht gehst, dachte er und wunderte sich über sich selbst. Wie konnte er nur so sein? So grausam gelassen – oder so gelassen grausam. Einen Moment betrachtete er sich selbst – nicht wie in einem Spiegel, sondern eher wie einen Affen im Zoo. Das Bild vor seinem geistigen Auge ließ ihn erstaunlich kalt. Sollte er nicht eigentlich Angst haben? Was, wenn sie ihn erwischten? Er fühlte sich nicht einmal fremd in seiner Haut. Er fühlte sich eigentlich gar nicht.
»Und wenn schon«, hörte er sie sagen, als könnte sie seine Gedanken lesen.
Mira bückte sich plötzlich und zog ihm die Schnürsenkel auf.
Er lachte lautlos, griff ihr in den Nacken und schüttelte sie.
Ein quiekender Laut stieg aus ihrer Kehle und er ließ sie los.
Sie sprang auf, stemmte die Fäuste in die Hüften. So stand sie da, starrte ihn an, sprachlos, wütend … albern.
»Irgendwas nicht in Ordnung?«
Der Mann schob ein Fahrrad neben sich her und stellte es sorgfältig an einen Laternenmast. Er kam langsam näher, so als müsste er sich vorsichtig heranpirschen, und beäugte sie misstrauisch, mit erhobenem Kinn und gewölbter Brust, als wäre er der Dorfsheriff.
»Alles bestens.«
»Pssierschein!«, zischte es zurück. Es regnete Spuckebläschen. Die Stimme klang nach Wodka und ein wenig roch sie auch so. Der Mann trug keine Uniform und war scheinbar auch nicht bewaffnet. Eine grüne Armbinde mit Staatswappen wies ihn als Freiwilligen Helfer der Grenztruppen aus und auf seinem Kopf befand sich etwas Mausgraues, das bei der Armee als Schiffchen bezeichnet wurde.
»Ach, Herr Heinze«, quengelte Mira. »Sie wissen doch, dass mein Vater heut Geburtstag feiert. Wir sind nur ein bisschen … frische Luft schnappen.«
Herr Heinze sah an ihr vorbei, als wäre sie gar nicht anwesend. Seine Wangen wirkten plötzlich hart. Er stand erstarrt wie eine Schaufensterpuppe.
Schließlich nahm er das Verlangte entgegen, hob die Karte irgendwie fahrig in die Höhe, als hätte er die falsche Brille auf. »Ihren Personalausweis!«, befahl er dann.
»Ach, Herr Heinze«, murrte Mira wieder, als wäre sie furchtbar enttäuscht. »Das ist doch nur der Hans. Ein Freund meines Vaters. Sie wissen doch … Der gleiche Fußballverein. Sie kommen doch manchmal zu den Spielen? Er spielt in der Abwehr. Sie müssen ihn doch kennen? Hans …« Sie lachte plötzlich auf. »Wie heißt du eigentlich mit Nachnamen?«
Hans ignorierte die Frage. Sein Gesicht zeigte ein verkrampftes Lächeln, als er dem Befehl Folge leistete. Er hatte keine Angst vor dem Möchtegernsheriff. Er wollte nur seine Papiere zurück.
Ohne den Passierschein war er aufgeschmissen. Ohne ihn konnten sie ihn rauswerfen. Konnten ihn sogar festnehmen. Ihm Handschellen anlegen und ihn ins Lindenhotel verfrachten.
Der Mann hielt den Ausweis in den Lichtkegel der Laterne, reckte den Hals und kratzte sich das Kinn, das weiß aussah und jetzt rosafarbene Striemen bekam.
Er sah zweifelnd Mira an, die sich vor Hans stellte und sich an ihn lehnte, als wollte sie ihn mit ihrem Körper schützen. Schließlich nickte er langsam und verächtlich, als wüsste er schon Bescheid.
Hans fühlte eine Gänsehaut. Genauer gesagt marschierte eine unsichtbare Armee Ameisen über seinen Rücken, hinauf bis zum Nacken. Und ihre kleinen Insektenfüße waren eiskalt.
»Grüße an deinen Vater und alles Gute zum Geburtstag«, sagte Herr Heinze plötzlich. Sein Mund, der so schmal war wie bei einem Strichmännchen, zog sich zu beiden Seiten in die Länge.
Hans betrachtete das Ereignis verblüfft und nahm, wie nebenbei, die Papiere wieder an sich. »Einen schönen Abend noch«, sagte er fröhlich und vermied gerade noch so ein Grinsen. Heiterkeit war hier verdächtig. Alles war hier verdächtig. Seine bloße Anwesenheit sowieso. Die Mauer lag nicht mal einen Katzensprung entfernt. Und er besaß den Schlüssel, um auf die andere Seite zu gelangen.
»Es ist doch wirklich alles in Ordnung, Mädel?« Herr Heinze räusperte sich, hustete, als hätte er auf einmal Sägespäne im Mund.
»Was soll sein«, sagte Mira gereizt. Ihr rechtes Bein zappelte ungeduldig.
Der Mann stieg umständlich und unsicher auf sein Fahrrad, als sei er es nicht gewohnt, und fuhr kopfschüttelnd davon.
Mira hörte auf zu zappeln. Sie seufzte tief.
Hans schaute sie an, und sie zwinkerte ihm zu wie einem Komplizen.
Sein Gesicht blieb starr. Sie waren keine Komplizen. Das Leuchten in ihrem Blick erlosch.
»Glück gehabt«, sagte sie nach einer Weile vorsichtig, als müsste sie mit den Worten nach etwas tasten.
Hans strich ihr durchs Haar. Er fühlte sich elend.
Gern würde er jetzt allein hier stehen, gegen die Hauswand gelehnt, sich von der feuchten Nachtluft umspülen lassen und von einem Leben auf einer Insel träumen: von einem üppigen Mahl am Feuer, von scheuen wölfischen Menschen und einsamen Spaziergängen. Er sah sich barfuß, über runde, vom Wasser geformte Steine laufen.
Hans hatte sich Mira nicht ausgesucht. Er besaß keine Antenne, um ihre Wellen zu empfangen. Ohne Zweifel begab sie sich in Gefahr wegen ihm. Vermutlich würde sie Probleme bekommen. Erhebliche Probleme. Hans versuchte, an etwas anderes zu denken.
Wieder fragte er sich, was er hier machte, in dieser Luft, die ihn umgab wie schlechter Atem, die an ihm klebte wie Schweiß oder Spinnweben. Ein normaler Mann würde sich abfinden mit den Gegebenheiten, sich einrichten in einem normalen Leben, vielleicht eine Nische suchen, in der man es bequem hatte, ohne sich ganz aufgeben zu müssen. Puppenspieler werden oder Dompteur im Zirkus. Schäfer, Glasbläser oder Orgelbauer. In den letzten Monaten hatte er sich von Job zu Job gehangelt – Bratwürste oder Eis verkauft, im Gastmahl des Meeres und im Froschkasten gekellnert oder Telegramme ausgetragen. Nichts davon besänftigte die Wut in ihm, nichts davon half gegen den Ekel. Er hasste den Geruch von Bratwürsten, das Eis, das ihm klebrig über die Hand lief, es demütigte ihn, als Telefonersatz herhalten zu müssen oder den genervten Gästen in den HO-Gaststätten zu erklären, welche Gerichte gerade »aus« waren. Falls sein Plan schief ging, konnte er später immer noch eine Karriere als Friedhofsgärtner starten. Nach der Haft. Wenn ihn der Westen nicht freikaufte.
Ein paar Minuten dachte er darüber nach, zu der Geburtstagsfeier zurückzukehren. Schwatzen, lachen, von Fußball reden und dem Training, von seinem alten Trabi, bei dem die Bremsen manchmal nicht funktionierten und die Hupe und die Scheibenwischer immer dann versagten, wenn man sie brauchte, die geschenkten hässlichen Krawatten, das billige Rasierwasser und die grauen Socken bewundern, Kartoffelsalat und Wiener Würstchen in sich hineinschlingen, sich den Bautzener Senf aus den Mundwinkeln lecken, ein Bier trinken und dann noch eines, ein paar Schnäpse kippen, Nordhäuser Doppelkorn. Doch er war nicht normal, ihn interessierten keine Geburtstage und Rasierwasser und graue Socken erst recht nicht. Seinen Trabi hatte er in der Karl-Marx-Straße in Babelsberg geparkt, unabgeschlossen, sollte ihn doch finden, wer ihn gebrauchen konnte.
Die Zeit verging. Sie versickerte. Sonst bewegte sich nichts in diesem Land.
Wenn er jetzt seinen Plan aufgab, würde er morgen oder übermorgen im Bad stehen und ein weißes Haar entdecken, ein einzelnes weißes Haar. Er würde es herausreißen, aber es würde ihm nichts nützen, und die Stunden, die folgten, würden sein wie immer. Es war dieses Wie-Immer, das seine Hände flattern ließ, sodass er sich morgens beim Rasieren schnitt. Vielleicht sollte er aufhören, in den Spiegel zu schauen, aufhören, sich die Zähne zu putzen und sich nie mehr rasieren. Aber dann würden sie ihn holen kommen, noch nicht gleich, aber bald, und ihn rasieren und ihm die Zähne putzen, ihm einen Spiegel vors Gesicht halten und ihn füttern, wenn er sich weigerte zu essen.
Er sah Mira an, ihr niedliches Mädchengesicht, das ihm nichts bedeutete und ihm war klar, dass er sie ihrem Schicksal überließ, wenn er seinen Plan durchführte – und das würde er.
Während er noch einmal durch ihr Haar strich, überlegte er, ob er sie fragen sollte, warum sie sich ausgerechnet an ihn hängte. Sie wusste doch Bescheid über ihn. Aber diese Spinnwebenluft machte ihn müde, und eigentlich interessierte es ihn nicht. Das, was ihm an ihr gefiel, stieß ihn auch ab: ihr Egoismus. Sie versuchte, sich zu nehmen, was sie haben wollte, das imponierte ihm. Aber sie bedrängte ihn. Sie war so aufdringlich wie der Duft von Haarwasser, das sie einem beim Friseur ungefragt in die Kopfhaut massierten.
Grob, zu grob, umfasste er Miras schmale Hüften.
»Lass mich!«, zischte sie.
Es tat ihm leid, dass er sie erschreckte, dass er ihr wehtat, aber er zeigte es nicht, er lachte sie an, es musste aussehen, als würde er sich über sie lustig machen.
Sie wich seiner Hand aus, die ihm die Wange tätscheln wollte.
»Mistkerl!«
Sie sah jetzt frostig und feindselig aus, sie sah aus, als sei sie fertig mit ihm.
Er hörte auf zu lachen, griff nach ihrem Handgelenk und zwang ihren Arm unter seinen.
»Lass los, du Mistkerl!«, sagte sie.
Beinahe freute er sich über die Wut, die er in ihr entfachte. Vielleicht kam sie ja doch noch zur Vernunft? Und gleichzeitig wurde ihm bewusst, dass er das verhindern musste. Das Einzige, was ihm zur Flucht verhelfen würde, war: der Verrat an ihr. Und das Einzige, was sie noch retten konnte, wäre: der Verrat an ihm.
Vielleicht sollte er ihr einen Tipp geben? Dass sie den Genossen Grenzhelfer informieren musste, sobald er … Nur damit sie eine faire Chance hätte …
»Ich bring dich noch ein Stück«, sagte er rau. Das klang doch beinahe romantisch, oder? Damit musste sie sich doch zufriedengeben.
Sie wehrte sich stumm und traurig, aber ohne Kraft. Er hielt sie fest.
»Spiel kein Theater und komm«, befahl er, als wäre sie seine Geisel.
»Mit offenen Schuhen? Meinst du, du kannst mit offenen Schuhen umherlaufen?« Sie sah ihn triumphierend an.
Er hielt sie fest und zog den Reißverschluss ihrer Jeans auf.
Als ihm klar wurde, was er da anstellte, ließ er sie los. Wartete, was sie nun tun würde.
»Jetzt sind wir quitt«, sagte sie trocken.
Im Licht der Laterne sah er, dass sie mühsam atmete. Seufzend kniete er sich nieder und band sich sorgfältig die Schuhe zu. Sie hatte recht: Mit offenen Schürsenkeln würde er nicht weit kommen.
Er stellte sich vor, wie er wie Charlie Chaplin über den Todesstreifen stolperte, und sah zu ihr auf, zu ihren Schenkeln, und sagte: »Hör mal, das nächste Mal ziehst du einen Rock an.«
Sie schaute verstört, als hätte er ihr aufgetragen, in Ritterrüstung zu erscheinen, dann nickte sie – langsam, artig. Er stand auf, drängte sich an sie und schob seine Hand in ihre Jeans. Er fühlte ihre warme Feuchtigkeit, ihre Erregung, die sich an ihm brach, wie die Welle an einem Felsen. Sie redeten nicht; ihr Geschlecht und die klamme Luft schienen sich verbündet zu haben: schienen einen Kokon um ihre Körper zu spinnen.
Ihre Hand bewegte sich vorsichtig, zögernd auf seiner Hose. Sie kam ihm vor, wie ein Taschendieb, der mit schlechtem Gewissen stahl.
Er lachte und das zarte Gespinst um sie zerriss. Ein paar Meter entfernt von ihnen bemerkte er jetzt den Mann mit dem Fahrrad.
»Warum hörst du auf?«, fragte sie. »Hör nicht auf.«
»Der starrt uns an.« Hastig zog er seine Hand aus ihrer Hose. Mira stöhnte enttäuscht.
»Das Schwein starrt uns an.«
Mira schaute nicht hin, als würde der Mann sie nicht sehen, wenn sie nicht hinschaute.
Hans fühlte Lust, sich zu prügeln, das Verlangen sich auszutoben.
Das Mädchen schlang sich die Arme um den Leib. »Du machst mich wahnsinnig.«
Er betrachtete sie neugierig. Sie sah komisch aus. Während ihre Augen noch gierig leuchteten, verzog sich ihr Mund missmutig. Ihr Körper wirkte angespannt und bittend. »Mensch«, sagte sie leise, flehend.
Er streckte langsam die Hand nach ihr aus, berührte ihre Brüste mit Daumen und Zeigefinger, als wollte er den Abstand zwischen ihnen messen. Das Mädchen zitterte plötzlich.
»Irgendwann wird der Tag kommen«, sagte er sanft. »Du vergisst mich doch nicht, oder?«
Sie schüttelte schnell den Kopf.
Er massierte ihre Brustwarzen, die hart und spitz waren wie Knospen von Rosen.
»Es ist besser, wenn du jetzt gehst.«
Sie rührte sich nicht. Sie stand stocksteif da, die Augen ungläubig aufgerissen.
»Geh jetzt!«, sagte er schroff.
Eine Träne kullerte über ihre Wange, ohne dass der Ausdruck ihres Gesichts sich veränderte. Er wusste nicht, ob sie tatsächlich weinte, aber wenn, schien sie es nicht zu bemerken.
»Heut Nacht träumst du von mir, okay?«
Er zog seine Hand vorsichtig von ihr zurück, als könnte eine schnellere Bewegung sie zerreißen. Drehte sich von ihr weg.
Der Grenzhelfer starrte noch immer unverblümt zu ihnen hinüber.
»Schon mal was von Privatsphäre gehört?«, schrie Hans unvermittelt. Die Wut brach aus ihm heraus, ohne dass er etwas dagegen tun konnte, und er begann auf den Mann mit dem Rad zuzurennen. Hinter sich hörte er ein Schluchzen.
Diesmal war der Freiwillige Helfer schneller – das Rad quietschte, als er in die Pedalen trat – und Hans schleuderte ihm einen saftigen Fluch hinterher.
Noch eine ganze Weile spürte er ein eigenartiges Jucken auf den Handflächen.
»Schmor in der Hölle, du feiger Hund«, brummte er.
Es gab immer weniger Männer in diesem Land, die den Mumm besaßen, sich ehrlich zu prügeln. Die Leute klebten an ihren Fernsehern, empfingen mit windschiefen Antennen die Signale aus einer verbotenen Welt und glotzten und glotzten, ohne wirklich etwas zu sehen. Sie waren auf die langweiligste Art süchtig: ohne das Bedürfnis nach einem Rausch.
Er warf einen Blick auf die Häuser der Straße und stellte sich saubere, grellrote Hakenkreuzfahnen vor, die aus den Fenstern hingen. Es ekelte ihn davor, dass es ihm so leicht gelang, dieses Bild in seinem Kopf entstehen zu lassen.
Er hätte sich gern mit dem Grenztruppenhandlanger, diesem miesen Spanner, geschlagen und Schmerz empfunden. Schmerz war besser als nichts.
Natürlich wäre das dumm gewesen, ausgesprochen idiotisch sogar und gleichzeitig ehrlich und authentisch. Nur eine Prügelei. Niemand würde ihn verdächtigen.
Auf der Straße war kein Mensch zu sehen. Überdeutlich hörte er seine eigenen Schritte, und einen irren Moment lang kam es ihm so vor, als hätte man die Menschen in dieser Mauerenklave evakuiert, wegen irgendeiner bevorstehenden Katastrophe. Natürlich hatte man ihn vergessen – er gehörte nicht hierher. Er war nur Gast im Sperrgebiet. Kein willkommener allerdings. Hans stellte sich vor, dass ein Panzer hinter ihm stand oder eine Flutwelle heranrollte, ein sattes Gefühl von Geborgenheit quoll in ihm auf und verebbte gleich wieder.
Hinter sich hörte er die Schritte einer Frau. Es war natürlich Mira, die ihm folgte.
Sie war ein Kind. Nur Kinder und Narren machten sich die Mühe, ihrem Gefühl zu folgen, auch wenn alles ganz und gar aussichtslos war.
Er lief über eine Baustelle. Betreten verboten, warnte ein Schild. Wie ein Akrobat balancierte er über Bretter und sprang über einen Graben. Wurde hier etwas gebaut oder abgerissen? Er tippte auf die zweite Variante.
Kaum vorstellbar, dass hier Menschen freiwillig lebten. Aber sie taten es.
Mit der Mauer vor der Nase. Tag und Nacht bewacht. Der Schrebergarten lag hier neben dem Todesstreifen. Die Dahlien blühten und die Hummeln summten unter Aufsicht. Dunkel wurde es nie. Motten tanzten im Licht der Scheinwerfer. Jede Stunde war Sperrstunde. Eine Sackgassenwelt.
Er nahm Miras tapsige Schritte wahr, ein Brett klapperte auf ein anderes Brett, und er hörte einen Schreckenslaut.
Mit Mühe unterdrückte er einen Fluch und blieb stehen. Zwar fühlte er sich nicht verantwortlich für sie, aber er fühlte sich verantwortlich für sich selbst. Wenn sie ihm die Tour vermasselte, würde er hinter Gittern landen und das erschien ihm nun doch reichlich verantwortungslos.
Er drehte sich um und wartete. »Was ist denn, meine Süße, was willst du?«
Mira kämpfte sich tapfer mit ihren hochhackigen Schuhen durch den Schlamm.
Als sie irgendwo stecken blieb, ging er ihr ein Stück entgegen und reichte ihr seine Hand. Er sah nun deutlich, dass sie geweint hatte. Jetzt versuchte sie zu lächeln, das arme Geschöpf.
Er fand, sie habe sich eine kleine Belohnung verdient und zog sie an sich und küsste sie auf den Mund.
»Was willst du?«, fragte er zärtlich.
»Das weißt du doch«, sagte sie trotzig.
Sie musste ausgiebig geweint haben. Ihr Gesicht sah aus wie das eines Indianers nach der Schlacht. Sie sah todmüde aus. Nur noch der Trotz, so schien es, hielt sie auf den Beinen.
»Komm, ich helfe dir hier raus«, sagte er sanft, nahm ihren Arm, um sie zu stützen und führte sie ein paar Schritte. Sie stolperte zweimal. Die Scheinwerfer leuchteten nicht jede Ecke aus. Und sie schien nachtblind zu sein.
Er griff um ihre Taille; sie schmiegte sich wie eine Katze an ihn und griff um seine Hüfte. Plötzlich gingen sie eng umschlungen. Es sah wie ein Zufall aus. Hans spürte sein Herz schneller schlagen, als ihm bewusst wurde, was er tat. Zuletzt war er, soweit er sich erinnerte, als Sechzehnjähriger so mit einem Mädchen gelaufen.
Dieses Kind hier war das einzige Wesen, das um ihn kämpfte. Aber er wusste nicht, ob es sich lohnte, um ihn zu kämpfen.
Vorsichtig begann er sich aus der Umarmung zu lösen und redete leise auf sie ein: »Du vergeudest deine Kraft, meine Süße, deine Kraft, deine Zeit, deine Lust. Du vergeudest dich. Sieh mal …« Hans wollte ihr etwas erklären, aber ihm fiel nicht ein, was er ihr erklären wollte.
»Ich liebe dich«, jammerte Mira erschöpft.
Hans versuchte, das Lachen, das ihm in der Kehle saß, zu unterdrücken. Ernst sagte er: »Ich hoffe, du weißt, dass ich dich nicht liebe.«
Ein Zucken lief durch ihren Körper; in ihrem Blick flackerte Entsetzen.
Hans beugte sich nah an ihr Gesicht und setzte eine besorgte Miene auf. »Ich möchte dich nicht verletzen, Süße. Aber, ich denke, es ist besser, mit offenen Karten zu spielen.« Sie bot ihm ihre Lippen. Sie waren aufgerissen und bluteten etwas.
Aus Angst, sie könnte wieder in Tränen ausbrechen, küsste er sie.
Ihr Speichel schmeckte metallisch salzig, und es wurde ein kurzer Kuss.
»Ich gehe jetzt«, sagte er sachlich. »Ich schnapp mir eure Leiter und hau ab.«
Den Rest konnte sie sich hoffentlich denken. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Aber er wollte nicht zu grob sein. Nicht gröber als nötig.
Sie nickte tapfer und er klopfte ihr beruhigend auf die Schulter. »Vielleicht sehen wir uns ja irgendwann wieder«, murmelte er und ärgerte sich über sich selbst. Es klang sentimental und unglaubwürdig.
Sie blieb zögernd stehen und sah irgendwie hoffnungsvoll zu ihm auf. Das hatte er nun davon.
»Hast du vergessen, mir etwas zu sagen?«, fragte er höflich. Er fühlte sich wie ein Lehrer, der seiner Lieblingsschülerin noch eine letzte Chance gewährt.
Mira seufzte. »Ich zeige dir noch, wo sie steht. Und dann brauche ich den Schlüssel zurück«, antwortete sie resigniert. »Wenn der Schlüssel nicht am Haken hängt, bringt mein Alter mich um.« Sie lachte leise.
Mit schmalen Augen blickte er auf sie hinab. Sie konnte ihm immer noch alles verderben. Und beinahe rechnete er damit.
Die Leiter stand an einer maroden kleinen Hütte und war tatsächlich an etwas angeschlossen: an einer rostigen Leitung, die zu einem verwitterten, grün verkalkten Wasserhahn führte.
Seine Hand zitterte leicht, als er den Schlüssel in das Schloss steckte. Ihm wäre lieber gewesen, sie würde nicht dabei zusehen.
»Und was ist, wenn ich mitkomme?«, fragte sie beinahe gelangweilt.
Er schnappte nach Luft. »Soll das ein Scherz sein? Du machst nur einen blöden Witz, oder?«
Sie schüttelte den Kopf. Er sah jetzt, dass sie schwitzte. Ihr Gesicht war rot angelaufen. »Nimm mich mit.« Ihre Stimme klang auf einmal fremd, fast gespenstisch leise, wie ein kalter Windhauch. Hatte sie das wirklich gesagt? Verwirrt betrachtete er die Leiter in seinen Händen. Was machte er hier eigentlich?
»Nimm mich mit. Ich mach dir keine Schwierigkeiten. Bitte.«
»Kommt nicht infrage!«, stieß er hervor.
Sie war eindeutig übergeschnappt. Man sollte sich nicht mit Kindern einlassen. Einen Moment sah er sich seine Finger um ihren Hals legen.
Seine Hände fühlten sich plötzlich kalt an, als er das Seil, das er wie einen Gürtel um seine Hüfte getragen hatte, an der obersten Sprosse festband. Auch seine Füße kamen ihm ein paar Sekunden lang erstarrt vor.
Er warf ihr den Schlüssel zu, aber sie machte sich nicht die Mühe, ihn zu fangen. Eigentlich hatte er vorgehabt, zum Abschied noch etwas Feierliches zu sagen.
»Scheiße! Geh nach Hause, verdammt!« Auch seine Stimme klang verändert. Als würde sie im nächsten Moment reißen, wie eine überspannte Bogensehne.
Sie zuckte mit den Schultern. Als hätte sie es nicht so ernst gemeint.
Er ließ sie stehen. Ohne noch ein Wort an sie zu richten. Hörte ihr Schweigen.
Keine Schritte mehr, die ihm folgten. Gut. So.
Trat mit den Zehenspitzen zuerst auf. Wie ein Balletttänzer.
Tänzelte über den maroden Straßenbelag. Kopf. Stein. Pflaster. Eine Armee von Totenköpfen unter seinen Füßen.
Unsinn.
Der Friedhof. Endlich. Eine kleine rote Backsteinmauer. Ein Tor aus verwittertem Holz. Windschiefe Grabsteine. Er trug die Leiter wie Jesus seine Bürde getragen hatte. Bloß mit mehr Hoffnung vielleicht.
Er durfte jetzt keinen weiteren Fehler begehen. Sonst würden sie ihn ans Kreuz nageln. Ohne mit der Wimper zu zucken. Einmal abdrücken genügte.
Peng und Schluss.
Minen. Selbstschussanlagen. Gab es hier nicht. Zu nah dran. Eine Ostblase im Becken des Westens, Westberlins genauer gesagt. Doch wie konnte er sich sicher sein …?
Er versuchte seine wirren Gedanken auszuschalten. Konzentrierte sich auf das, was vor ihm lag.
Der Antifaschistische Schutzwall schimmerte ihm blass entgegen. Wartete auf ihn. Das Tor zur Glückseligkeit war eine Wand, gegen die er anrennen musste – auf Gedeih oder Verderben.
Krank. Die Mauer. Die Welt. Er selbst.
Er glühte wie im Fieber, als er die Leiter an die Betonwand lehnte.
Die festgebundene Schnur baumelte hin und her, als wollte sie ihm von oben herab zuwinken.
Einen Moment lauschte er, bevor er anfing zu klettern. Es war so still. Zu still.
Als hätte sie aufgehört zu atmen.
Sie?
Sie war erst fünfzehn. Verdammt.
Sie würden ihr schon nichts tun. Er drehte sich nicht mehr um.
Dann, als er schon im Todesstreifen war, fiel ein Schuss.
(Kyra, 2002)
»Die Angst kommt und geht«, sage ich beschwichtigend.
Ich lege mir ein Lächeln auf die Lippen. Ein Lächeln für die Ärztin, die vor mir sitzt. Herbe Miene, blasse Haut, Stirn in Falten. Sie lässt meine Hand los und betrachtet mich. Ich sehe die Sorge in ihren Augen und fühle mich schuldig. Streiche mir eine Strähne aus dem Gesicht, warte.
Warte darauf, dass sie endlich das Rezept ausstellt.
»Sie haben Fieber. Sie haben einen viel zu hohen Blutdruck, Ihr Puls ist auf Hundertvierzig.«
Ich betrachte die Tischkante. Vielleicht erzählt sie mir ja auch noch etwas, was ich noch nicht weiß. Meine Zunge fährt über meine Lippen. Trockene Zunge, trockene Lippen. Ich bin ausgedörrt. Ich überlege, ob ich diesen Satz aussprechen kann.
»Ich bin müde«, sage ich und hoffe, dass sie versteht.
»Wovon?«, fragt sie.
»Es ist so schlecht zu erklären«, murmle ich.
»Versuchen Sie es.«
Was geht Sie das an. Was zum Teufel geht Sie das an.
»Ich will in mein Bett«, sage ich. »Schlafen. Ich habe ein paar Nächte nicht geschlafen.« Mein Blick rutscht von der Tischkante auf den Boden, fällt auf den blauen Teppich. Ein wolkenlos blauer Teppich, azurblau, ein vollkommen unmögliches Blau für einen Teppich. Mir wird schwindlig, wenn ich in dieses Blau starre. Der Himmel liegt unter mir, aber was ist dann oben? Die Hölle?
Ich lache. Eine lustige Vorstellung. Die Ärztin schaut irritiert.
»Herzrhythmusstörungen in Ihrem Alter«, sagt sie vorwurfsvoll.
»Ich bin einunddreißig«, entgegne ich.
»Eben. Eine junge Frau.« Sie schlägt mit einem metallisch glänzenden Kugelschreiber auf meine Krankenakte. »Sie sollten das nicht auf die leichte Schulter nehmen.«
Da können Sie Gift drauf nehmen, Frau Doktor. Ich nehme mein Herz schon nicht auf die Schulter.
»Wissen Sie, wie es ist, wenn der Schlaf Sie ignoriert? Wenn er einen Bogen um Sie macht, obwohl Sie müde sind, todmüde?« Meine Stimme klingt aggressiv. Gut so.
Sie seufzt, schreibt das Rezept aus. Endlich.
»Sie hätten die Therapie nicht abbrechen sollen«, sagt sie, erhebt sich und wandert um ihren Schreibtisch. Auf mich zu. Streckt ihre Hand aus wie eine Waffe. In ihren Brillengläsern spiegelt sich das Blau des Teppichs.
Ich liege auf dem Rücken und starre an die Decke. Wie ich bis nach Hause, bis ins Bett gekommen bin, weiß ich nicht. Ich habe einen seifigen Geschmack im Mund. Mein Puls rast. Ich drehe mich auf den Bauch und vergrabe mein Gesicht im Kissen.
Ich liege, doch der Schlaf kommt nicht. Ich bin müde. Warte auf die Wirkung der Tabletten.
Der Teppich der Ärztin kommt mir in den Sinn. Das Blau, das Ihnen direkt ins Hirn strahlt. Lassen Sie sich hypnotisieren! Fliegen Sie in eine andere Dimension!
Weg damit.
Ich schließe die Augen und stelle mir ein Meer vor. Welle für Welle. Und eine überschwemmt die andere.
Bringt nichts.
Kornblumen, Sonnenblumen. In einem Mohnfeld einschlafen.
Schafe zählen. Warum Schafe? Ich zähle Pferde.
Ein weißer Hengst bricht aus der Reihe. Rast auf mich zu. Bevor er mich niedertrampelt, greife ich mir die Zügel, bringe ihn zum Stehen und schwinge mich auf seinen Rücken.
Weg. Nur weg hier.
Es klingelt an der Tür. Aber ich erwarte keinen Besuch. Oder doch? Ich kann mich nicht erinnern.
Vielleicht ist es Lex. Er hatte vor einer Woche angerufen, aus einer Kleinstadt in Südfrankreich, und sein Kommen angekündigt. Lex ist ein Nomade, heute hier, morgen dort. Ein Staatenloser, der seine Heimat verlässt, immer wieder, seit sie aufhörte zu existieren. Seit die Mauer umgefallen ist – einfach so.
Ich gehöre zu seinen Frauen. Denkt er.
Im Moment will ich niemanden sehen. Nicht einmal ihn. Ich ziehe die Bettdecke über den Kopf. Das schützende Dunkel.
Ich sehe Jonas im Bauch des Wals. Ein alter Mann mit schlohweißem Haar im Innern des Königs der Meere.
Das Klingeln hört auf. Ich zähle jetzt Wale.
Sie springen in Zeitlupe aus dem Meer, sprühen ihre Fontänen und gleiten zurück in die Tiefe.
Es dauert ziemlich lange, Wale zu zählen. Manchmal starre ich nur ins Wasser und warte darauf, dass der nächste kommt.
Irgendwann kommt keiner mehr.
»Hab keine Angst«, sage ich leise vor mich hin. »Hab keine Angst. Da ist nichts im Dunkel, was auf dich lauert. Du brauchst nur die Gardinen aufzuziehen, und schon ist es hell im Raum. Sei lieb, mach die Augen zu und schlafe. Danach sieht alles gleich viel anders aus.«
Ich springe aus dem Bett, laufe in die Küche, reiße den Kühlschrank auf.
Doch als ich ans Essen denke, wird mir übel.
Ich fühle einen Schwindel und setze mich auf den Fußboden.
Im Schneidersitz hocke ich da, überlege, was zu tun ist. Ich schiebe ein Glas beiseite, starre die Würstchen an.
Ich bin hungrig. Aber der Gedanke, mir eine Wurst in den Mund zu schieben, erscheint mir seltsam.
In der Ginflasche ist nicht mehr viel Gin. Ich genehmige mir einen Schluck. Einen.
Angstsaft, selbst verschrieben. Drei Mal täglich. Nicht mehr, nicht weniger.
Abgesehen von den Ausnahmen.
Die Ausnahmen sind die Notfälle, in denen nichts anderes mehr hilft als ein kleines nettes einsames Besäufnis.
Ich verlasse die Wohnung.
Wenn dieser unbekannte wilde Rhythmus in mir spielt, wird alles um mich undeutlich. Verschwommen liegen die Wiesen vor meinen Füßen, doch habe ich nichts mehr mit ihnen zu tun. Manchmal nur zieht es mich hinab, und ich möchte mich tief in sie fallen lassen und einschlafen. Stattdessen haste ich auf dem schmalen Waldweg entlang, um den mir selbst auferlegten Spaziergang ja schnell hinter mich zu bringen.
Ich laufe an Bäumen vorbei, wie ich auf der Straße an Menschen vorbeilaufe.
Wenigstens sehen die Bäume mich nicht an, belästigen mich nicht mit Blicken oder Worten. Mir kommt der Gedanke, wie gelassen Bäume leben. Sie lassen ihre Blätter fallen, stehen nackt im Winter, ohne zu frieren, ohne zu klagen.
Die Tür der Kirche ist offen und so trete ich ein.
Vater unser, der du bist. Vater … Vater unser … Verdammt noch mal!
Ich wünschte, ich könnte beten. Die Angst fortbeten.
Ich kann nicht beten. Ich kann nur stammeln. Wie sollte er, den es nicht gibt, mich erhören?
Er hat mich längst erhört. Mich in die Angst geschickt wie in ein fremdes Land.
Es ist kalt. Ich kann meinen Atem sehen.
Die Bankreihen sind leer. Bis auf die letzte, dort sitze ich.
Die Leere ist auch in mir.
Der Himmel hat sich bezogen; es beginnt heftig zu regnen. Ich habe also Grund, meinen Spaziergang zur Flucht zu machen. Ich laufe, trete in Pfützen. Das Wasser schwappt mir in die Schuhe.
Es tut gut zu rennen.
Am Rand der Straße ein weinrotes Werbeplakat für Last-Minute-Reisen: Nix wie weg!
Beim Weglaufen bin ich wenigstens mit dem Weglaufen beschäftigt, obwohl ich das, vor dem ich weglaufe, mit mir trage.
Ich fühle Stiche in der Lunge. Bekomme keine Luft mehr. Ich taumle auf einen Zaun zu. Etwas in mir verstopft meinen Kehlkopf. Die Panik ist wie ein Stromschlag. Ziehe das Spray aus der Jackentasche. Einmal schütteln, sprühen, Luft anhalten, ausatmen. Fertig.
Ich hänge in dem Zaun wie ein verletzter Vogel. Warte darauf, dass sich mein Atem wieder normalisiert.
Angstasthma.
Der Rückweg jetzt: Schritt für Schritt. Ruhig atmen. Ich gewöhne mich an den Regen. Er fühlt sich beinahe warm an.
Ich stehe im Bad, betrachte mich im Spiegel: die Haut blass, das nasse Haar klebt an den Schläfen. Ist die Angst mir ins Gesicht geschrieben?
Mein Magen schmerzt. Ich fühle meinen Bauch hart werden.
Herzrasen.
Ich lehne mich gegen die Wand. Gegen die kühle, harte Wand.
Vielleicht kann ich einfach hier stehen bleiben. Für ein paar Stunden. Ein paar Minuten?
Ich kann nicht. Es treibt mich in den nächsten Raum. Zwischen Wand und Wand.
Die Angst
jetzt
hier
im Zimmer.
In der Küche verschütte ich Kaffee, weil meine Hand ein Eigenleben führt.
Die heiße Flüssigkeit auf meiner Haut, der braune Fleck auf dem Tisch.
Der dumme durchgeknallte Specht in mir zerhackt mir das Herz.
Die Angst gibt mir das Gefühl, mein Leben zu versäumen. Und das Gefühl, mein Leben zu versäumen, macht mir Angst.
Die Zeit vergeht. Nichts geschieht. Die Welt ist woanders. Das Einerlei meiner Tage klebt wie Kaugummi.
Das Einerlei. Das Einerlei. Das Einerleileid.
Meine Angst ist meine Sehnsucht, dem Einerlei zu entkommen.
Es ist doch etwas geschehen. Jemand hat angerufen. Das rote Licht des Anrufbeantworters blinkt.
Ich laufe im Zimmer umher, weiche dem Stuhl aus, dem Tisch.
Nehme die Tabletten vom Regal, lege sie wieder hin und schalte den Fernseher an und, noch ehe das Bild entstehen kann, wieder aus.
Ich hole mir aus der Küche ein Glas Wasser, proste meinem Spiegelbild im Korridor zu, schlucke eine weiße und eine blaue Pille. »Auf dein Wohl.«
Eine Weile sitze ich auf dem Schuhschrank, betrachte die Frau im Spiegel, wie jemanden, der zu Besuch gekommen ist. »Gibt es was Neues? Hast du einen vernünftigen Job gefunden? Bist du schwanger? Gibt es einen seriösen Herrn mit Geld und Familiensinn in deinem Leben?«
»Nichts dergleichen«, sage ich, wende den Blick ab, erhebe mich, wandere durch die Wohnung. Bleibe irgendwann stehen und sehe aus dem Fenster. Der Regen hat aufgehört. Es ist wenig Verkehr, zwei drei Autos, Leute sind kaum zu sehen, nur eine Radfahrerin, die an den Briefkasten heranfährt und dort hält.
Fühle einen sinnlosen Neid: Ein Mensch schreibt einem anderen Menschen. Wann habe ich den letzten richtigen Brief geschrieben? An wen?
Ich stehe auf, laufe im Zimmer umher, hin und her, mit kleinen Schritten.
Vor dem Bücherregal bleibe ich stehen.
Keinen Nerv zum Lesen. Alles dreht sich im Kreis. Chaos. Mich konzentrieren. Auf was? Auf mich. Denn das Chaos ist in mir.
Ich nehme irgendein Buch und versuche zu lesen, die Buchstaben zu einem Sinn zusammenzufügen wie ein Schulanfänger.
Die Worte rieseln, rauschen, säuseln. Sie blähen sich auf, um zu platzen wie Seifenblasen. Sie wirbeln umher wie Flocken.
Schneetreiben.
Das Schneetreiben in meinem Kopf.
Ich kann das Buch genauso gut verkehrt herum halten. Es macht keinen Unterschied.
Ich laufe im Zimmer umher, hinaus auf den Flur, bleibe vor dem Telefon stehen.
Drücke den Knopf.
Es ist die Chinesin. Sie will mich sehen. Sie klingt aufgeregt. Sie bittet um einen Rückruf.
Ich rufe nicht zurück.
Der Supermarkt ist gleich um die Ecke. Der Dunst des Regens liegt noch in der Luft, in den Straßen riecht es irgendwie neu. Ein würziger Geruch nach Lebendigem.
Vor dem Regal mit den Broten stehe ich unangemessen lange. Ich weiß nicht, für welches Brot ich mich entscheiden soll. Es erscheint mir plötzlich wichtig, das eine zu finden. Das eine für mich bestimmte. Woher kommen diese Worte? Hat die Chinesin sie benutzt?
Mein Herz schlägt schneller. Der Magen brennt. Ich reibe meinen Bauch mit langsamen kreisenden Bewegungen. So wie die Chinesin es mir beigebracht hat. Ich drehe mich einmal um mich selbst, zweimal, dreimal. Dann greife ich wahllos zu. Das Brot ist warm und schwer, ein Kartoffelbrot. Brot, das nach Kartoffeln riecht. Oder ist das Einbildung? Auf dem Weg zur Kasse presse ich den Laib an mich wie ein Baby.
Ich kann es nicht hergeben. Ich kann es nicht auf das Laufband legen.
Die Frau an der Kasse sieht mich seltsam an.
Ich würge mir ein Lächeln auf die Lippen und zahle.
Ich liege auf dem Bett, breche Brocken aus dem Brot, kaue.
Es ist das eine für mich bestimmte.
Jetzt werde ich schlafen können.
Träume süß. Vergiss die Angst. Diese peinliche Angst.
Peinlich, peinlich, weil sie ohne Grund ist.
Die Vergangenheit ist vergangen.
Überempfindlich? Wirr? Überspannt? Verrückt? Neurotisch? Geisteskrank?
Irgendetwas davon. Oder alles zusammen.
Das Brot schmeckt nach nichts. Es riecht auch nicht mehr nach Kartoffeln.
Ich höre noch einmal den Anrufbeantworter ab.
Die Chinesin sagt etwas von einem neuen Heilmittel.
Das eine für mich bestimmte.
Ich werde sie anrufen. Nicht jetzt. Später.
Oder ich gehe zu ihr. Hoffe, sie will nicht wieder Nadeln in mich stechen.
Die Akupunktur hat nicht viel gebracht. Für Yoga fehlt mir die Disziplin. Für Tai Chi die Ruhe.
Aber sie hat mich nicht aufgegeben.
Ich bin froh, dass sie mich nicht aufgibt.
Diesmal darf ich sie nicht enttäuschen.
Ich darf mich nicht enttäuschen.
Wie spät ist es?
Mein Wecker steht. Auch meine Armbanduhr tickt nicht mehr.
Ich habe mich nicht um neue Batterien gekümmert.
Die meisten Glühbirnen sind tot.
Das Licht ist gleichbleibend trübe.
Von der Nachbarwohnung dringen Geräusche zu mir. Das Geknatter der Gewehre. Die alte Frau ist schwerhörig. Der Nachtfilm oder schon der Morgenfilm?
Ich stehe vor dem Spiegel mit einem Glas Wasser in der Hand.
Ich sehe in meine geröteten Augen. Lege die Tablette auf meine Zunge.
Eine Pille gegen die Angst. Sie schmeckt bitterlich bitter.
Ich schlucke. Die Tablette bleibt in meinem Hals stecken.
Es ist, als stemme sich die Angst ihr entgegen.
Ich kippe das Wasser in mich hinein wie eine, die kurz vorm Verdursten ist.
Ich verschlucke mich, huste. Huste. Meine Augen glänzen feucht. Vielleicht sollte ich den Spiegel verhängen.
In ein weißes Laken starren, statt in mein Gesicht.
Es ist still.
Ich liege auf dem Bett und rühre mich nicht.
Es ist Nacht.
Ich stehe am Fenster. Öffne es. Lehne mich hinaus.
Immer der Gedanke: Brichst du dir die Knochen, wenn du springst?
Oder fällt man unbeschadet in den kurz geschorenen Rasen?
Oder können Menschen doch fliegen, und es hat ihnen nur niemand gesagt?
Ich breite die Arme aus.
Aber nach den Gesetzen der Logik werde ich nicht fliegen.
Ich werde fallen. Hinunterfallen, mir die Knochen brechen.
Vielleicht nicht einmal das Genick, aber einen Arm oder ein Bein.
Und darauf bin ich nicht scharf, liebe, verlockende Tiefe.
Wann begann dieses Immer? Ich weiß es nicht. Da wo andere glasklare Erinnerungen haben, sind bei mir Wolken im Kopf. Manchmal, in Träumen, reißen sie kurz auf und ich blicke hinab auf etwas Unbekanntes unter mir.
Ein Haus, das Augen hat und mich anstarrt, ein Treppengeländer … ein Keller, Sand im Mund oder Dreck … Die Masse rutscht mir in die Kehle, ich reiße die Augen auf und sehe nichts. Ich will um Hilfe schreien, aber es geht nicht. Das Fenster ist ein blindes Auge. Die Tür starrt mich an. Kurz vor dem Ersticken erwache ich. Keuche. Ringe nach Luft.
Wo war ich?
Ich werde die Chinesin anrufen, sobald es hell wird.
Ich muss hier raus. Weg. Schnell. Wohin?
Der nächtliche, menschenleere Markt. Kopfsteinpflaster.
… also wanderte ich durch die Stadt eurer Träume und wählte mir die ausgestorbenen Marktplätze für diesen reinen Umgang meiner Seele, unter euch
unsichtbar und immer von Neuem aufflackernd wie ein Feuer von Dorngestrüpp im offenen Winde …
Eine Zeitlang habe ich Gedichte gelesen. Gedichte vom Trödelmarkt – vergilbt, fleckig, mit geheimnisvollen Notizen am Rand. Saint-John Perse, ein Nobelpreisträger, den keiner mehr kennt.
Keine Romane, keine Zeitungen. Es half. Ein bisschen. Auch wenn mich manche Zeilen in die Tiefe zogen, auf den Grund eines unbekannten Meeres – wenigstens führten sie mich irgendwohin.
Und Musik. Ich habe sie nicht einfach gehört, sondern in mich fließen lassen, wie eine süße Medizin für Kinder. Musik ohne Worte. Klavierkonzerte, die nachts stundenlang im Radio laufen, ohne dass ein Moderator dazwischenquatscht.
Ein alter Mann sitzt auf einer Bank neben der Telefonzelle. Schläft.
Keine Tauben. Wo sind die Tauben?
Ich bleibe stehen, schaue zu dem bewegungslosen Mann hinüber.
Tot, denke ich, man hat sie vergiftet, die Tauben.
Wenn ich jetzt umkehre, muss ich wieder über dieses Pflaster laufen.
Jeder Schritt weiter wäre Flucht. Ich komme hier nicht weg. Jeder Schritt zurück wäre Flucht.
Das Kopfsteinpflaster glänzt vom Regen. Die steinernen Augen glotzen mich an. Es ist, als wäre ich unvermutet auf einem fremden Planeten gelandet.
Ich fühle die Steine unter den Füßen brennen.
Nein, ich bin nicht unvermutet gelandet.
Ich lebe hier. Auf einem fremden Planeten namens Erde.
*
»Legal oder illegal?«, frage ich in den Telefonhörer.
»Bitte?« Ich höre die Chinesin nervös lachen.
»Das Mittel.«
»Es ist … ein besonderes … ein ganz besonderes …«
»Also illegal. Vollkommen illegal?«
»Bitte? Ich erkläre alles. Aber nicht am Telefon.«
»Gut.«
»Ich erkläre alles. Sie entscheiden … dafür … dagegen …, wie Sie wollen.«
»Ja.«
Ich sehe sie so deutlich vor mir, als würde sie neben mir stehen.
Sie blättert in Papieren herum, lächelt ihrem Patienten zu, der genadelt auf dem Behandlungsbett liegt.
»Aber schnell. Sie müssen schnell sein. Kommen Sie dreizehn Uhr?«
»Heute?«
»Ja natürlich.«
»Wie spät ist es?«
Sie legt auf.
Heute noch. Dreizehn Uhr.
Die 13 ist böse. Das weiß jedes Kind.
Die Angst schlängelt sich auf mich zu. Ich sehe in ihre gelben Reptilienaugen. Halte dem Blick stand. Blinzle nicht. »Ich werde gehen«, erkläre ich ihr. »Du hältst mich nicht auf.«
Ich schalte den Fernseher an. Suche nach der Uhrzeit. Es ist kurz vor neun.
Ich frühstücke ein paar trockene Brocken Brot.
Trinke Kaffee. Schwarz. Heiß. Stark. Diesmal verschütte ich nichts.
Noch vier Stunden.
Warten.
Noch vier Stunden.
Herzrasen.
»Alles wird gut«, sage ich laut. »Ich verspreche dir, dass alles gut wird.«
Falls nicht, kann ich immer noch versuchen zu fliegen.
Bevor ich laufen lernte, konnte ich fliegen. Sagt meine Erinnerung.
Vielleicht können alle Kinder fliegen, bevor sie laufen lernen. Nachts, wenn sie allein sind. Wenn niemand sie kontrolliert. Nur vergessen sie später, wie es geht.
Etwas flattert in meiner Brust. Wie ein Vogel, der sich verflogen hat.
Mein Herz rast nicht mehr.
Ich liege auf dem Sofa. Starre die Mattscheibe an. Wie eine ordentliche Bürgerin.
Die Tabletten wirken endlich. Ich fühle mich betäubt. Kein angenehmes Gefühl. Aber besser als die Angst.
Noch drei Stunden.
Im Fernsehen krabbelt was herum. Ameisen. Ameisen vergrößert. Rattengroße Ameisen. Sie schleppen dies und das. Sie arbeiten fleißig. Man kennt das ja. Die Ameise unser Vorbild. Sie streiken nie. Sind immer einsatzbereit. Und auch noch ehrenamtlich. Jeder Firmenchef würde sich über sie freuen. Und die Mistkäfer und Schnecken hinauswerfen.
Meinen Job habe ich verloren. Wie die anderen Jobs davor auch. Zuletzt habe ich Zeitungen ausgetragen. Wenn man nicht schlafen kann, die ideale Beschäftigung. Dachte ich – zumindest zeitweilig. Wenn alle anderen schlafen, gehst du von Tür zu Tür. Der Geist mit den schlechten Nachrichten. Der Geist mit dem Wetterbericht und den Lottozahlen. Der Geist mit dem Fernsehprogramm und den Sportmeldungen. Fleißig wie eine Ameise.
Irgendwann warf ich einen Teil der Ware in die Grube einer Baustelle.
Ich wollte keine geistige Ameise mehr sein. Ich wollte Gedichte lesen und meine Ruhe haben.
Ruhe.
Beim ersten Mal gab es noch keine Beschwerden.
Aber beim dritten Mal schon.
Ich fühlte mich erleichtert, wie immer, wenn ich einen Job verlor, den jede Ameise besser erledigen könnte.
Li Ling zeigte sich weniger froh. Es waren ihre Rechnungen, die ich nicht rechtzeitig bezahlen konnte.
Wie soll ich das neue Heilmittel finanzieren?
Vorausgesetzt es ist das eine für mich bestimmte?
Ich weiß nicht, ob ich der Chinesin trauen kann. Aber es bleibt mir nichts anderes übrig.
Li Ling. Keine Ahnung, ob das ihr richtiger Name ist.
Sie könnte auch Mo Ment Mal heißen. Ich würde ihr trotzdem vertrauen.
Das erste Mal begegneten wir uns auf einem Trödelmarkt. Sie stand hinter mir und atmete in meinen Nacken. Ich las ein Gedicht, das ich nicht begriff, und dann hörte ich sie etwas fragen und drehte mich zu ihr um.
»Ein Gedicht ist … wie Traum …, oder?« Sie lächelte auf eine Art, als wüsste sie über mich Bescheid. Und dann gab sie mir ihre Karte. »Ich … Heilerin. Du zu mir kommen kannst.« Sie berührte mich leicht am Arm, dann verschwand sie wieder.
Am Abend desselben Tages rief ich sie an. Die Berührung saß auf meiner Haut wie ein Schmetterling.
Noch zwei Stunden.
Ich habe geschlafen. Vielleicht zehn Minuten. Aber immerhin.
Eher eine chemische Narkose als Schlaf. Aber ich will mich nicht beschweren.
Die Angst hat sich verzogen. Vorerst.
Sie wartet darauf, dass sich der Medikamentennebel lichtet.
Ich habe mir angewöhnt, die Angst wie ein Tier zu sehen, das in mir sitzt. Wenn sie keine Schlange ist, die scheinbar aus dem Nichts kommt, dann ein Insekt. Keine Ameise, eher eine Spinne.
Die Spinne kennt sich aus mit Angriff und Rückzug. Und erneutem Angriff.
Sie beobachtet mich. Sie lauert auf eine falsche Bewegung, auf einen günstigen Augenblick. Sie ist beinahe unsichtbar, solange sie in ihrem Versteck kauert. Sie lässt sich aus dem Nichts herab, an einem Faden, der nicht viel mehr ist als nichts. Sie krabbelt unerhört schnell. Kennt jede Ritze, jedes Schlupfloch, jede staubige Ecke in meinem Ich.
Mir kommt plötzlich der Gedanke, dass ich länger geschlafen habe als nur zehn Minuten. Vierundzwanzig Stunden und zehn Minuten.
Vielleicht ist heute schon vorbei? Vielleicht ist heute schon morgen? Und der Termin war gestern?
Der FernsNoch eine Stunde.eher zeigt mir die Uhrzeit, aber kein Datum. Die Nachrichten sind gerade vorbei.
Ich laufe barfuß die Treppen hinunter zu den Briefkästen. Ich weiß, wie man nach einer Zeitung fischt.
Heute ist immer noch heute. Gut zu wissen.
Noch eine Stunde.
Ich liege in der Wanne. Mit der Zeitung in der Hand. Entschuldigung, Frau Nachbarin. Der Anblick des Datums beruhigt mich. Zahlen kann ich noch lesen. Zahlen, die Schlagzeilen. Aber die Schlagzeilen machen mich schon nervös. Ich will nicht wissen, was sich hinter ihnen verbirgt.
Das Foto eines blutüberströmten jungen Mannes auf der Titelseite. Ein Kopfschuss? Ich will es nicht wissen.
Der Schaum duftet nach Schaum und nach Kräutern.
Melisse natürlich. Nichts dem Zufall überlassen.
Die Angstspinne nutzt jeden Fehler im System. Sogar falscher Schaum kann sie wecken. Oder ein falscher Geruch. Ein falscher Geschmack. Das Bild eines Toten.
An die Kellertür habe ich einen Zettel gehängt. Bitte die Kellertür schließen!!!
Aber sie steht trotzdem manchmal offen.
Ich starre auf das Datum. Heute.
Blättre die Seiten vorsichtig um. Ein Artikel über Saurier. Ich atme auf. Artikel über Saurier beruhigen mich. Nicht weil die Riesenechsen ausgestorben sind, sondern weil sie so lange auf dieser Erde überlebt haben. Zweihundert Millionen Jahre. Wahnsinn. Das schaffen die Menschen nie.
Die Stimme der Chinesin als Echo in meinem Kopf: Das eine. Das für dich bestimmte.
Ich werfe dem Saurier einen Abschiedsblick zu. Die gelben Augen wirken lebendig und wissend. Er weiß Bescheid über mich.
Werfe die Zeitung auf die Fliesen. Plansche mit dem Schaum herum, puste Bläschen in die Luft.
Das Fehlen der Uhrzeit irritiert mich plötzlich.
Steige aus der Wanne, trockne mich hastig ab. Laufe mit nassen Füßen zum Fernseher. Noch eine halbe Stunde.
Ich ziehe mich an. Frische Unterwäsche, frische Strümpfe, frische Jeans. Weiße Bluse. Als hätte ich Geburtstag.
Habe den BH vergessen. Macht nichts. Die Chinesin kennt meine Titten schon.
Ich stecke die Zeitung zurück in den Briefkasten. Sie ist ziemlich feucht geworden. Die Seiten werden zusammenkleben. Vermutlich haftet der Bundeskanzler jetzt an der neuesten Arbeitslosenstatistik. Geschieht ihm recht.
Haftet.
Eltern haften für ihre Kinder. Bundeskanzler für ihre Arbeitslosen.
Die U-Bahn meide ich. Grundsätzlich. Ich gehe zu Fuß durch die Stadt. Die Zeit vergeht schneller, wenn ich laufe. Und ich erspare mir die Angst, in der S-Bahn beim Schwarzfahren erwischt zu werden. Eine Angst weniger.
Ich gehe schnell, den Blick gesenkt. Ich habe einen wichtigen Termin bei einer Chinesin.
*
»Kyra, wo rennst du denn hin?«
Oh nein, nicht jetzt.
»Lex!« Ich bleibe stehen, hebe den Kopf, lächle.
»Ich war bei dir«, sagt er, während wir uns umarmen. »Aber du warst nicht da.« Ich weiß.
»Schön dich zu sehen«, sage ich. Das ist noch nicht mal gelogen. Er ist braun gebrannt. Seine Haare sind jetzt länger. Und heller. Steht ihm. Er kommt aus einem anderen Leben, aus einem anderen Land. Ich will ihn küssen und dann davonrennen. Ich stehe herum und starre ihn an. »Seit wann bist du zurück?«
Fragen, bevor er Fragen stellt. Aber er hört nicht zu.
»Geht’s dir gut? Du siehst müde aus. Wollen wir was frühstücken?«
Ich schaue auf meine Uhr, die seit Tagen die gleiche Zeit anzeigt. »Ich habe einen Termin«, sage ich steif. »Was Wichtiges.«
Lex streift mich mit einem Blick, nickt dann. »Schon okay, Kyrilie. Wir sehn uns.« Sein Mund ist schief; halb spöttisch, halb gekränkt.
Ich kann ihm nichts erklären. Ich will noch eine Umarmung, eine Berührung. Einen Kuss, wenigstens auf die Wange.
Er hebt kurz die Hand, läuft quer über die Straße, ein Wagen hupt. Der Fahrer tippt sich an die Stirn. Lex ignoriert ihn.
Von der anderen Seite winkt er mir zu. Ich winke zurück.
Ich muss verrückt sein. Ihn ziehen zu lassen.
Ich bin verrückt. Ver rückt. Bin ein Pinguin in der Wüste. Ein Kamel am Nordpol.
Lex kann warten. Wird er aber nicht. Nicht auf mich.
Aber es geht jetzt um mehr. Es geht um das eine für mich bestimmte.
Lex, mein Lieber, du verlässt mich zu oft. Zu oft, zu lange.
Ich bin eine Telefonnummer, eine Adresse, eine Wohnung mit Bett, Bad, Wein, Kerze, Küche.
Du bist der unerreichbare Herumtreiber. Der Filou, der Zigeuner, der Abenteurer.
Ich gehe weiter, Schritt für Schritt, Blick gesenkt. Der Medikamentennebel umhüllt mich noch. Es ist mir egal, was um mich her passiert. Es spielt keine Rolle. Ich höre ein schreiendes Baby. Kein Grund aufzublicken. Einen kläffenden Hund. Soll er kläffen.
Die Straßenbahn fährt so dicht an mir vorbei, dass ich ihren warmen Atem spüre. Ich registriere die Gänsehaut im Nacken.
Ist eine Gänsehaut ein Gefühl? Oder nur eine körperliche Reaktion?
Von außen betrachtet sehe ich normal aus. Es ist normal, dass ich niemanden anblicke, der mir begegnet. Die Menschen auf der Straße könnten genauso gut unsichtbar sein. Unsichtbar ihren Hund Gassi führen. Unsichtbar den Kinderwagen vor sich her schieben. Ich betrachte das Bild, das in meinem Kopf entsteht. Die Autos fahren ohne Fahrer. Die Post trägt sich allein ins Haus.
Kein großer Unterschied.
Vielleicht sollten nicht nur afghanische Frauen, sondern alle Menschen mit einer Burka umherlaufen. Es wäre ehrlicher. Einfacher.
Aber womöglich hätte Lex mich dann nicht erkannt.
Was will er nur von mir? Warum kommt er ausgerechnet zu mir?
Nun, er kommt ausgerechnet auch zu anderen. Ich bin kein Special Guest in seinem Leben, nur ein Gast. Er mag Zwiebelkuchen, und ich kann Zwiebelkuchen backen.
Ich biege in eine Seitenstraße ein, laufe an Restaurants vorbei; es riecht nach Knoblauch. Mir fällt ein, dass ich noch nichts gegessen habe. Abgesehen von den Tabletten. Amitriptylinhydrochlorid. Klingt lecker.
Ich überquere einen Spielplatz mit rostigem Klettergerüst. Ein Ball rollt mir vor die Füße. Ich steige umständlich über ihn hinweg. Das Lachen der Kinder interessiert mich nicht.
Hunger ist ein lebensnotwendiges Gefühl. So wie Angst. Aber je länger man fastet, desto weniger spürt man den Hunger. Wenn man sich immer wieder einer Gefahr aussetzt, spürt man dann die Angst weniger?
Vielleicht. Aber vielleicht wird Lex irgendwann überfahren, wenn er einmal mehr das Rot der Ampel ignoriert. Nun, bis jetzt wirkt er reichlich lebendig. Im Gegensatz zu mir.
Das ist es: Wir sind die Gegenpole, die sich anziehen und abstoßen.
So simpel. Zu simpel. Gegenpole gibt es mehr als Steine am Meer. Es kommt auf die Art des Steines an. Es muss schon ein Fossil sein oder wenigstens ein Hühnergott.
Lex, du bist mein Hühnergott. Wenn du das wüsstest.
Ich fange an, mich selbst zu nerven. Laufe schneller, stolpere. Drehe mich um, schäme mich: Da ist kein Stein, kein Riss in der Erde, nichts.
Endlich die Gasse, in die ich gehöre. Keine Sackgasse. Zum Glück. Aber so dunkel, als wäre sie eine. Die Häuser hier wirken schwer und robust, wie mittelalterliche Burgen. Li Ling wohnt im Gartenhaus. Es gibt zwar keinen Garten, aber was macht das schon. Hinterhaus klingt eben nicht so toll.
Vor der Ausfahrt steht ein weißer Lieferwagen, versperrt mir den Weg. Rohrfrei-Sofortservice Tag & Nacht, lese ich, als ich mich an dem Fahrzeug vorbeidrängle. Wir lösen Ihr Problem. 24-Stunden-Notruf. Ein gutes Omen, denke ich. Genau das, was ich brauche.
Ich gehe durch das erste Tor, durch das zweite und bleibe vor dem dritten stehen. Wie in einem Märchen. Jetzt muss ich eine Aufgabe erfüllen. Nur welche?
Klingeln wäre nicht schlecht. Die Haustür steht allerdings einen Spaltbreit offen.
»Come in!«, schreit Li Ling durch das Treppenhaus.
Klingt sie genervt oder bilde ich mir das ein?
Die Stufen knarren unter meinen Schritten. Das Geländer ist marode und wackelt, wenn man es berührt. Im ganzen Haus riecht es nach Li Lings Räucherstäbchen. Der Duft überdeckt den Gestank des feuchten Kellers. Irgendwo fällt ein Werkzeug klirrend zu Boden. Ein Rohr-Frei-Handwerker flucht in gebrochenem Deutsch.
Eine weiße mit goldenen Drachen bestickte Gestalt steht im Türrahmen.
Li Ling behandelt nicht nur Menschen, sie verkauft auch Kimonos. In allen Größen und Farben. Mit den Kimonos verdient sie mehr Geld.