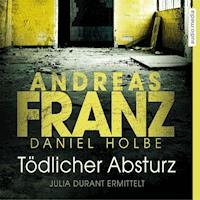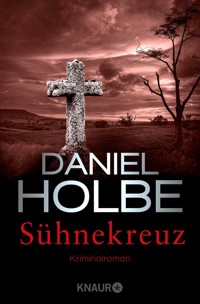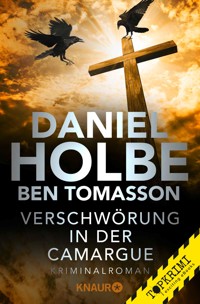
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein spannender Camargue-Krimi um einen ermordeten Archäologen und religiösen Fanatismus von Daniel Holbe und Ben Tomasson Einer Tausende Jahre alten Legende zufolge soll von Les-Saintes-Maries-de-la-Mer in der Camargue aus der christliche Glaube in Europa verbreitet worden sein – was der Archäologe Philippe Clairvaux durch Ausgrabungen in der Krypta der dortigen Kirche wissenschaftlich belegen will. Doch dann wird er ermordet. Capitaine Jacques Maillard, Mordermittler bei der Polizei in Arles, übernimmt den Fall und bekommt Unterstützung von der britischen Archäologin Meredith Bedford, die die Grabungen in der Kirche mit dem Ermordeten durchführen wollte. Beide ahnen nicht, dass sie ins Visier einer geheimen Bruderschaft geraten, die Südfrankreich zum neuen Zentrum der katholischen Kirche machen will … »Verschwörung in der Camargue« von Daniel Holbe und Ben Tomasson ist ein eBook von Topkrimi – exciting eBooks. Das Zuhause für spannende, aufregende, nervenzerreißende Krimis und Thriller. Mehr eBooks findest du auf Facebook. Werde Teil unserer Community und entdecke jede Woche neue Fälle, Crime und Nervenkitzel zum Top-Preis!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Daniel Holbe / Ben Tomasson
Verschwörung in der Camargue
Kriminalroman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Einer Tausende Jahre alten Legende zufolge soll von Les-Saintes-Maries-de-la-Mer in der Camargue aus der christliche Glaube in Europa verbreitet worden sein – was der Archäologe Philippe Clairvaux durch Ausgrabungen in der Krypta der dortigen Kirche wissenschaftlich belegen will. Doch dann wird er ermordet. Capitaine Jacques Maillard, Mordermittler bei der Polizei in Arles, übernimmt den Fall und bekommt Unterstützung von der britischen Archäologin Meredith Bedford, die die Grabungen in der Kirche mit dem Ermordeten durchführen wollte. Beide ahnen nicht, dass sie ins Visier einer geheimen Bruderschaft geraten sind, die Südfrankreich zum neuen Zentrum der katholischen Kirche machen will …
Inhaltsübersicht
Zitat
Proömium
Prolog
Erster Teil
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Zweiter Teil
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Dritter Teil
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Epilog
Nachwort
»Der Sohn Gottes ist in euch. Folget Ihm! Jene, die Ihn suchen, werden Ihn auch finden. Gehet hin und predigt das Evangelium des Königreichs.«
Als Er [Jesus] dies gesprochen, verschwand Er.
Sie [die Jünger] aber waren betrübt, weinten sehr und sagten: »Wie sollen wir zu den Heiden gehen und die frohe Botschaft vom Reich des Menschensohnes verkündigen? Wenn jener nicht verschont wurde, wie werden da wir verschont werden?«
Da stand Maria auf, küsste sie alle und sprach zu ihren Brüdern: »Weinet nicht, seid nicht betrübt und zweifelt auch nicht! Denn Seine Gnade wird mit euch allen sein und euch beschützen. Lasst uns vielmehr Seine Größe preisen, denn Er hat uns bereitet und zu Menschen gemacht.«
Apokryphes Evangelium nach Maria Magdalena
4,34 – 5,3
Proömium
Die drei Männer warteten. Sie trugen seltsame Gewänder, lange, schwarze Roben, die man aus der Entfernung für Kleider hätte halten können, dazu breite, glänzende Schärpen in verschiedenen Farben. Jeder von ihnen hielt etwas in der Hand, nicht erkennbar von seiner Position aus, doch er wusste, worum es sich handelte.
Es waren Geschenke für den, der in dieser Nacht das Licht der Welt erblicken sollte.
Der Prinzipal faltete die Hände und blickte über das weite Land. Rechts von ihm schlängelte sich der kleinere Mündungsarm der Rhône, die Petit Rhône, zum Meer. Der andere, größere, die Grande Rhône, lag gute dreißig Kilometer weiter links. Das Land dazwischen war Sumpfgebiet, aufgeschwemmt von der Erde, den Steinen und dem Geröll, das der Fluss seit Hunderten von Jahren zum Meer spülte, durchsetzt von zahllosen Tümpeln und Lagunen. Vereinzelt standen kleine, mit Ried, dem einheimischen Schilfrohr, gedeckte Häuser, die Cabanes. Sie gehörten zu dieser Landschaft, genau wie die weißen Pferde, die schwarzen Stiere und die rosafarbenen Flamingos.
Doch diese Dinge waren für ihn nicht von Belang. Sein Interesse galt der hereinbrechenden Nacht, der Dunkelheit, die sich langsam über die Sümpfe mit dem hochstehenden Riedgras, den geduckten Büschen und Bäumen und den Reisfeldern senkte, bis auch der letzte rötliche Schimmer im Westen verschwunden war. Nun konnte es nicht mehr lange dauern.
Die drei Männer in den schwarzen Roben waren nur noch Schemen im fahlen Mondlicht, und doch meinte er, ihre Anspannung sehen zu können. Es war dieselbe Mischung aus Ungeduld und freudiger Erwartung, die auch er selbst verspürte.
Die Zeit schien sich auszudehnen. Sekunden wurden zu Minuten, Minuten zu Stunden. Und dann geschah es.
Aus dem Nichts tauchte der Bolide auf, ein prächtiger, ungewöhnlich heller Meteorit, wie er einem nur einmal im Leben begegnet. Wenn überhaupt. Fast über den gesamten Himmel zog sich sein feuriger Schweif, und der Prinzipal glaubte beinahe, ein leises Zischen zu vernehmen. Gebannt stand er da, legte den Kopf in den Nacken und folgte der von hinten kommenden Bewegung über das Firmament in östlicher Richtung.
Ebenso schnell, wie sie erschienen waren, erloschen die Spuren des nächtlichen Spektakels wieder.
Die Männer mit den bunten Schärpen sanken auf die Knie und hoben die gefalteten Hände. Er selbst schloss die Augen und sprach ein rasches Gebet für das Kind. Auf seiner Netzhaut leuchtete noch das Bild, das der Komet auf seiner Bahn am Himmel hinterlassen hatte. Es erschien ihm so grell, dass er sich fast geblendet fühlte.
In den Jahren des Wartens hatte er oft gezweifelt, hatte nicht gewusst, ob das, was sie taten, zum Erfolg führen würde. Doch dieses Zeichen war nicht zu missdeuten. Er spürte, wie ihn eine fiebrige Erregung erfasste.
Nach fast genau zweitausend Jahren war es so weit.
Die Geschichte würde sich wiederholen. Ein neues Licht würde die Welt erhellen. Und er, der Prinzipal, Irenäus, würde es verkünden.
Prolog
Keine Zeit ist besinnlicher als die eines erwachenden Tages. Am Horizont erkämpfte sich ein roter, dunstiger Streifen seinen Platz, und in wenig mehr als einer halben Stunde würde die Sonne aufgehen. Die Nächte in der Provence waren kühl um diese Zeit, und auf die spitzen Blätter der Olivenbäume in der tiefen Ebene am Fuße der Chaîne des Alpilles legte sich sanfter Morgentau. Immer deutlicher traten die schroffen, kahlen Züge des Kalksteingebirges aus der Dunkelheit hervor.
Er schaltete einen Gang herunter und drosselte das Tempo auf der kurvigen Straße von Arles nach Les-Beaux-de-Provence im Herzen des Gebirgsmassivs. Allmählich lösten weißgraue Kalksteinfelsen und grobes Buschwerk die weiten Oliven- und Zypressenhaine im Tal ab, und es ging zunehmend steiler bergan.
Eigentlich fuhr er nicht mehr gern mit dem Wagen, und nach der viel zu kurzen Nacht fühlte er sich ermattet. Aber das, was ihn am Ende des Weges erwartete, würde die Mühe allemal wert sein. Wenn der Mann, der auf ihn wartete, die Wahrheit gesagt hatte, würde er die Antwort auf die Frage bekommen, die ihn seit Monaten umtrieb.
Endlich.
Der Mann in der dunklen Limousine atmete langsam und in einem tiefen Zug durch die Nase ein, hielt kurz inne und ließ die Luft anschließend ebenso langsam durch die geschürzten Lippen entweichen. Der Mann auf dem Weg nach Les-Beaux-de-Provence war an den Büschen, hinter denen er seinen Wagen verborgen hatte, vorbeigefahren, ohne ihn zu bemerken.
Wenn er heute keinen Fehler machte, war ihm in den nächsten Jahren ein steiler Aufstieg gewiss. Seine Mundwinkel bewegten sich unwillkürlich nach oben, als er das Bild vor seinem inneren Auge passieren ließ, doch dann drängte er es zurück. Vorerst musste er sich auf seine Aufgabe konzentrieren.
Er ließ den Motor an und fuhr den Wagen von der Böschung auf den Asphalt. Mit sicherer Hand schaltete er höher und beschleunigte, soweit es die Tücken der geschlungenen Straße zuließen.
Ein erneutes tiefes Ein- und Ausatmen löste die innere Spannung gerade lange genug, um den Blick schweifen zu lassen.
Sie waren ganz allein, zwei dunkle Wagen auf dem Weg durch helles Gestein im ersten Licht des frühen Morgens. Er war die Strecke bereits mehrfach gefahren und hatte sich markante Stellen eingeprägt. Die erste Gelegenheit war nur noch wenige Biegungen entfernt, und er richtete seine ganze Aufmerksamkeit auf seinen Vordermann.
Linker Hand baute sich ein hoher Felsvorsprung auf, um den sich die Straße eng herumwand. Ebenso steil, wie der Felsen nach oben ragte, fiel der Abhang zur Rechten ab. Ein einziges Fahrzeug war ihnen bisher begegnet – und dieses Zusammentreffen lag bereits einige Kilometer zurück.
Seine Hand schloss sich fest um den Knauf des Schalthebels, und einem weiteren tiefen Atemzug folgte die geplante Bewegung. Er schaltete einen Gang zurück und setzte zum Überholen an.
Er war so in seine Gedanken vertieft gewesen, dass er den anderen Wagen nicht bemerkt hatte. Erst als hinter ihm der leistungsstarke Motor aufheulte, entdeckte er ihn im Rückspiegel.
Offenbar fuhr er dem anderen zu langsam, denn der zog neben ihn, obwohl die Straße eng und unübersichtlich war. Er schaute zur Seite und begegnete dem Blick des fremden Fahrers. Obwohl er nicht mehr so gut sehen konnte und die Scheiben des anderen Wagens getönt waren, glaubte er plötzlich, eine Bedrohung zu erkennen.
Kalte Angst erfasste ihn. Er wollte bremsen, um den anderen vorbeiziehen zu lassen, Gas geben, um zu entrinnen. Doch ihm blieb weder für das eine noch für das andere Zeit.
Die dunkle Limousine schwenkte nach rechts. Metall kreischte auf Metall, und er verlor die Kontrolle über den Wagen. Im nächsten Moment raste er auf den Abgrund zu.
Als die Sonne über den Horizont kletterte, lag alles wieder friedlich da. Die Natur erwachte spürbar zum Leben, Vögel zwitscherten aufgeregt in den Bäumen.
Der verunglückte Wagen war gegen einen Felsen geprallt. Auf dem dunklen Blech lagerte sich langsam Tau ab.
Erster Teil
Kapitel 1
Er schaffte es nicht, die Rose auf das Grab zu legen. Der Schmerz packte ihn an der Gurgel und würgte ihn, und der stachelige Stiel glitt ihm aus den Fingern. Die Blume fiel und blieb auf der grauen Granitplatte liegen. Ein paar Blütenblätter lösten sich und wurden im nächsten Moment von einer Brise davongeweht.
Jacques Maillard folgte ihnen mit den Augen, ehe er sich wieder dem Gedenkstein zuwandte.
Julie Maillard. Geboren am 14. Juni 1974. Gestorben am 8. April 2015.
Viel zu früh. Viel zu jung.
Drei Tage nach Ostern war es gewesen, als sie gegangen war, für immer, nicht wiederauferstanden wie einst Jesus. Aber solche Dinge geschahen eben nur einmal.
Sein Kiefer schmerzte bereits, weil er die Zähne so fest zusammenbiss. Er wollte nicht daran denken. Aber er wollte Julie auch nicht loslassen. Das war der Grund, weshalb er einmal in der Woche hierherkam.
»Sie müssen sich Ihrer Trauer stellen«, hatte der Therapeut gesagt, den er damals einige Male aufgesucht hatte. Er hatte ihm nicht helfen können. Jacques hatte sein Mitgefühl nicht ertragen, genauso wenig wie die tränenreiche Trauer von Julies Eltern. Doch zumindest befolgte er seinen Rat, Julie an dem einzigen Ort zu besuchen, an dem er ihr noch nah sein konnte.
Einem Friedhof.
Den Kontakt zu ihren Eltern hatte er verloren. Freunde hatte er nie viele besessen, und auch zu ihnen waren die Verbindungen dünn geworden. Er hatte sich abgekapselt, und nach und nach hatten sie ihre Bemühungen, zu ihm durchzudringen, eingestellt. Der Einzige, der geblieben war, war sein Kollege Michel. Gut zehn Jahre jünger als Jacques selbst und vielleicht deshalb unbekümmerter als die anderen.
Maillard beugte die Knie und rückte die Rose in eine Position, in der die fehlenden Blätter nicht auffielen.
»Ich liebe dich«, stieß er hervor. Worte, die wie Sandpapier durch seine Kehle schrammten.
Abrupt erhob er sich und ging über den Weg zum Ausgang.
Er lief durch die Straßen, ohne irgendetwas zu sehen, über die Rhône-Brücke in die Altstadt und weiter zur Arena. Er mochte das gewaltige Bauwerk mit den unzähligen Arkaden. Mit angezogenen Schultern drängte er sich an den Besuchern vorbei nach drinnen. Der Mann an der Kasse grüßte mit einer knappen Geste. Man kannte ihn hier.
In der Arena überquerte er den großen Sandplatz in der Mitte und stieg auf der gegenüberliegenden Seite die Stufen der Tribüne hinauf. Vorbei an den steinernen Reihen zu jenen, die man in jüngerer Zeit auf Metallgerüsten errichtet hatte. Als er oben ankam, war er ein wenig außer Atem, aber auch beinahe der Einzige, der diese Anstrengung auf sich genommen hatte.
Er setzte sich und ließ den Blick durch das weite Rund schweifen. Er erinnerte sich noch genau. Bei einer ihrer ersten Verabredungen hatte er Julie hierhergeführt. Sie waren die Treppen in den Arkaden hinaufgestiegen und irgendwie auf das Dach der Arena gelangt. Sie hatten nicht recht gewusst, ob es erlaubt war, sie zu betreten, doch außer ihnen waren noch andere Touristen auf dem Dach gewesen, und so waren sie ein Stück auf den Bögen entlanggelaufen. Bis sie bemerkt hatten, dass sie ganz allein waren. Dunkle Wolken waren aufgezogen, bedrohlich aufgetürmt, und dann zuckte ganz in der Nähe ein Blitz. Der nachfolgende Donner brauchte kaum zwei Sekunden bis zu ihnen. Das Gewitter war nur ein paar hundert Meter entfernt. Er hatte Angst bekommen, als er sah, dass Julies halblange, seidig glänzende Haare in der elektrostatisch aufgeladenen Luft zu Berge standen, doch sie hatte nur gelacht.
Seine Julie.
Sie hatte keine Furcht gekannt. Bis zu dem Tag, als dieses verdammte Virus sie erwischt hatte. Aber da war es zu spät gewesen.
Er hatte gebetet und alle Heiligen angefleht, die ihn seit seiner Kindheit begleitet hatten. Er war täglich in die Kirche gegangen und hatte Kerzen für Julie angezündet. Doch es hatte nichts genützt.
Maillard stand auf und ging zurück. Er wollte nicht mehr nachdenken. Er würde in die kleine Bar gehen, die gleich gegenüber der Wohnung lag, in der er seit drei Jahren lebte.
Seit er allein war.
Er würde ein paar Gläser Pastis trinken. Und anschließend würde die Erinnerung an diesem Tag, der ihr Hochzeitstag gewesen war, vielleicht weniger aufdringlich sein. Weniger beklemmend.
Er schlenderte durch die engen Gassen bis zum alten Römerfriedhof Les Alyscamps. Der Schotter auf dem Weg an den alten Steinsärgen entlang knirschte unter seinen Schuhen. Vor einem der mächtigen Sarkophage entdeckte er einen alten Mann, um den sich eine Schar von Zuhörern versammelt hatte. Der Alte – Alexandre, ein Nachname war Maillard nicht bekannt – war beinahe jeden Tag hier und predigte. Jacques blieb für einen Moment stehen.
»Was tut denn der Papst in Rom?«, rief Alexandre. »Hier in der Provence sollte er sein. Hier, wo einst Lazarus und Maria Salome und Maria Jakobäa mit ihren Gefährten an Land gingen, nach ihrer Flucht aus Galiläa, nachdem man Maria Salomes Sohn Jakob hingerichtet hatte, für kein anderes Verbrechen als das, ihren Glauben zu verkünden. Das tobende Meer haben sie überwunden, ihren Häschern sind sie entronnen, und in einer winzigen Barke ohne Segel und Ruder und ohne jeglichen Proviant sind sie hierhergetrieben. Erschöpft und halb verhungert sind sie gelandet, hier, im Delta der Rhône, in der Camargue, und hier sind sie der jungen Sara begegnet, ein Kind fast noch und doch mit den klugen Augen einer Erwachsenen.«
Maillard nickte vor sich hin, ohne es zu merken. Natürlich kannte er die Geschichte, so wie die meisten, die hier lebten.
Die Legende.
Von dem Mädchen Sara, das die Barke erspäht hatte. Das die Schiffbrüchigen mitgenommen hatte zu ihrem Volk. Zigeuner waren es gewesen, Gitans, die wie in jedem Frühjahr ihre Heimat hinter den Bergen verlassen hatten und die Küste hinaufzogen, weil es hier auch in den heißen Sommern fruchtbaren Boden und gutes Weideland gab.
»Von hier aus sind sie losgezogen, Lazarus und seine Jünger Cedonius und Martha und Maximin und Maria Magdalena, nach Marseille – Massilia! – und Lyon – Lugdunum!, um ihre Botschaft zu verkünden«, rief der alte Alexandre. »Und sie begegneten Unglaublichem! Sie trafen auf Menschen, deren Kinder von einem gewaltigen Ungeheuer gerissen wurden, einem Drachen! Nicht weit von hier, in Nerluc, starb ein Kind am Wundfieber, das die Bestie angefallen hatte! Aber Cedonius und Martha retteten die Menschen und besiegten den Drachen!«
Er warf die Arme in die Luft und gestikulierte zum Himmel.
»Danach zogen sie weiter und verbreiteten die frohe Kunde von der Macht Gottes und von Jesus von Nazareth, der sein Leben hingegeben hat, auf dass alle Menschen erlöst werden. Sie tauften und lehrten die einfachen Menschen Lesen und Schreiben. Und seht, was daraus geworden ist! Lazarus wurde der erste Bischof von Marseille, Cedonius der erste Bischof von Lyon und Maximin der erste Bischof von Aix-en-Provence! Und zu Ehren der beiden Marien, Maria Salome und Maria Jakobäa, errichtete man dort, wo sie einst an Land gingen, in Saintes-Maries-de-la-Mer, eine Gedenkstätte, erst einen Altar, dann eine erhabene Kirche! Und für das Zigeunermädchen Sara, die zu Maria Jakobäas treuer Schülerin geworden war, schuf man die Statue, zu der jeder geht, der Hilfe sucht.«
So, wie es auch Jacques getan hatte, als Julie hinter der Glaswand der Quarantänestation im Sterben lag.
»Sie wartet auf euch in der Krypta der Kirche von Saintes-Maries! Die Schwarze Sara gibt euch Kraft!«, rief der Alte. »Seht in ihr Gesicht, und ihr seht die Hoffnung! Lächelt ihr Lächeln, und es wird das eure sein!«
Die Augen des alten Alexandre strahlten, während er seine Botschaft verkündete.
Jacques Maillard wandte sich ab. Für ihn klangen all diese Worte hohl. Er hatte seinen Glauben verloren.
Kapitel 2
Meredith Bedford stach lustlos in das kleine Stück gesalzene Butter. Nicht nur, dass die Butter salzig war, sie musste den Kühlschrank bereits seit Stunden verlassen haben und hatte jede Festigkeit verloren. Keine Eier, kein Bacon, keine Tomaten und kein Toast – stattdessen viel zu kleine und vor Fett triefende Croissants und dazu wahlweise Pfirsich- oder Erdbeermarmelade.
»Café ou chocolat?«
Die höfliche Frage der jungen Hotelangestellten unterbrach Merediths trübsinnige Gedanken.
»Un café au lait s’il vous plaît«, antwortete sie in einwandfreiem Französisch. Sie war immer wieder erstaunt, wie schnell und gut sie sich im Bedarfsfall in diese wohlklingende, aber nicht gerade einfache Sprache einfinden konnte. Wenn ihr das doch bloß bei den hiesigen morgendlichen Essgewohnheiten auch so leichtfiele.
Der Frühstücksraum war gerade groß genug, um acht runde Tische aufzunehmen, an die man mit gutem Willen jeweils vier Personen setzen konnte. Trotz des geöffneten Innenhofs mit weiteren, großzügigeren Sitzmöglichkeiten zog Meredith die in mediterranen Farben gehaltene Enge vor. An den Wänden hingen alte Fotografien des Ortes aus der vorletzten Jahrhundertwende zwischen Gemälden einheimischer Künstler, die Lavendelfelder, weiße Pferde oder Cabanes, die kleinen, riedgedeckten Häuser der Camargue, zeigten.
Meredith fuhr sich mit beiden Händen durch ihr offenes Haar, wie sie es gern tat, wenn sie ins Grübeln kam. Dabei fiel ihr Blick auf ihr schemenhaftes Spiegelbild in einer hinter Glas hängenden Landschaftsskizze, und kurz schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, wie froh sie darüber war, dass ihre Haare mittlerweile rotbraun geworden waren. Als junges Mädchen hatte sie deutlich hellere Haare gehabt, und mit dem leuchtenden Rot und den zahlreichen Sommersprossen hatte sie wie eine typische Irin ausgesehen. Was für ein englisches Mädchen definitiv eine Katastrophe war, und nicht wenige ihrer Schulkameraden hatten sie deswegen gehänselt. Glücklicherweise waren die Sommersprossen irgendwann fast vollständig verschwunden, und das Haar war im Laufe der Zeit dunkler geworden.
Doch darüber wollte sie jetzt nicht nachdenken. Was sie beschäftigte, lag keinesfalls in ferner Vergangenheit, sondern lediglich einige Tage zurück. Vor genau einer Woche nämlich hatte sich ihr Alltag grundlegend verändert, als sie nichtsahnend in ihrem Arbeitszimmer gesessen und sich mit der Gliederung ihrer Dissertation gequält hatte. In einem ernüchternden Moment der Erkenntnis, dass bis zur Abgabe ihrer Doktorarbeit noch sehr viel Zeit ins Land streichen würde, hatte sie dieser Anruf erreicht.
Obwohl sie seit zwei Jahren nichts von ihm gehört hatte, erkannte sie seine Stimme sofort. Philippe Clairvaux. Professor Philippe Clairvaux. Ihr alter … ja, was? Ihre Beziehung zu dem Professor war alles andere als einfach zu beschreiben, sie waren weder enge Freunde – dafür waren sie schon rein altersmäßig zu weit voneinander entfernt – noch einfach nur Kollegen. Auch als Vorgesetzten hatte sie ihn nie empfunden, obwohl sie oft unter seiner Leitung gearbeitet hatte. Aufgeblickt hatte sie allerdings stets zu ihm. Clairvaux war ihr Lehrer, ihr Vorbild, ihr Mentor – er verkörperte all das, was Meredith als junge Archäologiestudentin selbst einmal werden wollte. Damals hatte er ein Jahr lang als Gast in Cambridge doziert, und entgegen aller Vernunft und Ratschläge war sie ihm für ein weiteres Jahr nach Paris gefolgt.
Ihre gemeinsamen Exkursionen mit der Ultraschallausrüstung durch einige der ältesten Kirchen Europas mit aufsehenerregenden Funden und wegweisenden Erkenntnissen waren der Höhepunkt ihres Studiums gewesen. Wann immer Meredith in den darauffolgenden Jahren Rat suchte, war Clairvaux ihre erste Adresse. Heute genoss sie selbst ein gewisses Ansehen in Forscherkreisen, auch wenn ihr Spezialgebiet – evangelistische Überlieferungen durch wissenschaftliche Forschung historisch zu untermauern – nicht dem Mainstream entsprach und sie von einigen Kollegen der Scientific Community eher belächelt wurde.
Sie hatte sich gewünscht, dass Clairvaux ihr Doktorvater würde, doch aus organisatorischen Gründen, die die Kluft zwischen dem Kontinent und der Insel größer erscheinen ließen, als sie tatsächlich war, war das nicht möglich gewesen. Infolgedessen hatten sie einander längere Zeit nicht gesehen, und Meredith war daher außerordentlich überrascht über seine Anfrage gewesen. Philippe Clairvaux bat sie um ein »sofortiges Treffen« in einem kleinen Ort in Südfrankreich, irgendwo an der Mittelmeerküste, im Rhônedelta, jenem urwüchsigen, Camargue genannten Landstrich der Provence. Flugticket, Mietwagen, Unterkunft und Ausrüstung hatte er bereits organisiert. Meredith fühlte sich ein wenig überrumpelt, doch die Freude über seine Bitte überwog ihren Unmut.
Und nun saß sie also in einem kleinen, gemütlichen Hotel in Saintes-Maries-de-la-Mer, und die frische Meeresluft wehte durch die geöffneten Glastüren des Innenhofs zu ihr herein. Das Einzige, was ihr zu einem perfekten Morgen noch fehlte, war ein herzhaftes englisches Frühstück.
Meredith schnitt eines der Croissants in der Mitte durch und bestrich es mit Erdbeermarmelade. Entschlossen biss sie hinein und dachte an den seltsamen Beginn ihrer Expedition.
»Meredith!«
Professor Philippe Clairvaux war ihr mit ausgebreiteten Armen entgegengekommen, als sie aus dem Hotel in die Sonne trat.
Allerdings blieb das auch das Einzige, was er bereitwillig vor ihr ausbreitete. Nach der herzlichen Begrüßung – in seinem drolligen Englisch, grammatikalisch einwandfrei, aber mit einem deutlichen französischen Akzent − gab er sich ausgesprochen geheimnisvoll. Erst als sie nicht lockerließ und mehr oder minder ernsthaft mit ihrer sofortigen Heimreise drohte, erklärte er, dass er nach jahrelangen Antragstellungen und Bittschreiben die Genehmigung für eine umfassende Untersuchung der hiesigen Kirche bekommen habe. Clairvauxʼ übersprudelnder Enthusiasmus erweckte den Eindruck, als wäre ein alter Traum endlich in Erfüllung gegangen. Er schien sich viel von dieser Forschung zu versprechen und dirigierte Meredith so ungeduldig durch die schmalen Gassen, dass ihr kaum Zeit blieb, die hübschen Häuser in Augenschein zu nehmen.
Der Priester, der sie im Pfarrhaus der alten Wehrkirche Notre-Dame-de-la-Mer – einem wuchtigen Sandsteinbau mit umlaufenden Zinnen und einem Wehrturm – erwartete, zeigte dagegen alles andere als Begeisterung. Sein hageres Gesicht wurde lang und länger, während er Clairvauxʼ behördliche Genehmigungsschreiben penibel durchsah, die dem Professor, wie er Meredith auf dem Weg hierher berichtet hatte, just an diesem Morgen von der Post zugestellt worden waren. Schließlich sank der Prêtre bleich auf den nächsten Stuhl.
»Warum um alles in der Welt kommen Sie gerade jetzt und überrumpeln mich mit einem derart widersinnigen und zerstörerischen Vorhaben?«, krächzte er.
Professor Philippe Clairvaux setzte jene freundliche und zugleich ein wenig herablassende Miene auf, die Meredith aus seinen Vorlesungen kannte.
»Sehen Sie, Prêtre Guillaume«, begann er. »Die letzten umfassenden Ausgrabungen in der Krypta Ihrer Kirche fanden vor sechshundert Jahren statt. Sie sind gut dokumentiert, das gebe ich zu, aber die Methoden waren selbst für damalige Verhältnisse völlig unzureichend. Planlos, wenn ich es so nennen darf. Wie Goldwäscher in Alaska, ohne Rücksicht auf Verluste. Heute haben wir nicht nur weitaus, hm, dezentere Möglichkeiten, wir versprechen uns außerdem völlig neue Erkenntnisse. Und das, ohne hier alles kurz und klein zu schlagen.«
»Erkenntnisse welcher Art?«, kam es unwirsch zurück.
»Über die frühe Geschichte des Christentums hier in der Camargue. Dinge also, die auch für die Kirche nicht ganz unwesentlich sein könnten.«
Der Geistliche winkte ab. »Die hiesige Kirche weiß ihre Geschichte auch ohne neue Untersuchungen recht gut zu bewerten. Und Ihre sogenannte Wissenschaft erweist sich dabei eher als Gegenspieler. Unsere Interpretationen wurden in den letzten Jahren durch abenteuerliche Forschungen und Theorien eher in Frage gestellt als unterstützt.«
An dieser Stelle stieg Meredith in das Gespräch ein.
»Prêtre Guillaume, zugegeben, Verschwörungstheorien gibt es immer«, erklärte sie heftiger, als sie es beabsichtigt hatte, und rief sich im Stillen zur Ordnung. »Aber«, fuhr sie etwas verbindlicher fort, »Sie müssten doch auch wissen, dass besonders in den beiden vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Darstellungen der Evangelien historisch und archäologisch in einer Weise untermauert wurden, wie es sich die Amtskirche nicht besser hätte wünschen können. Sowohl, was die Person des Jesus und seiner Apostel angeht, als auch andere, bislang in Frage gestellte Begebenheiten aus der Heiligen Schrift. Und wir haben nichts Gegenteiliges vor, das können wir Ihnen versichern.«
Dem hatte Prêtre Guillaume nichts entgegenzusetzen, und es hätte ihm auch wenig genützt, denn die archäologische Untersuchung der Krypta war von oberster Stelle autorisiert worden, wie Clairvaux Meredith beim Verlassen des Pfarrhauses mit einem verschwörerischen Lächeln versicherte:
»Es ist im wahrsten Sinne des Wortes von ganz oben abgesegnet.«
Sie gingen durch die Straßen an der Arena vorbei zum Hafen, dem Port de Plaisance, und ließen sich im La Cave à Huitres zu einem frühen Abendessen nieder. Vom Fenster aus sah man die zahlreichen Segelboote. Hinter der Kaimauer lag, wie Clairvaux erklärte, ein weiterer der zahlreichen Strände, La Plage des Arènes.
Doch Meredith stand der Sinn nicht nach touristischen Erläuterungen. Sie wollte wissen, warum Clairvaux ausgerechnet der alten Wehrkirche in Saintes-Maries, die weder von außen noch von innen besonders schön war, so beharrlich sein Interesse widmete. Sie konnte sich nicht erinnern, dass er die Kirche je erwähnt hätte.
Philippe Clairvaux lächelte. »Ich nehme an, du hast nicht vergessen, dass es hier in Saintes-Maries-de-la-Mer wie an allen historisch wichtigen Orten, besonders bei denen mit kirchengeschichtlicher Bedeutung, eine unsterbliche Legende gibt? Dass angeblich Lazarus und seine Apostel hier an Land gegangen sein sollen, nach ihrer Flucht aus Jerusalem, wo sie verfolgt wurden. Und dass zu den Gestrandeten auch die beiden heiligen Marien gehörten, denen die Kirche gewidmet ist – wie es ja auch der Name des Ortes bereits sagt. Und dann ist da natürlich noch die alte Tradition der Zigeuner.« Clairvaux sah sie bedeutungsvoll an. »Du erinnerst dich? Die Schwarze Sara? Ich meine, sie in einer meiner Vorlesungen erwähnt zu haben.«
Meredith kramte in ihrem Gedächtnis. Tatsächlich hatte Clairvaux über ein Zigeunermädchen gesprochen, das Lazarus und seine Jünger in Empfang genommen haben sollte. Wenn sie sich richtig erinnerte, war diese Sara später selbst unter Anleitung der Apostel eine Lehrerin für ihr Volk geworden. Aber war da nicht noch etwas gewesen? Meredith runzelte die Stirn. »Sagtest du nicht, dass es zwar entsprechende Reliquien gibt, die diese Legende zu belegen scheinen, aber keinerlei wissenschaftliche Anhaltspunkte für deren Authentizität?«
Clairvaux schlug theatralisch die Hände über dem Kopf zusammen. »Natürlich. Ich hätte mir ja denken können, dass du dir das gemerkt hast. Aber genau diese Art von Beweisen ist doch dein Fachgebiet. Und was ist mit deinem Glauben? Oder ist die ehemals so eifrige Forscherin zur Agnostikerin geworden?«
Meredith musste lachen. »Mein lieber Philippe, ich bin nicht mehr die blauäugige Studentin, die ich einmal war, voller Elan, die Welt der Wissenschaft zu revolutionieren und am Thron der müden Koryphäen zu sägen. Ich habe genügend alte Legenden wissenschaftlich untersucht und festgefahrene Fehlvorstellungen widerlegt, um zu wissen, wo sich eine Forschung lohnt und wo nicht. Ich werde im Herbst neununddreißig Jahre alt und habe noch nicht einmal die Gliederung für meine Doktorarbeit fertig, weil ich den Großteil meiner Zeit bei Ausgrabungen und auf Kongressen verbringe, statt an meinem Schreibtisch zu sitzen. Wenn ich mich eines Tages auf eine Professur bewerben will, muss ich in Zukunft etwas pragmatischer sein, als ich es bisher war.«
»Warum bist du dann überhaupt gekommen?«
Mit dieser Frage hatte Clairvaux sie bewusst aus der Reserve gelockt, denn er kannte Merediths Antwort bereits im Voraus.
Sie hatte daraufhin gelächelt, im Stillen um seine Strategie wissend, und gesagt: »Ich könnte niemals so pragmatisch werden, als dass ich einer von dir geleiteten Exkursion widerstehen könnte.«
Der Eindruck, den Meredith am Nachmittag von der Kirche Notre-Dame-de-la-Mer gewonnen hatte, bestätigte sich, als sie mit Philippe Clairvaux nach dem frühen Abendessen am Hafen erneut hierherkam. Die rund tausend Jahre alte Wehrkirche wirkte wenig festlich und eher wie eine Burg. Was vermutlich gute Gründe hatte, überlegte sie. Dieser Ort musste angesichts seiner geographischen Lage in den vergangenen Jahrhunderten strategisch wichtig gewesen sein.
Clairvaux, der offenbar erriet, was in ihrem Kopf vor sich ging, schmunzelte. »Richtig, meine Liebe«, erklärte er jovial. »An diesem Ort im Rhônedelta haben Römer, Wikinger und Sarazenen Station gemacht und – die einen als Belagerer, die anderen als Plünderer – die einfache Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. Deshalb wird dieses kahle Mauerwerk nicht von schmucken Bögen geziert, sondern von klobigen Zinnen.« Er hob die Hand, wie er es gerne tat, wenn er etwas Beachtenswertes zu verkünden hatte. »Im Inneren der Kirche hatte man sogar eine Quelle aufgetan«, sagte er dann auch und betonte jedes Wort, so wie einst im Vorlesungssaal. »An diesem Ort, der Glaube und Hoffnung so tapfer verteidigte, ließ sich einer Belagerung dadurch lange standhalten.«
Meredith nickte, war aber abgelenkt. Sie war mit dem Professor während ihres Verdauungsspaziergangs, welcher primär dazu dienen sollte, sie in seine Forschungsziele einzuweihen, die enge Treppe hinauf auf das für Besucher zugängliche Kirchendach gestiegen. Dort blieb sie stehen und schaute auf die blaue Unendlichkeit, die sich zwischen den beigegrauen Zinnen ausbreitete. Plötzlich konnte sie sich vorstellen, wie es für die einstigen Beschützer gewesen sein musste. Schon von weitem hatten sie sehen können, wenn sich jemand in böser Absicht der Kirche näherte, ob vom Land oder vom Meer her. Und von hier oben hatten sie das Gebäude und alle, die darin Zuflucht gesucht hatten, gut verteidigen können.
Clairvaux nahm auf einer Bank Platz und bedeutete Meredith, sich zu ihm zu gesellen. Eine Weile saßen sie schweigend im Abendrot, den Blick zwischen den Zinnen hindurch in Richtung Meer gerichtet. Dann begann Clairvaux, ihr die alten Legenden, welche mit der Ortschaft Saintes-Maries-de-la-Mer und ihren Namensgebern, den Heiligen Marien des Meeres, verwoben waren, in Erinnerung zu rufen, und Meredith lauschte ihm mit derselben Aufmerksamkeit, mit der sie schon vor über zehn Jahren seine Vorlesungen verfolgt hatte. Clairvaux war ein begnadeter Erzähler, der Geschichte lebendig werden lassen konnte.
»Vor zweitausend Jahren sah die Gegend hier völlig anders aus«, berichtete er und machte eine weit ausholende Geste, die nicht nur die Kirche und den kleinen Ort Saintes-Marie-de-la-Mer, sondern das ganze umliegende Gebiet umfasste, ausgehend von Arles, wo sich die Rhône in ihre beiden Mündungsarme teilte, bis hinunter zur Küste, wo sich die beiden – die Grand Rhône und die Petit Rhône – mit dem Meer vereinigten.
»In Wirklichkeit verändert das Rhônedelta das Gesicht der Camargue täglich, aber deutlich sichtbar wird dies erst im Laufe der Jahrhunderte«, erläuterte er und wies in Richtung Meer. »Du kannst davon ausgehen, dass die Küstenlinie damals deutlich weiter im Inland verlief, irgendwo dort, wo heute die unzähligen vom Meer abgetrennten Étangs liegen und mit dem angeschwemmten Land eine Moor-, Steppen- und Seenlandschaft bilden. Vor zweitausend Jahren hätten wir hier, wo wir gerade sitzen, ziemlich nasse Füße bekommen.«
Er winkte in nordöstliche Richtung. »Dort, wo heute Port-Saint-Louis-du-Rhône liegt, gab es seinerzeit einen bedeutenden Handelshafen.« Er blinzelte ihr zu. »Wie du sicherlich weißt, war die Rhône einst die wichtigste Wasserhandelsstraße, auf der Schiffe tief ins Inland reisen konnten, und ihre Hauptmündung lag damals genau wie heute bei Port-Saint-Louis.«
Er stand auf. »Genug der Geographie. Du willst wissen, warum ich dir das alles erzähle.«
Meredith erhob sich ebenfalls. »Die Frage drängte sich auf, ja. Aber ich kenne dich lange genug, um zu wissen, dass du deine Gründe für diese Vorrede hattest.«
Philippe lächelte, doch er schien durch sie hindurchzusehen, vielleicht in eine ferne Vergangenheit oder eine ebenso ferne Zukunft. Dann fokussierte sich sein Blick wieder.
»Hier an diesem Strand geschah weit mehr als nur Belagerung und Handel«, sagte er und deutete auf die Steine, auf denen sie standen. »Unter unseren Füßen befindet sich die letzte Ruhestätte der engsten Familienangehörigen von Jesus Christus.« Sein Blick verklärte sich, und seine dunklen Augen versenkten sich in ihre. »Und wir werden sie finden. Wir werden sie ausgraben und damit eine der ältesten und standhaftesten Legenden des Christentums beweisen.«
Meredith kniff die Augen zusammen. War das noch der Philippe Clairvaux, den sie zu kennen glaubte? Der nüchterne Wissenschaftler, der seine Logik immer über Träume und Glauben gestellt hatte? Das fanatische Funkeln in seinen Augen passte nicht zu ihm. Hatte er plötzlich das Gefühl, dass ihm die Zeit davonlief, weil er alt wurde? Oder gab es noch einen anderen Grund, weshalb er sich so in die Marienlegende dieses kleinen Wallfahrtsortes verbiss? Und was wollte der Professor nun genau beweisen?
»Aber es gibt doch bereits Reliquien, die hier alljährlich zur Schau gestellt und verehrt werden. Was erhoffst du dir denn noch? Die Kirche wurde doch schon vor sechshundert Jahren gründlich untersucht, wie du mir erzählt hast. Meinst du nicht, dass man die Knochen gefunden hätte, wenn es noch welche gäbe? Und was die Echtheit der vorhanden Reliquien angeht, so wirst du sie kaum belegen können.« Sie breitete die Hände aus. »Wir wissen doch, wie es ist. Vor fünf-, sechshundert Jahren, als sich jede Gemeinde nach Reliquien verzehrte, um Anerkennung zu finden, tauchten plötzlich an allen möglichen und unmöglichen Orten welche auf. Da gab es einen ganzen Wald von angeblich authentischen Splittern des Kreuzes, an dem Jesus gestorben ist, und es existierten mehr Knochenfragmente eines jeden Heiligen, als man gebraucht hätte, um ihn gleich zweifach zusammenzusetzen. Die Glaubenshändler schreckten ja nicht einmal davor zurück, Ampullen zu verkaufen, die angeblich Tränen oder Schweißtropfen Christi enthielten. Literweise. Du weißt, dass mir immer daran gelegen ist, die Bibelgeschichte mit meiner Forschung nicht zu untergraben, sondern zu untermauern. Aber warum sollte ausgerechnet hier eine solche Sensation ruhen? Und mal angenommen, es handelt sich bei den vorhandenen Reliquien um echte, menschliche Knochen entsprechenden Alters – was genau möchtest du dann noch ausgraben?«
Der Professor sah Meredith einen Moment lang schweigend in die Augen, als müsse er sich sammeln. »Die Menschen hier zelebrieren intensiv ihre Verehrung für Maria Salome und Maria Jakobäa, aber die Kirche unterstützt sie nicht. Sie toleriert die Marienverehrung lediglich – als eine Art Kulthandlung. Die Kirche gesteht weder den hier dokumentierten Wundern noch den überlieferten Biographien der Heiligen, die diese Wunder vollbracht haben, einen Realitätsgehalt zu.«
»Das heißt, aus Sicht der heiligen katholischen Kirche ist die Ankunft von Lazarus und den Marien und die von Saintes-Maries ausgehende Verbreitung des Glaubens durch sie nur ein Märchen?«
»So ist es.«
»Aha.« Meredith fuhr mit der Hand an dem rauhen Sandstein der alten Zinnen entlang. »Und das treibt dich um? Du willst, dass die Kirche die Marienlegende als reales Geschehen anerkennt?«
Clairvaux trat neben sie. »Ich will, dass die Geschichte die Anerkennung bekommt, die sie verdient.«
Meredith studierte nachdenklich seine Miene. Natürlich war das ein legitimes Motiv. Aber die Untermauerung biblischer Erzählungen durch historische Fakten war eigentlich ihr Spezialgebiet. Was erklärte, weshalb Clairvaux sie zu seinem Projekt dazugebeten hatte, aber nicht, wieso er selbst plötzlich dieses Interesse verspürte. Bisher hatte seine Forschung nicht der Heiligen Schrift, sondern den Geschichtsbüchern gegolten. Die Bibel war für ihn immer ein Druckwerk mit schönen und lehrreichen, gleichwohl aber nicht allzu ernstzunehmenden Legenden gewesen. Was ihn interessierte, war, wie es in der Kirchengeschichte tatsächlich zugegangen war. Er liebte den Diskurs und, mehr noch, den Disput mit den Kollegen, und nichts bereitete ihm größere Freude, als fehlerhafte Darstellungen in deren Werken zu korrigieren. Doch jetzt hatte er offenbar seine Meinung geändert.
»Warum, Philippe? Und warum ausgerechnet jetzt?«, fragte Meredith.
Professor Clairvaux lehnte sich zwischen zwei der mannshohen Zinnen und schaute zum Meer. Ohne den Blick aus der Weite des Abendrots zu lösen, sagte er: »Es hat etwas mit den Forschungen zu tun, die ich seit mehreren Jahren in Südfrankreich durchführe.«
Meredith erwiderte nichts. Was hätte sie auch sagen sollen?
Er spürte ihre Skepsis und wandte sich zu ihr. »Allerdings«, fügte er hinzu, »habe ich auch ein persönliches Interesse daran, Klarheit in dieses Mysterium zu bringen.«
Meredith legte fragend den Kopf schief. Der Professor räusperte sich.
»Ich habe vor kurzem endlich erfahren, wer mein Vater war«, erklärte er und sah sie bedeutungsvoll an. »Er war vor vielen Jahren Priester hier in dieser Gemeinde.«
Meredith durchforstete jeden Winkel ihres Gedächtnisses, doch ihr fiel einfach nichts ein. In all den Jahren, die sie ihn kannte, hatte Professor Philippe Clairvaux nie über seine Eltern gesprochen, und Meredith hatte sich auch nie Gedanken darüber gemacht. Sie hatte in ihm stets den weisen alten Mann gesehen, der über ein unglaublich reichhaltiges Wissen über die Geschichte des alten Europas und der Kirche verfügte und dessen dunkle Augen zugleich eine jugendliche Neugier und Begeisterung ausstrahlten, wenn er über sein Fachgebiet sprach.
Aber natürlich war auch Clairvaux einmal jung gewesen.
Sie betrachtete ihn aufmerksam, und erst jetzt fiel ihr auf, dass zumindest ein Elternteil fremdländische Wurzeln gehabt haben musste. Selbst für einen Südfranzosen war Clairvauxʼ Haut eine Nuance zu braun, seine Augen eine Spur zu dunkel.
Sie hätte ihn gern danach gefragt, aber so nah waren sie einander trotz all der Jahre, die sie nun schon freundschaftlich verbunden waren, nie gekommen. Sie wusste nicht so recht, wie sie auf seine Eröffnung reagieren sollte.
»Du hast also deinen Vater nie kennengelernt?«, schien noch das Unverfänglichste.
»Nein. Leider.«
Die Sonne verschwand hinter dem Horizont, und schwarze Wolken, die aus dem Nichts gekommen zu sein schienen, verschluckten das letzte Abendrot. Clairvaux wandte sich der Treppe zu und stieg wieder hinunter, Meredith folgte ihm.
Sie ging neben ihm her durch die verwinkelten Gässchen des alten Ortskerns und wartete darauf, dass er mit seinen Erklärungen fortfuhr, doch Clairvaux schwieg.
»Warte bis morgen«, sagte er, als sie an der Kreuzung zur Rue Camille-Pelletan angelangt waren. »Ich muss noch ein paar Dinge überprüfen. Danach erkläre ich dir alles.«
Meredith fiel es schwer, ihre Ungeduld zu zügeln – Warten gehörte nicht zu ihren Stärken –, doch was blieb ihr übrig?
Da der Professor es vorgezogen hatte, sich ein Zimmer in einer Pension in der Nähe des Étang des Launes kurz vor dem Ortseingang von Saintes-Maries zu nehmen, trennten sich ihre Wege, als Meredith in Richtung ihres Hotels schlenderte.
Dort angekommen, lief sie kurzentschlossen weiter zum Meer und setzte sich an der Promenade auf eine Bank, um die Luft zu genießen, die hier trotz der frühen Zeit im Jahr lau war. Daheim in England wäre es weitaus kühler.
Meredith sah hinauf in den dunkler werdenden Himmel, an dem die ersten Sterne zu sehen waren. Anders als in der Stadt beeinträchtigte hier keine Lichtverschmutzung den Anblick, der schon vor Tausenden von Jahren derselbe gewesen sein musste. Meredith spürte mit einem Mal, wie sehr sie es genoss, hier zu sein.
Am nächsten Tag also würde es losgehen, und sie würde einen gewissen Alain kennenlernen, Philippe Clairvauxʼ neuen Forschungspartner, einen jungen Mann, der sich exzellent mit dem technischen Equipment auskannte, wie der Professor betont hatte. Meredith war nicht wenig erstaunt über diese Eröffnung gewesen. Früher hatte sich Clairvaux mit Händen und Füßen gewehrt, wenn ihm jemand einen Arbeitsschritt abnehmen wollte – und war es auch nur der unbedeutendste Handgriff.
»Früher hatten wir auch nur Hacken, Pinsel und Vergrößerungsgläser«, hatte Clairvaux mit einem Schmunzeln erwidert. »Und wie läuft es heute? Wir rücken der Geschichte mit Hightech-Artillerie zu Leibe. Mal abgesehen davon, dass ich von vielen dieser Gerätschaften nicht einmal die Namen aussprechen kann – herumschleppen werde ich sie jedenfalls nicht mehr. Das hat sich die Jugend verdient.«
Mit einem schelmischen Seitenblick fügte er abschließend hinzu: »Außerdem dachte ich, es würde dich freuen, wenn ich dir einen netten jungen Mann zur Seite stelle.« Er zwinkerte ihr zu. »Wenn ich ehrlich sein soll: Alain erinnert mich manchmal sehr an eine gewisse Studentin, die ich zu meinen besten Zeiten unterrichten durfte.«
In dieser Nacht schien derselbe Mond auf dasselbe Meer, wie es schon vor zweitausend Jahren gewesen war. Aus dem Hafen von Marseille fuhren Fischerboote hinaus, und in einem moderigen Keller eines heruntergekommenen Hauses in dem ziemlich verwahrlosten Hafenviertel trafen sich fragwürdige Gestalten. Es waren Männer südländischen Antlitzes, und sie fielen niemandem auf, denn man achtete in dieser Gegend nicht auf andere. Einer von ihnen hatte in den frühen Morgenstunden auf einer Serpentinenstraße durch die Alpilles einen anderen Wagen in den Abgrund gedrängt.
Meredith blickte versonnen aus dem Fenster des Frühstücksraums. Clairvauxʼ Enthüllung lag ihr nicht weniger schwer im Magen als das französische Frühstück. Sie brannte darauf, mehr über den Priester zu erfahren, der sein Vater gewesen war. Doch Clairvaux hatte sie vertröstet, und weil Privates zwischen ihnen seit jeher kein Thema gewesen war, war sie nicht weiter in ihn gedrungen. Doch sie würde es nicht dabei bewenden lassen. Immerhin stand Clairvauxʼ Familiengeschichte ja in irgendeinem Zusammenhang mit der geplanten Grabung und dem Geheimnis, das der Professor daraus machte.
Sie warf einen Blick auf die WetterApp auf ihrem Smartphone und entschied sich für einen Spaziergang am Strand. Bis zu ihrem Treffen mit Clairvaux an der alten Wehrkirche blieb noch über eine Stunde Zeit.
Sie durchquerte den Eingangsbereich des Hotels und trat durch die Glastür auf die Straße. Ihre Augen glitten über die Fassaden der Häuser in der Rue Camille-Pelletan. Alte Steine, gestrichen in Weiß oder dem hellen, mediterranen Terrakotta. Dazu ein milder Wind, der einen leichten Duft nach Baumharz zu transportieren schien, und ein Flair, wie sie es von Reisen in die Toskana kannte.
Meredith ging die schmale Straße bis zum Meer. Sie überquerte den riesigen Parkplatz, auf dem zu dieser frühen Stunde nur wenige Wagen standen, und gelangte über die Promenade zum Strand. Mit dem tiefblauen Meer und den pittoresken weißen Häusern mit den roten Ziegeldächern erinnerte er sie an Filmaufnahmen von Touristenorten aus den sechziger oder siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Kurzentschlossen zog sie ihre Schuhe aus und folgte der Wasserlinie, die sich in Bögen von einer Buhne zur nächsten zog. Die Wellenbrecher sahen aus wie riesige, aus Steinen geformte T-Stücke. Nicht besonders schön, aber sie schützten den feinkörnigen Sand vor dem Abtrag und milderten die Wogen.
Während Meredith genauso nah am Wasser lief, dass die sanft auslaufende Brandung ihre Zehen umspielen konnte, herrschte andernorts helle Aufregung: Ein deutsches Rentnerehepaar hatte bei seiner Fahrt nach Les-Baux-de-Provence ein Autowrack entdeckt.
Kapitel 3
Capitaine Jacques Maillard hätte sich den Start in die neue Woche weniger spektakulär gewünscht, und um ehrlich zu sein, hatte er auch nichts anderes erwartet. Hier im Hinterland passierten zurzeit keine schlimmen Dinge, und die »wahren Verbrecher« zog es ohnehin eher nach Marseille als nach Arles. Hätte ein eifriger Brigadier nicht mehr oder weniger zufällig herausgefunden, dass es sich bei den am verunglückten Fahrzeug befindlichen Nummernschildern um kürzlich gestohlene handelte, und hätte sein ebenso eifriger Brigadier-Major ihn daraufhin nicht herbeigerufen, so würde nun jemand anders in der Einöde herumklettern. Früher hätte er sich über die Aufmerksamkeit der Kollegen gefreut, doch jetzt wünschte er, er könnte stattdessen an seinem Schreibtisch sitzen und zusehen, wie sich die Morgensonne in den Fensterscheiben der alten Arleser Gemäuer spiegelte.
Das Modell des Wagens, ein schwarzer, schon etwas in die Jahre gekommener Peugeot, war nicht auf den ersten Blick zu identifizieren. Glücklicherweise hatte man den Fahrer bereits aus dem Fahrzeug herausgeschnitten, und der Capitaine musste nur das Gesicht der vom Aufprall entstellten Leiche in Augenschein nehmen. Den Körper hatte man mit einem weißen Tuch bedeckt.
Es war ein Mann im fortgeschrittenen Alter, sicher über sechzig, vielleicht auch schon über siebzig. Die Umrisse, die sich unter dem Tuch abzeichneten, zeigten einen durchschnittlichen, in der Tendenz eher schmalen und langen Körperbau. Die Gesichtszüge waren unauffällig, der graue Schnurrbart und die buschigen Augenbrauen nicht ungewöhnlich für einen Mann seines Alters. Was allerdings auffiel, waren der deutliche Braunton der Haut und die ungewöhnlich dunklen Augen des Toten. Maillard fragte sich, ob es das weiße Tuch war, das diesen Eindruck verstärkte, oder ob es tatsächlich Vorfahren aus weiter südlich gelegenen Gegenden gab. Er beugte sich vor und entdeckte ein kleines, silbernes Kruzifix, das an dem groben Leinensakko steckte.
Maillard verzog den Mund. Offenbar war der Tote gläubig gewesen, doch genützt hatte es ihm nichts.
Der Allmächtige war wohl gerade anderweitig beschäftigt gewesen, als der alte Mann ihn in der gefährlichen Kurve so dringend gebraucht hätte.
Wieder einmal.
Seit Julies Tod kamen ihm solche zynischen Gedanken häufiger und ohne dass er sie steuern konnte. Julie war Ärztin gewesen, war nach einer steilen Karriere am Schweizer Tropeninstitut nach Marseille zurückgekehrt und hatte sich dort der Forschung verschrieben. Ein unbekanntes Virus aus einem afrikanischen Krisengebiet hatte sie und einen Kollegen infiziert. Der Kollege überlebte. Julie starb einen einsamen Tod hinter zentimeterdickem Glas.
Maillard atmete tief durch und schob die Erinnerungen, die über ihn hereinfluteten, zurück in den hintersten Winkel seines Gedächtnisses. Langsam löste er den Blick von dem Toten und schaute über die gewundene Straße auf die Kalksteinformationen der Alpilles, die rechts und links von ihm aufragten.
Er liebte das Land, in dem er aufgewachsen war. Die Farben, die Düfte, die vielfältige Landschaft, teils schroff, teils lieblich, und die Atmosphäre, dieses starke Gefühl von Freiheit, Liberté, all das, weshalb Touristen aus aller Welt herkamen, war seine Heimat. Doch heute war etwas anders. Über dem morgenfrischen Aroma von Pinien und Zypressen lag der Geruch von Öl, Benzin und verbranntem Gummi.
»Nun, was genau liegt hier vor?«, fragte er den Brigadier-Major, der ihn angerufen hatte. Der nahm unwillkürlich Haltung an. Das Militärische lag allen Polizisten Frankreichs im Blut, selbst wenn sie sich einem Kollegen in Zivil gegenübersahen. Einem höhergestellten Kollegen.
»Wie gesagt: Zunächst wirkte alles wie ein ganz normaler Unfall«, erklärte der Brigadier-Major, »aber während der Notarzt und die Feuerwehr tätig waren, haben wir die Zulassung überprüft und festgestellt, dass die Nummernschilder vor einigen Tagen als gestohlen gemeldet wurden. Und dann schauen Sie sich diesen Toten an. Mal abgesehen davon, dass ich mir an seiner Stelle nicht so ein altes Auto gestohlen hätte, sieht dieser Mann nun wirklich nach allem anderen aus als nach einem Autodieb oder überhaupt nach einem Kriminellen.«
»Bien.« Capitaine Maillard gab sich geschlagen. Als junger Lieutenant war er genauso gewesen, und dies hatte ihm schließlich zu seinem zügigen Aufstieg verholfen. »Gibt es Bremsspuren? Und was ist mit der Identifizierung?«
Der Brigadier-Major setzte eine ernste Miene auf. »Nichts«, erklärte er düster. »Ich will der Spurensicherung natürlich nicht vorgreifen, aber auf den ersten Blick sieht es nicht so aus, als hätte der Fahrer versucht zu bremsen. Und es gibt keine Hinweise auf seine Identität. Keine Brieftasche, keine Ausweise, kein Geld. Die Brieftasche könnte natürlich zwischen die Sitze gerutscht sein. Aber wir wollten, wie gesagt, der Forensik nicht vorgreifen.«
Maillard signalisierte mit einer knappen Geste, dass dieses Vorgehen in seinem Sinne war. Auch er wollte keine Spuren zerstören. Nur einen kurzen Blick auf das Wrack werfen …
Vorsichtig und ohne etwas zu berühren, beugte sich Maillard in die herausgeschnittene Öffnung an der Stelle, wo einmal die Fahrertür gewesen war. Er zog eine kleine Taschenlampe hervor und leuchtete in alle Zwischenräume, vom gewellten Teppich im Fußraum bis hin zu den zerdrückten Armaturen. Außer einem leeren Notizblock mit gelben, selbstklebenden Zetteln – einem dieser Exemplare, die man als Werbegeschenk bekam und in der Regel nie benutzte – entdeckte auch er keinerlei persönliche Gegenstände. Nicht einmal eine Straßenkarte, ein Serviceheft oder eine Tankquittung konnte er ausmachen.
Selbstverständlich würde das Fahrzeug von der Kriminaltechnik noch einer deutlich penibleren Untersuchung unterzogen werden. Doch Maillard hatte das ungute Gefühl, dass man auch dort nichts Weiterführendes finden würde.
Kapitel 4
Jacques Maillard schaute gedankenverloren aus dem Fenster seines Büros, als das Telefon klingelte. Es war Michel Duphet, sein Ansprechpartner in der Kriminaltechnik.
»Dürftig«, sagte dieser nach einer knappen Begrüßung. »Selten so karge Beweismittel gesehen.«
Das Fahrzeug des Verunglückten war kein Mietwagen gewesen, davon konnte zumindest ausgegangen werden, nicht zuletzt wegen der falschen Nummernschilder. Für einen Privatwagen jedoch, vor allem einen in diesem Alter, hatte es erstaunlich wenig persönliche Dinge gegeben.
»Neben den üblichen Papierschnipseln, die sich im Laufe eines Autolebens im Fußraum sammeln, und dem gelben Haftnotizblock, den du schon gesehen hast, gab es nichts außer einem Bleistiftstummel mit Radiergummi, einer angebrochenen Packung Hollywood-Kaugummis und einem Kugelschreiber, den die Kollegen zwischen den Polstern der hinteren Sitzbank hervorgeangelt haben.« Er schnaubte leise. »Ich habe schon Neuwagen gesehen, die mehr hergegeben haben.«
Eine berechtigte Feststellung, wenn auch eine, die für die weiteren Ermittlungen nicht von Belang war.
»Ich wollte dir auch nur sagen, dass der Wagen jetzt bei den Kollegen in der Werkstatt ist«, fuhr Duphet fort. »Vielleicht gibt ja zumindest das Fahrzeug selbst etwas her.«
»Ja. Das hoffen wir«, sagte Maillard und legte auf, ohne sich zu verabschieden. Eine Marotte, die dem einen oder anderen sauer aufstieß. Michel allerdings war daran gewöhnt und nahm es ihm längst nicht mehr krumm. Er würde verstehen, dass es Maillard nach draußen zog. Das Büro war eng und stickig, er hasste Klimaanlagenluft, und er wusste, dass er in dieser Umgebung nicht weiterkommen würde. Also würde er sich deutlich früher als gewöhnlich auf den Weg zum Mittagessen machen – immerhin hatte der morgendliche Anruf sein Frühstück nach den ersten Schlucken lauwarmen Kaffees unterbrochen und ihm kein Sättigungsgefühl gegönnt.
Eine Viertelstunde später saß Jacques Maillard in einem der wenigen Bistros, in denen man eine vernünftige Mahlzeit zu angemessenem Preis erhalten konnte, und schaute durch das Fenster auf den Platz vor dem Portal von Saint Trophime. Zumindest die Hälfte der Menschen, die dort entlangliefen, waren keine Einheimischen, das erkannte man an den umgehängten Kameras oder den aufgeblätterten Stadtplänen. Die Touristen fielen das ganze Jahr hindurch scharenweise über Arles her, auch außerhalb der Saison. Die alte Römerstadt hatte einiges zu bieten: Neben der zweitausend Jahre alten Kultur fand man hier künstlerische Inspiration, und Arles war zudem ein Mekka für Van-Gogh-Pilger. Immerhin hatte der Maler zwei Jahre seines Lebens hier verbracht, und einige seiner bekanntesten Bilder zeigten Motive aus Arles und der näheren Umgebung. Maillard mochte besonders das Nachtcafé und die Brücke von Langlois. Auf der anderen Seite traf man auf dementsprechend viel Kult und Kitsch. Die Einheimischen schätzten jedoch genau wie Maillard selbst die trotz aller touristischen Ausbeute noch vorhandenen ruhigen, besinnlichen Plätze, die sich das Flair von südfranzösischer Gelassenheit und Lebensart bewahrt hatten.
Maillard betrachtete die Kirchenfassade aus hellem Stein und das beeindruckende Portal, die erhabenen Säulen mit dem Dach, darin eingefasst die hölzerne Doppeltür unter dem romanischen Bogen. Obwohl er sich über die Mahlzeit eine Pause von seiner Arbeit gönnen wollte, kehrten seine Gedanken immer wieder zu dem seltsamen Unfall zurück. Noch nie hatte sich ein Unfallopfer nicht identifizieren lassen – immerhin gab es eine Ausweispflicht, und Wagenpapiere fand man auch in den heruntergekommensten Fahrzeugen. Zumindest im Hinterland war das so, wo es kein organisiertes Verbrechen oder diese großstädtische Niedertracht gab.
Er griff zu seinem Handy.
»Haben Sie das Fahrzeug bereits identifizieren können?«, fragte er, nachdem die Verbindung hergestellt war. Irgendwie musste man das Blech doch so weit entfalten können, dass man an eine der Fahrgestellnummern kam. Der Polizeimechaniker erklärte ihm ausführlich, warum man dies bislang nicht bewerkstelligen konnte, doch zumindest versprach er im gleichen Atemzug einen baldigen Erfolg.
»Bien«, sagte Maillard und winkte dem Kellner, ihm einen Mokka zu bringen. »Sie erreichen mich unter diesem Anschluss. Und, bitte: Geben Sie mir irgendetwas, mit dem ich arbeiten kann.«
Kapitel 5
Der schwarze Peugeot 405 hatte es den Mechanikern nicht leichtgemacht. Den ersten Versuch, die Identifizierungsnummer aus dem Motorraum zu bergen, hatten sie zugunsten der zwei weiteren üblichen Positionen schnell aufgegeben. Zu sehr war die Front des Fahrzeugs zusammengeschoben worden, als es nach seinem Absturz gegen einen Felsen geprallt war. Ebenso schwierig stellte sich die Suche zwischen den Sitzen dar, da auch hier zunächst das darüberliegende Metallgestänge entfernt werden musste. Dies wiederum war nur unter Einsatz schweren Geräts möglich, weil sich kaum noch eine Schraube bewegen ließ. Also ruhte alle Hoffnung auf der dritten Position im Heck des Fahrzeugs, und tatsächlich waren die Aussichten gut, dass sich das gesuchte Stück Metall in Kürze freilegen ließ. Capitaine Maillard würde erfreut sein.
Einen weiteren und äußerst bemerkenswerten Fund immerhin hatte der Techniker bereits jetzt zu vermelden, und er wählte die Nummer, die Maillard ihm durchgegeben hatte.
Der Capitaine hatte die Rückkehr in sein Büro noch eine Weile hinauszögern wollen und sich deshalb zu einem Verdauungsspaziergang durch die Arleser Altstadt entschieden. Nun stand er vor der Arena, zu der ihn eine heimliche Macht immer wieder zog.
»Und das ist sicher?«, erkundigte er sich.
»Absolut«, berichtete der Mechaniker. »An der linken Seite des Fahrzeugs befinden sich frische Schrammen, die nicht vom Absturz oder Aufprall herrühren. Und wir konnten Lackpartikel sicherstellen. Sie haben zwar eine ähnliche Farbe wie das Unglücksfahrzeug, stammen aber nicht von diesem.«
Maillard blickte an dem Rund mit den steinernen Bögen empor.
»Das heißt, an dem Unfall war ein zweiter Wagen beteiligt?«, fragte er nach.
»Daran besteht kein Zweifel«, versicherte der Techniker. »Die Frage ist nur, ob ihn der andere aus Versehen oder mit Absicht gerammt hat.«
»Danke.« Maillard beendete das Gespräch und dachte nach.
So wenig Interesse er daran gehabt hatte, die Sache zu übernehmen, so sehr beschäftigte ihn der Fall jetzt.
Woher war der alte Mann gekommen? Wohin hatte er gewollt? Hatte ihn jemand vorsätzlich von der Straße gedrängt? Oder war es ein Unfall gewesen, dem eine Fahrerflucht gefolgt war, begangen in der Panik des Augenblicks, ausgelöst von der Angst vor den Konsequenzen eines Moments der Unachtsamkeit, der ein ganzes Leben verändern konnte?
Der ein Leben beendet hatte.
Doch im Moment gab es nichts, was Maillard tun konnte. Solange sie nicht wussten, wer der Halter des verunglückten Wagens war. Solange der Fahrer nicht identifiziert war. Solange die Spuren, die man hoffentlich aus den Schrammen auf der Fahrerseite des Unfallwagens extrahieren konnte, sie nicht zu dem anderen Wagen führten, der an dem Unglück beteiligt gewesen war.
Die falschen Nummernschilder, das hatten die Kollegen von der Gendarmerie herausgefunden, gehörten zum Privatwagen eines Arleser Bäckers. Der Besitzer hatte zum Zeitpunkt des Unfalls in seiner Backstube gestanden, das hatten seine beiden Lehrlinge bezeugt. Und es gab keinen Grund, ihrer Aussage zu misstrauen. Es war eine Sackgasse, genau wie die bisherige Suche nach Vermissten. Niemand war als vermisst gemeldet worden, der auch nur entfernte Ähnlichkeit mit dem Toten hatte. Aber dafür war es möglicherweise auch zu früh. Solange eine Person weniger als vierundzwanzig Stunden abgängig war, wurde keine Anzeige aufgenommen.
Das Einzige, worauf sie derzeit berechtigterweise hoffen konnten, war, anhand der Fahrgestellnummer des Unfallwagens den Eigentümer zu ermitteln.
Bis dahin war er verdammt zu warten. Doch so erstrebenswert ihm dieses Verweilen in der Leere zwischen dem Schmerz der Vergangenheit und jenem der Zukunft am Morgen noch erschienen war, nun hatte ihn der Tatendrang erfasst.
Er schob sein Handy zurück in die Tasche und machte sich auf den Weg in das Forensische Institut.
Der junge Mann lehnte lässig am Kirchenportal. Er trug verwaschene Jeans, und seine dunklen Haare fielen ihm fast bis auf die Schultern. Als er Meredith entdeckte, löste er sich von der Mauer und kam auf sie zu.
»Salut, Mademoiselle Bedford! Schön, Sie kennenzulernen!«, begrüßte er sie lächelnd und streckte im Entgegenkommen die Hand zum Gruß aus.
»Monsieur Alain, vermute ich?«, erwiderte Meredith während des kurzen Händedrucks, etwas verwundert, dass er sie offenbar ohne Schwierigkeiten erkannt hatte. Wahrscheinlich hatte der Professor seinem Protegé ein Bild aus einem ihrer Artikel gezeigt. Und hoffentlich hatte Alain den zugehörigen Artikel dann auch gelesen.
»Wollen wir schon hineingehen, oder möchten Sie draußen auf Professeur Clairvaux warten? Ich dachte, Sie bringen ihn gleich mit.«
»Nein, wir wohnen nicht im selben Hotel.« Sie dachte kurz nach. »Lassen Sie uns hineingehen und Prêtre Guillaume begrüßen. Er ist nicht sehr angetan von unserem Vorhaben. Da kann es nicht schaden, wenn wir zumindest die Gebote der Höflichkeit befolgen«, schlug sie vor.
Gemeinsam mit Alain und Prêtre Guillaume betrat sie eine Viertelstunde später zum ersten Mal die Krypta, in der die Grabungen stattfinden sollten. Sie war nicht besonders romantisch veranlagt, doch der Anblick entlockte ihr ein tief berührtes »Oh!«.
Natürlich hatte Clairvaux ihr verraten, dass hier unten die Statue der Sara stand, jener Zigeunerin, die der Legende zufolge vor zweitausend Jahren die Ankunft der Apostel in ihrer Barke entdeckt haben sollte und später selbst eine christliche Lehrerin für ihr Volk geworden war. Meredith hatte nicht weiter darüber nachgedacht, wie diese Statue wohl aussehen würde, doch wenn, hätte sie sich ein kleines, braunhäutiges Mädchen mit ungebändigtem, struppigem Haar vorgestellt. Was sie definitiv nicht erwartet hatte, war, dass diese Statue so schön war.
Sara war schwarz wie eine Afrikanerin, und sie war kein Mädchen, sondern eine erwachsene, stolze Frau. Sie trug ein prächtiges Gewand, behängt mit zahlreichen Schals und Tüchern in Rot, Weiß und Gold und einen kostbaren Umhang in gelben, roten und blauen Pastelltönen. Auf dem pechschwarzen Haar saß eine reichverzierte, silberne Krone. Die ebenfalls schwarzen Augen wirkten nahezu lebendig. Wissend, großmütig und mitfühlend schienen sie in die Welt zu blicken.
Meredith ließ sich von dem Anblick verzaubern, ehe sie zurück zu Clairvauxʼ jungem Kollegen ans Tageslicht trat.
Die Sonne schien ihr warm ins Gesicht, und eine milde Brise zog vom Meer herüber. Meredith spürte, wie die Vorfreude von ihr Besitz ergriff. Es war genau wie damals, als sie als Studentin mit Clairvaux auf Expedition gegangen war. Die Ausgrabungen mit ihm gehörten zu ihren liebsten Erinnerungen. Und nun durfte sie etwas in dieser Art noch einmal erleben. Ein Glück, dass sie seiner Einladung gefolgt war.
Sie blickte zu dem Fahrzeug, das Alain auf dem Vorplatz der Kirche abgestellt hatte.
In der geöffneten Tür des reichlich abgetakelten Transporters konnte sie Paletten und Koffer mit den unterschiedlichsten Gerätschaften erkennen. Das meiste davon war ihr vertraut – zumindest theoretisch, denn ihre letzte Exkursion dieser Art lag schon geraume Zeit zurück, und die Technik kannte ja bekanntlich keinen Stillstand.
Unter den misstrauischen Blicken von Prêtre Guillaume schleppte Alain alles hinab in die Krypta, nachdem er Meredith verboten hatte, bei den schweren Teilen der Ausrüstung mit anzupacken. Sie trug zwei Notebooks und meterweise Kabel in verschiedener Stärke und Farbe und fühlte sich irgendwie herabgewürdigt. Traute er ihr das Heben nicht zu, oder hatte er Angst um seine teuren Geräte?
Aber dann entschied sie, dass sich Alain ruhig abschuften sollte – wenn er ihr damit spätere Rückenschmerzen ersparte, konnte ihr das nur recht sein. Lediglich eines störte: Selbst als alle Ausrüstungsgegenstände in die Krypta befördert worden waren, warteten sie noch immer auf den Professor.
Michel Duphet war ein typischer Junggeselle Anfang dreißig, immer ein wenig unsortiert und mit einem Kalender voller Rendezvous und geheimnisvoller Termine, von denen – wie böse Zungen behaupteten – über die Hälfte frei erfunden war. In der Tat galt der größte Teil seiner liebevollen Zuwendung seinen elektronischen forensischen Gerätschaften, und man erlebte ihn selten ausgeglichener als vor dem überdimensionalen Flachbildschirm seines Computers.
Von jenem blickte er auf, als Capitaine Maillard durch die Glastür stürmte.
»Jacques? Was tust du hier? Ich habe dir doch gesagt, dass wir nichts haben.« Er deutete auf die Arbeitsplatte, auf der die mageren Fundstücke aus dem Unfallwagen ausgebreitet lagen. »Oder geht es um die Telefonnummer meiner Cousine? Die hätte ich dir doch einfach per SMS schicken können.«
Maillard winkte unwirsch ab. »Lass die Späße. Deine Kollegen aus der Werkstatt haben mich informiert, dass unser Unfallopfer nicht aus Versehen in den Abgrund gerast ist. An dem Unglück war ein zweites Fahrzeug beteiligt.«
»Aha?« Duphet legte den Kopf schief. »Das macht die Sache spannender. Aber weiter kommen wir erst, wenn wir zumindest die Fahrgestellnummer des Unfallwagens haben.«
»Ja.«
Jacques Maillard setzte sich auf einen Stuhl vor der Arbeitsfläche, während sich Duphet wieder seinem Monitor zuwandte. Warum war er überhaupt hergekommen? Solange sie nichts hatten, konnte auch Michel Duphet keine Wunder vollbringen. Auch wenn er ansonsten durchaus in der Lage war, das eine oder andere Kaninchen aus dem Hut zu zaubern.
Duphet klapperte auf seiner Tastatur. Dann trat er an den Tisch, zog sich ein Paar Latexhandschuhe über und beschäftigte sich mit einem Mobiltelefon, das vermutlich zu einem anderen Fall gehörte.
Maillard sah ihm eine Weile dabei zu und ließ dann seinen Blick über die spärlichen Beweisstücke aus dem Unfallwagen wandern, die Kaugummis, den Bleistiftstummel und den gelben Haftnotizblock. Gedankenverloren nahm er den Stift und begann, das oberste Blatt des Blocks zu schraffieren. Er zuckte zusammen, als plötzlich etwas sichtbar wurde, die Spur einer Schrift, die sich auf dem Blatt befunden haben musste, das abgerissen worden war, und sich durchgedrückt hatte.
Maillard sprang auf. »Michel!«, rief er aufgeregt.
Der Forensiker blickte hoch. Als er sah, was Maillard getan hatte, legte er das Mobiltelefon beiseite.