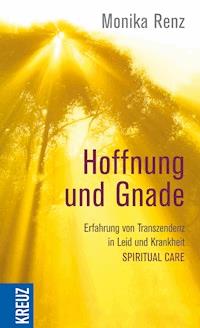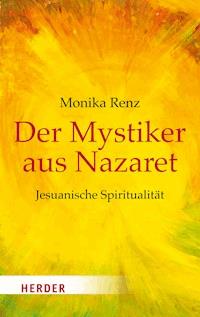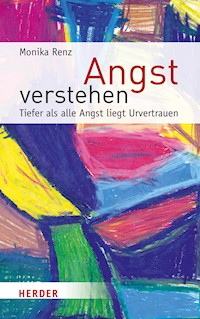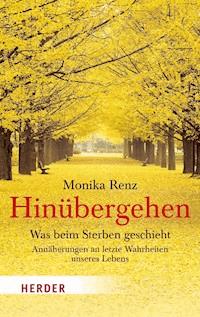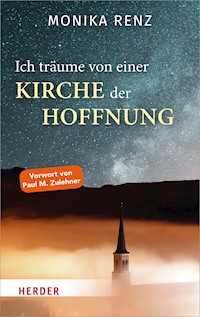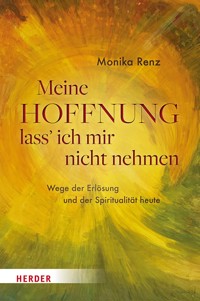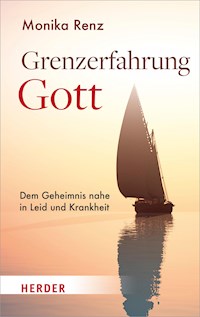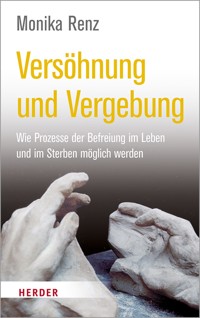
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Warum sind Versöhnung und Vergebung so schwierig? Und wie können sie als Befreiung gelingen? Dies sind drängende Fragen, nicht nur für Opfer seelischer Verletzungen oder verstörenden Missbrauchs, sondern auch für Menschen, die an anderen schuldig wurden. Im Zugehen auf den Tod wird das Thema besonders existenziell. Welche Wege wirkliche Versöhnung braucht, und welche Phasen sie durchläuft, zeigt Renz aus therapeutischer, psychologischer und spiritueller Perspektive. Ein wegweisendes Buch für alle, die Menschen in Konfliktsituationen begleiten oder mit Sterbenden arbeiten. Aber auch für alle, die dem Thema in ihrem eigenen Leben Aufmerksamkeit schenken wollen. Monika Renz ermutigt, Versöhnungsprozesse in ihren Hürden und Chancen auch selbst zu wagen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Monika Renz
Versöhnung und Vergebung
Wie Prozesse der Befreiung im Leben und im Sterben möglich werden
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2019
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlagmotiv: Monika Renz
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN E-Book: 978-3-451-81892-9
ISBN Print: 978-3-451-60083-8
INHALT
Einleitung
Was ist Versöhnung, was ist Vergebung?
Kulturhistorische, anthropologische und biologische Hintergründe
Zur Studie »Versöhnungsprozesse im Zugehen auf den Tod«
Rückblick und Ausblick
1. Warum überhaupt Versöhnung – warum vergeben?
1. Wie frei geschieht Vergebung?
2. Was motiviert Menschen, sich auf den Prozess einzulassen?
3. Vor großen Lebensübergängen – Chance der Todesnähe
4. Versöhnung und Vergebung sind Ausdruck von Stärke
5. Was, wenn der Andere nicht will?
6. Der Mensch als Beziehungswesen – Unversöhntheit als Beziehungsproblem
2. Nur wer eine Perspektive hat, kann vergeben und sich versöhnen
1. Versöhnung und Vergebung setzen einen Kategorienwechsel voraus
2. Räume des Fühlens
3. Bewusstwerdung, Nachreifung und Wahrheitsfindung
4. Versöhnung und Vergebung beginnen mit einer neuen Einfühlung
5. Widersagen, Warten, Vertrauen: Durststrecken überstehen
6. Wie realistisch ist Versöhnung als gegenseitiger Prozess?
7. Versöhnung und Vergebung werden möglich mit Hilfe eines Dritten
8. Verwundbarkeit riskieren: der Stellenwert der Sündenböcke
9. Was brauchen Opfer?
10. Was brauchen Täter?
11. Zwei Modelle aus der Opferperspektive: Vergebung als Entscheidung
12. Zwei Modelle aus der Täterperspektive: Erlösung aus Schuld
3. Fünf Phasen im Versöhnungsprozess – was führt zur Wende?
3.1. Vermeidung
3.2. Zuspitzung
3.3. Hoffnungserfahrungen oder der Faktor Gnade
3.4. Entscheidung
3.5. Versöhnung und Vergebung
4. Es geschieht, wo Reue und Gnade sich berühren
Literaturverzeichnis
Anmerkungen
Anhang
EINLEITUNG
Was ist Versöhnung, was ist Vergebung?
Versöhnung ist ein sperriges Wort. Es beinhaltet mehr als ein Sich-Arrangieren mit dem Anderen und ist etwas anderes als bloße Strategie. Das mittelhochdeutsche Wort »versuenen« bedeutet Frieden stiften, schlichten. Es erinnert an Sühne, und dieses Wort verweist auf eine Aufarbeitung von Schuld. So wundert es nicht, dass das Wort »Versöhnung« in unserem Alltag kaum vorkommt. Und doch lässt das aufhorchen, denn das Thema ist existenziell, taucht immer wieder auf, erst recht im Zugehen auf den Tod. Wird Versöhnung so lange wie möglich verdrängt? Mitten im Leben bedeutet Versöhnung meist zunächst Vergebung, und das fällt schwer – und befreit doch.
Genau dies versuchte mir mein Vater von Jugend an nahezubringen. Er erzählte mir von Situationen in seinem Leben, wo es ihm gelungen war, ja zu sagen. Ja zu einer streitbaren Schwester, Ja zu einem jähzornigen Mitarbeiter, dem er als Reaktion darauf spezielle Aufgaben übertrug und ihn so stärker in den Betrieb und die Verantwortung einband. Und er ergänzte: Da wie dort sei es nach der Versöhnung oder dem Handschlag nicht einfach gut gewesen zwischen ihm und dem Andern, aber freier. Er habe doch den Streit nicht ein halbes Leben lang herumtragen wollen. Monate nach einem solchen Gespräch – ich hatte es nicht vergessen – fragte ich nach, wie es weitergegangen sei, und stellte fest, dass es für ihn kein Thema mehr war. Er hatte es vergessen. – Mein Vater ist inzwischen verstorben. Er war ein friedliebender Mensch, impulsiv zwar und insistierend, weil von Grund auf ehrlich. Aber er war stets der erste, der nach einem Konflikt die Hand zur Versöhnung ausstreckte. Vor allem war es wichtig für ihn, dass es die großen um Frieden und Versöhnung ringenden Vorbilder auch in der Weltgeschichte tatsächlich gibt: so etwa den Ägypter Anwar as-Sadat, oder den südafrikanischen Bischof Desmond Tutu am Ende des Apartheidregimes.
Vergebung und Versöhnung sind abschiedliche Gaben – Schwellenerfahrungen. Ein Thema abschließend, vor einer großen Lebensveränderung und mit Blick auf etwas Neues wird es möglich, zu vergeben. Stehen zu lassen, was war. Am meisten gilt dies für die Schwelle auf den Tod hin. Vergebung und Versöhnung sind in ihrer Radikalität vom Tod her zu denken! Im Blick auf Jesus gesprochen: von der Auferstehung her. Doch warum?
Im Zugehen auf den Tod findet nicht nur in Einzelfällen, sondern bei der Mehrheit der Menschen etwas vorher Undenkbares statt. Dort öffnen sich – wie ein Arzt dies einem Angehörigen zu erklären versuchte – uralte hirnphysiologische Anbahnungen und Fehlanbahnungen. Erstarrte Gefühle werden aufgeweicht. Alles kommt so sehr ins Fließen, dass Menschen – auf einer primären sensitiven Ebene betrachtet – schon lange nicht mehr so »lebendig« waren wie jetzt. Das Sterben tritt, genau betrachtet, nicht beim erstarrten, sondern beim inwendig offenen Menschen ein.
Im Zuge solchen Lebendig-Werdens aus der Tiefe finden in Todesnähe auch Versöhnung und Vergebung einfach statt. Es geschieht ferner, wo Neuwerdung mitten im Leben so tief ansetzt, dass selbst uralte Fehlanbahnungen wie oben angesprochen hinter sich gelassen wurden. Dafür steht, christlich gesprochen, Ostern. In österlichem Dasein wird möglich, was vorher nicht möglich war. Dass Jesus Vergebung und Versöhnung eher selten zu Lebzeiten, wohl aber zentral als ein Auferstandener verkündete, ist kein Zufall.
Trotz der Radikalität des Themas handelt dieses Buch – auch wo es um den Prozess des Sterbens geht – nicht vom Tod, sondern vom Lebendig-Werden. Von der Chance zur Vergebung und Versöhnung und von deren »Torfunktion« hin zu neuem Leben. Es geht darum, Vergebung und Versöhnung als tiefgreifende Prozesse zu verstehen: Was dazu befähigt und warum sie sich lohnen.
Worin liegt der Unterschied zwischen Versöhnung und Vergebung? Versöhnung ist ein Beziehungsgeschehen. Sie beschreibt den Weg zur Wiederherstellung friedlicher Ordnungsverhältnisse zwischen verfeindeten Parteien. Im Unterschied dazu findet Vergebung meist in der Tiefe der eigenen Seele statt. Während Vergebung auf eine Gabe und einen Geber verweist, betont Versöhnung die Reue, Sühne und das Moment der Wandlung. Streng genommen wäre Versöhnung jener Läuterungsprozess im Täter, der bewirkt, dass das Opfer vergeben kann. Doch im Konkreten lassen sich Opfer- und Täterposition nie eindeutig trennen. Versöhnung ist im Alltag stets Angelegenheit von Opfern und Tätern, in je eigener Herausforderung. Und Prozesse verlaufen oft umgekehrt: Vergebung ermöglicht den Versöhnungsprozess überhaupt erst.
Vergebung ist jene einseitige Vorgabe (vgl. Gerl-Falkovitz 2008, S. 174), die den neuen Anfang schafft. Sie beinhaltet mehr als das Schaffen von ausgeglichenen Rechnungen. Sie läutet einen eigentlichen Kategorienwechsel ein: von der Existenzweise des Habens zum Sein. Wo man vorher wie ein Gefangener die Dinge besitzen, im Blick haben, aber auch rechthaben musste, gelten diese »Besitzverhältnisse« und »Rechnungen« nachher nicht mehr. Man hat sie hinter sich gelassen und ist entsprechend gelassener und frei (vgl. Kap. 2.1). Vergebung geschieht, wo Menschen ausharren, ringen und auf Lösung setzen. Vergebung ist auch Verzeihung, diese zwei Begriffe stehen sich nahe. Verzeihung betont das Bezichtigen, die Anklage1. Es gilt etwas anzuklagen und man zieht sich aber aus dem unheilvollen Kreislauf der Vergeltung heraus. Verzeihung wird umgangssprachlich bevorzugt verwendet, etwa bei leichter zu bewältigenden Beziehungsproblemen (vgl. Herzog 2017, S.19). Vergebung verweist darüber hinaus mehr auf die Gabe und Vorgabe: es ist auch Gnade, vergeben zu können; wohl deshalb ist mir dieser Begriff näher. Vergebung ist das bedingungslose Ja dem anderen, mir selbst, dem Leben, dem Schicksal und Gott gegenüber. Sie überfordert von Grund auf, weshalb man sich zur Vergebung richtiggehend entscheiden muss (vgl. Enright 2006). Und diese Entscheidung wird immer wieder neu vollzogen.
Und Versöhnung? Auch dem Versöhnungsprozess wohnt das Moment der Entscheidung inne. In meiner über zwanzigjährigen Arbeit in der Psychoonkologie des Kantonsspitals St. Gallen erfuhr ich oft, dass Patienten sich regelrecht entschieden, das Thema anzugehen und in dieser Absicht dann etwa therapeutische Hilfe annahmen.
Ein Spezialfall sind Prozesse in Todesnähe: Sie gehen schneller vonstatten und bleiben oft fragmentarisch, weshalb auch ein willentlicher Entscheid von außen nicht immer sichtbar wird. Diese Prozesse sind aber nicht weniger befreiend und intensiv (vgl. Kap. 1.3). Das »Ja« zu allem, so wie es war, findet vielleicht unmerklich statt, in einem entsprechenden Ausatmen, in einem körperlichen »Ruck«, im weich werdenden Blick oder Muskeltonus.
Was aber bewegt Menschen überhaupt, sich zur Vergebung zu entscheiden oder konkrete Schritte in Richtung Versöhnung anzupeilen? Das Undenkbare geschieht dort, wo ich mich über mich selbst hinauszustrecken vermag, wo ein Mensch getragen ist von einer tiefen Motivation, sei es vermittelt durch ein Vorbild, eine tragende Hoffnungs- oder Gnadenerfahrung (vgl. Kap. 2; 3.3). Diese Erfahrung als eigene Phase im Versöhnungsprozess hervorzuheben, ist das Novum dieses Buches. Selbst im Sterben, ja gerade hier wird sichtbar, dass Menschen über sich selbst hinaus hoffen können. Es zeigt sich, wie wichtig dies für ihr Sterben sowie für den Frieden in ihrem Umfeld ist.
Setzen Vergebung und Versöhnung also Hoffnung voraus? Ja, auch wenn diese bisweilen nur verborgen, in einer »anderen Kategorie von Sein« (vgl. Kap. 2.1) oder über eine verstehende Drittperson da ist. Eine neue Hoffnung macht möglich, was in der Wirklichkeit unmöglich erscheint. Denn gerade nach schwerwiegenden Verletzungen können Menschen über lange Zeit ehrlicherweise nicht vergeben und sich nicht versöhnen.
Das Moment des Vergebens innerhalb des Versöhnungsprozesses setzt Hoffnung nicht nur voraus, sondern schafft sie auch. Selbst inmitten von Resignation, traumatischen Blockaden und Verzweiflung ist über den Weg der Vergebung – dort, wo sie sich ereignet – nochmals etwas Neues möglich. Hoffnung ist mit dem Akt der Vergebung wie neu geboren, spürbar »da«. Gedankengänge haben plötzlich eine andere Stoßrichtung: Es geht nicht mehr um ein in der Logik »geschlossenes« »Wenn-Dann«, sondern um ein öffnendes »Wie weiter?«. Und diese Ausrichtung auf Zukunft schafft eine neue Atmosphäre. »Es darf sein, wie es ist«, vermögen Sterbende etwa zu sagen; und man verweilt gerne bei ihnen. Sterbende in der Haltung solchen Vergeben-Könnens haben eine ganz besondere, »schöne« Ausstrahlung. Das gilt auch für Sterbende, die unter einer Schuld leiden, zugleich aber offensichtlich in der Hoffnung angekommen sind, dass ihnen zu gegebener Zeit vergeben wird.
Und Versöhnung? Während Vergebung ein Akt ist, den ich auch alleine – in mir drin – angehen kann, ist Versöhnung meist abhängig vom Gegenüber und muss oft auf unbestimmte Zeit verschoben und bei einer Drittperson oder bei Gott deponiert werden. Ich spreche auch von einseitiger Versöhnung (vgl. Kap. 1.5; 2.7). Dass auch Gott dieses Dritte sein kann, besagt der alte hebräische Begriff »Schafat«. Er meint: »Gott ist der Richter«. Versöhnung mit Hilfe einer Drittinstanz ist in sich Akt der Hoffnung: Das Dritte spendet Mut und motiviert.
Kulturhistorische, anthropologische und biologische Hintergründe
Was sind Hintergründe und Vorgaben von Versöhnung und Vergebung?Historisch betrachtet, verweist uns das Denken in der Kategorie von Schuld und Versöhnung in die jüdisch-christliche Tradition. Versöhnung ist hier eine uralte Praxis, die den Weg hin zur Vergebung durch Gott vorgibt. Es geht um die Wiederherstellung der ursprünglichen Verbundenheit zwischen Gott und Mensch, welche im Laufe der menschlichen Evolution und Entwicklung irgendwann unterbrochen wurde (vgl. Renz 2018). Versöhnung ist Gegenwort zum altertümlichen Begriff Sünde: Versöhnung heilt aus Sünde. Und diese wiederum ist als Sonderung, als Absonderung des Menschen von Gott und vom eigenen Urgrund zu begreifen. Sie beschreibt den Abbruch oder die Störung in dieser fundamentalen Beziehung und geht einher mit der Abwanderung des Menschen aus der eigenen Seelentiefe. Versöhnung verbindet demzufolge wieder mit der eigenen Seelentiefe.
Interessanterweise kennt das Englische zwei Bedeutungen des deutschen Begriffs »Versöhnung«. Während »reconciliation« die Wiederherstellung einer freundschaftlich wohlwollenden, konzilianten Beziehung unter Menschen und durch Menschen beschreibt, verweist der wenig gebrauchte Begriff »atonement«2 auf die wiederherzustellende Beziehung Gott-Mensch. Und gemäß alter Überzeugung hatte das eine auch mit dem anderen zu tun.
Religionsgeschichtlich und biblisch betrachtet, durchlief die Bedeutung von Versöhnung eine Entwicklung. Früher glaubte man, dass der Mensch Sühne und Reue zur »Umstimmung Gottes« brauche; ich erinnere an das Sühnopfer bei Mose (Ex 29,41) oder an den Versöhnungsritus (Lev 16,9; Lev 20–22). Die Vergebungsbereitschaft Gottes wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr als reine Gnade – als »unkäuflich« also – betrachtet3. Umgekehrt wurde die Versöhnungs- und Vergebungsbereitschaft der Menschen untereinander wichtiger. Diese Tendenz ist schon sichtbar im Alten Testament bspw. bei Jesus Sirach4 und erst recht im Neuen Testament im Verhalten Jesu oder im Vaterunser-Gebet: »Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.«
In anderen, nichtbiblischen Religionen gibt es die Begriffe Versöhnung und Vergebung zumindest in diesem ursprünglichen kategorialen Sinne nicht, auch wenn dort die Frage nach einer Wiederherstellung der kosmischen Ordnung auf ihre Weise eine Rolle spielt. Die Begriffe Versöhnung und Vergebung sind weder im Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe5, noch in der Encyclopedia of Religion (Eliade 1993) zu finden, wohl »weil Heilswege nicht wie im Juden- und Christentum von einem versöhnenden Handeln Gottes am Menschen ausgehen«.6 Im Islam findet sich die Vorstellung einer Vergebung aus Gottes Barmherzigkeit bei Verfehlungen, nach Reue und Buße, resp. nach der Wiedergutmachung.7 Auch daraus wächst eine entsprechende Haltung: »Vergebend und auf Vergebung hoffend sollen wir unser Leben führen«, so legt es Mohammed den Muslimen ans Herz.8 In Hawaii gibt es ein naturreligiöses Ritual, das als Versöhnung mit den Ahnen interpretiert wird.9 Gemäß dem Psychologieprofessor Michael McCullough gibt es in 56 von 60 Kulturen Hinweise oder Riten in Richtung Konfliktbereinigung.10 Ob Versöhnung für diese Phänomene das richtige Wort ist, muss wohl von Fall zu Fall diskutiert werden.
Mit dem Beginn der Neuzeit ist die Vorstellung eines »vergebenden« und »aktiv Versöhnung initiierenden« Gottes mehr und mehr verdunstet. Menschen- und Gottesbilder wandelten sich, und so auch die Bedeutung von Versöhnung. Diese wurde zu einem humanistischen Anliegen, ich denke etwa an die Wahrheitskommission in Südafrika oder an die Aufarbeitung der Holocaustverbrechen in Deutschland. Sie wurde konkret in der politischen, psychotherapeutischen und spirituell orientierten Friedensarbeit.11 Therapiekonzepte12 und spirituelle Wege zur Versöhnung, wie etwa das Herzensgebet und die Pilgerkultur des Jakobsweges, wurden entwickelt.
Zeitgleich mit dem Schwinden der Religiosität rücken heute neue Vorstellungen vom Göttlichen, Ganzen näher, auch beeinflusst von Forschungen der Quantenphysik und zur Nahtoderfahrung (van Lommel 2011). Die höchste Macht wird jetzt – je nach persönlichem Hintergrund – als Sein wie auch als Beziehung oder als Energie vorgestellt. In beiden Aspekten (als Sein wie als Beziehung) ist sie erfahrbar (vgl. Renz 2014). Die These einer letztlichen Verbundenheit, wonach der Mensch am solchermaßen Ganzen teilhat, ist damit auch in der säkularisierten Welt legitim geworden. Hierzu passen Forschungen über tief im Menschen, seinen Genen13 und teils auch in Tieren angelegte Verhaltensmuster in Richtung Deeskalation, Zusammenschluss und Mitgefühl. Der Primatenforscher Frans de Waal (2000) etwa hat bei Schimpansen und Bonobos beobachtet, dass diese nach aggressiven Konflikten wieder freundschaftliche Gesten austauschen, und betont, es gebe nicht nur Reaktionen der Rache, sondern auch der Kooperation (vgl. S. 16). McCullough (2008) erkennt kooperative Verhaltensmuster bei Schimpansen, Ziegen, Schafen, Delphinen u.a.m. Diese Muster dienen – anders als zur Selbsterhaltung – den Beziehungen in der Gruppe (S. 119–120; 130–132). Der Mensch erst recht ist auf ein »Du« angelegt, man bedenke den Stellenwert der ersten Bezugspersonen für das Kind und seine Entwicklung.
Ist der Mensch im Letzten also auf ein tiefes Bezogensein und auf Verbundenheit angelegt? Gibt es neben dem Drang nach Vereinzelung und Sich-Durchsetzen noch ein anderes, ähnlich tiefgreifendes Streben? Eine Sehnsucht nach Beziehung, Friede, Gemeinschaft, Verbundenheit? Diese These ist gewagt und doch für unser Thema brisant. Versöhnung ist dieser These zufolge mehr als Korrekturversuch in Konflikten. Sie entspricht der menschlichen Natur!14 Ähnlich sagt es der Neurowissenschaftler und Psychiater Joachim Bauer: Über Vergebung nachzudenken, mache nur Sinn bei einem Menschenbild, das von einer letztlichen Verbundenheit ausgehe.15 Wenn der Mensch hingegen, rein darwinistisch gedacht, allein durch Aggressionstrieb und Selektion bestimmt wäre, würden Versöhnung und Vergebung der menschlichen Natur zuwiderlaufen. Der Mensch kann, wie ich meine, durch beides bestimmt sein: durch den Drang nach Vereinzelung und Macht im Ich (Aggressionstrieb im Sinne Darwins), aber auch durch eine schwer definierbare tiefe Sehnsucht nach Verbundenheit. Das meint der Ausdruck connectedness nach Richard Rohr (2012) und Pim van Lommel (2011).
Versöhnung und Vergebung sind Kulturphänomene. Rein biologisch lassen sie sich nicht einholen. Ich halte es also für fragwürdig, wenn für neurobiologische oder instinkthafte Reaktionen sowie für Strategien der Gruppenerhaltung der Begriff »Versöhnung«16 verwendet wird. Ich würde nicht von »Versöhnung« auf der Instinktebene sprechen, sondern von instinkthaften Anbahnungen in diese Richtung sowie von Verhaltensmustern der Kooperation. Die Muster sind grundlegend für eine Weiterentwicklung im Emotionalen, Kulturellen und Spirituellen bis hin zur eigentlichen Versöhnung und Vergebung. Doch letztere beinhalten, wie sich im Verlauf des Buches immer neu zeigen wird, ein Mehr an emotionaler Reife, an Persönlichkeitsstärke und Willenskraft, als das, was in der Instinktebene vorzufinden ist. Und Versöhnung und Vergebung haben zu tun mit Demut, Selbsterkenntnis, Wahrheitsfindung und Bewusstwerdung. Sie setzen eine gewisse Bewusstheit irgendwie voraus. Doch wie sieht das bei Sterbenden aus? Wie sehr kann, ja muss auch hier von emotionaler Reife, von Bewusstsein, von Schuldfähigkeit gesprochen werden (vgl. Kap. 2.3)?
In diesem Buch verbinden sich theoretische und praktische Zugänge mit humanistischen und spirituellen Gedanken. Sie sind auf dem Hintergrund meiner 20-jährigen Tätigkeit in der Psychoonkologie eines Zentrumsspitals erwachsen. Konkrete Einzelschicksale ebenso wie die Resultate aus empirischer Forschung fließen ein. Das Buch richtet sich an Fachleute, die Menschen in Konfliktsituationen mitten im Leben begleiten oder mit Sterbenden arbeiten. Aber auch an Menschen, die dem Thema in ihrem eigenen Leben Aufmerksamkeit schenken wollen. Es möchte dazu ermutigen, Versöhnungsprozesse mit ihren Hürden und Chancen auch selbst zu wagen.
Zur Studie »Versöhnungsprozesse im Zugehen auf den Tod«
(Vgl. Grafiken im Anhang, Tabellen und weitere Abbildungen im Internet:www.herder.de/vergebung)
Dem vorliegenden Buch liegt eine Studie »Versöhnungsprozesse im Zugehen auf den Tod« zugrunde. In den zwanzig Jahren meiner Spitaltätigkeit stand bei vielen Patienten etwas in dieser Richtung an: Versöhnung mit einem nahestehenden Menschen, Versöhnung mit der Krankheit und sich selbst, mit dem Schicksal und Gott. Wir, ein kleines Team interessierter Fachleute17, wollten diese Prozesse besser verstehen.
Wie gehen verschiedene Menschen um mit dem Unversöhnten in und um sich herum? Das Thema bewegte unsere Patienten über Wochen, Monate oder Jahre, dazwischen gab es kürzere oder längere Unterbrechungen (vgl. exemplarische Verlaufskurven, Anhang). Es blieb teils präsent bis hinein in die Sprachlosigkeit unmittelbar vor dem Tod und wurde doch von den allermeisten Sterbenden angegangen (vgl. Kap. 1.3). Wie können wir als Begleiter mitgehen – in ehrfürchtiger Zurückhaltung und in Mut? Was sollen wir überhaupt ins Wort bringen und wie können wir uns in Anbetracht solcher Konfrontation selbst dabei exponieren? Das Spektrum an Themen war breit: Da waren von Alkohol beeinflusste Gewalttäter neben Opfern häuslicher Gewalt. Schlimme projektionslastige Anschuldigungen standen neben Selbstanklagen oder der schlichten Sorge um jemanden, der aus dem Bewusstsein der Familie wie verloren gegangen war. Es gab regelrechte Familienthemen: Ein Patient verging sich in Wirtschaftskriminalität, sein Vater und sein Großvater hatten dies im dörflichen Kontext auch bereits getan. Eine Patientin ging wiederholt fremd, was in ihrer Familie gang und gäbe gewesen sei. Eine andere, schwermütig, hatte ihre Kinder misshandelt und sie schließlich weggegeben; es stellte sich dann heraus, dass auch ihr als Kind dasselbe Schicksal durch ihre alleinerziehende Mutter schon widerfahren war. Ein weiterer Patient gehörte einer Familie an, in welcher sich seit Generationen einer nach dem andern das Leben nahm. Nicht selten spielte eine Abwendung von Gott mit hinein. Was uns dabei vorrangig interessierte, waren nicht nur Inhalte und Hintergründe von Konflikten, sondern mehr noch die innere Dynamik von Versöhnungs- und Vergebungsprozessen. Was hemmt, was treibt voran? Was fällt extrem schwer, was fällt einem zu und wenn ja wann, unter welchen Voraussetzungen? Was öffnet oder führt dazu, dass schlussendlich Frieden sich ereignen mag? Können innerhalb eines Prozesses Phasen unterschieden werden? Darf überhaupt von einem Ablauf geredet werden?
Heute liegt ein Modell mit fünf Phasen vor: Vermeidung – Zuspitzung – Hoffnungserfahrung – Entscheid – Versöhnung/Wandlung/Entspannung (vgl. Kap. 3). Die Versöhnung (Phase 5) wurde in unterschiedlichen Nuancen erlebt, selten einmal ging es nur um eine Entladung auf Kosten eines Sündenbockes, etwa eines Arztes, was nicht wirklich als Versöhnung, sondern eher als Pseudoversöhnung eingestuft werden kann. Ein andermal war ein »Leben und Leben-Lassen« realistisch. Ein drittes Mal, sehr oft, kam es zu einer inneren Versöhnung und Vergebung, ein viertes Mal zu einer versöhnten Wiederbegegnung mit der Konfliktpartei.