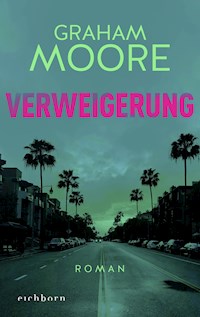
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es ist das spektakulärste Gerichtsverfahren des Jahrzehnts: Jessica Silver, Erbin eines Immobilienmoguls, verschwindet, und ihr Lehrer Bobby Nock wird des Mordes angeklagt. Der Afro-Amerikaner führte eine geheime Affäre mit Jessica.
Die Jury ist gespalten, bis die junge Geschworene Maja alle von einem Freispruch überzeugt. Jetzt, 10 Jahre später, wird der ganze Fall neu aufgerollt. Als einer der Geschworenen tot aufgefunden wird, gerät Maja ins Visier der Polizei und wird zur Hauptverdächtigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Über dieses Buch
Es ist das spektakulärste Gerichtsverfahren des Jahrzehnts: Jessica Silver, Erbin eines Immobilienmoguls, verschwindet, und ihr Lehrer Bobby Nock wird des Mordes angeklagt. Der Afro-Amerikaner führte eine geheime Affäre mit Jessica.
Die Jury ist gespalten, bis die junge Geschworene Maja alle von einem Freispruch überzeugt. Jetzt, 10 Jahre später, wird der ganze Fall neu aufgerollt. Als einer der Geschworenen tot aufgefunden wird, gerät Maja ins Visier der Polizei und wird zur Hauptverdächtigen.
Über den Autor
Graham Moore, Jahrgang 1981, arbeitet als Drehbuchautor und Schriftsteller. In seinen Romanen fiktionalisiert er gerne historische Personen und Gegebenheiten. 2015 gewann er den Oscar für das beste Drehbuch; »The Imitation Game« wurde mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley verfilmt und von der internationalen Kritik gefeiert. Moore lebt in Los Angeles.
GRAHAM
MOORE
VERWEIGERUNG
ROMAN
Übersetzung aus dem amerikanischen Englischvon André Mumot
EICHBORN
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Dieser Titel ist auch als Hörbuch erschienen
Titel der US-amerikanischen Originalausgabe:
»The Holdout«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2020 by Graham Moore
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München unter Verwendung von Illustrationen von © Josue Soriano / EyeEm / GettyImages
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-9508-2
www.eichborn.de
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Für Caitlin,die das Beste ist in L. A.
Kapitel 1
ZEHN JAHRE IN L. A.
Heute
Maya Seale zog zwei Fotografien aus ihrer Aktentasche, hielt sie aber noch verdeckt in der Hand. Jetzt würde es nur aufs richtige Timing ankommen.
»Miss Seale?« Die Stimme des Richters klang ungeduldig. »Wir warten.«
Belen Vasquez, Mayas Mandantin, war von Elian, ihrem Ehemann, schwer misshandelt worden. Es gab ausführliche Dokumentationen aus der Notaufnahme, die dies bewiesen. Vor einigen Monaten dann war Belen eines Morgens durchgedreht. Sie hatte ihren Ehemann im Schlaf erstochen und seinen Kopf mit einer Gartenschere abgetrennt. Anschließend war sie den ganzen Tag in ihrem grünen Hyundai Elantra in der Gegend herumgefahren – mit dem Kopf auf dem Armaturenbrett. Entweder hatte es niemand bemerkt oder niemand wollte in die Sache hineingezogen werden. Schließlich hatte ein Polizist sie angehalten, weil sie eine rote Ampel überfahren hatte, und es war ihr gerade noch gelungen, den Kopf ins Handschuhfach zu stopfen.
Die gute Nachricht war, wenigstens für Maya, dass die Staatsanwaltschaft nur über einen einzigen greifbaren Sachbeweis verfügte, den sie gegen Belen verwenden konnte. Die schlechte Nachricht: Bei diesem Sachbeweis handelte es sich um einen Kopf.
»Ich bin so weit, Euer Ehren.« Maya legte ihre Hand ermutigend auf die Schulter ihrer Mandantin. Dann ging sie langsam zum Zeugenstand hinüber, wo Officer Jason Shaw wartete – den Orden für besondere Verdienste gut sichtbar am Revers seiner blauen LAPD-Uniform.
»Officer Shaw«, sagte sie, »was passierte, nachdem Sie den Wagen von Mrs Vasquez angehalten hatten?«
»Na ja, Ma’am, wie ich schon gesagt habe, mein Partner blieb hinter dem Fahrzeug von Mrs Vasquez, und ich bin nach vorn zu ihrem Fahrerfenster.«
Er war also einer der Polizisten, die die »Ma’am«-Nummer abzogen. Maya hasste das. Nicht, weil sie sechsunddreißig war, was, wie sie zugeben musste, das »Ma’am« vermutlich rechtfertigte, sondern weil es so ein offenkundiger Versuch war, sie überheblich und verstockt wirken zu lassen.
Sie strich sich die kurzen dunklen Haare hinters Ohr. »Und haben Sie, als Sie sich dem Wagenfenster näherten, Mrs Vasquez auf dem Fahrersitz sitzen sehen?«
»Ja, Ma’am.«
»Haben Sie sie nach ihrem Führerschein und den Fahrzeugpapieren gefragt?«
»Ja, Ma’am.«
»Hat sie Ihnen beides gegeben?«
»Ja, Ma’am.«
»Haben Sie sie noch etwas anderes gefragt?«
»Ich habe sie gefragt, warum sie Blut an den Händen hatte.« Officer Shaw hielt kurz inne, dann setzte er hinzu: »Ma’am.«
»Und was hat Ihnen Mrs Vasquez darauf geantwortet?«
»Sie sagte, sie hätte sich bei Küchenarbeiten in die Hand geschnitten.«
»Und hat sie diese Aussage irgendwie stützen können?«
»Ja, Ma’am. Sie hat mir den Verband an ihrer rechten Handfläche gezeigt.«
»Haben Sie sie noch etwas gefragt?«
»Ich habe sie gebeten, ihren Wagen zu verlassen.«
»Warum?«
»Weil sie Blut an den Händen hatte.«
»Aber hatte sie Ihnen nicht eine vollkommen vernünftige Erklärung für diesen Umstand genannt?«
»Ich wollte der Sache weiter nachgehen.«
»Aber warum hatten Sie den Eindruck, dieser Sache weiter nachgehen zu müssen«, fragte Maya, »wenn Mrs Vasquez Ihnen doch eine vernünftige Erklärung gegeben hatte?«
Shaw sah sie an, als wäre sie eine Pausenaufsicht, die ihn wegen einer reinen Lappalie zum Schuldirektor schickte.
»Intuition«, sagte er.
In diesem Augenblick tat Maya der arme Kerl regelrecht leid. Offenbar hatte ihn der Staatsanwalt nicht gut vorbereitet.
»Entschuldigen Sie, Officer, aber können Sie mir diese Intuition bitte etwas genauer beschreiben?«
»Vielleicht hatte ich schon etwas von dem Kopf gesehen.« Er ritt sich immer weiter rein.
»Vielleicht«, wiederholte Maya langsam, »hatten Sie schon etwas von dem Kopf gesehen?«
»Es war dunkel«, gab Shaw zu. »Aber vielleicht hatte ich unterbewusst die Haare wahrgenommen – ich meine die Haare auf dem Kopf – die aus dem Handschuhfach ragten.«
Sie warf dem Staatsanwalt einen Blick zu. Stumm kraulte er sich seinen weißen Bart, während Shaw im Alleingang die gesamte Anklage in die Luft gehen ließ.
Zeit für die Fotografien.
Maya hielt in jeder Hand eine und hob sie in die Höhe. Die beiden Fotos zeigten, aus verschiedenen Blickwinkeln, den in ein Handschuhfach gestopften Kopf eines Mannes. Elian Vasquez’ Haare waren auf wenige Millimeter abrasiert gewesen, außerdem sah man seinen struppigen, mit Blut verklebten Schnurrbart. Auf seiner Wange zeichnete sich ein scharlachroter Streifen ab. Der Kopf war eindeutig an einem anderen Ort ausgeblutet und erst später in das Handschuhfach verfrachtet worden, auf das abgegriffene Betriebshandbuch und die alten Zulassungspapiere.
»Officer, haben Sie in der fraglichen Nacht diese Aufnahmen gemacht?« Sie reichte ihm die Fotos.
»Das habe ich, Ma’am.«
»Zeigen diese Fotografien nicht, dass der Kopf vollständig im Handschuhfach gelegen hat?«
»Der Kopf liegt im Handschuhfach, Ma’am.«
»War das Handschuhfach geschlossen, als Sie Mrs Vasquez aufforderten, aus dem Wagen auszusteigen?«
»Ja, Ma’am.«
»Wie ist es dann möglich, dass Sie vielleicht irgendwelche Haare gesehen haben, wenn der Kopf vollständig im geschlossenen Handschuhfach gelegen hat?«
»Ich weiß nicht, aber ich meine, wir haben ihn ja gefunden, als wir den Wagen durchsucht haben. Sie können mir nicht sagen, dass er nicht da drin war, denn das war er.«
»Ich frage Sie, warum Sie den Wagen überhaupt durchsucht haben.«
»Sie hatte Blut an den Händen.«
»Haben Sie mir nicht gerade gesagt, dass Sie vielleicht Haare gesehen haben, die aus dem Handschuhfach ragten? Der Protokollführer kann Ihnen Ihre Aussage gerne noch mal vorlesen.«
»Nein, ich meine … da war Blut. Vielleicht habe ich irgendwelche Haare gesehen. Ich weiß es nicht. Intuition, hab ich doch gesagt.«
Maya hatte sich dicht vor dem Zeugenstand positioniert. »Was war denn nun der Grund, Officer? Haben Sie die Durchsuchung von Mrs Vasquez’ Wagen vorgenommen, weil Sie ein Stück eines abgetrennten Kopfes gesehen haben – was tatsächlich gar nicht möglich war – oder haben Sie die Durchsuchung vorgenommen, weil Mrs Vasquez Blut an den Händen hatte, wofür es eine vollkommen harmlose Erklärung gab?«
Shaw brütete wütend vor sich hin, versuchte, eine akzeptable Antwort zu finden. Ihm war klargeworden, dass er alles verbockt hatte.
Maya warf dem Staatsanwalt einen weiteren Blick zu. Inzwischen rieb er sich die Schläfen. Er sah aus, als hätte er Migräne.
Der Staatsanwalt unternahm einen heroischen Versuch, Shaw dazu zu bringen, sich auf eine seiner beiden Geschichten festzulegen, aber das Kind war längst in den Brunnen gefallen. Der Richter wies beide Parteien an, bis zum kommenden Montag schriftliche Stellungnahmen einzureichen, bis dahin würde er eine endgültige Entscheidung über ein Beweisverwertungsverbot des abgetrennten Kopfes erlassen.
Maya setzte sich neben ihre Mandantin und flüsterte ihr zu, die Befragung sei sehr gut verlaufen. Belen murmelte: »Okay«, vermied aber Augenkontakt. Sie war noch nicht in Feierlaune, und Maya wusste ihren Pessimismus zu schätzen.
Der Gerichtsdiener führte Belen aus dem Saal, zurück in ihre Zelle. Dann rief ein Saaldiener die nächste Anhörung auf.
Der Staatsanwalt schlängelte sich zu ihr herüber. »Wenn Sie den Kopf aus dem Verfahren bekommen, lasse ich mich auf fahrlässige Tötung ein.«
Maya stieß einen spöttischen Laut aus. »Wenn Ihnen der Kopf durch die Lappen geht, verlieren Sie auch die Leiche in der Küche und die Gartenschere im Schrank. Sie werden keinen noch so winzigen Sachbeweis mehr haben, um meine Mandantin mit dem Tod ihres Mannes in Verbindung zu bringen.«
»Ihres Mannes, den sie umgebracht hat.«
»Haben Sie die Unterlagen aus der Notaufnahme gesehen? Die gebrochenen Rippen? Den gebrochenen Kiefer?«
»Wenn Sie auf Selbstverteidigung gehen wollen – meinetwegen gern. Wenn Sie argumentieren wollen, ihr Ehemann hätte seinen Tod verdient, können Sie die Geschworenen womöglich für sich gewinnen. Aber den Kopf zurückhalten? Ist das Ihr Ernst?«
»Sie wird nicht in Haft gehen. Das ist nicht verhandelbar. Heute können wir uns gern auf gefährliche Körperverletzung einigen, das wäre mit der Untersuchungshaft abgegolten. Oder Sie versuchen nächste Woche Ihr Glück, wenn das Gericht seine Entscheidung getroffen hat.« Maya nickte dem Richter zu. »Wie, glauben Sie, wird die wohl ausfallen?«
Der Staatsanwalt murmelte in seinen Bart, er bräuchte die Unterschrift seines Vorgesetzten, dann schlich er davon. Maya schob die Fotografien zurück in ihre Aktentasche und ließ mit einem befriedigenden Klicken den Verschluss zuschnappen.
Der Flur draußen war überfüllt, und Dutzende Gespräche hallten von der gewölbten Decke wider. Gerichtsgebäude zählten zu den letzten Orten, an denen alle Teile der Gesellschaft auf Tuchfühlung miteinander gingen. Die Reichen, die Armen, die Alten, die Jungen, Menschen jeder Hautfarbe und jeden ethnischen Hintergrunds aus Los Angeles überquerten diese Marmorböden. Sie beeilte sich, zu ihrem Büro zurückzukommen, und genoss kurz, Teil dieses demokratischen Gedränges zu sein.
»Maya.«
Die Stimme war direkt hinter ihr. Sie erkannte sie sofort. Aber er konnte es doch nicht sein … oder doch?
Sie zwang sich, tief Luft zu holen, und drehte sich um. Zum ersten Mal seit zehn Jahren stand sie Rick Leonard gegenüber.
Er war noch immer schlank. Immer noch groß. Er trug immer noch eine Brille, auch wenn das silberne Drahtgestell, das ihm als Student kurz vor der Promotion auf der Nase gesessen hatte, dem dicken schwarzen Brillengestell eines arrivierten Mannes gewichen war. Noch immer kleidete er sich formell, trug einen hellgrauen Anzug. Er musste inzwischen Ende dreißig sein, nur ein klein wenig älter als sie selbst. Grausamerweise hatten ihn die Strapazen der letzten zehn Jahre noch attraktiver gemacht.
»Tut mir leid«, sagte Rick mit einnehmender Stimme. Er klang selbstsicher. »Ich wollte dich nicht so einfach überfallen.«
Maya erinnerte sich, wie gehemmt und unbeholfen Rick früher oft gewesen war. Nun trat er auf wie ein Mann, der sich endlich wohlfühlte in seiner Haut.
Sie dagegen war vor Verlegenheit rot angelaufen. »Was machst du hier?«
»Können wir uns unterhalten?«
In den letzten zehn Jahren war sie sich oft sicher gewesen, ihn gesehen zu haben: in Supermärkten, Restaurants und einmal – noch unwahrscheinlicher – auf einem Flug nach Seattle. Jedes Mal war es ihr eiskalt den Rücken heruntergelaufen, bis sie begriffen hatte, dass es bloß Einbildung gewesen war. Wie wahrscheinlich konnte es schon sein, dass sie ihm in einer Walgreens-Filiale über den Weg lief? Doch nun war er wirklich hier. Im Gericht.
Wie eine Idiotin wiederholte sie ihre Frage. »Was machst du hier?«
»Ich habe es per Mail probiert, per Telefon. In deiner Kanzlei. Aber ich habe nie eine Antwort bekommen. Ich bin hier, um mit dir zu sprechen.«
Sie hatte keinerlei Nachrichten erhalten, aber das war auch nicht erstaunlich. Ihre Assistentin hatte strikte Anweisung, sofort aufzulegen, wenn jemand nach dem Fall fragte. Maya hatte außerdem einen Spam-Filter eingerichtet, der alle einkommenden Mails abfing, in denen die Namen der am Fall beteiligten Personen auftauchten. Ihre Privatadresse war nirgends verzeichnet. Sie hatte ihr Haus unter dem Deckmantel einer GmbH gekauft, um ihren Namen aus den Besitzurkunden herauszuhalten.
Maya hatte jenen Grad von Berühmtheit erlangt, bei dem man sie mit genau einer Sache in Verbindung brachte. Manchmal stellte sie sich vor, wie es sich anfühlen musste, eine Schauspielerin zu sein, die in einen Skandal verwickelt war, oder ein Politiker, der plötzlich bloßgestellt wurde. Die Vergehen dieser Leute wurden katalogisiert, öffentlich gemacht, wurden zu feststehenden Suchbegriffen im Internet. Sie waren offene Bücher der Schuld. Mayas Sünden waren zum Glück ausschließlich privater Natur – mit einer einzigen Ausnahme.
Wenn jemandem klar wurde, wer sie war, gab es nur noch ein Gesprächsthema. Potenzielle Rechtsanwaltsgehilfinnen hatten während ihrer Vorstellungsgespräche darauf angespielt. Männer hatten bei ersten Dates Bemerkungen darüber fallen lassen. Bei Geburtstagsfeiern vermied Maya Eckplätze, um nie wieder am Ende der Tafel in der Falle zu sitzen und mit gequältem Gelächter über einen Witz hinweggehen zu müssen, den der Freund eines Freundes darüber riss. Alles, was in ihrer Macht stand, hatte sie getan, um diese Geschichte hinter sich zu lassen, aber es hatte nicht genügt.
Beweisaufnahmen waren öffentlich. Ihr Name musste in Belen Vasquez’ Gerichtsakten auftauchen. Hierherzukommen war für Rick tatsächlich der beste Weg gewesen, sie aufzuspüren.
»Worüber willst du denn sprechen?« Sie tat so, als würde sie die Antwort nicht schon kennen.
»Der Jahrestag steht kurz bevor«, sagte Rick.
»Das war mir gar nicht bewusst«, log Maya.
»Am neunzehnten Oktober ist es genau zehn Jahre her, dass Bobby Nock von der Anklage freigesprochen wurde, Jessica Silver umgebracht zu haben.«
Maya bemerkte die vorsichtige Formulierung. Aber sie wusste nur zu gut, dass es einzelne Menschen gewesen waren, die Bobby Nock freigesprochen hatten. Genauer gesagt: zwölf Personen.
Maya und Rick waren zwei davon gewesen.
Vor zehn Jahren – bevor sie Anwältin geworden war, bevor sie auch nur einen Gerichtssaal von innen erblickt hatte – war Maya einer Geschworenenvorladung gefolgt. Sie machte auf dem Formular ihr Kreuz und steckte einen vorfrankierten Umschlag in den Briefkasten. Anschließend verbrachte sie fünf Monate des Prozesses und der anschließenden Beratung mit Rick und den anderen, abgeschirmt von der Außenwelt.
Keiner von ihnen war auf die Kontroverse vorbereitet gewesen, die ihr Urteil auslöste. Erst als sie wieder aus ihrer Abschottung auftauchten, erfuhr Maya, dass 84 Prozent der Amerikaner glaubten, Bobby Nock habe Jessica Silver umgebracht. Was bedeutete, dass 84 Prozent der Amerikaner glaubten, Maya und Rick hätten den Mörder eines jungen Mädchens auf freien Fuß gesetzt.
Maya hatte versucht, etwas anderes zu finden, bei dem sich 84 Prozent der Bevölkerung einig waren. Wie sich herausstellte, glaubten nur 79 Prozent der Amerikaner an Gott. Immerhin stellte sie mit Dankbarkeit fest, dass mindestens 94 Prozent davon überzeugt waren, die Mondlandung habe tatsächlich stattgefunden.
Unter dem Druck der gewaltigen öffentlichen Ablehnung war Rick der erste der Geschworenen gewesen, der sein Urteil widerrufen hatte. Er war in alle Nachrichtensendungen gegangen und hatte sich entschuldigt. Er hatte Jessica Silvers Familie um Vergebung angefleht. Er hatte ein Buch über seine Erfahrung veröffentlicht und darin behauptet, ihr ungerechtes Urteil sei einzig Mayas Schuld gewesen. Er warf ihr vor, ihn so unter Druck gesetzt zu haben, dass er einen Mann freigesprochen hatte, den er in seinem tiefsten Innern immer für einen Mörder gehalten hatte.
Einige der anderen hatten sich ihm angeschlossen und sich ebenfalls von ihrer Entscheidung distanziert. Die meisten aber waren, wie Maya, stumm geblieben. Hatten gehofft, den Sturm aussitzen zu können.
Manchmal wünschte sie immer noch, sie hätte die Geschworenenvorladung damals einfach in den Müll geworfen wie jeder normale Mensch.
»Alle Nachrichtensender planen Rückblicke«, fuhr Rick fort. »CNN, Fox, MSNBC. Außerdem 60 Minutes und einige der anderen Magazine. Ist ja kein Wunder, wenn man bedenkt, wie viel Aufmerksamkeit der Prozess damals erregt hat. Und wenn man bedenkt, was seitdem passiert ist.«
Mit ihren Eltern hatte sie über die Jahre hinweg immer wieder über den Prozess gesprochen. Auch mit ihren Freunden, von denen es, da sie nun berühmt und berüchtigt war, deutlich weniger gab. Außerdem mit einer ganzen Parade von Therapeuten. Ihren Seniorpartnern in der Kanzlei hatte sie das Ganze grob zusammengefasst und ihren Mandanten einige beruhigende Details mitgeteilt. Aber in zehn Jahren hatte sie sich über den Fall nicht ein einziges Mal öffentlich geäußert.
»Ich rede nicht über das, was damals passiert ist«, sagte Maya. »Nicht mit CNN. Nicht mit 60 Minutes. Nicht mal mit dir. Ich habe damit abgeschlossen.«
»Hast du schon mal von Murder Town gehört?«, fragte Rick.
»Nein.«
»Das ist ein Podcast. Er ist sehr beliebt.«
»Okay.«
»Sie produzieren eine Dokuserie für Netflix. Acht Stunden. Und die basiert auf dem Podcast.«
Maya dachte an all die Stunden ihres Lebens, die der Fall Jessica Silver verschlungen hatte. Vier Monate Gerichtsverhandlung, gefolgt von drei Wochen erhitzter Beratungen. Während ihrer Abschottung war gewissermaßen jede wache Stunde dem Fall gewidmet gewesen. Wie gut sie sich an jede Bahn der Fleur-de-lis-Tapete in ihrer Suite im Omni Hotel erinnerte, an jeden Zentimeter des beigefarbenen Teppichs. Wenn sie jetzt an die Nächte in diesem Zimmer zurückdachte, kam es ihr vor, als hätte der Fall auch die Stunden ihres Schlafs vollständig vereinnahmt. Manchmal hatte sie es sich im Kopf ausgerechnet, um die Zeit totzuschlagen. Zwanzig Wochen à sieben Tage die Woche à vierundzwanzig Stunden pro Tag ergab … Sie kannte das Ergebnis noch immer auswendig.
»Wer«, fragte sie, »möchte denn bitte noch einmal acht Stunden durchkauen, was Jessica Silver zugestoßen ist?«
»Ziemlich viele Leute. Und ich bin einer von ihnen.«
»Du bist an dem Podcast beteiligt?«
»Es ist eine Dokuserie. Ich helfe den Produzenten. Indem ich uns zusammentrommele. Uns alle. Die Geschworenen.«
Maya wurde übel.
»Wir können darüber sprechen, wie wir über die Sache denken«, sagte Rick, »nach all der Zeit. Nach dem, was wir heute wissen …«
Rick machte eine dramatische Pause, als wären sie bereits auf Sendung.
»… würdest du immer noch für nicht schuldig stimmen?«
Maya wurde sich plötzlich der Menschenmenge bewusst, die sich an ihnen vorbei über den Gerichtsflur schob. All die Fremden, die in dieses Justizgebäude gekommen waren, weil sie sich nach Gerechtigkeit sehnten, nach Absolution oder Rache.
»Nein, danke«, sagte Maya.
»Ich habe mit den anderen gesprochen«, setzte Rick nach. »Sie sind dabei.«
»Alle?«
»Carolina ist gestorben. Ich weiß nicht, ob du das wusstest.«
Maya wusste es nicht. Carolina Cancio war zum Zeitpunkt des Prozesses schon über achtzig gewesen. Trotzdem berührte es Maya schmerzhaft, dass sie sich derart aus den Augen verloren hatten – nach allem, was sie gemeinsam durchgemacht hatten. Zwanzig Wochen á sieben Tage á vierundzwanzig Stunden …
Aber Maya hatte jahrelang weder mit Carolina noch mit einem der anderen gesprochen.
»Woran?«, fragte sie. »Wann?«
»Krebs. Vor vier Jahren, sagte mir ihre Familie.« Rick zuckte mit den Schultern. »Und Wayne hat den Produzenten eine Absage erteilt. Genau genommen hat er ihnen gesagt, dass sie ihn am Arsch lecken können.«
Wayne Russel. Maya fragte sich, ob er sein Leben irgendwann in den Griff bekommen hatte. Sie hoffte es. Aber wenn er immer noch derselbe Mann war wie damals am Ende ihrer Beratungen, war es gewiss das Beste, wenn er sich fernhielt.
»Aber alle anderen«, fuhr Rick fort, »die anderen acht … sind alle dabei.«
»Dann hoffe ich, ihr habt zusammen viel Spaß.«
»Ich bin hierhergekommen, um dich zu bitten, dich uns anzuschließen.«
»Nein.«
»Wir haben uns geirrt«, sagte Rick.
Maya konnte einen kurzen Wutausbruch nicht zurückhalten. »Ich habe dein Buch gelesen. Du hast alles Recht der Welt, die Entscheidung zu bereuen und dich damit zu foltern, aber lass mich aus dem Spiel.«
Einige der Leute um sie herum warfen ihnen einen Blick zu, kümmerten sich dann aber rasch wieder um ihre eigenen Angelegenheiten.
»Ein Mädchen ist gestorben«, sagte Rick mit einer Ernsthaftigkeit, die Maya nur zu gut wiedererkannte, »und ihr Mörder ist freigelassen worden, weil wir einen Fehler gemacht haben. Macht dir das gar nichts aus? Möchtest du denn gar nichts unternehmen – irgendetwas –, um das wiedergutzumachen?«
»Selbst, wenn ich der Ansicht wäre, dass Bobby schuldig war – was ich nicht bin –, können wir nichts mehr tun. Wir müssen das hinter uns lassen.«
Rick schaute sich auf dem Gerichtsflur um. »Du bist Prozessanwältin geworden. Du arbeitest im selben Gebäude, in dem die Verhandlung gegen Bobby stattgefunden hat. Du hast das ganze gerade mal zwei Stockwerke hinter dir gelassen.«
»Mach’s gut«, sagte Maya.
»Ich habe etwas herausgefunden.«
»Was?«
»Ich habe Nachforschungen angestellt.«
Es überraschte sie nicht. Sie wusste besser als die meisten, wie obsessiv er sein konnte. Wenn er sich erst mal auf etwas eingeschossen hatte, vor allem wenn es Ungerechtigkeiten betraf, ließ er nicht locker. Im Jessica-Silver-Fall war er allerdings nicht der Einzige, auch Jessica Silvers Eltern, Lou und Elaine, hatten nicht aufgegeben. Ihr Vermögen war damals auf drei Milliarden Dollar geschätzt worden. Herrgott, dachte Maya, inzwischen hatte es sich vermutlich längst verdoppelt. Lou Silver gehörte ein nicht unwesentlicher Teil der Immobilien im Los Angeles County. Das Verschwinden seiner Tochter war wirklich von den Allerbesten untersucht worden.
»Dutzende von LAPD-Beamten haben an dem Fall gearbeitet«, sagte Maya. »Das FBI. Journalisten aus der ganzen Welt sind hier eingeflogen, Privatdetektive haben Tag und Nacht für die Familie Silver durchgearbeitet, die Teams aus Anwälten auf beiden Seiten, Heerscharen von Amateur-Bloggern und Verschwörungstheoretiker mit Youtube-Kanälen und …« Maya unterbrach sich. Sie durfte nicht zulassen, dass sie wieder in all das hineingezogen wurde. »Es gibt keine Beweise, die man noch finden könnte.«
»Tja, ich habe aber welche gefunden.«
»Was?«
»Komm zu den Dreharbeiten.«
»Was hast du gefunden?«
Er trat näher an sie heran. Sie spürte seinen warmen Atem an ihrem Hals. »Das kann ich dir jetzt nicht sagen.«
»Schwachsinn.«
»Es ist kompliziert. Es ist heikel … Hör zu. Komm einfach zum Dreh, dann werde ich ihn offenlegen … uns allen … den unwiderlegbaren Beweis, dass Bobby Nock Jessica Silver umgebracht hat.«
Maya schaute in seine flehenden Augen. Sie sah, wie sehr er das brauchte. Er glaubte aus allertiefstem Herzen, dass sie einen unverzeihlichen Fehler begangen hatten.
Maya wusste nicht, ob Bobby Nock Jessica Silver getötet hatte. Genau das war es ja: Sie hatte es nie gewusst. Deswegen hatte sie ihn freigesprochen. Nicht, weil er unschuldig gewesen wäre, sondern schlicht, weil es nicht genug Beweise gegeben hatte, um es mit Sicherheit sagen zu können. Es war besser – so hatte sie argumentiert –, dass zehn Schuldige freigelassen würden, als dass ein einziger Unschuldiger fälschlich verurteilt würde.
Vielleicht glaubte Rick tatsächlich, einen bisher übersehenen, eindeutigen Beweis gefunden zu haben. Maya dagegen hatte schon vor langer Zeit die Hoffnung aufgegeben, dass ein solcher Beweis existierte. Zehn Jahre hatte sie gelernt, mit ihren Zweifeln zu leben. Und wenn Rick sich jemals davon befreien wollte, würde er es genauso machen müssen.
Rick hatte ihr einmal sehr am Herzen gelegen. Sein Gesicht vor sich zu sehen, hätte nicht dafür sorgen sollen, dass sich ihr Magen derartig zusammenzog. Er war ein guter Mensch. Er verdiente ein Lebensglück, das er unter den Trümmern von Jessica Silvers Tod niemals finden würde. Das wusste sie.
»Viel Glück«, sagte Maya leise. »Ich hoffe, du bekommst am Ende, was du dir davon versprichst. Aber ich kann mich daran nicht beteiligen.«
Sie drehte sich um und ging.
Sie schaute nicht zurück.
Mayas Büro bei Cantwell & Myers befand sich im dreiundvierzigsten Stock des im Stadtzentrum gelegenen Kanzlei-Hochhauses. Sie saß an ihrem Schreibtisch, der aus der Mitte des vergangenen Jahrhunderts stammte und den ihre Assistentin aus einem Firmenausstattungskatalog für sie bestellt hatte. Ihr fiel es schwer, sich zu konzentrieren.
Sie wandte sich den Fenstern zu und ließ die Skyline der neuen City auf sich wirken, eine Flotte schlanker Wolkenkratzer, die sich vor ihr in den Himmel reckten. Die Hälfte der Gebäude hatte es vor zehn Jahren noch gar nicht gegeben. Wie viele davon gehörten Lou Silver?
Der blaue Himmel über Los Angeles sah ewig aus, ja, geradezu urzeitlich – dieselbe Farbe heute, dieselbe Farbe morgen, exakt derselbe Blauton, den er vor zehn Jahren gezeigt hatte, an jenem Nachmittag, als ein junges Mädchen verschwand. Nur wenige Meilen entfernt war es passiert. Die Leute sagten immer, L. A. hätte keinen Sinn für seine Geschichte, doch Maya war zu der Überzeugung gelangt, dass genau das Gegenteil der Fall war. L. A. war eine Zeitkapsel seiner selbst, umschlossen und für alle Ewigkeit konserviert in einer unveränderbaren himmelblauen Muschel.
»Haben Sie kurz Zeit?«
Craig Rogers stand in der offenen Tür. Er trug einen dunklen, maßgeschneiderten Anzug. Seine kurz geschnittenen Haare waren an den Schläfen weiß meliert. Als sie damals bei Craig angefangen hatte, hatte sie seinen Lebenslauf zurate ziehen müssen, um herauszufinden, wie alt er war – war er eher dreißig oder fünfzig? Unmöglich zu erkennen. Schließlich ermittelte sie das Jahr seines College-Abschlusses und rechnete es sich aus: Er war sechsundfünfzig Jahre alt.
In seiner Jugend war Craig Bürgerrechtsanwalt gewesen, einer jener schwarzen Anwälte, die in den 80er-Jahren den Kampf aufgenommen und Zivilklagen gegen kriminelle LAPD-Beamten der Rampart Divison eingereicht hatten. In den 90ern hatte er mit dem NAACP Legal Defense Fund am Prozess Thomas gegen das Los Angeles County gearbeitet. Und nun war er Senior-Partner bei Cantwell & Myers.
Hatte Craig sich verkauft? Vielleicht. Aber er hatte es dabei nicht schlecht getroffen. Bei Cantwell & Myers standen ihm unvergleichliche Ressourcen zur Verfügung, um sich den Fällen zu widmen, die er für wichtig hielt.
»Natürlich«, sagte sie.
Er schloss die Tür und setzte sich auf einen Stuhl. Wenn der Staatsanwalt im Belen-Vasquez-Fall sie übergangen und direkt bei Craig ein Angebot für eine neue Anklage eingereicht hatte, würde sie dem Arschloch die Hölle heiß machen.
»Unsere PR-Abteilung«, sagte Craig, »ist von Leuten kontaktiert worden, die etwas produzieren, das sich Murder Town nennt.«
Sie hätte wissen müssen, dass Rick Leonard sich nicht so leicht abschütteln ließ. Natürlich wandte er sich an ihren Boss.
»Sie drehen eine achtstündige Dokuserie über den Fall Jessica Silver«, erklärte sie, »und die Leute wollen, dass alle damaligen Geschworenen – ich eingeschlossen – daran mitwirken.«
»Man hat also schon mit Ihnen gesprochen?«
Maya beschrieb kurz ihren morgendlichen Zusammenstoß mit Rick.
Craig machte einen zufriedenen Eindruck. »Das ist doch hervorragend. Sie machen die Show?«
»Ich habe abgelehnt.«
Craig runzelte die Stirn. »Darf ich fragen, warum?«
»Ich glaube nicht, dass es noch relevante neue Beweise aufzuspüren gibt. Auch wenn sich Rick offenbar als Amateurdetektiv betätigt hat. Die Fakten sind schon lange geklärt: Blut, DNA, Überwachungskameras, Mobilfunkdaten, die mehrdeutigen SMS …« Sie erinnerte sich immer noch an alles. »Da sind alle Knochen bis aufs Mark abgenagt worden.«
»Knochen? Ich dachte, man hätte die Leiche nie gefunden.«
»Metaphorisch gesprochen.«
Craig lehnte sich in seinem Stuhl zurück, als wolle er suggerieren, dass die Knochen vielleicht doch mehr waren als eine bloße Metapher.
»Es ist absolut unmöglich«, sagte Maya, »dass Rick Leonard Jessica Silvers Leichnam gefunden hat.«
»Amateur oder Profi, wenn man zehn Jahre lang nach etwas gräbt … Aber das ist genau der Grund, weshalb ich vorschlagen würde, dass Sie doch an der Sendung mitwirken.«
»Definieren Sie vorschlagen.«
»Die Entscheidung liegt bei Ihnen«, sagte Craig. Ein Satz, den Menschen immer nur dann benutzten, wenn sie das Gegenteil meinten. »Es steht Ihnen frei, zu tun, was immer Sie wollen.« Noch ein Satz, der nur benutzt wurde, wenn das Gegenteil gemeint war. »Die Kanzlei steht hinter Ihnen.«
Maya war sich nur allzu bewusst, dass die Rolle, die sie als Geschworene im Fall Bobby Nock gespielt hatte, einer der Gründe dafür gewesen war, dass Cantwell & Myers sie eingestellt hatten. Hatte diese Tatsache ihr geholfen, Mandanten zu gewinnen? Natürlich. Es war Teil ihrer Akquise. Viele Strafverteidiger hatten früher für die Staatsanwaltschaft gearbeitet, Maya aber war früher Geschworene gewesen – und zwar in einem der berüchtigtsten Prozesse aller Zeiten. Sie hatte nicht nur auf der gegnerischen Seite gestanden, sondern auf der anderen Seite des Gerichtsaals. Wer wusste besser als sie, wie eine Jury entscheiden würde? Welcher Angeklagte, schuldig oder nicht, würde sich nicht von der Frau verteidigen lassen wollen, die für Bobby Nocks Freispruch verantwortlich war?
Ja, das Urteil hatte Maya geholfen, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber das Urteil war nicht dafür verantwortlich, dass sie das Jurastudium an der UC Berkeley als Elftbeste ihres Jahrgangs abgeschlossen hatte. Das Urteil hatte nicht drei Dutzend Mandanten durch komplizierte Vergleiche gebracht und dazu geführt, dass alle vier Fälle, die sie tatsächlich vor Gericht verteidigt hatte, mit einem Freispruch geendet hatten. Das Urteil hatte sie nicht innerhalb von drei Jahren zum Partner gemacht. Und in Anbetracht all der Widrigkeiten, die das Urteil ihr im Laufe der Jahre zugemutet hatte, lehnte sie es ab, sich für die wenigen positiven Dinge zu entschuldigen, die sie ihm zu verdanken hatte.
»Es glauben doch sowieso schon alle, dass Bobby Nock es getan hat«, sagte Maya. »Wen interessierte es da noch, was Rick Leonard – zum tausendsten Mal – in einer Fernsehsendung sagt?«
»Sie sind jetzt Partner«, erwiderte Craig. »Und das bedeutet, dass alles, was über Sie gesagt wird – über Sie persönlich –, sich auch auf die anderen Partner auswirkt. Wir sind jederzeit bereit, ihnen ein herausragendes Charakterzeugnis auszustellen. Und deshalb würde ich Sie gern ermutigen, dies auch aktiv für sich selbst zu tun.«
Craigs Fähigkeit, alles, was er wollte, so wirken zu lassen, als läge es in ihrem eigenen Interesse, war beeindruckend. Was er wirklich meinte: Dass die Kanzlei sich nicht in ein schlechtes Licht würde rücken lassen durch Mayas Rolle in einem Prozess, für den Cantwell & Myers keinen Cent gesehen hatten.
»Dass ich zehn Jahre lang aus Prinzip nicht nachgegeben habe, ist das eine«, sagte sie. »Aber eine Idiotin zu sein, die sich an einer dummen Entscheidung festklammert, selbst wenn neue Beweise auftauchen, die zeigen, dass ich mich geirrt habe, ist noch mal ganz was anderes.«
»Wir bemühen uns doch alle, aus unseren Fehlern zu lernen, oder?«
Das Dumme an der Sache: Wenn Rick Leonard tatsächlich über neue Beweise verfügte, die Bobby Nock eindeutig belasteten – und Maya sich öffentlich entschuldigte –, stünde sie besser da als jetzt. Manche Strafverteidiger beharrten aus Prinzip darauf, Mörder als unschuldig zu betrachten, auf Maya traf dies aber nicht zu. Sie konnte von sich behaupten, sich immer an den Beweismitteln orientiert zu haben, auch wenn das bedeutete, dass sie ihre Meinung ändern musste. Und sie war stets mit dem Gefühl vor Gericht aufgetreten, eine ehrliche Haut zu sein.
Wenn sie erfuhr, dass es diese geheimnisvollen neuen Beweismittel tatsächlich gab, würde sie also lediglich zugeben müssen, dass sie sich geirrt hatte.
Maya sagte nicht viel, als Craig ihr ein Memo mit den Einzelheiten reichte. Das große Wiedersehen würde in einem Monat stattfinden. Und wieder würde die Jury eingeladen sein, die Nacht im Omni Hotel in der Olive Street zu verbringen. In demselben Hotel, in dem sie auch damals von der Öffentlichkeit abgeschottet worden waren.
Maya sprach während des gesamten Gesprächs das Wort »Ja« kein einziges Mal aus. Sie nickte bloß, hörte zu und versuchte, das nagende Gefühl zu unterdrücken, in der Falle zu sitzen.
Schließlich erhob sich Craig. Er warf einen Blick auf ihren Schreibtisch und verzog das Gesicht.
»Ist das der Kopf von Belen Vasquez’ Mann?«
Sie hatte die Fotos vorhin vor sich ausgebreitet. »Ja.«
»Ich habe gehört, dass man Ihnen gefährliche Körperverletzung zugestanden hat. Gut gemacht.«
Nachdem er gegangen war, blieb Maya sitzen und tippte mit den Fingern auf der glatten Oberfläche der schauerlichen Fotos herum.
Was hätte sie vor zehn Jahren über diese Bilder gedacht? Als sie das ernste, naive sechsundzwanzigjährige Mädchen gewesen war, das zum ersten Mal einen Gerichtssaal betreten hatte. Sie war ein anderer Mensch gewesen, an den sich Maya, wie an eine flüchtige Party-Bekanntschaft, selbst nur schwach erinnerte.
Manchmal wurde Maya noch immer wütend. Es gab so viele Menschen, auf die sie wütend sein konnte: Auf den Richter, der sie zu lange in der Abschottung festgehalten hatte, auf die Anwälte, die sie manipuliert hatten, auf die Talkshow-Moderatoren, für die sie bloß ein reißerischer Aufmacher gewesen war. Ihnen allen hätte sie am liebsten entgegengeschrien: Ich habe Jessica Silver nicht getötet.
Jessicas Gesicht lag für immer und ewig direkt unter der Oberfläche ihres Gedächtnisses. Jeden Augenblick konnte es auftauchen. Manchmal stand sie in einem Café in der Warteschlange, und da war es plötzlich. Jessicas blaue Augen, ihre weichen Wangen, ihr strahlendes Lächeln. Das berühmte Bild eines wunderhübschen jungen Mädchens, das einfach so vom Angesicht der Erde gewischt worden war. Wer auch immer sie ermordet hatte, war das Ungeheuer, das Mayas ganze Wut verdiente, und auch die von allen anderen.
Und doch, während sie hier an ihrem Tisch saß, war es nicht der Mörder, auf den Mayas Wut fiel. Nein, ihre ganze Bitterkeit richtete sich auf die Person, die dafür verantwortlich war, dass sie sich nun in dieser Lage befand: auf den Geschworenen 272.
Kapitel 2
RICK
29. Mai 2009
»Wer bitte schafft es denn nicht, sich vor einem Geschworenendienst zu drücken?« So hatte Rick Leonards Mitbewohner Gil es an diesem Morgen in der Küche ihrer Zweizimmerwohnung ausgedrückt.
Rick war ein achtundzwanzigjähriger Student kurz vor der Promotion. Er hatte noch nie zuvor eine solche Vorladung erhalten, erinnerte sich aber daran, dass sein Dad in seiner Jugend einmal Geschworener gewesen war. Sowie einige seiner Lehrer in der Grade School, die deswegen eine Weile ausgefallen waren. Ehrlich gesagt erschien Rick eine Verpflichtung dieser Art wie ein ziemliches Luxusproblem. Selbst sich darüber zu beklagen – »Oh Mann, kannst du dir das vorstellen, jetzt hängt mir diese Geschworenensache an der Backe« –, klang eher wie eine Auszeichnung.
»Wenn du da rauswillst, Alter«, sagte Gil, »dann kannst du das hundertprozentig hinkriegen.«
Rick zuckte mit den Schultern. »Ach, eigentlich kann ich es auch einfach hinter mich bringen.«
Es war Mai, vorlesungsfreie Zeit zwischen den Semestern. Er hatte eine halbe Stelle bei einem Professor, für den er während des Sommers Recherchearbeiten übernahm. Es ging um das Versagen der Stadtplanung in Brasília und die daraus resultierenden unregierbaren Favelas. Er hatte Zeit. Außerdem – auch wenn er es Gil gegenüber niemals so gesagt hätte –, bestand nicht die Möglichkeit, dass er tatsächlich etwas Gutes tun konnte? Das Justizsystem konnte Geschworene, die ihren Dienst verantwortungsbewusst ausübten, gut gebrauchen. Er mochte ja seine Fehler haben – Recht und Gesetz aber nahm er ernst.
Rick rückte den blauen Blazer auf seinen schmalen Schultern zurecht.
»Was soll’s«, sagte er. »Ein Tag, maximal zwei. Rein, raus, erledigt. Was kann schon schlimmstenfalls passieren?«
Rick traf beim Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center ein und stieß auf ein dichtes Gewimmel von Pressevertretern. Er nahm an, dass die Journalisten und Kameracrews hier jeden Tag anrückten – um aufzunehmen, wie Filmstars ihren Vorladungen wegen Geschwindigkeitsübertretung nachkamen oder DJs wegen Drogenbesitzes zu gemeinnütziger Arbeit verurteilt wurden. Später, als aus den Tagen Wochen wurden und aus den Wochen Monate, kam er sich dumm vor, weil er den Presseauflauf nicht mit der Tatsache verbunden hatte, dass Bobby Nock kurz davorstand, wegen des Mordes an Jessica Silver vor Gericht gestellt zu werden. Wofür hätten sich die Journalisten mehr interessieren können?
Ein paar Minuten vor neun betrat Rick den Geschworenenraum. Der uniformierte Gerichtsbeamte überprüfte seinen Namen auf einem Klemmbrett und reichte ihm einen Zettel, der ihm seine neue Identität verschaffte: Geschworener 158.
»Für Ihre persönliche Sicherheit und Privatsphäre«, sagte der Beamte, »werden Sie, solange Sie sich hier aufhalten, mit Ihrer Geschworenennummer angesprochen, und zwar ausschließlich mit Ihrer Geschworenennummer. Haben Sie das verstanden?«
»Klar.«
»Das bedeutet: Keine Klarnamen. Nicht im Gespräch mit uns, und nicht untereinander.«
»Untereinander?«
»Mit den anderen Geschworenen.« Darauf wandte sich der Beamte zum nächsten in der Schlange.
Rick nahm Platz. Er betrachtete die paar Dutzend Leute, die hier bereits warteten. Er musterte ihre Kleidung und die Magazine, Zeitungen, Rätselhefte und die vereinzelten Taschenbuchkrimis, die sie lasen.
Wer bitte, schafft es denn nicht, sich vor einem Geschworenendienst zu drücken?
Er fragte sich, wer von diesen Leuten Unwahrheiten vorschieben würde, um sofort wieder von der Verpflichtung entbunden zu werden. Kleine Kinder, kranke Eltern, finanzielle Sorgen, psychische Probleme – all das konnte als Grund dienen, um wieder nach Hause geschickt zu werden. Man musste sich nur vor einem Richter darauf berufen. Das Gericht hatte schwerlich die Möglichkeit, so etwas zu prüfen.
Man musste lediglich lügen.
Was bedeutete, dass diejenigen, die blieben, was auch immer sie sonst sein mochten, ehrlich waren.
Eine junge Frau setzte sich auf den Stuhl neben ihm. Sie war weiß, hatte kurze dunkle Haare und weiche Züge, wodurch er sie anfangs für sehr viel jünger hielt als sie tatsächlich war. Erst ihre ruhige selbstbewusste Haltung ließ ihn erkennen, dass sie vermutlich in seinem Alter war. Sie trug einen dunkelblauen Rock, dazu ein helles, formelles Oberteil. Die meisten anderen Geschworenen waren in Jeans und losen Hemden hier aufgekreuzt, aber sie hatte sich ebenso dem Anlass entsprechend gekleidet wie er.
Er überlegte, ob er Hallo sagen sollte. Aber was dann? Er wusste nie, was man auf Hallo folgen lassen sollte.
Sie saßen schweigend nebeneinander, bis die Frau den letzten Schluck Kaffee aus ihrem Pappbecher trank und ihn direkt neben seinen auf den Boden stellte.
Er erhob sich. »Sind Sie damit fertig?«
Sie schien einen Augenblick zu brauchen, bis sie verstand, was er meinte. »Oh … ja.«
Er hob beide Becher vom Boden auf und trug sie zum Papiermülleimer hinüber.
»Nett von Ihnen«, sagte sie, als er zu seinem Platz zurückkehrte.
Er deutete auf ein Plakat an der Wand, auf dem Anweisungen standen. Bitte entsorgen Sie Ihren Müll in den entsprechenden Behältnissen war der zweite Punkt. »Ich halte mich bloß an die Regeln.«
Sie musterte ihn von Kopf bis Fuß, betrachtete seine Khakihosen und sein gebügeltes Hemd. »Ich nehme an, der rebellische Typ sind Sie wohl eher nicht.«
Sie hob ihren Rucksack auf und ließ ihn in ihren Schoß fallen. Rick bemerkte einen großen Obama-Kampagnen-Button, der an eine der Taschen gepinnt war. Der Button war quadratisch und darauf stand das Wort H-O-P-E in Rot, Weiß und Blau.
Rick hielt seinen eigenen Rucksack hoch und offenbarte ihr denselben vorn angesteckten Button.
»Er ist jetzt seit vier Monaten im Amt«, sagte sie lächelnd. »Es wäre wohl langsam Zeit, die Dinger abzunehmen.« Sie hatte ein großartiges Lächeln.
»Behalten Sie ihn. Sie können ihn in drei Jahren wieder anstecken.«
»Gott, Sie können sich vorstellen, all das noch einmal durchzumachen?«
»Ja. Kann ich.« Er hatte das Gefühl, sie würde schon jetzt etwas geradezu peinlich Ernsthaftes an ihm zum Vorschein bringen. »Haben Sie ehrenamtlich im Wahlkampf mitgearbeitet?«
»Ich hab ein paar Wochenenden lang in Pennsylvania an einige Türen geklopft. Da habe ich noch in New York gelebt.«
»Nevada«, sagte er. »Ich meine, die Türen, an die ich geklopft habe, waren in Nevada. Da habe ich gelebt.«
»Meine Damen und Herren«, rief der Beamte. »Haben Sie vielen Dank für den Dienst, den Sie der Stadt Los Angeles erweisen. Wenn Sie Ihre Aufmerksamkeit bitte nach hier oben richten, werde ich Ihnen ein kurzes Video vorspielen, in dem Ihre Pflichten und Aufgaben für dieses Gericht erklärt werden.«
Aus einer Ecke des Raumes zog er einen schwarzen Metallwagen, auf dem ein alter Fernseher stand. Er mühte sich damit ab, den richtigen Kanal zu finden, drückte mit wachsender Frustration auf der Fernbedienung herum. Endlich tauchte der Schauspieler Sam Waterston auf dem Bildschirm auf.
»Das kommt … unerwartet«, sagte Rick.
»Ist das nicht … der Typ aus Law & Order?«, fragte die Frau.
»Hallo«, sagte Sam Waterston. »Und willkommen zu Ihrem Geschworenendienst.«
Sie schauten zu, wie der Schauspieler ihnen im Verlauf des zehnminütigen Einführungsvideos ihre verantwortungsvollen Pflichten auseinandersetzte. Sam Waterston informierte sie darüber, dass keineswegs jedes Land, nicht einmal jede Demokratie, einem Angeklagten in einem Strafprozess Geschworene gewährte, die mit ihm oder ihr auf derselben Stufe stünden. In Frankreich und Japan beispielsweise oblag die Tatsachenfindung einem Richter. In Deutschland einem Drei-Personen-Team aus einem Richter und zwei Schöffen. Die Berufung von Geschworenen mache unser System so einzigartig und zugleich so wertvoll für das große Experiment namens Amerika. Seinen Dienst als Geschworener zu leisten, gehörte zu den erhabendsten Aufgaben der Staatsbürgerschaft, die man überhaupt ausüben könne.
Rick ließ die Frau an seiner Seite nicht merken, dass er das Ganze tatsächlich ziemlich erhebend fand.
Nach dem Video begann der Beamte den langwierigen Prozess, sie alle nacheinander aufzurufen und einem Gerichtssaal zuzuordnen. »Geschworener 101! Bitte kommen Sie nach vorn.«
Der Geschworene war ein alter Mann, ein Asiate, der kein Wort sprach, als man ihn einem Gerichtssaal zuteilte.
»Warum glauben Sie, macht er es?«, fragte die Frau und nickte dem frisch getauften Geschworenen 101 zu, während er zur Tür schlurfte.
»Macht er was?«, sagte Rick.
»Warum wird er Geschworener? Man kommt doch leicht raus. Jeder, der sich keine Ausrede einfallen lässt, muss doch einen guten Grund dafür haben, warum er das hier machen will.«
»Vielleicht fühlen sie sich, keine Ahnung, verpflichtet, ihrem Land zu dienen.«
Die junge Frau beobachtete den älteren Asiaten nachdenklich. »Oder … er ist eigentlich professioneller Bankräuber. Bloß nie erwischt worden. Liebt es, seine Grenzen auszutesten, mit der Polizei Katz und Maus zu spielen und immer riskantere Dinger zu drehen. Als er die Vorladung zum Geschworenendienst erhalten hat, konnte er der Versuchung nicht widerstehen. Er musste einfach dem Gericht einen Besuch abstatten, das es nie geschafft hat, ihn hinter Gitter zu bringen.«
»Vielleicht«, fügte Rick hinzu, »wird er ja auch beim Prozess von einem seiner früheren Komplizen eingesetzt. Vielleicht gehört das alles zu seinem Plan.«
»Das wäre kein besonders guter Plan.«
»Woher wollen Sie das wissen?«
»Die statistische Wahrscheinlichkeit, bei genau dem Prozess eingesetzt zu werden, auf den man es abgesehen hat …«
»Ah«, sagte Rick. »Jetzt weiß ich, warum Sie hier sind.«
»Warum?«
»Sie planen einen Raubüberfall.«
Sie warf ihren Kopf zurück und ein tiefer Lacher kam hervor, von ganz tief unten. Einige der anderen drehten sich zu ihr um.
Ein paar Minuten später rief der Beamte den Geschworenen 111 auf und schickte einen genervt aussehenden Weißen zu seinem vorgesehenen Gerichtssaal. Rick und die junge Frau waren sich einig, dass er hergekommen sein musste, um einen freien Tag zu genießen – ohne den Job, den er hasste, und in der Hoffnung, hier endlich mal in Ruhe seine Sports Illustrated lesen zu können.
Den Rest des Vormittags spielten sie ihr Spiel weiter, brauten Motivationen und Geschichten für jeden Geschworenen zusammen, dessen Nummer aufgerufen wurde. Sie war witzig. Und was noch überraschender war: Rick kam sich selbst witzig vor, was nicht jeden Tag passierte. Er fragte sich, wie er es anstellen sollte, sie zu fragen, ob sie mit ihm Mittag essen würde, als der Beamte den Geschworenen 158 aufrief.
»Das bin ich«, gab er zu.
»Dann viel Glück beim Rechtsprechen.«
»Geschworener 158«, blaffte der Beamte.
»Viel Glück bei Ihrem Raubüberfall«, sagte Rick und trat vor.
Mann, er wünschte, er hätte ihren Namen herausbekommen.
Zwanzig Minuten später wurde Rick klar, dass er tief in der Scheiße steckte. Ihm und acht anderen angehenden Geschworenen waren ein schwarzer Kugelschreiber und ein zwölfseitiger Fragebogen in die Hand gedrückt worden. Es gab Hunderte Fragen, aber gleich die allererste lieferte Rick den entscheidenden Hinweis darauf, was ihm bevorstand.
»Haben Sie Robert Nock jemals persönlich getroffen oder mit ihm zu tun gehabt?«
Verdammt. Wurde er gerade für den Fall Jessica Silver geprüft?
Frage Nr. 2: »Haben Sie Jessica Silver jemals persönlich getroffen oder mit ihr in irgendeiner privaten, familiären oder geschäftlichen Verbindung gestanden?«
Rick hatte ein vages Bild davon, wie Jessica Silver ausgesehen hatte. Gil und er besaßen keinen Fernseher, aber er hatte ihr Gesicht Dutzende Male auf den Bildschirmen bei Mohawk Bend oder in einem der anderen Restaurants und Cafés gesehen, in die er sich manchmal setzte, um aus der Wohnung rauszukommen und etwas zu lesen. Sie sah aus wie so viele andere hübsche weiße Mädchen, deren Verschwinden die 24-Stunden-Programme der Nachrichtensender füllte: blond, blauäugig, immer lächelnd, der Inbegriff gut situierter Unschuld. Sie sah aus wie die Tochter irgendwelcher x-beliebigen Vorort-Eltern, die das Zielpublikum dieser Sender darstellten. Sie waren die eigentlichen Opfer all der Shows, deren Aufgabe es war, wohlhabende, anständige Leute so lange zu ängstigen, bis sie glaubten, ihr wohlgeordnetes Leben stünde unter ständiger Bedrohung. Es spielte keine Rolle, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein weißes Kind einer wohlhabenden Familie aus einer guten Gegend plötzlich ermordet wurde, verschwindend gering war. Nie erwähnten die Nachrichtensender, dass ein Mädchen wie Jessica Silver mit höherer Wahrscheinlichkeit vom Blitz getroffen würde. Anstatt die Seltenheit solcher Ereignisse zu erklären, lautete die Botschaft stets: Dies könnte auch Ihnen zustoßen. Sie sendeten es zu jeder vollen Stunde aufs Neue: Dies könnte auch Ihren Kindern passieren.
War Rick jemals Bobby Nock oder Jessica Silver begegnet? Nein. Aber er wusste, dass Jessica Silver weiß und reich gewesen war und Bobby Nock schwarz war und kein Geld hatte und dass man diesem Typen die Hölle heiß machen würde.
Ein vernünftiger Mensch hätte diesen Augenblick genutzt und beim Ausfüllen des Formulars gelogen. Sich zu einem Geschworenendienst berufen zu lassen, war das eine, aber Geschworener beim Prozess gegen Bobby Nock zu sein, etwas gänzlich anderes. Wählte man Rick aus, würde er wochenlang hier sein. Womöglich den halben Sommer über. War er dem wirklich gewachsen? Es gab so viele Lügen, die er vorbringen konnte: Er konnte behaupten, jemanden zu kennen, der ermordet worden war, oder dass er Polizisten derart hasste, dass er ihnen nie auch nur ein einziges Wort glauben könnte. Er konnte auch einfach etwas völlig Irres sagen, so dass sie ihn für einen Verrückten hielten.
Er blickte auf den Fragebogen hinab. Und dann seufzte er, weil ihm klar wurde, dass er sich nicht davon abhalten konnte, alles ehrlich zu beantworten.
Scheiße.
Neunzig Minuten später wurde Rick in einen Gerichtssaal geführt. Der Richter forderte ihn auf, sich einen Platz auf der Geschworenenbank zu nehmen, allein, während der Staatsanwalt und die Verteidigerin seine Antworten auf dem Fragebogen begutachteten. Rick stellte überrascht fest, dass ein junger Schwarzer am Tisch der Verteidigung saß. War das Bobby Nock?
Zum ersten Mal konnte Rick einen ausgiebigen Blick auf ihn werfen. Von Angesicht zu Angesicht sah er aus wie ein Teenager. Er war eindeutig jünger als Rick, und es war nicht nur die Tatsache, dass ihm der Anzug, der von seinen Schultern herabhing, zu groß war; der Mann war dürr. Den Blick hatte er starr auf seine gefalteten Hände gerichtet. Dieser Junge sollte ein Mörder sein?
Die wenigen verbliebenen Haare auf dem Kopf des Richters waren weiß, und er sprach so leise, fast flüsternd, dass Rick sich anstrengen musste, um ihn zu verstehen, während er ihm erklärte, dass sich Rick nun einem Prinzip namens voir dire zu unterwerfen habe.
»Das ist altes Französisch«, sagte der Richter, »und bedeutet: nur und ausschließlich die Wahrheit zu sprechen.« Der Ankläger und die Verteidigerin würden Rick nun abwechselnd in die Zange nehmen wegen der Antworten, die er auf seinem Fragebogen gegeben hatte.
Der Staatsanwalt war ein schwergewichtiger Mann mit Hängebacken. Er hieß Ted Morningstar und hatte die arrogante Attitüde langer Berufserfahrung. Als er Rick fragte, ob er bereits eine Meinung zur möglichen Schuld des Angeklagten gefasst habe, antwortete Rick ehrlich, dass dies nicht der Fall sei.
Aber Rick war nicht blind. Es befanden sich vier Schwarze in diesem Gerichtssaal: der Angeklagte Bobby Nock, eine Assistentin des Staatsanwalts, die kein Wort von sich gab, während sie am Tisch der Staatsanwaltschaft Fragebögen durchsah, ein uniformierter Polizeibeamter, der für die Sicherheit sorgte, und Rick.
Was wusste Rick über den Angeklagten? Nur, dass sie beide schwarze Männer waren, die in Los Angeles lebten. Wenn die Anwälte glaubten, Rick könne deshalb nicht gerecht urteilen, dann sagte das mehr über sie als über ihn. Rick starrte Bobby an. Das Gesicht des Jungen war nicht zu entziffern. Es war, als würde man einen alten Fernseher anstarren, der nur Rauschen zeigte.
Morningstar tänzelte weiter um die eine Frage herum, von der Rick genau wusste, dass er sie ihm stellen wollte. Die Frage, die die Hinterlassenschaft all der Prozesse war, die in diesem Raum und in so vielen ähnlichen Räumen stattgefunden hatten.
Können Sie, Rick Leonard, als Afroamerikaner, sich dazu bringen, über die Tatsache hinwegzusehen, dass es sich bei Bobby Nock, der beschuldigt wird, eine junge weiße Amerikanerin umgebracht zu haben, ebenfalls um einen Afroamerikaner handelt?
Können Sie, Rick Leonard, sich von diesem ganzen Mist losmachen?
Mehr als alles andere wünschte sich Rick, der Staatsanwalt würde es einfach aussprechen. Aber er wusste, das würde nicht passieren.
Pamela Gibson, die Verteidigerin, war jünger als der Staatsanwalt, eine dünne, kantige Frau. Sie durchquerte den Gerichtssaal wie eine Sportlerin ihren Trainingsplatz. Während der Tonfall des Staatsanwalts klang wie: Wir wissen doch alle, was hier in Wirklichkeit gespielt wird, oder?, suggerierte ihrer eher: Wer weiß schon, was mit Wirklichkeit überhaupt gemeint ist?
Nachdem Morningstar fertig war, lag es an der Verteidigung, herauszufinden, wie man Rick nicht direkt fragen konnte, inwieweit sein »Schwarzsein« seine Urteilsfähigkeit beeinflussen würde.
Werden Sie, Rick Leonard, im Zweifel für den Angeklagten entscheiden, weil Sie und er etwas gemeinsam haben? Na ja, Sie wissen schon, was.
Während seiner fünfundvierzig Minuten dauernden Befragung kam es nur ein einziges Mal zum Augenkontakt mit Bobby Nock. Pamela Gibson forderte Rick auf, die Personen aus seinem Umfeld aufzuzählen, die Opfer von Gewaltverbrechen geworden waren. Es war eine kurze Liste. Und als er davon sprach, dass man seine Mutter einmal überfallen hatte, als er neun Jahre alt gewesen war, schaute Bobby Nock ihm direkt ins Gesicht.
»Allerdings war das nicht wirklich ein Gewaltverbrechen«, stellte Rick klar. »Der Typ hat sich einfach ihre Handtasche geschnappt und ist weggerannt.« Dann starrte er zu Bobby hinüber, in die ängstlichen Augen des armen Jungen, von dem alle glaubten, er hätte ein junges Mädchen umgebracht. War Bobbys Blick in diesem Augenblick ein stummer Hilferuf? Eine Art Signal? Kannst du mir hier raushelfen?
Rick konnte es nicht sagen, und ihm wurde bewusst, dass es ihm egal war. Die einzigen Leute, die glaubten, er und Bobby Nock hätten etwas gemeinsam, waren Menschen, die keine Ahnung von ihnen hatten. Rick meinte, was er den Anwälten sagte: Er würde gerecht urteilen. Unparteiisch. Er würde sich an den Beweisen orientieren, ganz gleich, zu welchem Ergebnis sie ihn führten.
»Geschworener 158?« Die Stimme des Richters riss ihn aus seinen Gedanken. »Sie werden als Geschworener zugelassen.«
Der Richter wies ihn an, im Gerichtsgebäude nicht seinen Namen zu benutzen und anderen Geschworenen auch sonst keine Informationen zu geben, über die man ihn identifizieren könnte. Er würde jeden Morgen um acht Uhr vor Gericht erscheinen müssen und durfte jeden Nachmittag um fünf Uhr wieder gehen. Es wurde ihm jedoch ausdrücklich untersagt, in den Medien jedwede Nachrichten über den Fall zu verfolgen. Darüber hinaus durfte er mit niemandem außerhalb des Gerichtsgebäudes über den Fall sprechen – nicht mit seiner Familie, nicht mit seinen Freunden, nicht mit irgendwelchen neugierigen Journalisten. Das Gericht würde seine Identität vor der Öffentlichkeit geheim halten. Es gab ein spezielles Prozedere, mit dem seine Ankunft und sein Aufbruch jeden Tag geschützt wurden, sodass er sich über Einschüchterung und Belästigung keine Sorgen machen musste.
Ob Rick alles verstanden habe, was der Richter ihm gesagt hatte?
»Ja, Sir«, sagte Rick. Und das war’s.
Der Gerichtsdiener begleitete Rick in den Geschworenenraum. Es befand sich nur noch eine weitere Person dort. Eine ältere Frau – sie musste mindestens achtzig sein –, die schweigend auf ihrem Stuhl saß. Rick ging zu ihr hinüber und stellte sich vor.
»Geschworener 158«, sagte er.
»Ich bin 106.« Sie hatte einen schweren spanischen Akzent.
Sie trug dunkle, weite Hosen und ein helles Oberteil mit langen Ärmeln. Eine schwarze Stofftragetasche ruhte zu ihren Füßen. Darauf war in weißen Großbuchstaben HOUSE OF TAROT zu lesen.
»Sind Sie Wahrsagerin?«, fragte Rick.
Die Geschworene 106 schaute Rick an, als wäre er verrückt. »Nein.«
Er deutet auf ihre Tasche. »Das House of Tarot. Das liegt am Sunset, oder? Ich bin schon mal daran vorbeigelaufen. Ich bin davon ausgegangen, dass es da ums Wahrsagen geht. Kartenlesen … in die Zukunft schauen.«
Sie sah unglücklich aus. »Wir sollen doch hier nichts voneinander wissen.«
»Stimmt. Ich wollte auch gar nicht Ihren Namen erfahren oder irgendwas, ich wollte bloß …« Er unterbrach sich. Er hatte ihr nicht zu nahetreten wollen.
Er nahm ein paar Stühle von ihr entfernt Platz.
»Ich glaube nicht daran, dass man in die Zukunft sehen kann«, sagte sie, während sie sich in ihr Sudoku-Heft vertiefte.
Der Tag war beinahe vorbei, als sich die Tür öffnete und der Gerichtsdiener das dritte Geschworenenmitglied in den Raum führte, der ihr neues Zuhause werden sollte. Rick lachte. Und sie lachte auch.
»Rein statistisch gesehen …«, sagte Rick.
»Was glauben Sie?«, fragte die Frau. »Gehört das alles zu meinem teuflischen kriminellen Plan?«
Die Geschworene 106 schaute Rick und die Frau misstrauisch an. »Kennen Sie sich?«, fragte sie.
»Wir sind alte Freunde«, sagte Rick.
Geschworene 106 sah alarmiert aus.
»Das heißt in diesem Fall: seit heute Morgen«, erklärte die Frau.
Rick wandte sich ihr zu und streckte seine Hand aus. »Ich bin Ri…« Er unterbrach sich. »Tut mir leid.«
»Müssen wir wirklich diese ganze Sache aufrechterhalten? Keine Klarnamen?«
Rick fühlte sich ihrer Aufgabe verpflichtet, und wenn dies bedeutete, sich auch an einige besonders nervtötende Regeln zu halten, musste es eben sein. Das war das Mindeste, was die Justiz verdient hatte.
»Ich bin 158«, sagte er.
»Freut mich, dich kennenzulernen.« Sie schüttelte seine Hand. Ihre Finger fühlten sich weich an in seinen. »Ich bin Geschworene 272.«
Kapitel 3
H-O-P-E
Heute
»Ich bin Maya Seale«, sagte sie zu der Produktionsassistentin, die in der Lobby des Omni Hotels auf sie wartete. »Geschworene 272.«
»Ja, ich weiß«, sagte die energische PA, ohne das Klemmbrett zurate zu ziehen, das sie sich unter ihren Arm gesteckt hatte. »Alle sind ganz aus dem Häuschen, dass Sie hier sind! Ich bin Shannon!«
Maya ließ ihren Blick durch die Lobby schweifen. Es war ein später Mittwochvormittag, einen Monat, nachdem Rick bei ihrer Beweisaufnahme vor Gericht aufgetaucht war. Die Kunst an den Wänden hatte sich geändert in den letzten zehn Jahren. Ebenso das Mobiliar und die Uniformen der Angestellten, aber noch immer entsprach alles derselben zeit- und ortlosen Hotelästhetik, die man in jeder Stadt finden konnte, überall auf der Welt. Es war immer bloß eine neue Abstufung von Ödnis.
Diesen Ort zehn Jahre zu meiden, war ihr nicht schwergefallen.
Shannon deutete auf die Fahrstühle. »Wie wär’s, wenn ich Sie zu Ihrem Zimmer begleite, damit Sie sich einrichten können? Die Moderatoren werden Sie dann zum Einzel bitten. Heute und morgen Vormittag.«
»Einzel?«
»Einzelinterviews. Nur Sie und die beiden Moderatoren.«
»Dann sind wir aber schon zu dritt.«
Shannon überlegte sichtlich, ob sie etwas falsch gemacht hatte. »Wie’s aussieht …« Sie nahm sich ihr Klemmbrett vor. »… wird Ihr Einzel heute Morgen stattfinden. Aber wer gerade nicht interviewt wird, ist herzlich eingeladen, sich mit den anderen im Restaurant aufzuhalten. Das ist ganz zwangslos. Wir haben das Hinterzimmer reserviert. Die offizielle Neuabstimmung zeichnen wir dann morgen auf.«
»Sind die anderen schon angekommen?«
Shannon nickte.
»Was ist mit Rick Leonard?«
So viel zum Thema Nonchalance. Sie hatte genau zwanzig Sekunden gebraucht, um zu verraten, dass sie angespannt war – und weswegen. Aber andererseits: Warum sollte es sie interessieren, für wie nervös sie eine Produktionsassistentin hielt?
Shannon schien die Frage nicht sonderlich bemerkenswert zu finden. »Ich glaube, er ist noch nicht eingetroffen.«
Maya hatte Rick ausgiebig gegoogelt, nachdem er im Gericht aufgetaucht war. Aktuelle Informationen über ihn hatte sie jedoch nicht finden können. Nichts über seinen Arbeitsplatz, welcher Tätigkeit er nachging, wo er lebte. Scheinbar war er auf keiner der ihr bekannten Social-Media-Plattformen vertreten.
Es gab nur einige alte Fotos. Alte Gehässigkeiten, die gegen sie gerichtet waren. Während sie verpixelte Youtube-Clips von Interviews schaute, die er rund um seine Buchveröffentlichung gegeben hatte, spürte sie erneut, wie sehr es sie traf, was er über sie und die anderen Geschworenen gesagt hatte.
»Wann bekomme ich Gelegenheit, seine neuen Beweismittel zu sehen? Wenn ich darauf reagieren soll, werde ich Zeit brauchen, sie sorgfältig in Augenschein zu nehmen.«
»Ich weiß nur, dass er ganz zum Schluss interviewt werden möchte. Anschließend werden Sie alle erfahren, was er zu sagen hat – vor der Neuabstimmung.«
Maya schaute auf ihre Uhr. Es würde ein langer Tag werden.
Shannon zog eine elektronische Schlüsselkarte aus einer Aktenmappe und reichte sie Maya. »Wir sind wirklich froh, dass Sie hier sind.«
Zimmer 1208 hatte sich kein bisschen verändert. Die Bilder, der Schreibtisch, die Stühle, selbst der Couchtisch schienen exakt dieselben zu sein, mit denen sie gelebt hatte, tagein, tagaus, fünf Monate lang. Sie stellte sich vor, dass sich ein ausgebrochenes Zootier genauso fühlen müsse, wenn es in die Gefangenschaft zurückgebracht wurde.
Sie ging über den vertrauten gemusterten Teppich. Sie berührte das polierte Holz der Stühle. Sie starrte die Gemälde an den Wänden an, die wohl englische Feldlandschaften abgeben sollten. Sie stellte sich vor, durch diese Felder zu laufen. Draußen zu sein, den Wind auf ihren Wangen zu spüren. Irgendwo zu sein, ganz gleich wo, nur nicht hier, wo sie damals gewesen war … und nun schon wieder.
Instinktiv drückte sie die Schlüsselkarte in ihrer Hand. Im Gegensatz zum letzten Mal konnte sie gehen, wann immer sie wollte.
»Ziemlich cool, oder?«, sagte Shannon. »Authentizität – historische Authentizität – so was ist uns echt wichtig.«
Maya fuhr mit dem Finger über den Schreibtisch. Das Holz hatte einen gut geölten Glanz. Aber irgendetwas stimmte nicht. Die Oberfläche war zu glatt. Sie tastete nach der Pockennarbe an der vorderen Kante des Schreibtisches. Die hatte sie ihm in einer langen, frustrierenden Nacht mit einem Kugelschreiber beigebogen. Die Delle war nicht da.
»Wir haben Hotelausstatter gefunden, die immer noch ältere Modelle des Mobiliars auf Lager hatten«, erklärte Shannon. »Wir haben alles letzte Woche anliefern lassen.«
»Das sind Duplikate?« Mayas Fingerspitzen fuhren über den Lederrahmen der Schreibunterlage.
»Derselbe Hersteller, dasselbe Modell, dasselbe Jahr. Wir haben sie aus einem Hotel in Atlanta.«
Maya stand in einem Simulacrum ihres früheren Lebens.
Der Raum war identisch eingerichtet. Es gab einen Obstkorb und Schokolade auf einem der Beistelltische und eine Karte, auf der stand: »Danke, dass Sie bei unserem Projekt mitmachen.« Darunter stand, als Unterschrift: »Murder Town«.
Und in diesem Augenblick sah sie es, direkt neben dem Korb.
Maya musste einen Schritt zurücktreten.
»H-O-P-E« stand auf dem kleinen, quadratischen Button, dessen rote, weiße und blaue Buchstaben verschmiert und abgegriffen aussahen.
»Was zur Hölle?«, entfuhr es Maya.
Shannon kam ins Schlafzimmer geeilt. Als sie sah, was Maya anstarrte, entspannte sie sich. »Der gehörte doch Ihnen, oder? Wir dachten, das wäre bestimmt ein witziges Erinnerungsstück.«
»Ich hatte früher so einen Button an meinem Rucksack«, sagte Maya.
»Ja! Ich weiß noch genau, wie er mir aufgefallen ist, als Sie aus dem Gerichtssaal gekommen sind, nach dem Urteil. Dieses Bild, wie alle zwölf Geschworenen abgerauscht sind damals … Ich meine, dieser Scheiß ist echt legendär.« Sie biss sich auf die Zunge. »Tut mir leid.«
Maya konnte ihren Blick nicht von dem Button abwenden. »Ich habe den noch. Ich habe meinen noch.«
»Weil ich Scheiß gesagt habe, meine ich.«
»Haben Sie den online aufgetrieben, oder was?«
»Ebay. Das sind jetzt Sammlerstücke. Das Ding hat fünfzig Dollar gekostet.«
Maya kam der Gedanke, dass ihr früheres Leben nun also auf Sammlerstücke reduziert worden war. Aus ihren Erinnerungen waren Memorabilien geworden. Sie waren kommerzialisiert, eingepackt und verkauft worden, und zwar zu einem saftigen Aufpreis.
Sie zuckte zusammen.
Sie hatte sich ja selbst zur Komplizin gemacht – nicht wahr? –, indem sie hierhergekommen war. Sie verkaufte ihre Vergangenheit, oder zumindest den einzigen Teil ihrer Vergangenheit, für den sich irgendwer interessierte – weil er mit der Tragödie eines anderen Menschen verbunden war. Entsetzt hatte sie über die Jahre hinweg zugesehen, wie andere mit dem, was sie getan hatte, ein Vermögen verdienten. Die Nachrichtensender, die Buchautoren, die Journalisten »mit Zugang«. Wie viele Menschen hatte der Mord an Jessica Silver reich gemacht? Da gab es die New-York-Times





























