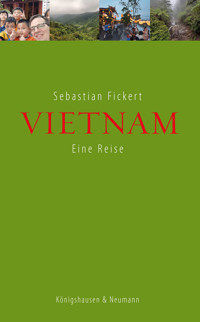
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Königshausen & Neumann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Hanoi über die alte Kaiserstadt Hue bis Ho-Chi-Minh-Stadt reist Sebastian Fickert mit dem Zug, Motorrad und Open Bus. Er schläft auf einem Schiff in der Halong-Bucht und fährt mit einem Boot auf dem Mekong. Er überquert den Wolkenpass sowie schmale Hängebrücken zu entlegenen Bergdörfern, schwimmt in einer Militäreinrichtung nahe dem Ho-Chi-Minh-Pfad, kriecht durch die Tunnel von Cu Chi, erlebt in der historischen Altstadt von Hoi An eine euphorische Begegnung mit einem Urahn und in Nha Trang große Wertschätzung für zwei Franzosen. Die Spuren der französischen Kolonialzeit und des Vietnamkriegs sind auf diesem Weg so sichtbar wie der Wille, zu verstehen und gemeinsam die Gegenwart zu meistern. Sebastian Fickert gibt Einheimischen bereitwillig Englischunterricht und singt mit anderen Backpackern. Er bricht allein auf. Einsam fühlt er sich während der Reise nie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 305
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sebastian Fickert
Vietnam
Eine Reise
Königshausen & Neumann
Dr. Sebastian Fickert wurde am 29. April 1976 geboren. Nach dem Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Würzburg promovierte er auf dem Gebiet des Strafprozessrechts. Anfang 2004 wurde er zum Richter ernannt. Er arbeitete zwischenzeitlich als Staatsanwalt, danach als Richter am Amtsgericht Gemünden am Main, am Landgericht Würzburg sowie am Oberlandesgericht Bamberg. Seit November 2023 ist Fickert Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht. Im Verlag Königshausen und Neumann erschienen von ihm bislang das Buch „14 Wochen Japan“, die Reiseerzählungen „Kasachstan“, „Ararat“, „Ecuador“, „Namibia“ sowie die Romane „Der Frosch auf dem Wasser“ und „Eckert oder der Vogel im Weinberg“.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg 2024
E-Book-Herstellung: Zeilenwert GmbH, Rudolstadt
Umschlag: skh-softics/coverart
Umschlagabbildungen: Fotos: Autor; bis auf S. 2 Meike Keller
Karte S. 236: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vietnam-map.png
Lizenz: Dieses Dokument wird von seinem Autor unter der Creative Commons Share Alike 1.0 (Weitergabe unter gleichen Bedingungen 1.0) veröffentlicht. Wenn Sie diesen Inhalt bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten, verändern oder als Grundlage für einen anderen Inhalt verwenden, dann dürfen Sie den neu entstandenen Inhalt nur unter Verwendung identischer Lizenzbedingungen weitergeben. Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter die dieser Inhalt fällt, mitteilen. Jede dieser Bedingungen kann nach schriftlicher Einwilligung des Rechtsinhabers aufgehoben werden.
Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-8260-8713-4
eISBN 978-3-8260-8714-1
www.koenigshausen-neumann.de
www.ebook.de
www.buchhandel.de
www.buchkatalog.de
Inhalt
Eins:
Aufbruch
Zwei:
Dien Bien Phu – Hanoi
Drei:
Hanoi
Vier:
Hanoi – Ha Long
Fünf:
Ha Long – Hanoi
Sechs:
Hue
Sieben:
Hue – Ho-Chi-Minh-Pfad – Prao
Acht:
Wolkenpass – Da Nang – Hoi An
Neun:
Hoi An
Zehn:
My Son
Elf:
Nha Trang
Zwölf:
Ho-Chi-Minh-Stadt
Dreizehn:
Saigon
Vierzehn:
Cu Chi
Fünfzehn:
My Tho
Sechzehn:
Ho-Chi-Minh-Stadt – Doha
Siebzehn:
Der Weg zurück
Anhang:
Karte
Zeittafel
Literatur
Dank
Eins
Aufbruch
Ich kann jetzt nicht weg, ohne nicht auch was hinter mir zu lassen.
Hubert von Goisern
Der Regen lässt nach. Hinter der Glaswand werden die Schritte langsamer und die Züge der jungen Frau, die den Kinderwagen schiebt, entspannen sich. Auf dem unebenen Asphalt übernimmt ihr älteres Kind den Rollkoffer. Ein kurzes Lächeln huscht über ihr Gesicht.
Die Deutsche Bahn schenkt mir diesen Moment in dem Café mit Blick auf den Bahnhofsvorplatz, wobei ich meinen Anteil nicht verschweigen möchte: Um 8.50 Uhr betrat ich das Bahnhofsgebäude, der Fahrkartenautomat tat sicherlich sein Bestes, um meine Anfrage „Frankfurt (M) Flughafen“ gewissenhaft zu beantworten und bat um „einen Moment“. Der Moment dauerte – zumindest gefühlt – sehr lang. Mit großem Travelrucksack auf dem Rücken, einem etwas kleineren Rucksack vor mir und der Fahrkarte in der Hand lief ich kurz darauf durch die Unterführung und die Treppen zum Gleis hinauf. Etwa 15 Stufen und 10 Meter entfernt stieg der Schaffner um 8.54 Uhr und 40 Sekunden (die Uhr mit Sekundenanzeiger war direkt über ihm gut zu erkennen) ein und schloss die Tür hinter sich. 10 Sekunden später drückte ich auf die runde Taste an der Waggontür. Sie leuchtete nicht mehr grün auf. Ich sah nach oben ins Gesicht des Zugbegleiters. Mit ernster Miene schüttelte er den Kopf. Mit möglichst entsetztem Blick sprach ich lautlos durch die Scheibe eine „55“. Er zog gleichzeitig Augenbrauen und Schultern nach oben. Wir standen uns weitere 30 Sekunden bei verriegelten Türen gegenüber. Dann fuhr der Zug fahrplanmäßig ab. Jetzt steht der große Rucksack, der mich schon vor 20 Jahren nach Japan begleitete, neben mir. Ich schaue durch die Glasfront oder auf einen Bildschirm im Café, über den Ozelots in Texas streifen. In einigen Wiederholungsschleifen werde ich sie eingehend studieren können. Vom nächsten ICE, der über den Hauptbahnhof Frankfurt fährt, wird wegen des angekündigten Warnstreiks abgeraten. Es folgt laut Plan eine Direktverbindung in einer Stunde. Für diese wird bereits jetzt eine Verspätung von 40 Minuten angezeigt. Ich hatte mir fest vorgenommen, dieses Mal zwei bis drei Stunden vor Abflug am Flughafen anzukommen. Es soll nicht sein. Dafür kann ich mich hier in den nächsten eineinhalb Stunden auf die Reise einstimmen.
Aus meiner Jacke ziehe ich ein kleines Blatt. Gestern schrieb mir ein vietnamesisches Ehepaar, das mein Stamm-Sushi-Lokal in Würzburg betreibt, die wichtigsten Worte für eine Minimalkommunikation auf. Danach feilten sie mit bewundernswerter Geduld an meiner Aussprache – wie sie bald merkten, ein ambitioniertes Unterfangen. An welchem Wort ich mich auch versuchte, die Frau schüttelte den Kopf und wiederholte es lächelnd mit dem Zeigefinger dirigierend. Nach der vierten Wiederholung war ich davon überzeugt, kein Naturtalent zu sein. Diese Einschätzung bestätigen frühere Erfahrungen: Vor vier Jahren erlebte ich eine ganz ähnliche Situation in Okahandja, wo sich eine Namafrau vergeblich bemühte, mir ein paar Worte der Klicksprache beizubringen. Vietnamesisch klingt in meinen Ohren nicht einfacher: Eine Silbe kann in sechs verschiedenen Tonhöhen ausgesprochen werden, wovon der Sinn des Wortes entscheidend abhängt. Hinzu kommen Implosive und Diphthonge, für die es keine annähernd vergleichbare Aussprache im Deutschen gibt. Meine Versuche weckten das Interesse der gesamten Belegschaft, die – sichtlich erheitert – Verbesserungsvorschläge machte, die sich ihrerseits unterschieden, je nachdem, ob der Ratgeber aus Hanoi, Hue oder dem Süden des Landes stammte.
Noch mehr als die Verständigung beschäftigte mich in den letzten Wochen aber etwas anderes: Wie wird es sein, allein zu reisen? Dieser Gedanke kam mir immer häufiger in den Kopf, besonders kraftvoll am Morgen während des Aufwachens oder wenn Bekannte mich fragten, mit wem ich unterwegs sei, und auf meine Antwort hin das Wort „allein“ – meistens mit Betonung der zweiten Silbe – wiederholten. Und „allein“ bedeutet, dass ich Menschen, Gewohnheiten, ja meinen Alltag in Würzburg und Bamberg zurücklasse. Hubert von Goisern sagte einmal in einem Interview, der Aufbruch sei immer mit Neugier und Fantasie verbunden. Es bleibe zwar auch etwas zurück, aber daran denke man zunächst nicht, wenn man diese Sehnsucht habe: „Kurz vor der Reise kommt dir dann der Gedanke: Ich kann jetzt nicht weg, ohne nicht auch was hinter mir zu lassen. Das ist zwar schmerzvoll, aber kurz.“
In mir setzt sich jetzt eine positive Anspannung durch, bestärkt durch die Nachrichten einiger Freunde, die sich mit mir freuen. Außerdem habe ich meine beiden schwarzen Notizbücher dabei. Es ist, als würde ich mit ihnen denjenigen, der später diese Zeilen liest, jetzt mitnehmen, für „das Gespräch, das jedes Buch sein will“, wie Navid Kermani schreibt.
Der übernächste Zug nimmt mich bis Frankfurt mit. Kurz vor dem Flughafen bleibt er an einer kleinen Haltestelle stehen. Die Weiterfahrt sei wegen einer „Stellwerkstörung und/oder behördlichen Anordnung“ nicht möglich. Alle Fahrgäste sollen aussteigen und mit „einem anderen Zug“ weiterfahren. Werde ich eine Stunde vor Abflug am richtigen Terminal sein? Allein bin ich mit dieser Ungewissheit nicht. In der folgenden, gut gefüllten Regionalbahn zum Flughafen herrscht gespannte Stille.
Dort eile ich (wieder einmal) im Grenzbereich zwischen beschleunigtem Gehen und Laufschritt durch lange Gänge bis zu einem Busshuttle. Die Abfahrt des Busses verzögert sich, weil tröpfchenweise neue Fahrgäste heraneilen. Am Gepäckschalter stehen keine Passagiere mehr. Nur eine Bedienstete unterhält sich gut gelaunt mit ihrem Kollegen. Lächelnd nehmen sie mich zur Kenntnis und sprechen weiter.
„Ich würde gerne um 13.55 Uhr nach Hanoi fliegen“, störe ich ihr Gespräch. Beide unterbrechen und sehen mich an.
Er atmet hörbar aus: „Na, dann wird es Zeit!“
„In sechs Minuten schließt der Schalter“, ergänzt sie. Sie nimmt meinen großen Rucksack entgegen und sagt freundlich wie bestimmt: „Sie sollten jetzt direkt zum Gate gehen!“
Wäre mein Bruder mitgereist, hätte er sie vermutlich – ebenso freundlich – nach den Duschen im Gebäude gefragt. Ich dagegen nicke und bedanke mich artig. Es bleibt wenig Zeit, die Flughafenatmosphäre aufzunehmen. Als ich am Gate ankomme, ist es bereits geöffnet. Kurz danach sitze ich auf meinem Platz. Für Zweifel an der Reise war in den letzten beiden Stunden kein Raum. Ich bin froh, im Flieger zu sein.
Und dort werde ich nun freundlich von der Stewardess in einem Ao Dai (gesprochen „ow zai“ im Norden beziehungsweise „ow yai“ im Süden Vietnams), einem „langen Kleid“ begrüßt. Ich habe einiges darüber im Vorfeld gelesen: Es sei eine Kombination aus Tradition und Moderne, ein vietnamesisches Symbol für Grazie und Schönheit, anmutig, jedoch nicht kokett. Der Ursprung liege in der Cham-Kultur des 17. Jahrhunderts. Durch eine Verfeinerung sei ein Kompromiss zwischen der konservativen, konfuzianischen Kleidungstradition und dem Wunsch nach individueller Freiheit entstanden. Jetzt sehe ich ihn das erste Mal konkret und kann sagen: Jedenfalls dieser Frau steht der Ao Dai gut. Genau genommen ist es ein Set: ein oben eng anliegendes, rotes Seidenkleid, das an zwei Seiten etwa ab dem oberen Rand des Beckens geschlitzt ist. Wäre das alles, wäre Konfuzius nicht einverstanden gewesen, auch wenn das Kleid lange Ärmel hat und am Hals eng ist. Unter dem geschlitzten Kleid trägt die Stewardess aber noch eine weite, weiße Hose. Nach einem vietnamesischen Sprichwort bedecke der Ao Dai alles, aber verstecke nichts. In der Kolonialzeit des Landes trugen ihn nur vietnamesische Frauen, die mit französischen Männern verheiratet waren, später wurde er ein weit verbreitetes Kostüm. Jetzt kann ich bestätigen, dass ihn zumindest die Stewardessen von Vietnam Airlines anziehen.
Auf dem kleinen Bildschirm vor mir sehe ich vertraute Orte: Die Fluglinie wirbt für eine Reise nach Japan, unterlegt mit strahlenden Aufnahmen des Kaiserpalastes, des Tokyotower und der Natur Hokkaidos. Es folgen die Sicherheitsanweisungen, sonst eine nüchterne Angelegenheit: Da ist die Rettungsweste, hier steckt eine Pfeife und dort sind die Notausgänge. Dieses Mal wird etwas anderes geboten und jeder in meiner Umgebung schaut zu: Gedreht wurde die Einweisung nicht in einem Flieger, sondern an verschiedenen Orten in Vietnam – im Hochland, auf einem Reisfeld, einer Tempelanlage und vor einem Wasserfall. Vor allem aber werden die Anweisungen tänzerisch dargestellt. Ich brauche einen Moment, um zu verstehen, was da gerade vor sich geht. Es scheint, als müssten die Tänzer selbst ein Lachen unterdrücken. Am meisten Spaß aber hat jetzt ein etwa zweijähriger Passagier, der drei Reihen weiter euphorisch zur Performance mittanzt. Spätestens das sorgt in seinem Umkreis für gute Laune. Das erste Mal finde ich es fast schade, dass eine Einweisung zu Ende ist und wir kurz darauf abheben. Ich schaue mir noch einen ästhetischen Werbefilm über das Land an, während das Flugzeug wackelnd der Sonne entgegenfliegt. Ein paar Minuten später ist es draußen dunkel. Mein Nachbar fasst ungläubig an die Scheibe, als wolle er einen Vorhang zur Seite schieben. Es ist 15 Uhr MEZ und wir haben laut Flugkarte gerade Würzburg überflogen. Es war weder ein Gewitter noch eine Sonnenfinsternis angekündigt. Ein plötzlicher Zeitsprung ist nicht sehr wahrscheinlich. Ich vergewissere mich: der Werbefilm dauerte nur acht Minuten. Die Stewardess kommt vorbei, ich frage sie, warum es draußen dunkel sei. Sie lächelt verständnisvoll. Draußen sei es hell. Das sei eine automatische Abdunkelung der Fenster, man könne sie aber für das jeweilige Fenster jederzeit ändern. Sie deutet auf die Tasten. Nein, winke ich betont gelassen ab, das könne so bleiben. In Vietnam ist es bereits nach 22 Uhr. So werden die Lichtverhältnisse schon jetzt angepasst. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, dem Jetlag vorzubeugen – oder die Augen vor zu grellem Licht zu schützen.
Ich richte sie wieder auf den Bildschirm. Der nächste Film stellt die südvietnamesische Stadt Nha Trang mit ihrem langen Strand vor. Der Arzt und Bakteriologe Alexandre Yersin leitete dort während der französischen Kolonialherrschaft das Pasteurinstitut, baute Straßen, ein Telegrafennetz, sagte den Fischern Taifune voraus. Ganz gleich, was ich jetzt noch über ihn schreibe, etwa, dass er den Pesterreger entdeckte, landwirtschaftliche Betriebe errichtete, die Schule für Medizinisches Personal in Hanoi aufbaute oder Forschungen in Bereichen der Elektrizität oder Astronomie betrieb – es wird sehr unzureichend sein. An der Stelle begnüge ich mich damit, dass der gebürtige Schweizer, der die französische Staatsangehörigkeit annahm, noch heute in Vietnam wegen „Verdiensten auf unterschiedlichen Gebieten“ gewürdigt wird. Und dass Patrick Deville ihm mit „Pest und Cholera“ ein literarisches Denkmal geschaffen hat.
Ein Werk anderer Art beeinflusst meine nächste Entscheidung: Weil mich Brad Pitt in der Rolle des Cliff Booth in „Once about a time in Hollywood“ überzeugte, ziehe ich „Bullet train“ den zur Auswahl stehenden vietnamesischen, koreanischen und japanischen Produktionen vor. Während Turbulenzen am Flugzeug rütteln, wird Pitt durch einen Shinkansen zwischen Tokyo und Kyoto geschleudert. Inmitten zahlreicher Profikiller wirkt er – wie der gesamte Streifen – sehr um Effekt und Witz bemüht. Und nach den ersten Dialogen ist klar: Es ist kein Quentin Tarantino-Film, auch wenn er irgendwie daran erinnern will. Als Pitt der letzten ausweglosen Situation entronnen ist, passieren wir den Van-See und kurz darauf das türkische Dogubeyazit an der Grenze zum Iran und zu Armenien. Vor zehn Jahren war ich mit einer kleinen Bergsteigergruppe hier. Und die Bilder von meinen Beinen, die nur noch imstande waren, winzige Schritte zu machen, dem gefrorenen Gletscher und unserem Jubel auf dem Gipfel des Ararat sehe ich scharf vor mir.
Danach überqueren wir den südlichen Teil des Kaspischen Meeres und den Iran. Auf der Karte ist eine zerklüftete Berglandschaft zu erkennen, aber keine Stadt. Auch nach dem zweiten Becher Rotwein schlafe ich nicht ein. Betrachte ich zuhause am späten Abend Landkarten, wirkt das oft so beruhigend, dass nach kurzer Zeit meine Augenlider schwer werden. Jetzt bleibt der Effekt aus: Unter mir ziehen ein dünn besiedelter Teil Pakistans, der Norden Indiens, die Grenze zu Nepal vorbei. Auf der Karte sehe ich Bangladesch, den Golf von Bengalen und Myanmar. Bei den vielen unbekannten Orts- und Flussnamen wird mir wieder bewusst, wie begrenzt mein Wissen von der Welt ist. Und auch meine Kenntnisse in Bezug auf Vietnam waren lange Zeit auf „den“ Vietnamkrieg beschränkt, auf Begriffe wie „Dschungelkrieg“, „Guerillataktik“ oder „Viet Cong“, die ich als Kind aufschnappte, wenn mein Vater, ein Lehrer oder Jugendliche davon sprachen. Um die Begriffe bildeten sich Sätze, wie der von der „blutigen Nase“, die sich die Amerikaner bei ihrem Kampf gegen den Kommunismus im Regenwald geholt hätten. Als Jugendlicher sah ich Filme, die – Mitte der 80er Jahre gedreht – das Gesamtbild ausmalten: In „Platoon“ kämpfte William Dafoe als heldenhafter Elias, Sylvester Stallone befreite (noch heroischer) nach dem Krieg in Gefangenschaft geratene US-Soldaten in „Rambo II“. Minimal weiteten „Good Morning Vietnam“ (es war möglich, mit einem „Viet Cong“ Freundschaft zu schließen und sich in dessen Schwester zu verlieben!) und „Full Metal Jacket“ (der Krieg hatte auch etwas Absurdes!) meine Perspektive. Als ich „Apocalypse Now“ das erste Mal in geselliger Runde eher beiläufig schaute, wunderte ich mich schon weniger über Lieutenant Colonel Kilgore und seine Vorlieben für Napalm oder Surfbretter als über den Umstand, dass Captain Willard mitten im Dschungel französische Plantagenbesitzer trifft.
Und einige Jahre später ertappte ich mich beim Lesen von „Pest und Cholera“ oder Werken von Marguerite Duras dabei, dass ich zunächst keine Vorstellung hatte, wo diese Geschichten angesiedelt waren. Als wären sie Fremdkörper in meinem bereits gefertigten Bild, musste ich sie langsam in die Vorstellung von Vietnam integrieren.
Zwei
Dien Bien Phu – Hanoi
Die Tonkin-Franzosen haben sich beeilt. Innerhalb von zwanzig Jahren haben sie, um ihre Macht zu untermauern, als blieben sie für Jahrhunderte da, mit der Selbstsicherheit und Dreistigkeit und Verblendung der Römer, die sich nach Gallien verirrten, das Hotel Metropole und das Palais Puginier errichtet, eine Pferderennbahn und die Markthallen gebaut, die beiden Seen entwässert und trockengelegt.
Patrick Deville
Die ersten Missionare waren Dominikaner. Dauerhaft richteten sich erst französische und portugiesische Jesuiten in dem Land ein. Einer von ihnen war Alexandre de Rhodes, der ab 1624 hier seinen Glauben verbreitete und später das erste vietnamesisch-portugiesisch-lateinische Wörterbuch schrieb. Ihm wird vereinzelt auch die Entwicklung der vietnamesischen Schrift auf Basis lateinischer Buchstaben zu-geschrieben. Inwieweit zuvor schon Portugiesen diese Schrift entwickelt hatten, ist umstritten, jedenfalls wird sie nach wie vor unter dem Namen Chu Quoc Ngu verwendet und de Rhodes hat sich mit ihr zumindest intensiv auseinandergesetzt.
Die Glaubensbrüder und die Franzosen waren nicht von vornherein unbeliebt. Kaiser Gia Long besiegte mit französischer Unterstützung seine Gegner im eigenen Land und holte Anfang des 19. Jahrhunderts Missionare als Berater an den Hof. Doch unter seinem Nachfolger Minh Mang kippte die Stimmung. In der katholischen Missionsbewegung sah dieser eine Gefahr für die konfuzianisch geprägte Staatsordnung. Auf die Repressionen des Kaisers folgten Aufstände, an denen sich die Katholiken beteiligten. Im Gegenzug wurden Christen öffentlich hingerichtet. Der nächste Kaiser Tu Duc goss noch mehr Öl ins Feuer, und das in einer Situation, in der Frankreich bereits begonnen hatte, seine Fühler nach Südostasien auszustrecken. Lange Zeit hatten die europäischen Kolonialmächte an dem armen Land kein nennenswertes Interesse. Mit der erzwungenen Öffnung Chinas entstand eine neue Perspektive: In Vietnam konnten wichtige Stützpunkte für den Land- und Seeweg aufgebaut werden. Und seit Waterloo wartete Frankreich darauf, sich zumindest außerhalb Europas wieder zu vergrößern.
Als Tu Duc 1857 zwei spanische Missionare hinrichten ließ, lieferte er den ersehnten Anlass. Mit Truppen, die auf Grund des sich abzeichnenden Sieges im Zweiten Opiumkrieg gegen China frei geworden waren, startete Frankreich gemeinsam mit Spanien eine „Strafexpedition“. Ende August 1858 tauchte ein französisches Flottengeschwader vor Tourane, heute Da Nang, auf. Die Franzosen besetzten die Bucht. Von dort mussten sie sich zwei Jahre später zwar zurückziehen, in der Zwischenzeit hatten sie aber Saigon unter ihre Kontrolle gebracht. 1862 annektierten sie drei Provinzen im Süden Vietnams, die sie zur Kolonie Cochinchina zusammenschlossen. Bis 1887 beherrschten sie auch die Mitte und den Norden Vietnams, bezeichneten die Gebiete als Protektorate Annam beziehungsweise Tonkin und bildeten daraus mit dem Protektorat Kambodscha die „Union Indochinoise“. 1893 wurde das heutige Laos eingegliedert. In den folgenden Jahren regte sich starker Widerstand gegen die Fremdherrschaft. Regelmäßig brachen Aufstände aus. Diese wurden zwar niedergeschlagen, doch die Sicherheitslage blieb fragil. Im Zweiten Weltkrieg besetzten Japaner das Land und diesmal formierte sich ein Widerstand, der militärisch sogar von dem US-Geheimdienst OSS unterstützt wurde: Die Viet Minh, die „Liga für die Unabhängigkeit Vietnams“, gegründet und politisch geführt von Ho Chi Minh, war ein Zusammenschluss aus nationalistischen und kommunistischen Kämpfern unter militärischer Leitung von Vo Nguyen Giap. Nach der Kapitulation Japans wollte Frankreich die Kolonie wieder zurück, die Viet Minh hingegen waren entschlossen, die Fremdherrschaft jetzt endgültig abzuschütteln. 1946 brach der Indochinakrieg aus, dessen Ende zugleich die französische Kolonialzeit abschloss.
Dass es so kam, hängt mit einem Ort zusammen, den wir gerade überfliegen. Die Viet Minh setzten gegen die militärisch überlegenen Besatzer Nadelstiche mit Guerillaaktionen, nach deren Ausführung sie sich in ländlichen Rückzugsgebieten versteckten. Die französischen Truppen kontrollierten zwar weitgehend die Städte. Sobald sie diese aber verließen, mussten sie Anschläge fürchten. Hinzu kam, dass China ab 1950 die Viet Minh erheblich militärisch unterstützte, so dass Giap noch im selben Jahr mehrere Divisionen aufstellen konnte. Um dem Krieg eine günstige Wendung zu geben, wollte die französische Militärführung eine offene Entscheidungsschlacht herbeiführen. Und entscheidend war diese dann in der Tat. Im Nordwesten des Landes, 30 Kilometer von der Grenze zu Laos und 300 Kilometer Luftlinie von Hanoi entfernt, befand sich ein kleiner, in einem Tal gelegener Militärstützpunkt der Viet Minh, die auch die umliegenden Berge besetzten. Die Franzosen erhofften sich, mit der Übernahme des 15 Kilometer langen Tals sowie des Hochlands auch die Kontrolle über die Opium- und Reisernte in der Gegend übernehmen zu können. Tatsächlich gelang es im November 1953 gut 2.000 französischen Fallschirmjägern, den Stützpunkt samt Landeplatz einzunehmen und erste Befestigungen zu errichten.
Mit über 2.000 Tonnen Holz und Eisen bauten die Franzosen acht Stützpunkte zu kleinen Festungen aus, gaben ihnen wohlklingende Frauennamen wie Beatrice, Dominique oder Isabelle, und bestückten sie mit eingeflogenen Haubitzen, Mörsern, Luftabwehrgeschützen sowie kleinen Panzern. Minen, Stacheldraht und ausgeklügelte Schützengräben sicherten die Stellungen, ein kleiner Landeplatz die Versorgung aus der Luft. Erfahrene Fremdenlegionäre, darunter viele Deutsche, von denen wiederum ein Teil in der Waffen-SS gewirkt hatte, standen bereit. Jetzt konnten die Viet Minh kommen.
Und sie kamen. Noch Anfang 1953 war sich die Führung der Viet Minh einig, dass man an der Guerillataktik festhalten und eine verlustreiche offene Schlacht vermeiden müsse. Doch Ende des Jahres hatte Giap einen anderen Plan, von dem er die Kader nach und nach überzeugte. Was folgte, überstieg die Vorstellungskraft der Kolonialmacht: Die Viet Minh schafften es, schwere Geschütze, hunderte Tonnen Munition und über 17.000 Tonnen Nahrungsmittel durch unwegsames Gelände zu transportieren. Ich habe einmal einen alten Dokumentarfilm gesehen, in dem gezeigt wurde, wie die Dan Cong, so hießen die Trägereinheiten, Waffen in die eine und Verwundete in die entgegengesetzte Richtung schafften. Mit Seilen und bloßen Händen hievten sie auf schlammigen, engen Pfaden schwere Artillerie über steile Hügel. Und ich sah in dem Film viele Frauen: Zwei Drittel der Träger waren weiblich.
Als am 13. März 1954 die vietnamesische Artillerie das Feuer eröffnete, wurde den Franzosen im Tal schlagartig bewusst, dass es sehr ungemütlich wird. Am ersten Tag der Schlacht wurden der Hauptflugplatz zerstört und Beatrice überrannt. Am 15. März fiel Gabrielle und zwei Tage später Anne-Marie. Um eigene Verluste zu reduzieren, gruben die Viet Minh sich immer näher an die verbliebenen Festungen heran. Sie schossen Versorgungsflugzeuge ab. Die Fallschirme, an denen Munition und Nahrungsmittel hingen, warfen die französischen Flugzeuge zum Selbstschutz aus so großer Höhe ab, dass sie meistens ihr Ziel verfehlten. Der Monsunregen flutete das Grabensystem, das Schutz bieten sollte. Immer mehr verteidigende Soldaten desertierten, die Viet Minh nahmen eine Stellung nach der anderen ein und zogen den Belagerungsring enger und enger. In der Not baten die eingekesselten Franzosen die USA um Unterstützung durch die Air Force. Sogar der Einsatz von Atomwaffen wurde als Option in Erwägung gezogen. Aber die US-Regierung zierte sich, zumal die Briten unter Churchill erklärten, sich an keiner Militäraktion beteiligen zu wollen.
Kurz vor Zusammenbruch der Franzosen setzen die Viet Minh am 6. Mai gegen Eliane, Claudine und deren verbliebene Freundinnen das erste Mal „Katharinchen“ ein. Michail Issakowski und Matwai Blanter komponierten 1938 das russische Liebeslied, in dem das Mädchen zwischen Nebelschwaden, blühenden Apfel- und Birnbäumen auf das hohe, steile Ufer läuft und jauchzend die erhoffte Heimkehr des Geliebten besingt. Im Zweiten Weltkrieg wurde „Katjuscha“ zu einer Kriegshymne der Roten Armee und in der Folge die Namensgeberin für den sowjetischen Raketenwerfer, den die Deutschen – weniger zärtlich – „Stalinorgel“ nannten. Als die verbliebenen Verteidiger der französischen Stellungen nun deren Pfeifen, vor allem aber die schnellen Einschläge hörten, war die Kampfmoral vollends gebrochen. Zwei Tage später kapitulierte als letztverbliebene Festung Isabelle, kurz darauf erklärte Frankreich bei der Indochinakonferenz in Genf, sich vollständig aus Südostasien zurückzuziehen. Von den Frauen, die hinter den Namen der Stellungen standen, ist nichts mehr bekannt. Geblieben ist Dien Bien Phu als Begriff für die Vertreibung der europäischen Kolonialmacht.
Wir überfliegen den Schwarzen und kurz darauf den Roten Fluss. Ich sitze bequemer als der Auslandskorrespondent Thomas Fowler, den Graham Greene in seinem Roman „Der stille Amerikaner“ während des Indochinakrieges in ein französisches Militärflugzeug setzt: „Ich wurde in einen kleinen Metallsitz hineingepfercht, der nicht größer war als ein Fahrradsattel, sodass meine Knie an den Rücken des Copiloten stießen. Erst flogen wir, langsam Höhe gewinnend den Roten Fluss aufwärts, und zu dieser Stunde des Tages war der Rote Fluss wirklich rot. Man fühlte sich weit in die Vergangenheit zurückversetzt und sah den Fluss mit den Augen jenes alten Geographen, der ihn erstmals so genannt hatte, zu ebensolch einer Stunde, als die sinkende Sonne den Wasserlauf von Ufer zu Ufer ausfüllte. In fast 3.000 Meter Höhe drehten wir dann zum Schwarzen Fluss ab, der tatsächlich schwarz war, voll tiefer Schatten, weil das Licht nicht mehr im richtigen Winkel einfiel, und die gewaltige, majestätische Szenerie von Schluchten, Felsabstürzen und Dschungel schwenkte herum und ragte unter uns senkrecht empor. Man hätte ein ganzes Geschwader in jene Felder von Grün und Grau werfen können, und es hätte nicht mehr Spuren hinterlassen als ein paar Münzen in einem Kornfeld.“ Wir fliegen wesentlich höher und ich kann in dem Dunst keinen der Flüsse erkennen. Auch fünf Minuten vor der angekündigten Landung sehe ich durch das Fenster nur milchiges Weiß. Dann kommen grüne Felder zum Vorschein und wir setzen auf.
Ich fühle mich auch noch bewölkt. Müde packe ich meine Sachen in den Rucksack. Dort finde ich nach kurzer Überprüfung nur einen schwarzen Geldbeutel. Um mich für den Fall eines Diebstahls oder sonstigen Verlusts abzusichern, habe ich zwei mitgenommen. In einem sind 400,- Euro Bargeld, in dem anderen eine EC- und eine Kreditkarte. Leider finde ich nur den ersten. Sofort erhöht mein Hirn die Aktivität: 400,- Euro für Unterkünfte, Transporte und Lebensmittel. Ich habe ein Ticket für den Rückflug, der in über zwei Wochen von Ho-Chi-Minh-City aus geht. Bis dahin sind es 1.700 Kilometer und ich habe noch Tickets für zwei Teilabschnitte mit der Bahn. Das könnte sehr knapp werden. Ein weiteres Mal durchsuche ich Sitz, Jackentasche und Rucksack. Tatsächlich ist der zweite Geldbeutel in eine Seitentasche gerutscht. Ich bin wieder wach.
Sehr aufgeweckt ist auch die Dame, die mich nach der Passkontrolle in einer kleinen Wechselstube empfängt. Ich frage sie, ob sie weiß, wo ich eine vietnamesische SIM-Karte für mein Mobiltelefon erwerben kann. Diesen Rat erhielt ich von den beiden vietnamesischen Gastwirten aus Würzburg. In einem Bewegungsablauf nickt die Frau, springt lächelnd auf und zieht mich ohne Berührung, aber schnell redend aus der Halle in einen Seitengang. Sie ist sehr zierlich, eineinhalb Köpfe kleiner als ich. Ihrem Elan fühle ich mich nicht gewachsen. Und dasselbe gilt für die noch jüngere Frau, die nach kurzer Kontrolle meines Reisepasses mit flinken Fingern eine zweite SIM-Karte einlegt, alle Einstellungen an meinem Smartphone vornimmt und sie mir zeitgleich erklärt. Ihre Geschwindigkeit erinnert mich an „Speedcuber“, also die Meister, die einen Zauberwürfel in wenigen Sekunden so zurechtdrehen, dass wieder alle Farben geordnet sind. Nur zweimal unterbricht sie kurz, damit ich meine PIN eingebe – was ich in der gewohnten Geschwindigkeit tue. Sie sieht mir dabei aufmerksam zu und gibt mir dann so schnell drei Anweisungen, als müsste sie die verlorene Zeit wieder einholen.
Dafür bin ich es dann, der vor dem Eingang im schwülen Dunst wartet. Gestern reservierte ich für die ersten beiden Nächte in Hanoi ein Zimmer und gleich dazu einen Transfer vom Flughafen. Nach etwa zehn Minuten taucht der Fahrer auf und ich merke sogleich, anders als mit den beiden Frauen werde ich mit ihm kein lebhaftes Gespräch führen. Dass er mein „xin chao“ nicht erwidert, mag an der Aussprache liegen. Aber er antwortet auch nicht, als ich ihn auf Englisch frage. Seltsam, wir haben uns doch geschrieben, um meine Ankunftszeit abzustimmen. Genau genommen wüsste ich ganz gerne, ob wir uns geschrieben haben. Ich frage ihn, ob er den Weg zum Hotel kenne. Er hält mir sein Smartphone entgegen. Soll ich das Ziel eingeben? Ich habe gelesen, dass eine solche Eingabe durch den Fahrgast hier nicht unüblich ist. Doch er verwendet ein anderes Programm. Ich soll in das Smartphone sprechen und meine Sätze werden augenblicklich übersetzt. Dann lese ich seine Antwort: Ja, er kennt den Weg zum Hotel. Das soll genügen.
Ich sehe aus dem Fenster. Rechts steht mitten auf einer Wiese eine Kirche mit hohen Türmen. Abseits der Straße ist ein grünes Pflanzenmeer. Dann nehmen Straßenschilder und Fahrzeuge zu, vor uns erheben sich aus dem Dunst Hochhäuser, wir folgen einer Brücke über den Fluss. Danach sehe ich vor allem ein Meer aus Zweirädern. Die vietnamesische Schriftstellerin Duong Thu Huong schreibt in ihrem Buch „Bitterer Reis“ über Hanoi, dass es mit seinen „ohrenbetäubenden, anarchischen Hupkonzerten permanent in epileptischen Zuckungen zu liegen scheint.“ In der Tat wird die Hupe hier gerne betätigt – möglicherweise haben sich die Hupkonzerte seit der Veröffentlichung des Buches bereits reduziert, denn es gibt mittlerweile eine weitere Beschäftigung, die viele Motorrad- und Rollerfahrer favorisieren. Gleich, ob sie einen mit Gemüse beladenen Anhänger hinter sich ziehen, von einem transportierten Müllberg überragt werden oder ein Kind auf dem Lenker sitzt: Der eine telefoniert, der nächste schaut auf sein Smartphone, der dritte tippt darauf. Auch die Beifahrer halten sich überwiegend an ihren Mobiltelefonen fest. Ob die Begeisterung damit zusammenhängt, dass sie hier durchgehend ein 5-G-Netz nutzen können, weiß ich nicht. Bei der Vielzahl an Zweirädern, die sich nebeneinander die Straße sehr dynamisch teilen, wirkt das einhändige Fahren bisweilen akrobatisch, vor allem an den Kreuzungen. An einer großen kommen uns – auf unserer Spur – fünf Roller entgegen, die nach links abbiegen wollen, zeitgleich fahren von rechts zwei Roller und ein Motorrad ein. Mein Fahrer geht kurz vom Gas, zieht entschlossen nach links und dann sanft nach rechts. Vor uns kreuzen sich die Wege. Wie in einer Zirkus-, oder besser noch Tanzvorstellung fließen die Beteiligten in- und wieder auseinander, ohne sich zu berühren. Als wären sie von einem unsichtbaren Film überzogen, gleiten sie durch das bewegliche Dickicht, ohne zu kollidieren. Barack Obama soll bei einem Staatsbesuch am Ende seiner Präsidentschaftszeit einmal gesagt haben, er würde gerne als Privatmann wiederkommen, nur wisse er nicht, wie er allein in diesem Land eine Straße überqueren solle. Ähnlich dynamisch wie der Verkehr wirkt auf mich auch die Bebauung mit einem sehr vielfältigen Mix in den Kategorien Höhe, Farbe und Abstand. Die langen Bauzäune auf beiden Seiten der Straßen deuten auf großflächige weitere Veränderungen hin.
All das lasse ich hinter mir, als ich in einer kleinen Seitengasse in der Altstadt das Hotel betrete und dort zur Begrüßung ein Glas Zitronensaft und auf einem Teller ein großes Stück der Drachenfrucht serviert bekomme. Es ist eine weiße Scheibe mit winzigen, schwarzen Kernen und schmeckt wie eine leichte Mischung aus Melone, Birne und Kiwi. Die Dame am Empfang sieht, dass es mir hier gut gefällt und fragt in tadellosem Englisch, was ich denn in den nächsten Tagen zu unternehmen gedenke.
„Heute und morgen möchte ich mir Hanoi ansehen.“
„Brauchen Sie einen Stadtführer? Wir können hervorragende vermitteln.“
„Nein, ich habe mich selbst informiert.“
„Und was schauen Sie sich an?“
„Verschiedenes. Es würde zu weit führen, alles aufzuzählen.“
Ein leichtes Zucken der Mundwinkel verrät ihre Enttäuschung.
„Und übermorgen?“
„Da würde ich gerne in die Halong-Bucht reisen. Können Sie mir eine Tour empfehlen?“
Ihre Mundwinkel gehen augenblicklich nach oben. Sie ist wieder im Spiel. Mit einem Handgriff zaubert sie eine Mappe mit ansprechenden Bildern hervor und benennt die denkbaren Varianten mit zugehörigen Preisen. Auch sie spricht sehr schnell. Ich frage mehrmals nach. Auch sie ist geduldig mit mir.
„Im Allgemeinen gilt: Man bekommt, was man bezahlt.“
Das habe ich bereits mehrfach gelesen. Letztlich muss man sich bei den angebotenen Touren keine Sorgen machen, ein großes Schnäppchen zu versäumen oder über den Tisch gezogen zu werden. Die Preise werden von vornherein den Leistungen angepasst. Zudem stellt sie klar, dass es keinen Verhandlungsspielraum gibt. Das Hotel kassiert offenbar eine Vermittlungsprovision von dem Veranstalter und vermutlich bietet jede Unterkunft seinen Gästen Touren an. Jedenfalls steht mein Plan für die nächsten Tage.
Mein Zimmer ist sauber. Vom Balkon aus habe ich einen ansprechenden Blick auf verwinkelte Altstadtgassen. Es ist Vormittag und ich bin bereit für Hanoi, übersetzt die „Stadt zwischen den Flüssen“ oder „in der Flussbiegung“, die bereits verschiedene Namen hatte: Etwa im 15. Jahrhundert Dong Kinh, „östliche Hauptstadt“. Durch niederländische Händler wurde im 17. Jahrhundert dieser Name als „Tonkin“ nach Europa getragen, woraus in der französischen Kolonialzeit die Bezeichnung für den nördlichsten Teil des Landes wurde. Nur wenige Straßen vom Hotel entfernt ist der legendäre Hoan-Kiem-See, der früher mit dem Roten Fluss direkt verbunden war und auf dem noch im 18. Jahrhundert Flottenparaden stattfanden. Weniger ist rund um den See heute gewiss nicht los. Es ist eine Art Volksfeststimmung, zu der gewiss beiträgt, dass die mehrspurige Straße, die ihn umgibt, für Fahrzeuge gesperrt ist, wenngleich nicht für alle: Ganz kleine Kinder dürfen in elektrischen Autos ihre Fahrkünste testen, beobachtet, verfolgt oder manchmal auch mit einer Fernbedienung gesteuert von mindestens einem Elternteil. Ich sehe kleine Feuerwehr- oder Polizeiautos. Ein kleines Mädchen fährt einen pinken VW-Käfer, von dessen Tür ein großer Katzenkopf mit Schleife lächelt. Ein Junge steuert strahlend eine Panzerhaubitze. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses Gefährt bei einem vergleichbaren Fest in Deutschland eine ähnlich starke Begeisterung bei Kind und vor allem Mutter auslösen würde. Am südlichen Ende des Sees schließt sich das „Französische Viertel“ an. Als Alexandre Yersin die „grüne, dunstverhangene Stadt“ Anfang des 20. Jahrhunderts besucht, staunt er über die Veränderung, wie Patrick Deville schreibt: „Die Neustadt von Hanoi ist zwanzig Jahre jünger als die von Saigon. Die Tonkin-Franzosen haben sich beeilt. Innerhalb von zwanzig Jahren haben sie, um ihre Macht zu untermauern, als blieben sie für Jahrhunderte da, mit der Selbstsicherheit und Dreistigkeit und Verblendung der Römer, die sich nach Gallien verirrten, das Hotel Metropole und das Palais Puginier errichtet, eine Pferderennbahn und die Markthallen gebaut, die beiden Seen entwässert und trockengelegt.“ Davon ist noch einiges zu sehen: Die weiße Fassade des Metropole, die alte Residenz des französischen Gouverneurs und das Opernhaus haben an Glanz nichts verloren. Auf die Vergangenheit wird vor der Oper zurückgeblickt: Gerade finden dort die Vorbereitungen für einen großen Festakt zum Gedenken der 50jährigen vietnamesisch-japanischen Freundschaft statt.
Unprätentiös wirken dagegen die Innenräume im Revolutionsmuseum, wo an verschiedenen Stellen die Farbe abblättert und die Zeit an den Fenstern deutliche Spuren hinterlassen hat. Auf einem Gemälde wird karikaturhaft die Knechtung des Volkes in einer Hierarchiepyramide dargestellt, an deren Spitze die „Imperialisten und Feudalisten“ stehen. Auf einem anderen sieht man die wenigen weißen Kolonialherren, die einer großen Menge armer Einheimischer Befehle erteilen. Ein paar Schritte weiter spricht Lenin zu einer begeisterten Masse. Daneben beschreibt Ho Chi Minh, der anfangs als Patriot nur die Unabhängigkeit seines Landes wollte, „den Weg, der ihn zum Leninismus führte“: „Die Thesen Lenins – welch Emotion, Enthusiasmus, Klarsicht und Vertrauen flößte mir das ein. Ich war vor Glück zu Tränen gerührt. Als ich allein in meinem Zimmer war, rief ich so laut, als würde ich mich an eine große Menge richten: Meine sich aufopfernden Landsleute! Das ist es, was wir brauchen. Dies ist der Weg zu unserer Befreiung!“
Es folgen Bilder, welche französische Truppen zeigen, die zu Fuß oder mit Panzern nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in das Landesinnere vorstoßen. Auf anderen bereiten Partisanen entlang einer Eisenbahnstrecke einen Sabotageakt vor. Danach folgt der Triumph von Dien Bien Phu. Die Aufbereitung der Schlacht ist entsprechend der Räumlichkeit sehr sachlich. Man kann militärische Auseinandersetzungen auch anders darstellen, wenn man sie beispielsweise für politische Botschaften verwendet. Oder wenn der Blick auf die einzelnen Soldaten oder gar Zivilisten gerichtet wird, die dem Kugelhagel nicht entrinnen können. Als Thomas Fowler einen kleinen Ort 100 Kilometer südlich von Hanoi besucht, sieht er, was passiert, wenn die Dorfbewohner zwischen die Fronten geraten und die Kriegsparteien, die das Feuer bereits eröffnet haben, sich denken, „was sie können, können wir auch.“ Das Ergebnis beschreibt Fowler so: „Der Kanal war voller Leichen: Heute fällt mir dazu ein Irish-Stew ein, das zu viel Fleisch enthält. Die Toten lagen übereinander, ein Kopf, grau wie ein Seehund, ragte gleich einer Boje aus dem Wasser heraus. Ich wandte ebenfalls den Blick ab, wir wollten nicht daran erinnert werden, wie wenig wir zählten, wie rasch, wie einfach und wie namenlos der Tod kam.“
Wenige Fotos zeigen den „Amerikanischen Krieg“ (wie der Vietnamkrieg hier genannt wird): Ein GI zündet das Dach einer Hütte in einem Dorf an, in dem er Unterstützer der Viet Cong vermutet. Die Schäden und Opfer der Bombardierungen sind auf kleinen Abbildungen zu sehen. Verglichen mit anderen Museen, die den Krieg zum Inhalt haben, etwa dem Unabhängigkeitsmuseum in Windhoek, ist auch diese Darstellung nüchtern. Vielleicht meinen die Verantwortlichen hier in Hanoi, keine Besucher überzeugen zu müssen. Dass es auch eine Zeit vor dem Krieg gegen die Franzosen beziehungsweise Amerikaner gab, zeigt das benachbarte Geschichtsmuseum. Jeder historisch Interessierte kommt dort auf seine Kosten. Wen die ältere Geschichte des Landes wenig anspricht, kann sich im hinteren Teil des Buches einen Kurzüberblick anhand der Zeittafel verschaffen und nach dem Museum wieder dazustoßen.
Geschichtsmuseum
Vor etwa 30.000 Jahren lebten Menschen südlich von Hanoi rund um die Höhle Dieu, die dieser Kultur den Namen gab. In derselben Gegend, der heutigen Provinz Hoa Binh, wurden vor 16.000 Jahren





























