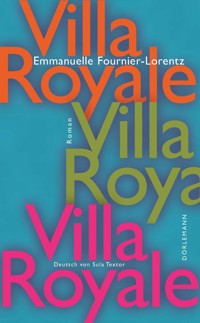
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Palma ist gerade mal elf, als ihr Vater unerwartet stirbt. Ebenso unangekündigt ist der plötzliche Umzug auf die Insel La Réunion, wo es sie mit ihrer Mutter und ihren Brüdern Charles und Victor hinverschlägt.Was als Flucht vor der Trauer beginnt, wird zu einer jahrelangen Irrfahrt quer durch Frankreich. Während der hochbegabte Victor im Auto gegen sich selbst Schach spielt, Charles Gefallen an Glücksspielen und Autoknacken findet und sich die Mutter ihrer Melancholie hingibt, ist auch die sarkastische, leicht desillusionierte Palma auf der Suche nach ihrem Platz in der Welt. Bis die Jugendlichen von Lanvin erfahren, dem der Vater Geld schuldete und der die Familie nun verklagt. Gemeinsam fassen sie einen Plan, ihn loszuwerden.Spritzig, rasant und voller Leben – ein Roman wie ein Roadmovie. Temporeich und doch unendlich zärtlich erzählt Emmanuelle Fournier-Lorentz von einer turbulenten Familie, in der gestritten, gestichelt und geschwiegen wird – und in der aus Liebe füreinander alles möglich wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Emmanuelle Fournier-Lorentz
Villa Royale
Roman
Aus dem Französischenvon Sula Textor
DÖRLEMANN
Die französische Originalausgabe »Villa Royale«erschien 2022 bei Éditions Gallimard, Paris. Die Übersetzerin dankt dem Deutschen Übersetzerfonds für die Bewilligung eines Johann-Joachim-Christoph-Bode- Stipendiums und Patricia Klobusiczky für das Mentorat. Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Copyright © Éditions Gallimard, Paris, 2022 © 2023 Dörlemann Verlag AG, Zürich Umschlaggestaltung: Mike Bierwolf Satz: Dörlemann Satz, Lemförde Satz und eBook-Umsetzung: Dörlemann Satz, Lemförde ISBN 978-3-03820-907-2www.doerlemann.ch
Inhalt
I
1
Wir zogen immer in der kalten Jahreszeit um, wie die Wale, meinte Victor. In unsere Mäntel gehüllt saßen wir im seltsamen Geruch der Autoheizung, meine Mutter und Charles vorn, Victor und ich auf der Rückbank, die Stirn an die Scheibe gelehnt. Falls wir Geld hatten, kamen die Möbel in Lastwagen nach – und falls nicht, hatten wir eben keine Möbel. Wenn jemand nach meinen Kindheitserinnerungen fragt, sehe ich Asphalt an einem Autofenster vorbeiziehen, und egal, was man sagt: Autobahnen sind nicht alle gleich. Jede schien sich auf ganz eigene Weise durch Frankreich zu schneiden, dieses unbeständige und uneinheitliche Land, von dem ich jeden Winkel zu kennen glaubte.
Während dieser langen Fahrten redete Charles immer nur von einem, und das tat er auch nur dann, sonst nie: von meinem Vater und seinem Tod. Zuerst umkreiste er das Thema stundenlang, traute sich nicht oder hielt sich zurück. Erst später, wenn wir schon Hunderte Kilometer durch die Nacht gefahren waren, wenn meine Mutter zum Rauchen nicht mehr auf Rastplätzen Halt machte, sondern die Fenster runterließ und ihre Zigaretten einfach im Auto anzündete, drehte Charles sich zu ihr und begann behutsam über ihn zu reden, immer unter irgendeinem Vorwand: das Thema der Sendung, die gerade im Radio lief, oder der Name einer Stadt auf einem Verkehrsschild, ein totes Tier am Straßenrand, die eiskalten Hände des Mannes, der eingezwängt in der kleinen Kabine einer Mautstation saß. So fingen die Gespräche an, jedes Mal. Ich sah vom Rücksitz aus nur seine Kapuze oder seine Mütze, manchmal ein Ohr, das hinter der Kopfstütze hervorragte. Und das Gesicht meiner Mutter im Profil: ihr langes schwarzes Haar, den aufgestellten Kragen ihres Mantels, ihre Zigarette. Wir wussten alle, dass Charles immer, wenn wir im Auto unterwegs waren, einen Anlass finden würde, über ihn zu sprechen, seinen Geist heraufzubeschwören. Ich glaube, sie war froh, dass er es in Momenten tat, die es gut meinten mit brüchigen Stimmen, mit heiklen Gefühlen, als ob der Motor jede Spur von Lächerlichkeit überdeckte. Als ob die Abgeschlossenheit des Autos und das unerbittliche Dröhnen der Autobahn die Melancholie erlaubten, die meine Brüder und ich sonst sorgfältig vermieden, denn dieses Gefühl konnte einen von der Dachkante auf den Bordstein stoßen.
»Papa.« (Er drehte den Kopf zu meiner Mutter und schaute sie sanft durch seine langen Wimpern an.) »Papa lag nachts auch oft lange wach, oder?«
»Das war eigentlich nicht so seine Art …«, antwortete meine Mutter dann, wie jedes Mal, wenn wir unbedingt eine nicht existierende Besonderheit an unserem toten Vater finden wollten, der schließlich auch nur ein ganz normaler Mensch gewesen war.
»Dabei kann von uns doch keiner richtig schlafen.«
»Palma schon …«
Charles’ Kiefer verkrampfte sich leicht, er starrte durch die Windschutzscheibe ins Leere. Er trug oft dunkelgraue Jacken ohne Reißverschluss, und wenn ich heute Jungen mit so einer Jacke sehe, zieht sich mein Herz zusammen und ich würde am liebsten kurz meinen Kopf auf ihre Schulter legen.
»Palma tunkt immer ihren Camembert in den Kaffee.«
»Ja …, das stimmt. Das hat sie wirklich von ihm.«
Ihre Stimmen lullten uns ein, genau wie das Brummen des Motors, Victor und mich auf der Rückbank – in unsere Decken gekuschelt verfielen wir in ein Larvenstadium. Zwei Larven, die zuhörten, aber kaum am Gespräch teilnahmen. Manchmal beugte Victor sich leicht vor, um sie besser zu verstehen, er pausierte sogar seinen Schachcomputer. Aber im Wesentlichen spielte sich das Gespräch zwischen Charles und meiner Mutter ab. Manche Sätze waren ein festes Ritual geworden, wie: »Habe ich dir von diesem einen Mal erzählt, als er unbedingt bis nach Schweden trampen wollte, und das bei minus zehn Grad?« oder »Er kannte das Leben von Marilyn Monroe in- und auswendig.« Diese nächtlichen Gespräche haben meine Kindheit geprägt. Ganz egal, wovor wir gerade flohen, Unglück, Armut, Wahnsinn, vielleicht auch nur dem Alltag, wir wussten, in diesem Auto, mitten in der Nacht, wenn wir ihn, den Toten, heraufbeschwörten, dann gab es das alles nicht mehr: keine Geldsorgen, keine Zukunftsängste, keine Tragödien und erst recht nicht seinen Tod. Er war bei uns, in einem Raum, der unendlich war, weil wir immer weiterfuhren, in einer Zeit, in der nichts mehr wirklich zählte, eine Zeit, wie sie allen vertraut ist, die sich davonmachen, die Frau und Kinder zurücklassen und an einen Ort verschwinden, von dem niemand etwas weiß. Kraft der Erinnerungen meiner Mutter waren wir unterwegs in eine neue Stadt, auf der Suche nach nichts, schon gar nicht nach Glück.
Das Gespräch dauerte bis zur Autobahnausfahrt, bis meine Mutter den Blinker setzte und nicht mehr mit sanfter Stimme sprach, sondern sich in ihrem Sitz aufrichtete, sich räusperte und konzentriert auf die Schilder schaute. Gleich wären wir da. Charles drehte sich eine Zigarette, schaltete das Radio ein, der Himmel färbte sich rosa. Zwischen zwei Kreisverkehren packte Victor seinen Schachcomputer weg und sah zu, wie Linie um Linie vom Auto gefressen wurde. Die Namen der Kleinstädte, auf die wir so zurollten, waren alles andere als verheißungsvoll: Buxières-les-Mines, Montaigu, Châteauneuf-de-Galaure, Escamadur, Crotelles.
»Ist es hier, Mama?«
»Ja, ich glaube schon.«
Sie setzte ihre Brille wieder auf und ließ Charles noch hundertmal den Namen der Straße nachschauen, es war immer die richtige, wir waren vor unserem neuen Haus oder der neuen Wohnung angekommen. Meistens war es ein ganz gewöhnliches Wohn- oder Einfamilienhaus, immer in dem gleichen Beige. Es war, als läge eine unsichtbare Hülle um diese Viertel, eine Hülle, die wir nur in der Benommenheit der ersten Schritte nach dem Aussteigen durchdringen konnten, oder vielleicht noch morgens, wenn wir uns auf den Weg in unsere neue Schule machten. Die immer gleichen Straßen, die üblichen Kreisverkehre, über die eine Hausfrau in Schlappen einen vollen Einkaufstrolley hinter sich herzieht. Wir stiegen verschlafen aus dem Auto, unsere Rucksäcke über der Schulter, meine Mutter schaute sich misstrauisch um, rümpfte die Nase und entschied dann in einem Ton, der keinen Widerspruch zuließ:
»Es wird schon gehen.«
Manchmal schoben die Nachbarn kurz einen Vorhang beiseite und beobachteten uns. Charles zeigte ihnen den Stinkefinger, ich lächelte verlegen, meine Mutter hatte sie gar nicht bemerkt. Und nach Hunderten von Kilometern quer durch Frankreich saßen wir zu viert auf der Bordsteinkante und warteten, dass der Makler kam und uns aufmachte. Meine Mutter rauchte schweigend eine Zigarette, und ich sah ihr dabei zu und dachte jedes Mal, dass es für diese merkwürdige Kindheit nur eine Erklärung geben konnte: Sie war Geheimagentin.
2
In meiner Erinnerung, wenn sie denn stimmt (was ich bezweifle), standen in unserem Wohnzimmer Dutzende von Lampen. Der Raum war düster, vollgestellt mit schwarz lackierten Möbeln (eine Obsession meiner Mutter) und mit diesen Lampen, eine seltsamer als die andere. Jede leuchtete in eine andere Richtung, nach unten oder zur Tür, auf den Teppich oder das Sofa, jede für sich und trotzdem wachsam. Sie bevölkerten das ganze Zimmer mit ihren insektenartigen Formen, zeichneten mit ihrem Licht klar umrissene Flächen und tauchten andere ins Dunkel wie kleine, selbstbezogene Laternen. Meine Mutter sammelte sie. Es waren große pompöse Lampen aus dem 18. und 19. Jahrhundert mit schwarzem Schirm, schwerem Fuß aus vergoldetem Metall, fast schon antik und sehr eindrucksvoll. Ein paar Wochen nach der Tragödie hat sie dann alle verkauft, oder einer von den Gerichtsvollziehern hat sie mitgenommen, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls waren sie am nächsten Morgen und am übernächsten und überhaupt an den Tagen nach dem Tod meines Vaters noch im Wohnzimmer, wie Ableger meiner Mutter, die rund um die Uhr leuchteten. Meine Mutter und ihre Lampen. Sie liebte künstliches Licht. Sie hat nie verstanden, was die Menschen dazu drängt, die Rollläden hochzuziehen und Licht von draußen reinzulassen. Und es stimmt ja, Lampen sind schon eine herrliche menschliche Erfindung, genau wie Straßenlaternen. Ein beruhigendes Artefakt. Wie ein Finger, der über eine Wange streicht und uns leise sagt: »Alles wird gut.«
Wenn sie uns abends ins Bett gebracht hatte, legte sie sich auf das schwarze Sofa. Sie hatte stark abgenommen, ihre Levi’s und ihre T-Shirts hingen an ihr herunter wie Fledermäuse aus Stoff. Sie ließ den Fernseher aus, schaute zur Decke und wartete, bis die Panik, die in den langen Tagen nach dem Tod meines Vaters ihr Netz zu spinnen begann, sich in ihr breitmachte. Im Licht ihrer Lieblingslampe, deren Fuß die griechische Furie Alekto darstellte, spürte sie das Blut heftiger in ihren Adern und Schläfen pochen. Die Angst kam von hinten, hauchte ihr in den Nacken, packte sie an der Kehle. An den ersten Abenden gab sie ihr nach. Stundenlang schluchzte sie, das Bild meines reglos daliegenden Vaters blitzte so lange vor ihren Augen auf, bis sie schließlich mit letzter Kraft nach der Packung mit den Beruhigungstabletten auf dem Sofatisch griff und vier oder fünf davon schluckte.
An anderen Abenden kam die Furie ihr zu Hilfe. Die Lampe war groß, sie stand auf dem kleinen, runden Tisch neben dem Sofa. Der schwarze Schirm bedeckte sie zur Hälfte und lenkte ihr Licht auf das Gesicht meiner Mutter. Mühsam hob sie das Kinn und schaute die Furie fest an. Sie klammerte sich mit dem Blick an sie, damit die Panik sie nicht überwältigen konnte. Alekto, ganz aus vergoldetem Metall. Sie strahlte etwas aus, das gebe ich heute gern zu, die Ahnung einer göttlichen Gerechtigkeit, die uns nicht einfach nur am Anfang unseres Lebens begleitet hat: Damals hat sie unsere Vorstellung von der Welt geformt, tief in unserem schlummernden Unbewussten. Ich hatte keine Angst vor ihr. Sie war furchterregend und trotzdem schön. Meine Mutter starrte sie stundenlang an und rauchte dabei eine Zigarette nach der anderen, steckte mit dem Stummel der einen direkt die nächste an. Sie drückte sie in einem schwarzen Metallaschenbecher aus, der absurderweise geformt war wie eine vornehme Hand mit gold lackierten Fingernägeln, und wenn der Aschenbecher voll war, direkt auf dem Sofatisch. Vom Tabak benebelt lag sie da und ließ die Furie nicht mehr aus den Augen. Sobald sie den Blick von ihr löste, sich dem Dunkel des Zimmers zuwandte, fiel die Panik über sie her, sah sie das Gesicht meines Vaters, grau und weiß, vor Angst und Schmerz entstellt, Blutspritzer an den Wänden, abgetrennte Köpfe, Schreie. Also heftete sie ihre Augen fest auf die Furie, auch wenn das Licht ihr die Netzhaut verbrannte, auch wenn sie dabei verrückt wurde. Manchmal ist verrückt sein besser: lange Phasen der Abwesenheit, in die die Wirklichkeit nicht mehr vordringt. Irgendwann in der Nacht, wenn sie schon gar nichts mehr sehen konnte, begannen die Haare der Furie zu wogen und streichelten ihr die Wange. Dann sprachen die beiden über die Liebe. Denn eins war klar: Selbst wenn man von der Liebe alles Angenehme abzieht, wenn man ihr Zärtlichkeit, Vertrautheit, die Gegenwart des anderen nimmt und man Tod, Folter und eine herzzerreißende Leere an ihre Stelle setzt, bleibt trotzdem ihr reiner Kern. Vielleicht steht er in Flammen, leidet Qualen, aber er ist immer noch da. Und ganz offensichtlich liebte meine Mutter meinen Vater, ob er nun tot war oder nicht, und sie starrte auf die Furie und ins Licht, einfach damit er nicht ins Nichts und in die Nacht verschwand. Wenn einer von uns in diesen Momenten aufgestanden wäre, hätte er vom Flur aus eine Art Pythia sehen können, die von halluzinogenen Dämpfen umgeben im Halbdunkel ihres Tempels lag, beschienen von unzähligen bizarr geformten, prächtigen Lampen, allesamt schwarz-golden. Aber wir sind nie aufgestanden, glaube ich.
Später ging sie ins Bad, nahm ihre Kontaktlinsen heraus und ein Schlafmittel ein. Die Frau mit den braunen Haaren, die sie aus dem Spiegel anblickte, sah mit ihren eingefallenen Gesichtszügen regelrecht verwüstet aus. Sie hatte in der ersten Woche zehn Kilo abgenommen, nichts mehr gegessen und nur noch Kaffee und Orangensaft getrunken. Wenn das Schlafmittel dann wirkte, schlief sie für ein paar Stunden ein, bis es Zeit war aufzustehen, und das Aufwachen muss grauenvoll gewesen sein. In Victors Buch über die Götter der Antike stand: »Das Alter der Furien lässt sich nicht genau bestimmen. Sie sind so alt wie das Verbrechen, das sie strafen, und die Unschuld, die sie rächen; die Furien sind die Rachebeauftragten der Götter. Zunächst waren sie zahllos, doch die bekanntesten, von den Dichtern am häufigsten erwähnten sind Tisiphone, Megaira und Alekto. Sie verdanken ihren Namen dem Furor, der Raserei, der unbändigen Wut, die sie bringen. Manchen Quellen zufolge wurden sie im Meer aus dem Blut des Uranus geboren, der von Saturn verletzt worden war. Laut anderen sind sie Töchter der Erde, die sie durch das Blut des von Jupiter verwundeten Saturn empfangen hat; oder sie sind Töchter der Nacht und des Acheron; oder aber der Erde und des Skotos, der Dunkelheit. Ihr Machtbereich ist unbegrenzt, er reicht bis in die Unterwelt. Ihr Auftrag ist die Bestrafung des Vatermords. Alekto, die dritte Furie, gönnt den Mördern keine Ruhe; sie quält sie ohne Unterlass. Sie ist die reine Rachsucht, es gibt kaum eine Gestalt, die sie nicht annimmt, um zu täuschen und ihrer Wut freien Lauf zu lassen. Darstellungen zeigen sie bewaffnet mit Vipern, Fackeln und Peitschen, ihr Haar besteht aus sich windenden Schlangen.«
»Siehst du«, sagte Victor Jahre später (und tippte dabei gedankenverloren mit dem Zeigefinger gegen den Einband des bei R aufgeschlagenen Buchs). »Rache ist etwas Heiliges, selbst bei den Göttern, und zwar schon immer. Steht das nicht hier irgendwo? Schau: Die Furien, usw., ihr Auftrag ist die Bestrafung des Vatermords. Vatermord, Palma!«
Meine Augen suchten nach denen meiner Lieblingsfurie, meiner Alekto aus Messing und Eisen und Wut, und ich fand (in ihrem Schlangenhaar, über ihren glatten Brüsten) eine Antwort, die uns in unserem Entschluss bestärkte: »Ich verstehe euch«, oder so ähnlich.
3
Das Ziel unseres ersten Umzugs, des kürzesten und misslungensten von allen, erfuhren wir zwei oder drei Monate nach dem Tod meines Vaters. Charles, Victor und ich verbrachten einen letzten trübseligen Abend in der Rue Chauvelot damit, zu dritt in einem unserer Zimmer lustlos irgendwelche Spielchen zu spielen – wir versteckten uns in der staubigen Kiste mit den Stofftieren, erzählten uns schauerliche Geschichten, die wir in den Lokalnachrichten gelesen hatten und die ganz in der Nähe passiert waren, in der Essonne oder der Oise – während meine Mutter fast alle unsere Sachen entsorgte (oder das, was noch davon übrig war). Mitten in einer heftigen Rauferei, als ich Charles’ Beine ins Gesicht bekam und Victor zu würgen versuchte, verkündete sie uns plötzlich:
»Übrigens, wir gehen nach La Réunion. Auf eine kleine Insel, neben Madagaskar.«
Das Entsetzen in unseren Gesichtern muss unerträglich gewesen sein, denn sie machte die Tür sofort wieder zu. Victor richtete sich ruckartig auf, stieß meinen Arm weg und rannte ihr hinterher.
»Eine Insel«, sagte Charles am Flughafen und schüttelte ungläubig den Kopf, als hätte uns wirklich nichts Absurderes passieren können. »Zehntausend Kilometer. Zehntausend!« Victor dagegen war immer noch ganz benommen. Mit offenem Mund und mit seinem kleinen Rucksack auf dem winzigen Rücken stand er da und starrte auf den Boden. Meine Mutter war völlig aufgedreht und versuchte ihn mit einem Schwall schwärmerischer Worte auf andere Gedanken zu bringen: was für ein Glück – jeder träumt doch davon, auf einer Insel zu leben – das Meer, die Chamäleons, ein eigener Garten – braun wirst du werden – ein aktiver Vulkan, Victor, ein Vulkan! mit Lava – und ganz viele Seesterne! Charles machte jetzt auch mit. Aber Victor war untröstlich. Und es stimmte ja auch, natürlich würde unser Leben nicht mehr werden wie früher, ohne die Wohnung direkt am Boulevard Périphérique und ohne meinen Vater, aber mitten im großen, bunten Spektakel des Flughafens war ich glücklich, denn mir stieg ein berauschender, derber Geruch in die Nase, der viel stärker war als meine Traurigkeit: Es roch nach Flucht.
*
Irgendwo über dem Sudan bin ich elf geworden. Ich döste in meinem Sitz vor mich hin, den Kopf zur Schulter meiner Mutter geneigt, als Charles sich ganz aufgeregt und mit strahlenden Augen über den Gang zwischen uns lehnte und so laut flüsterte, dass sich mehrere Passagiere zu uns umdrehten:
»Alles Gute zum Geburtstag, Palma! Jetzt bist du schon elf!«
Er packte mich am Handgelenk und schwenkte triumphierend meinen Arm hin und her, wie zum Zeichen des Sieges. Dabei hatte ich seit Stunden versucht, wachzubleiben, weil ich den Moment nicht verpassen wollte, und war dann doch eingeschlafen. Meine Mutter drehte sich zu mir und lächelte breit, aber in ihren Augen lag eine fast greifbare Angst, als blickte sie geradewegs in die Scheinwerfer eines heranrasenden Autos. Charles redete weiter:
»Jetzt kannst du deinen Freunden erzählen, wenn du irgendwann wieder welche hast, meine ich, dass du deinen elften Geburtstag in der Luft gefeiert hast, genau über der Grenze zwischen Ägypten und der … dem …«
»Dem Sudan, dem Sudan«, ergänzte Victor, der aufgewacht war und vage in Richtung des kleinen Flugzeugsymbols auf dem Bildschirm vor uns zeigte.
Wie immer brauchte er ein paar Minuten, bis er richtig wach war, und mit seinem starren Blick und den zerzausten Haaren sah er aus wie ein gerade gelandeter Kobold, der noch nicht ganz in seiner neuen Umgebung angekommen war. Er gähnte, küsste mich auf die Wange, stieß dabei gegen die Knie meiner Mutter, stemmte seine Füße gegen den Sitz vor ihm und eröffnete mir, während er aus dem Fenster blickte:
»Jetzt bist du näher an zwanzig als an null.«
Was ja auch stimmte. Und Charles, der energisch die Seiten eines Air-France-Katalogs Frühjahr/Sommer 2001 umblätterte, fügte hinzu: »Und wusstest du, dass nach Einsteins Relativitätstheorie die Zeit umso langsamer vergeht, je schneller man sich bewegt?« Ein paar Minuten später war Victor auf der Armlehne zwischen ihm und meiner Mutter wieder eingeschlafen. Wir waren so weit weg von früher, von unseren üblichen Geburtstagen. Flugbegleiterinnen glitten den Gang entlang und sammelten Tabletts ein, flüsterten sich etwas ins Ohr und lachten leise. Leute, die in Decken gehüllt schliefen, gedämpftes Licht, das Vibrieren der Maschine, das Flüstern meiner Mutter und die ferne Insel, all das schien so unwirklich, dass ich mich mehrmals fragte, ob wir nicht alle gestorben waren, ohne es zu merken.
*
Der Flughafen Roland Garros in Saint-Denis war ganz anders als die Flughäfen in Paris. Nach der zu stark eingestellten Klimaanlage im Flugzeug brannte uns die drückend heiße, stickige Luft auf dem Rollfeld in der Kehle. Die von der Feuchtigkeit aufgebauschten Haare meiner Mutter schwebten vor uns her, während wir uns über einen Untergrund schleppten, der mehr trockener Erde als Asphalt glich. »Es ist nicht mal schönes Wetter«, grummelte Victor, als er mit seinem Rucksack im Arm die Stufen der kleinen Metalltreppe hinunterstieg. Auch das Licht war anders. Es war gelber, aus einem ganz anderen Stoff als in Frankreich und umgab die Silhouetten meiner Brüder mit einem goldenen Rand, der sich deutlich vom Himmel abhob. Wir waren zum ersten Mal auf einer Insel. Ein Fels, entstanden bei der Kollision von zwei Vulkanen, umgeben von Wasser und Haien, weit weg von allem, was wir kannten. Im Flughafengebäude liefen große braune Lüftungsanlagen, die aber völlig nutzlos waren und nur laut brummend die feuchten Luftmassen umwälzten und Pfützen aus trübem, kaltem Wasser bildeten, die Charles zum Spaß mit der Fußspitze antippte, während meine Mutter am Schalter einer Autovermietung stand und wartete. Ab und zu drehte sie sich zu uns um, eine Hand in der Tasche ihres gelben Overalls – sie tastete nach ihren Zigaretten, klar. Sie hatte immer eine Schachtel und ein Feuerzeug in der Tasche, wie alle Raucher der Welt, sie alle verbindet dieses Päckchen, das sie immer irgendwo versteckt bei sich tragen, und mich fasziniert noch immer die Präzision ihrer Handgriffe und ihres Verlangens, wie sie nach dem rechteckigen Objekt tasten, ohne ihr Gegenüber aus den Augen zu lassen, die Zigarette zwischen die Lippen schieben, sie mit einem Klicken des Feuerzeugs anzünden, tief ein- und Rauch wieder ausatmen und kurz darauf mit einer beiläufigen Geste die Asche wegschnippen – und sie flüsterte: »Seid bitte still.« Also blieben wir still und ein wenig verängstigt stehen, wurden ab und zu von vorbeieilenden Reisenden angerempelt, im nicht abreißenden Strom der Gestalten, die von irgendwo fortgingen oder anderswo ankamen. Danach versinkt alles in einer fast schon halluzinatorischen Schläfrigkeit, aus der nur einzelne Bilder in meiner Erinnerung blitzartig wieder auftauchen: die Schweißtropfen im Nacken meines Bruders, das trübe Licht auf dem Parkplatz und später in der Stadt und wie es sich auf den unzähligen Blechdächern spiegelte, die lila Schnecken, die vom fahrenden Auto zerquetscht wurden, die dichte, unbezwingbare Natur, die am Fenster vorbeizog (Bananenstauden, Wunderblumensträucher, Wespennester, Kakteen und Kängurubäume, wild wuchernde Gräser, Bremsen und rote Ameisen und ein riesiger, braungrüner Leguan), und rechts von mir natürlich das funkelnde Grau des Ozeans: eine ruhige und geheimnisvolle, monochrome Fläche, unter der unheimliche Tiere lebten, eine so unermessliche Weite, dass die Vorstellung, in ihr zu baden, beängstigend war, und die ich in den Augen meiner Brüder gespiegelt sah, wenn sich unsere Blicke kreuzten. Wir waren schockiert.
Bis dahin war La Réunion für mich eine Insel gewesen, auf der ein paar Kinder aus meiner Schule Urlaub machten, meistens im Winter. Gepolsterte Liegestühle, makellose Strände, die Bambusdächer kleiner Strohhütten, dahinter Wolkenkratzer. Aber die Insel, die ich von meinem Sitz aus sah, war nicht, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Überall wilde Natur. Dschungel. Er war maßlos, schien unendlich, kaum gezähmt in den Jahrhunderten des Zusammenlebens mit den Menschen. Überall Grün und Braun, obwohl ich doch mit Blau und Weiß gerechnet hatte: Bäume, Blätter, Halme, Sträucher, Pflanzen, dazu knallbunte Blumen, Erde. Wir fuhren um Saint-Denis herum, das weder paradiesisch noch besonders touristisch wirkte. Wenn meine Mutter an einer Ampel hielt, sah ich die ausgebleichten Jalousien fast leerer Geschäfte, Ball spielende Kinder, die kaum etwas anhatten, und Kisten, wie man sie nach einem Markttag herumliegen sieht. Neben diesen wie ausgestorbenen, farblosen Straßen standen schicke neue Wohnviertel, kleine moderne Einfamilienhäuser für die Mittelschicht auf einzelnen Parzellen, wo noch keine Pflanzen Zeit gehabt hatten zu wachsen, Trockengebiete voller Leben. Meine Mutter hatte gesagt, dass wir in einem Viertel im Norden der Stadt wohnen würden, und wir waren fest entschlossen, in dessen Namen kein schlechtes Omen zu sehen. Als wir irgendwo am Rand der Stadt, wo Bäume und Pflanzen herrschten, über schlampig geteerte und über unbefestigte, fast schon ländliche Straßen fuhren, setzte meine Mutter den Blinker. Das Geräusch erinnerte mich an den Heimweg an Sonntagnachmittagen. Irgendwo an einer von riesigen Bäumen gesäumten Kreuzung, wo ein Typ neben einer Kühltasche voller Kamelien saß, bog sie auf eine lange, steile Straße ab, Palmblätter klatschten an die Autotüren.
»Wir sind gleich … Ich glaube, es ist …«, setzte sie an.
»Mama.«
Victor hatte sie unterbrochen.
»Mama … Guck mal. Die ›Agentur‹.«
Und tatsächlich, so seltsam es scheinen mochte: Zehntausend Kilometer von Paris, in diesem Dschungel, wo hier und da ein beiger Supermarkt stand, zwischen den aus der Zeit gefallenen grauen Straßen erwartete uns, fast unwirklich, vor einem grünen Tor ein vertrautes Gesicht – Rosa.
4
Rosa war eine alte Freundin meiner Mutter, die Victor, als er noch ganz klein war, nur die »Agentur« genannt hatte, weil sie in einer Immobilienagentur arbeitete. Der Spitzname war geblieben. Meine Mutter nickte und zog die Handbremse an.
»Ah. Ja.«
Sie stopfte ein paar Sachen in ihre Handtasche.
»Das hab ich euch gar nicht erzählt. Das alles, La Réunion, dass wir weggegangen sind … Das war Rosas Idee. Sie hat einen Job für mich gefunden.«
Wir schauten sie entgeistert an, aber sie machte nur eine wegwerfende Handbewegung.
»Ist nicht kompliziert, das erklär ich euch später. Jetzt steigen wir erst mal aus.«
Victor machte den Mund auf. Charles schaute meine Mutter an, als ob er sie noch nie zuvor gesehen hätte. Ich zog am Griff der Autotür und wollte aussteigen.
»Seid ihr lesbisch?«
Charles’ Frage kam ganz unvermittelt. Meine Mutter hob den Kopf. Sie war so perplex, dass sie zum ersten Mal seit drei Monaten, seit dem Tod meines Vaters, grinsen musste. Ihre Mundwinkel zogen sich langsam auseinander, dann fing sie richtig an zu lachen, laut und durchdringend, und hörte gar nicht mehr auf, sie lachte, dass sich Tränen und Spucke mit Rotze vermischten und mit der reinsten Freude, ein Lachen wie eine Flutwelle, die uns mitriss, mich, Charles und Victor und sogar die »Agentur«, die uns von Weitem sah und bestimmt gar nicht verstand, was los war, ein Lachen, bei dem wir uns die Köpfe aneinanderstießen, wenn wir nach Luft schnappten, und bettelten, dass es aufhört.
»Früher war das hier eine schicke Gegend. Ein Jachthafen, quasi. Die Weißen hatten hier alle eine Hütte, um übers Wochenende mal rauszukommen.«
Charles murmelte etwas vor sich hin, aber keiner achtete auf ihn.
»Inzwischen ist das Viertel ein bisschen verwahrlost. Na ja (Rosa zeigte auf die riesigen Bäume um uns herum), das ist euch ja bestimmt nicht entgangen. Du wirst sehen«, sagte sie und wandte sich zu meiner Mutter, »es ist fast ein bisschen ländlich hier. Aber es gibt einen Supermarkt ganz in der Nähe, ich dachte, das ist sicher praktisch.«
»Ja, perfekt, Rosa. Danke, vielen Da…«
»Und zur Arbeit hast du es auch nicht weit. Fünfzehn Minuten mit dem Auto.«
Rosa hielt einen Becher in der Hand, in dem Sektschaum schwamm. Sie sprach sehr langsam. Das hatte ich schon ganz vergessen, dabei war dieses Detail noch typischer für sie als ihre Kleider oder ihre Art zu gehen. Nachdem sie uns das Haus gezeigt hatte, erklärte sie uns, dass sie in der Immobilienfirma, für die sie seit zwei Jahren arbeitete, eine Art Stelle für unsere Mutter gefunden hatte, und um uns das zu erzählen, brauchte sie mindestens zwei Stunden (zitternde Stimme, Gestottere, extrem gedehnte Aussprache, und während sie einen ihrer Schuhe auszog, hätte ich mir vor Ungeduld fast in die Faust gebissen, damit war sie nämlich gut fünf Minuten beschäftigt). Victor schaute sie an, als wüsste die Ärmste nicht, dass wir ein Rudel ausgehungerter Wölfe waren und vor lauter Ungeduld nicht warten konnten, bis jemand einen Satz beendete – er hatte Angst, dass Charles und ich über sie herfallen würden. Meine Mutter hörte ihr zu, lächelte zaghaft, war höflich und verlegen. Wir saßen auf der Terrasse auf dem Boden, das Summen der Insekten und das Rauschen der Bäume hingen schwer über unseren Köpfen. Ich hatte vergessen, dass Rosa Kreolin war. Als wir klein waren, hatte sie in Aubervilliers gewohnt (»bei Auber«, »in Auber«, sagte sie immer) und uns manchmal in der Rue Chauvelot besucht, todlangweilige Nachmittage waren das, meine Mutter zwang uns, stundenlang am Tisch sitzen zu bleiben, während die Erwachsenen Kaffee tranken und von Dingen redeten, die uns genauso wenig interessierten wie sie selbst. Sie hatten sich in der Schule kennengelernt. Wo, weiß ich nicht. Rosa trug immer diese orange oder braunen Leinenkleider, die aussahen wie aus einem Sack genäht, und brachte uns unbrauchbare Geschenke mit, die wir ungeduldig auspackten und dann einfach auf dem Tisch liegen ließen: ein Mikadospiel für unterwegs, ein Aquarellfarbenset für Erwachsene. Meine Mutter und sie fühlten sich einander nah, weil ihre Familiengeschichten sehr ähnlich waren, »in Übersee« als Kind »gemischter« Eltern geboren, meine Mutter auf Martinique, Rosa hier, die Väter unbekannt oder kurz mal Zigaretten holen gegangen, eine düstere Kindheit halb im Verborgenen, der nur der Passatwind und die Sonne Farbe verliehen hatten. Ich freute mich fast, sie hier zu sehen, zehntausend Kilometer weit weg von allem, was wir kannten, aber meine Güte redete sie langsam. Kaum vorstellbar, dass sie Immobilienmaklerin war.
»Und dann nach links … Oder rechts? Jedenfalls … Wenn du oben durch den schmalen Flur gehst und dann nach links oder nach rechts, also … Ich weiß nicht mehr … Dann ist da eine kleine Kammer, aus der könntest du ein Spielzimmer für sie machen«, hatte sie gerade gesagt.
Charles fluchte leise vor sich hin (»Ein Spielzimmer …«), aber wir wussten genau, alle drei, dass Rosa uns als Einzige von unseren Bekannten geholfen hatte. Nach dem Tod meines Vaters hatte sie meine Mutter angerufen, aber nicht, wie die anderen, wegen irgendwelcher Geldgeschichten oder aus krankhafter Neugier. Sie kam ihr nicht mit einem »Meld dich einfach, wenn du irgendwas brauchst …« Nein, Rosa hatte sie an die Hand genommen und ihr einen Notausgang gezeigt. Vielleicht war sie einfach zivilisierter als die anderen. Außerdem hatte sie etwas total Abgefahrenes für uns gefunden, wenn auch zehntausend Kilometer weit weg. Denn das Haus auf La Réunion war das verrückteste, in dem wir je gewohnt haben. Riesengroß und leer stand es mitten in einem üppigen Garten voller Akazien, Feigenbäumen und Blättern von Bananenstauden und mit einem Pool – unbenutzbar, grün, voll mit Schlamm, Blättern und sogar kleinen, ertrunkenen Biberratten, aber trotzdem ein Pool –, von dem aus man »eine krasse Aussicht auf den Ozean« hatte, wie Charles betonte. »Auf die Lagune«, korrigierte ihn Rosa, die dieses Haus mit der spottbilligen Miete für uns aufgetrieben hatte. Ich habe Jahre gebraucht, um die Adresse wiederzufinden, und wenn ich sie jetzt aufschreibe, muss ich fast lachen: die Rue Le Brûlé. Es hatte wohl schon bessere Zeiten erlebt. Es hatte zwei Stockwerke, die Zimmer waren mit blassrosa falschem Marmor gefliest und führten auf Balkone, so groß wie unser altes Wohnzimmer in der Rue Chauvelot, die Risse im Beton verliehen dem Meer in der Ferne noch einen zusätzlichen Charme. Kurzsichtig, wie ich war, sah ich nur eine blaue Masse, aber als meine Brüder die Landschaft betrachteten, waren sie sprachlos, und das kam selten vor. Der Garten war leicht abschüssig, voll mit verstümmelten Kakteen, die mitten auf einem Stück trockener Erde wild durcheinanderwuchsen, rötlichen Steinen, jungen Bananenstauden und anderen Bäumen, in denen wir Wespennester, Schnecken und Vögel entdeckten. Hier und da ragten dazwischen die weißen oder silbrigen Dächer unserer Nachbarn auf.
»Ihr werdet sehen, es ist schön ruhig hier. Ein bisschen zu ruhig vielleicht. Okay, es ist fast, als wäre die Zeit stehen geblieben«, sagte Rosa keuchend, nachdem sie die Wendeltreppe in den ersten Stock, wo sich die Schlafzimmer befanden, hinaufgestiegen war. Von einem der Balkons aus ließ Victor seinen Blick mit Grandezza über den Garten gleiten, als wären wir eine dieser Adelsfamilien, die nach einem Skandal oder Putsch verarmt und zum Exil verdammt waren und Zuflucht auf einer fernen Insel suchten. Eigentlich erinnerte das alles aber eher an Dealer-Banden, die irgendwo in einer verlassenen Küstenstadt im Süden Spaniens, Marbella oder so, noch mal von vorn anfangen – verlassene Häuser, brütende Hitze, Tankstellen in Spuckweite.
Am gleichen Abend, sobald Rosa gegangen war, packten wir in einem Zimmer die zwei großen Luftmatratzen aus, die wir im Supermarkt am unteren Ende unserer Straße gekauft hatten. Es gab zwar mindestens vier Schlafzimmer und genauso viele Bäder, aber das war uns alles zu groß: Wir schliefen lieber zusammen in dem geräumigen, gefliesten Zimmer mit Dachschrägen im ersten Stock, das eigentlich das Elternschlafzimmer sein sollte. Geckos krochen über die Decke, Victor gab ihnen Namen.
*
Der erste Morgen war hart. Als ich aufwachte, war die Luft schwer vor Feuchtigkeit, die Blätter des Ventilators wälzten die Hitze im Zimmer nutzlos hin und her und mein Kopf schmerzte, als wollte er zerspringen. Victor hatte die Augen offen und starrte an die Decke. Unsere Familie litt schon immer an Schlaflosigkeit. Reihenweise Ahnen allein im gedämpften Licht eines nur von einer kleinen Lampe erleuchteten Zimmers neben einer Tasse Verbenentee. Ich war es gewohnt, dass Victor oder Charles mit offenen Augen dalagen, wenn ich aufwachte, dass sie die Nase in ein Buch steckten oder aus dem Fenster schauten und meine Mutter schon seit Stunden am Küchentisch saß. Es war hell im Zimmer, wir hatten vergessen, die Fensterläden zu schließen, die fliederfarben gestrichen und ganz anders waren als alles, was ich bis dahin kannte. Und sie stand unten vor der Glastür und rauchte. Meine Mutter. Wie eine Schattenfigur hob sich ihre dunkle Silhouette von dem dschungelartigen Garten ab, der zu wild war, als dass wir kleinen Städter vom Pariser Stadtrand etwas aus ihm hätten herausholen können. Sie hatte mich nicht kommen hören. Es begann gerade erst zu dämmern. Meine Mutter. Was für ein Charakter, sagten die Leute, wenn sie nicht dabei war. Aber sie war meine Mutter. Groß. Schöner, als ich mir eingestehen wollte. Oder vielleicht war es auch weniger Schönheit als eine Art, in der Welt zu sein, die ich bei niemandem sonst je gesehen habe. Ein stilles Auflachen. Wie sie den Jackenkragen hochschlug. Wie sie sich energisch in die Verzweiflung stürzte. Die alten Sprüche aus den Siebzigern, die ausladenden Gesten. Die ungeheure, für Kinder sonst fast unerhörte Freiheit, in der wir schwammen: frei, zu sein, was immer wir wollten, weil sie uns weiterhin lieben würde. Nabelschnüre, unsichtbar, aber nie durchtrennt, über die sie nie sprach oder höchstens, wenn man sie folterte. Das Schwarz, das sie an die Wände malte, buchstäblich. Ihre reine Freundlichkeit, manchmal getrübt vom Hauch einer Boshaftigkeit, einer eiskalten Gemeinheit. Die Unfähigkeit, »Ich liebe dich« zu sagen, aber Augen, die so oft leuchteten, wild und scheu zugleich. Meine Mutter. Jeden Tag betrachtete ich mich prüfend im Spiegel und wartete darauf, dass in meinem Gesicht endlich eindeutige Zeichen auftauchen und dem Rest der Welt beweisen würden, dass ich wirklich ihre Tochter war, dass ich etwas von ihr geerbt hatte: etwas von ihrem Haar, der Fülle und dem Glanz; die hohen, wie bei einer Apachin geformten Wangenknochen; die Schwärze ihres Blicks; ihre überragende Eleganz, von der mir ein Zehntel schon gereicht hätte. Aber ich glich nun einmal meinem Vater, bis unter die Haut, dort, wohin meine Mutter doch so gern vorgedrungen wäre. Ich las, ohne es zu wissen, die gleichen Bücher wie er, aus einem Regal voller DVDs, die ich nicht kannte, nahm ich den Film, den auch er hätte sehen wollen. Meine Mutter schien sich dafür nicht besonders zu interessieren. Wie die Kraft eines Feuers, das auf seinem Weg alles niederbrennt. Dabei hatte ich doch Monate in ihr drinnen verbracht – bei diesem Gedanken war ich wie gelähmt vor Stolz, obwohl ich gar nicht greifen konnte, worin er eigentlich bestand. Sie drehte sich um.
»Oh, du bist ja da, mein Schatz …«
»Schläfst du gar nicht?«
Sie verzog das Gesicht und wiegte den Kopf hin und her. Wahrscheinlich hatte sie ein bisschen geweint.
»Mama, ich hab Kopfweh.«
Sie ging in die Küche und wühlte in einer ihrer Taschen, die dort auf dem Boden standen, brachte mir eine Aspirin und ein Glas Wasser und sah mich besorgt an, wie immer, wenn sie dachte, dass irgendwo Keime lauern könnten.
»Mama.«
Ich trank das Wasser, während sie die Tablettenschachtel in einer Schublade verstaute, direkt neben einem Feuerzeug.
»Müssen wir wieder in die Schule?«
Sie zog ihren gelb gestreiften Morgenmantel enger, einer der wenigen Überreste aus unserem früheren Leben.
»Ich dachte … Na ja, ich dachte, es ist vielleicht noch ein bisschen zu früh.«





























