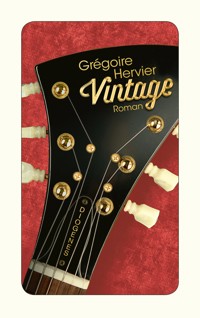
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einem jungen Gitarristen und Journalisten bietet sich der große Deal und die Story seines Lebens: eine Million, wenn er beweisen kann, dass die ›Gibson Moderne‹, die legendärste Gitarre aller Zeiten, tatsächlich existiert hat. Auf seiner Suche begegnet er besessenen Musikliebhabern, leidenschaftlichen Sammlern, zwielichtigen Gestalten und sagenumwobenen Instrumenten. Eine faszinierende Reise quer durch Amerika und die goldenen Jahre von Blues und Rock.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Grégoire Hervier
Vintage
Roman
Aus dem Französischen von Alexandra Baisch und Stefanie Jacobs
Diogenes
Der Blues, die Countrymusik und ihr uneheliches Wunderkind, der Rock ’n’ Roll, haben etwas Grundlegendes gemeinsam: ihre Verrücktheit. Sie sind, übers Ganze gesehen, mehr die Musik des Wahns als der Weisheit.
Nick Tosches,
Unsung Heroes Of Rock ’n’ Roll
I fell in love with the sweet sensation
I gave my heart to a simple chord
I gave my soul to a new religion
Whatever happened to you?
Whatever happened to our rock ’n’ roll?
Whatever happened to my rock ’n’ roll?
Black Rebel Motorcycle Club,
Whatever Happened To My Rock ’n’ Roll
Intro
Paris, Pigalle
»Wach endlich auf, Mann, der Rock ’n’ Roll ist tot, da stehen nur abgehalfterte Typen drauf. Die rauchen, saufen, ohne Gummi vögeln und mit zweihundert Sachen durch die Gegend rasen. Alles völlig out! Glaubst du vielleicht, Elvis hat die Fünf-am-Tag-Regel befolgt und sich ständig Obst und Gemüse reingeschoben? Der hat sich das Erdnussbutter-Sandwich mit dem Flugzeug geholt!«
»Die CO2-Bilanz lässt grüßen …«
Der Typ, der da mit grauem Haar, buschigen Augenbrauen, blauen Augen und leichtem Bauchansatz hinter dem Ladentisch stand und sich so ereiferte, war Alain de Chévigné, zweiundsechzig Jahre alt, Autor von Die Gitarren der Pop-Generation und anderen Standardwerken, ein Freund von Eddy Mitchell und Besitzer von Prestige Guitars in der Rue de Douai. Und der vor ihm, halblange braune Haare, schlank und elegant in der schnittigen Lederjacke, das war ich, Thomas Dupré, fünfundzwanzig Jahre alt, Gitarrist, ehedem Mitglied der Band Agathe the Blues and the Impostors, Zeilenschinder bei kaum bekannten Musikzeitschriften und Besitzer von rein gar nichts. Ich half hier gerade aus, weil der eigentliche Verkäufer sich beim Skaten an einem waghalsigen Sprung über einen Einkaufswagen versucht hatte. Zwei Monate krankgeschrieben. Immerhin, ein cooles Video. Und ich fand mich dank diesem Wagemut seit sechs Wochen zwischen einzigartigen und zumeist völlig unerschwinglichen Vintage-Gitarren wieder, eine meiner großen Leidenschaften.
Der Preis dafür war Alains schlechte Laune, weil er vor kurzem das Rauchen aufgegeben hatte und sich in diesen Krisenzeiten nur wenige Kunden in seinen Laden verirrten. Ich kannte ihn seit einer Ewigkeit, hatte ihm mal eine Gitarre abgekauft und mir für meine Konzerte immer wieder hochkarätige Modelle ausgeliehen, wenn ich nicht einfach in seinem Laden abhing und mit ihm fachsimpelte. Jetzt, wo ich ihn täglich sah, lernte ich auch seine weniger charmanten Seiten kennen.
Als das Telefon klingelte, wollte ich mich in die Werkstatt absetzen, schnappte aber noch ein paar Fetzen von Alains broken english auf, der Anrufer musste also ein Engländer oder zumindest ein Ausländer sein.
Für mich ist Prestige Guitars der schönste Gitarrenladen in Paris. Um nicht zu sagen, der schönste Laden überhaupt in Paris. Ein Hafen des Friedens mitten in Pigalle, eine Zeitinsel, in der man sich in der goldenen Ära des Rock vergnügen und vielleicht auch verlieren konnte. Die Gitarren an den Wänden waren keine verstaubten, unantastbaren Reliquien, sondern Waffen, an denen noch das Blut einer Revolution klebte. Einer Revolution, die nicht gewaltfrei und doch so fröhlich gewesen war. Sie waren Überlebende, wenn man so wollte, aber nicht reumütig, im Gegenteil, sie brannten geradezu darauf, ihre kühnen oder schmerzlichen Geheimnisse preiszugeben, wenn man ihnen die nötige Aufmerksamkeit schenkte. Manche kamen in tadellosem Zustand zu uns, anderen hatten die Jahre etwas zugesetzt, und wieder andere sahen einfach nur schlimm aus. Diese lagen mir besonders am Herzen. Ich hatte unheimlichen Spaß daran, für sie im hintersten Winkel alte Originalteile aufzustöbern und ihnen durch feine Justierungen und sorgfältiges Reinigen neues Leben einzuhauchen. War ich mit ihnen allein, dann verflog die Zeit nur so, und erst das Läuten der Türglocke beim Eintreten eines Kunden katapultierte mich zurück ins Hier und Jetzt.
Diesmal war es ein Schrei, ein lautes »Yessss!«, das von einem sichtlich erfreuten Alain de Chévigné vorn im Laden kam. Kurz darauf stand er strahlend vor mir.
»Rate mal, wer soeben einen Gratistrip nach Schottland gewonnen hat?«
»Du, vermute ich?«
»Falsch. Du!«
»Ach ja?«
»Ich hatte gerade einen Kunden am Telefon, der mir eins meiner Schätzchen abgekauft hat. Seine einzige Bedingung: dass wir sie persönlich vorbeibringen, in Schottland. Er zahlt das Ticket und die Spesen. Dein Flug geht am Samstag.«
»Samstag? Diesen Samstag?«
»Ja.«
Schnell ging ich gedanklich durch, welche Verpflichtungen ich dieses Wochenende hatte: keine. Die Vorstellung, mal rauszukommen, und sei es nur für vierundzwanzig Stunden, mir mal nicht den Schrott aus dem Radio anhören zu müssen, das meine Mitbewohner permanent dudeln ließen, gefiel mir nicht schlecht.
»Geht klar!«
»Moment, das ist noch nicht alles. Ich habe noch eine zweite gute Neuigkeit: Ich vertraue dir die Goldtop an!«
»Die Goldtop? Du hast die Goldtop verkauft?«
»Yessss!«
»Ausgeschlossen … Wie viel?«
»Hehe … Der Typ hat nicht mal verhandelt: Er wollte nur, dass ich, also dass man ihm die Gitarre persönlich übergibt. Kein Witz, er hat auch direkt online bezahlt.«
Was für eine merkwürdige Geschichte. Die berühmte Goldtop, eine Les Paul von 1954, die ihren Namen der funkelnden goldlackierten Decke verdankte, war Alains bestes Stück. Sie gehörte zu einer limitierten Auflage mit dem Beinamen »All Gold«, denn auch Zarge, Boden und Hals glänzten golden. Sie war ein Traum, einzigartig, und selten, wie sie war, strahlte ihre Aura auch auf die übrigen Gitarren ab. Wer sich bei Prestige Guitars irgendeine Klampfe aussuchte, der kaufte sie im einzigen Laden von Paris, in dem man eine echte Goldtop bestaunen konnte. Ja, bestaunen, denn niemand, nicht einmal meine Wenigkeit, durfte sie auch nur berühren. Sie befand sich in einer alarmgesicherten Einzelvitrine, in der Temperatur und Luftfeuchtigkeit sorgfältig geregelt waren und zu der einzig Alain den Schlüssel besaß. Da ihr Wert immer weiter stieg, stand sie eigentlich gar nicht zum Verkauf. Drängte jemand darauf, den Preis zu erfahren, dann warf Alain irgendeine Zahl in den Raum, die den offiziellen Schätzwert um das Zwei- bis Dreifache überstieg, in jedem Fall aber hoch genug war, um sowohl die reinen Liebhaber als auch die ausgefuchsten Sammler abzuschrecken. Nachdem nur sehr wenige Leute eine solche Summe hinblättern konnten, ohne den tatsächlichen Wert der Gitarre zu kennen oder in Erfahrung gebracht zu haben, kamen für mich nur zwei Möglichkeiten in Betracht. Entweder war dieser Anrufer ein stinkreicher Schnösel, der der Schönheit dieses speziellen Exemplars erlegen war und jede Vernunft über Bord geworfen hatte, weil er die Gitarre unbedingt besitzen wollte, egal, zu welchem Preis. Oder aber der wahre Wert dieser Gitarre überstieg bei weitem ihren Schätzpreis: zum Beispiel, weil sie einst einer Rocklegende gehört hatte.
Doch da war ich auf dem Holzweg, wie sich schon bald zeigen sollte. Fest stand, dass dieser Verkauf eine sehr gute Nachricht für Alain und die Finanzen seines Ladens bedeutete.
»Wer ist denn der glückliche neue Besitzer?«, fragte ich.
Alain runzelte die Stirn. »Ach ja, stimmt, sieh an. Ich glaube, er hat mir seinen Namen gar nicht genannt. Warte mal …« Er schaute im Computer nach und kam kurz darauf wieder zurück. »Nein, ich weiß nicht, wie er heißt …«
»Und seine Adresse?«
»Hab ich auch nicht … Er hat gesagt, die Flugtickets bekäme ich zugeschickt, und ein Auto würde mich am Flughafen abholen.«
Ich hatte zwar nur wenig Erfahrung mit Verkaufsgeschäften allgemein und schon gar keine mit internationalen Deals, aber das hier roch doch verdammt nach Abzocke. »Und du bist sicher, dass er tatsächlich bezahlt hat? Diese Geschichte klingt eigenartig.«
»Die Überweisung wurde bestätigt.«
»Na, dann sollte ja alles glattgehen.«
Ich erinnere mich ganz genau daran, gesagt zu haben: »Dann sollte ja alles glattgehen.« Also muss ich sogar ein bisschen daran geglaubt haben.
Erste Strophe
1
Flughafen von Inverness, Schottland
Unter der Wucht der Böen geriet das kleine Flugzeug immer heftiger ins Schlingern, je näher es dem Flughafen kam. Ich hatte die ganze Armlehne für mich und klammerte mich fest daran, denn der Platz neben mir war für die Gitarre reserviert, damit ihr der Frachtraum erspart blieb, selbst wenn er klimatisiert war.
Was für ein seltsamer Botengang … Ich wusste nichts über den Empfänger, Alain hatte mir vor dem Abflug nur noch sibyllinisch mitgeteilt: »Ich glaube, er wollte mir etwas zeigen … Wenn dem so ist, dann sag ihm, dass du meine offizielle Vertretung bist und ich, falls nötig, später persönlich vorbeikomme.« Der Rückflug war im Übrigen für den Abend des Folgetages gebucht, was also mehr einer Einladung als einem bloßen Botengang gleichkam.
Das Flugzeug landete unsanft auf der Rollbahn. Stürmischer Applaus brandete auf, was eigentlich nur noch in brenzligen Situationen vorkam.
In der Ankunftshalle entdeckte ich ein Schild »M. de Chévigné«, ganz ohne Fehler und mit den Akzenten. Hochgehalten wurde es von einem Riesen, der seinem Turban nach ein Sikh sein musste. In dem Moment ging mir auf, dass Alain offenbar die Tickets auf meinen Namen hatte umschreiben lassen, ohne den Empfänger davon in Kenntnis zu setzen. Ich baute mich vor dem Koloss auf und entschuldigte mich auf Englisch wirr für diese Änderung. Ihn schien das nicht zu kümmern, er ging gar nicht darauf ein. Ich hatte einen Gitarrenkoffer in der Hand, das war offenbar alles, was ihn interessierte. Er wiegte leicht den Kopf und bedeutete mir, ihm zu folgen, wollte mir aber vorher noch die Gitarre abnehmen, was ich ausschlug. Ohne die Gitarre verlor ich den letzten Hauch Glaubwürdigkeit.
Mit Bedauern eilte ich hinter ihm her an dem ganzen Nippes mit dem Konterfei von Nessie vorbei, dem scheuen Monster vom Loch Ness, einem der berühmtesten und offensichtlich auch einträglichsten Fakes, seit es Fakes gibt.
Draußen empfing uns strömender Regen. Glücklicherweise waren wir nur etwa zwanzig Meter vom Kurzzeitparkplatz und unserem Auto entfernt: ein stattlicher Rolls-Royce aus den sechziger Jahren.
Ich hätte wetten können, dass es ein Phantom V war, durch John Lennon zu Berühmtheit gelangt, weil er einen davon gelb lackieren und mit einem bunten psychedelischen Muster versehen ließ. Die Beatles hatten diese Limousine, die eigentlich den Staatsoberhäuptern vorbehalten war, in eine Ikone der Gegenkultur verwandelt. Auf mich wartete ein schwarzlackiertes Modell, klassischer, doch nicht weniger beeindruckend.
Der Chauffeur öffnete den riesigen Kofferraum, damit ich die Gitarre hineinlegen konnte, dann hielt er mir die gegenläufig öffnende Tür auf und bat mich feierlich, im Fond des Rolls-Royce Platz zu nehmen. Ich bugsierte meinen ziemlich nassen Hintern auf die weiße Lederrückbank. Der Mann mit dem Turban setzte sich ans Steuer. Zwischen uns eine Scheibe, Reden war offenbar nicht angesagt. Ganz abgesehen davon, war mein Fahrer viel zu sehr damit beschäftigt, sich ohne Blechschaden in die Autoschlange einzureihen, die den Flughafen von Inverness verließ.
Fragen über Fragen gingen mir durch den Kopf. Wer war dieser mysteriöse und extravagante Gastgeber, von dem ich nicht einmal den Namen kannte? Funktionierte dieses vorsintflutliche Radio noch? Warum kaufte man sich so eine Gitarre, ohne sie probegespielt zu haben? Wo würde ich heute Nacht schlafen? Gab es in allen Rolls-Royce-Modellen eine Fußstütze und ausklappbare Tischchen? War der Chauffeur eigentlich stumm, und wieso fuhr er verkehrt herum in den Kreisverkehr? War er der verlängerte Arm eines Barons von Frankenstein, eines Grafen Dracula oder der Leibwächter von Goldfinger? Durfte ich mir ein Glas von dem dreißigjährigen Whisky einschenken, der in der Minibar stand? Warum hatte ich bloß so eine Abneigung gegen Nussbaumholz in Autos, aber auch anderswo? Wohin fuhren wir, und warum wurde die Straße so gewunden, düster und trostlos? Würde diese Sintflut irgendwann zumindest mal weniger? Gab es in der Unfallstatistik einen Unterschied zwischen Links- und Rechtsverkehr?
Was die Minibar anbelangte, so bejahte ich mir die Frage schließlich selbst, und zwar gleich zweimal.
In Serpentinen ging es eine Forststraße hinauf, mit den Scheinwerfern des Rolls-Royce als einziger Lichtquelle. Rechter Hand erstreckte sich eine gewaltige, finstere Masse, und als ich in einer Kurve silberglänzende Spiegelungen sah, wurde mir klar, dass wir am Loch Ness entlangfuhren. Wir hatten die Stadt bereits seit einer Stunde hinter uns gelassen, als das Auto langsamer wurde und nach links abbog. Wir passierten ein Tor mit zwei Säulen, auf denen zwei einander zugewandte Adler thronten, dann ging es über einen schmalen Schotterweg hinauf. Der Kies knirschte unter den Reifen, während das Auto an einer von Steinen gesäumten kleinen Bauminsel vorbeikam und schließlich vor einem einstöckigen, langgestreckten Gebäude hielt, das grellweiß vor mir lag.
Der Chauffeur stieg aus und öffnete mir erst die Tür, dann den Kofferraum. Er bedeutete mir, zur Eingangstür vorzugehen, und stieg daraufhin wieder ein, um das Auto etwas weiter weg abzustellen. Nur im rechten Flügel des Anwesens brannte Licht. Es wirkte ebenso faszinierend wie unheimlich. Blitze, gefolgt von laut grollendem Donner, durchzuckten die Nacht wie in einem dieser alten Horrorfilme aus den Hammer Studios. Was mir eine weitere meiner Fragen beantwortete: Ich hatte es anscheinend doch eher mit einem Baron von Frankenstein oder einem Grafen Dracula zu tun, so golden die Gitarre auch war, an die ich mich klammerte.
Eigentlich hatte ich keinen Schritt weitergehen wollen, doch angesichts des Wolkenbruchs flüchtete ich mich unter das Granitportal. Neben der zweiflügeligen Eingangstür hing eine Tafel: Boleskine House.
Schwindel erfasste mich. Diesen Namen hatte ich doch schon mal irgendwo gelesen … Vor meinem inneren Auge tauchte ein Bild auf: ein altes körniges Schwarzweißfoto, auf dem ein Mann mit zotteligem Haar vor ebendiesem alabasterfarbenen Geisterhaus stand und mit tiefsinnigem, gedankenschwerem Blick in die Kamera schaute. Dieser Mann war … ja, genau der! Er war mehr als nur ein Mann, er war ein Halbgott, eine Legende, ein absolutes Genie des Rock ’n’ Roll, ein zartgliedriger, geheimnisvoller Aristokrat, der von einer Sekunde auf die andere von der größten melodischen Feinheit zur Klangapokalypse wechseln konnte.
Dieser Mann war Jimmy Page.
Ich stand vor dem Landhaus von Jimmy Page, das er in der Anfangszeit von Led Zeppelin gekauft hatte.
2
Boleskine House, Loch Ness
Ich zuckte zusammen, als der Chauffeur neben mir auftauchte, um die Tür zu öffnen. Er bat mich hinein, verneigte sich und verschwand wortlos im rechten Gebäudeflügel. Ich blieb allein in der fast leeren Eingangshalle zurück. Im Schein der elektrischen Wandfackeln entdeckte ich in einer Ecke ein rundes Tischchen, auf dem unter einer Glasglocke eine seltsame kleine Gitarre lag. Ich trat einen Schritt näher. Bei genauerer Betrachtung war es vielmehr eine große Mandoline, eine Mandola, auf deren geschweiftem Kopf der Schriftzug ›The Gibson‹ prangte. Ich kannte sie bisher nur aus Büchern: Es war eine der berühmten Lloyd Loars, die Stradivari unter den Mandolinen, wenn man so will. Unter den Mandolinen der Bluegrass-Countrymusik, sollte ich vielleicht hinzufügen, denn dieses Instrument unterschied sich ziemlich stark von den Mailänder Mandolinen oder den klassischen Mandolinen der Renaissance.
Gegen Ende des neunzehnten Jahrhunderts hatte sich irgendwo in den Appalachen zwischen den italienischen Einwanderern, die gekommen waren, um in den Kohlebergwerken zu arbeiten, und den einheimischen Hinterwäldlern, den hillbillies, etwas Folgenschweres ereignet. Es muss eines Abends am Lagerfeuer passiert sein, als einer der Bergarbeiter seine Mandoline hervorholte, einen der wenigen Gegenstände, die ihn auf der Atlantiküberfahrt begleitet hatten, und Lieder aus seiner italienischen Heimat spielte. Den Gebirgsbewohnern gefielen die wehmütigen Töne. Genau wie die Geige nahmen sie die Mandoline in ihre Folklore auf, wenn auch in leicht abgewandelter Form. Orville Gibson hatte ihren Hals verlängert und den Korpus etwas abgeflacht. Und mit ebendiesem Instrument wurde 1902 die Gibson Mandolin-Guitar Ltd. gegründet. Der Durchbruch gelang schließlich Lloyd Loar – selbst Musiker und Komponist, aber auch Ingenieur und herausragender Instrumentenbauer – in den zwanziger Jahren. Seine Mandoline F5 erlangte dank Bill Monroe, dem Urvater des Bluegrass, schon bald Berühmtheit. Schnell wurden Hunderte von Instrumenten gebaut, von denen zahlreiche bis auf den heutigen Tag erhalten sind, weshalb man sie recht einfach und zu annehmbaren Preisen findet. Auf dem Höhepunkt seines Schaffens baute Lloyd Loar jedoch eine ganz besondere Serie, die einen horrend hohen Schätzwert besitzt. Diese Mandolinen sind an den wunderschönen Perlmuttintarsien zu erkennen, ein Farnornament direkt unterhalb des Gibson-Schriftzugs. Solch ein Exemplar hatte ich vor mir, und zwar in tadellosem Zustand. Die Decke hatte eine herrliche Wölbung, die Mechaniken sowie alle anderen Metallteile waren vergoldet und allem Anschein nach original. Was mochte dieses Prachtstück wohl wert sein? Womöglich vier- oder fünfmal so viel wie die Gitarre, die ich ihrem neuen Besitzer überreichen sollte …
»7. Oktober 1924, die letzte von dreiundzwanzig Exemplaren, die gebaut wurden. Sie steht nicht zum Verkauf.«
Erschrocken fuhr ich herum. Der Mann, der das auf Englisch gesagt hatte, war um die siebzig Jahre alt, was man ihm durchaus ansah, aber sein Blick war wach und durchdringend. Er saß im Rollstuhl, und es war nicht Jimmy Page.
»Lord Charles Winsley«, sagte er und streckte mir die Hand entgegen.
»Thomas«, erwiderte ich und schüttelte sie. »Es tut mir schrecklich leid. Monsieur de Chévigné war in letzter Minute verhindert, wollte Sie aber nicht warten lassen und –«
»Wir hatten vereinbart, dass er mir diese Gitarre persönlich liefert, das war meine einzige Bedingung. Ich hätte durchaus warten können, bis Monsieur de Chévigné seinen Verpflichtungen nachgekommen ist.«
»Das wusste ich nicht«, sagte ich verdattert. Erst jetzt begriff ich, dass sich Alain offenbar einfach aus der Affäre gezogen hatte. »Das ist mir sehr unangenehm. Ich nehme an, dass Alain Ihren Wunsch nicht richtig verstanden hat, denn es ist nicht seine Art, Kunden zu enttäuschen.«
»Davon gehe ich aus.«
»Er hat mich gebeten, ihn dieses eine Mal ausnahmsweise zu vertreten, und versprochen, so bald wie möglich persönlich zu erscheinen, sollten Sie das wünschen.«
In den Augen des Lords flackerte Genugtuung auf, ich nutzte den Moment, um aus der Defensive zu kommen.
»Gestatten Sie mir, Ihnen in seinem Namen diese Gitarre zu überreichen«, plapperte ich forsch wie ein Straßenverkäufer drauflos und reichte ihm den Koffer.
»Kommen Sie bitte mit mir.«
Ich folgte ihm in eine dieser typisch britischen Bibliotheken – dunkel gehaltene Wandtapeten, mit Schnitzereien verzierte Möbel und Chesterfield-Sofas.
»Nehmen Sie doch bitte Platz. Was darf ich Ihnen zu trinken anbieten?«, fragte der Lord und steuerte auf eine gutbestückte Hausbar zu. »Wie wäre es mit einem Whisky hier aus der Gegend?«
»Sehr gern.«
»Sie vertreten also Monsieur de Chévigné. Sind Sie denn ebenfalls Spezialist für Vintage-Gitarren?«, fuhr der Lord fort, während er zwei Stielgläser herausholte.
»Nein, Spezialist würde ich nicht sagen. Ich verkaufe sie nur, und gelegentlich repariere ich eine. Eigentlich bin ich Musiker, Rockgitarrist. Und ich begeistere mich für Gitarren, besonders für E-Gitarren.«
»Da könnte ich Ihnen so einige zeigen. E-Gitarren mag ich auch am liebsten, aber nur die aus den Fünfzigern und Sechzigern. Die heutigen Instrumente sind qualitativ einwandfrei, keine Frage, aber für einen Nostalgiker wie mich haben sie keinen Wert.«
»Verständlich. Alain sieht das genauso, auch wenn er aus finanziellen Gründen hier und da Kompromisse eingeht.«
Das war keine sehr geschickte Bemerkung gewesen, also fügte ich schnell hinzu: »Das gilt natürlich nicht für die Goldtop, die ich Ihnen bringe. Sie war das Juwel seines Ladens.«
»Monsieur de Chévigné ist ein ausgezeichneter Kenner mit untrüglichem Geschmack. Und doch habe ich einige Vorbehalte bezüglich der Qualität seiner Popgitarren. Aber wie jeder gute Geschäftsmann ist er auch ein kluger Stratege. Im Übrigen weiß ich, dass die Goldtop, die vor Ihnen steht, über jeden Zweifel erhaben ist«, fügte er hinzu und schenkte mir ein.
»Soll ich sie aus dem Koffer nehmen?«
»O nein, jetzt doch noch nicht! Ich nehme sie erst morgen früh in Augenschein. Das Material hat während der Reise sicher mehr gearbeitet, als ihm guttut, deshalb möchte ich den Koffer erst dann öffnen, wenn sich die Luft darin auf Zimmertemperatur erwärmt hat. Stoßen wir lieber auf unsere Begegnung an, mon cher Thomas.«
»Auf unsere Begegnung«, sagte ich und nippte an meinem Glas.
Es war ein einheimischer Whisky, verdammt torfig. Ich hüstelte so diskret wie möglich, während mein Gastgeber tat, als bemerkte er nichts.
»Sie sind also Rockgitarrist …«
»Ganz genau.«
»Spielen Sie in einer Band?«
»Ich hatte mal eine … Wir haben uns vor kurzem aufgelöst.«
»Keinen Erfolg gehabt?«
»Kann man so sagen.«
»Haben Sie auch eigene Stücke geschrieben?«
»Ja.«
»Musik, die Ihnen gefiel, oder Musik, von der Sie glaubten, sie könnte gut ankommen?«
»Hm. Gute Frage … Ich würde sagen, eher Musik, die mir gefiel.«
»Das ist ein Fehler. Aber bei euch Franzosen ist das ja meistens so. Ihr verlasst euch auf die Kraft der Grundidee und wollt das Wesentliche daran, ihre Reinheit bewahren und sie nur ja nicht verfälschen. Wir Angelsachsen sind da pragmatischer: Wenn wir eine Idee haben, interessiert uns vor allem, ob sie funktioniert oder nicht. Wir fragen andere nach ihrer Meinung und wandeln die ursprüngliche Idee ab, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns von ihr entfernen oder sie womöglich sogar ganz aus den Augen verlieren. Rationalismus versus Empirismus. Ihre Methode kann etwas Geniales hervorbringen. Das Problem ist aber, dass Ihnen nur Genies folgen können. Und wie Sie wissen, sind Genies rar gesät. Auf jeden Fall nicht zahlreich genug, um Sie zum Millionär zu machen.«
»Oh, ich will auch gar kein Millionär werden. Ich wäre schon zufrieden, wenn ich von der Musik leben könnte.«
»Sie haben Ihr Leben noch vor sich, und vor Erfolg ist niemand gefeit. Man braucht nur den Fernseher einzuschalten, dann sieht man es. Aber in einem haben Sie recht: Man darf sich nie auf die Erwartungen anderer beschränken. Man muss tun, was man will. Das ist das einzige Gesetz. Das eigentlich Schwierige ist herauszufinden, was man wirklich will.«
Die darauffolgende Stille hätte peinlich werden können, hätte mein Gastgeber sie nicht unterbrochen.
»Ob man, wie in Ihrem Beispiel, Musik machen will, zu der nur man selbst Zugang hat, oder Musik, die einen Teil des Planeten berührt.«
»Sind Sie auch Gitarrist?«, fragte ich.
»Das war ich früher einmal«, sagte er, eine Spur von Bedauern in der Stimme. »Ein ziemlich miserabler Gitarrist, um ehrlich zu sein. Aber in London Mitte der Sechziger drängte sich das auf. Ich hatte damals mit ziemlich vielen Musikern zu tun. Richtig guten Musikern, meine ich, weshalb mir auch irgendwann klarwurde, dass ich mich besser anderweitig orientiere. Aber der Kontakt ist nie abgerissen. Und die Leidenschaft für den Rock ’n’ Roll und die Kraft, die von ihm ausgeht, sind mir bis heute geblieben.«
»Apropos, bitte verzeihen Sie, falls ich zu neugierig bin, aber hat dieses Haus hier nicht einmal jemand Berühmtem gehört?«
»Stimmt genau«, antwortete der Lord mit einem Leuchten in den Augen. »An wen dachten Sie denn?«
»Na ja, ich meine, ich hätte mal ein Foto von Jimmy Page hier im Hof gesehen. Hat er nicht damals zu Led-Zeppelin-Zeiten ein Anwesen in Schottland gekauft?«
»Haargenau! Ich hätte das Grundstück hier schon Ende der sechziger Jahre gern erworben, aber meine finanziellen Mittel waren damals zu begrenzt. Und als Jimmy mir eines Tages erzählte, er suche etwas Ruhiges und Zurückgezogenes, um neue Energie zu tanken, habe ich ihm dieses Objekt empfohlen. Nur ein paar Tage nach seinem ersten Besuch hat er es gekauft, das war 1971. Er hat mich oft hierher eingeladen, mich und andere Freunde, und wir haben hier viele schöne Momente verbracht. Jimmy ist ein begabter Künstler, aber als Gastgeber ist er herausragend. Er behielt das Boleskine House zwanzig Jahre lang, und als er mir dann erzählte, dass er sich davon trennen wollte, habe ich es ihm abgekauft. Sie werden morgen den Berg sehen, den er in dem Film The Song Remains The Same erklimmt. Aber ich rede und rede, dabei haben Sie sicher Hunger. Wenn Sie mir bitte folgen würden.«
Durch die Eingangshalle gelangten wir ins Speisezimmer. Dort war für zwei Personen gedeckt, an beiden Enden einer langen Tafel, auf der eigentlich nur noch der Kerzenleuchter in der Mitte fehlte. Der Raum war dunkel und kühl, und von den harten Oberflächen hallten mit einem leisen Echo das Surren des elektrischen Rollstuhls meines Gastgebers sowie meine eigenen Schritte wider.
Ich weiß nicht mehr, worüber wir alles gesprochen haben, aber ein Satz von Lord Winsley ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Als ich, ganz sicher höchst naiv, vom Lauf der Welt sprach oder vielmehr davon, dass ihr die Richtung fehle und sie zwischen einer chaotischen Finanzwelt und einem Rückfall ins Mittelalter schwanke, erwiderte Lord Winsley: »Wenn Sie die Welt nicht kontrollieren können, kontrollieren Sie diejenigen, die sie in der Hand haben.« Diese Idee ließ mich aufhorchen, auch wenn ich persönlich nicht bei Weltenlenkern ein und aus ging. Sprach er von verstärkten Kontrollen der Regierenden durch demokratische Gremien oder von etwas anderem?
Ich weiß nicht mehr, was wir gegessen haben. Auf jeden Fall keinen gefüllten Schafsmagen, das hiesige Nationalgericht, denn daran hätte ich mich erinnert. Und selbst beim »wir« bin ich mir nicht ganz sicher. Mir scheint, als hätte nur ich etwas zum Abendessen aufgetischt bekommen.
Nach dem Essen lud mich Lord Winsley noch auf einen Likör in die Bibliothek ein und bot mir eine Zigarre an. Ich hatte bisher nur selten Zigarren geraucht, nahm aber dankend an.
»Morgen machen wir einen kleinen Ausflug zum See, wenn Sie mögen.«
»Mit Vergnügen.«
»Glauben Sie an das Monster von Loch Ness?«
»Na ja, also, um ehrlich zu sein … ich glaube eigentlich nur, was ich sehe«, antwortete ich nach kurzem Zögern.
»Sie machen Ihrem Vornamen alle Ehre. Nur glauben, was man sieht …«, sagte er mit nachdenklichem Blick. »Das ist eine kuriose Philosophie. In der Theorie ist sie sehr einleuchtend, aber in der Praxis schert sich niemand darum. Es spricht zwar einiges dafür, aber es führt doch nirgendwohin, finden Sie nicht?«
»Na ja … ich weiß nicht.«
»Sie sind mit dieser Haltung bisher sicher gut gefahren, denn offenbar hängen Sie daran. Trotzdem liegt es auf der Hand, dass sie den Einzelnen stark einschränkt.« Lord Winsley schwieg einen Moment. »In Wahrheit ist diese Vorstellung schlicht unvereinbar damit, wie die Welt funktioniert – diese und jene andere, die man nicht sieht. Ich bin überzeugt, dass man genau das Gegenteil tun muss: nicht etwa sehen, um zu glauben, sondern glauben, um zu sehen.«
»Das ist interessant … So habe ich es noch gar nie betrachtet.«
Lord Winsley rückte näher. »Wenn man beispielsweise Rockstar werden will, muss man doch daran glauben, oder?«, fragte er mich und sah mir dabei direkt in die Augen.
»Stimmt.«
»Wenn ich Ihnen erzählen würde, woran die Rockstars glaubten, mit denen ich verkehrte, dann würden Sie staunen. Aber es ist schon spät, und Sie sind sicher müde, ich will Sie nicht mit alten Geschichten langweilen.«
»Sie langweilen mich nicht, ganz im Gegenteil.«
»Dann sprechen wir vielleicht morgen darüber. Einstweilen wünsche ich Ihnen eine angenehme Nachtruhe.«
Lord Winsley machte seinem Diener ein Zeichen, der mir bedeutete, ihm zu folgen. Er führte mich in den linken Flügel des Herrenhauses, schaltete mir das Licht an und verabschiedete sich. Es war ein großes Zimmer, altmodisch, aber mit Charme. Ich fand nur schwer in den Schlaf. Ich hatte zu viel getrunken, und die Stille der schottischen Landschaft erdrückte mich. Außerdem grübelte ich über diese interessante Frage nach: »Muss man sehen, um zu glauben, oder glauben, um zu sehen?«
3
Boleskine House, Loch Ness
Ich hatte vergessen, mir vor dem Schlafengehen den Wecker zu stellen, und tauchte gegen halb zehn Uhr morgens aus meinen Träumen auf. Ich duschte, zog mich rasch an und verließ das Zimmer mit noch nassen Haaren.
Die Tür zu meiner Rechten stand halboffen. Dort war die Küche. Eine Frau in Schürze begrüßte mich und begleitete mich zum Speisezimmer, wo mich das Frühstück erwartete. Sie fragte, ob ich Tee oder Kaffee wünsche, dann stellte sie mir mit ihrem unverständlichen schottischen Akzent eine Frage, die ich zwar nicht verstand, aber bejahte.
Durch die Bäume hindurch hatte man eine großartige Aussicht auf den dunkel und ruhig daliegenden See. Ich schlürfte gerade meinen Kaffee in der wohltuenden ländlichen Stille, als die Frau zurückkam und mir vorsetzte, was ich offenbar bestellt hatte: angebratenen Räucherhering und dazu ein pochiertes Ei. Mehr brauchte es nicht, um auch die letzten Nebelschwaden aus meinem Gehirn zu vertreiben und mich in Alarmbereitschaft zu versetzen: Jeder Aussetzer konnte mich teuer zu stehen kommen.
Als ich fertig war, kündigte mir die Haushälterin an, Lord Charles Dexter Winsley erwarte mich in der Bibliothek. Das also war der vollständige Name meines Gastgebers. Sie ging mir voran. Sobald er mich sah, faltete Lord Winsley die Zeitung zusammen, die er gerade las, und legte sie auf den Couchtisch. Wir begrüßten uns, und er erklärte: »Ihr Flugzeug geht erst heute Abend, es bleibt noch ein bisschen Zeit. Haben Sie vielleicht Lust, einen Blick auf meine bescheidene Sammlung zu werfen, oder würden Sie lieber gleich einen kleinen Ausflug zum Loch Ness machen?«
»Es wäre mir eine Ehre, Ihre Sammlung zu sehen!«
»Sehr gut, dann mal los.«
»Haben Sie die Goldtop denn schon getestet?«, fragte ich ängstlich.
»Sie entspricht in jeder Hinsicht meinen Erwartungen, wir sind geschäftseinig.«
»Das freut mich sehr.«
Als mich Lord Winsley in einen Raum neben der Bibliothek brachte, wären mir, obwohl ich an Alains Raritäten gewohnt war, fast die Augen aus dem Kopf gefallen. Etwa dreißig Gitarren, allesamt Prachtstücke und perfekt zur Geltung gebracht. Hier eine weiße Broadcaster, die bestimmt zu den Ersten zählte, die Leo Fender gebaut hatte; da eine Stratocaster in dem wunderbaren Lake-Placid-Blau aus der Mitte der fünfziger Jahre; und dort der Traum von Sammlern auf der ganzen Welt: eine Les Paul Standard von 1959 mit der atemberaubenden geflammten Decke. Letztere mochte so um die 500000 Dollar wert sein. Direkt darunter hing eine Gretsch White Penguin, weiß und goldfarben, zwar weniger beliebt, aber noch viel seltener. Alle Gitarren befanden sich in ausgezeichnetem Zustand, und soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen konnte, waren sie auch durch und durch original. Es waren die besten Modelle der besten Jahre in bestmöglichem Zustand. Außerdem besaß der Lord auch noch etwas bescheidenere Gitarren, von denen die meisten allerdings signiert waren. Brian Wilson, Keith Richards … Und dann, in einer Glasvitrine, eine Les Paul Deluxe mit gebrochenem Hals zusammen mit einer Notiz: »Für Charlie, von Pete«. Das musste Pete Townshend von The Who sein, was Lord Winsley mir bestätigte.
Ich war platt. Ich ging zur Gretsch White Penguin zurück, einer so seltenen Gitarre, dass es meines Wissens keine Einspielung mit ihr gab. Ich stellte mir vor, was für einen Klang sie wohl hatte.
Als könnte er meine Gedanken lesen, sagte Lord Winsley: »Nur zu, probieren Sie sie aus. Sie bettelt nur darum, gespielt zu werden.«
»Vielen Dank, aber ich hätte zu große Angst …«
»Sie brauchen keine Angst zu haben, Sie kennen sich doch mit Gitarren aus«, wischte er mein Zaudern vom Tisch. »Da gibt es jene, die einen einschüchtern, jene, die Zartgefühl erfordern, und jene, die geradezu danach verlangen, hart rangenommen zu werden. Das finden Sie schnell heraus. Da sind die knallbunten, die etwas weniger auffälligen, die strahlenden und die finsteren. Einigen ist das Altern nicht gut bekommen, die lassen sich nur schwer spielen, oder vielleicht waren sie ja schon immer so, andere wiederum werden Ihnen ungeahnte Horizonte eröffnen. Ich bitte Sie, probieren Sie sie aus. Alle, wenn Sie wollen.«
Ich brannte nur so darauf, die Gitarren zu spielen, doch noch zögerte ich. War es richtig, dieses Angebot anzunehmen?
»Das ist keine Sammlung wie jede andere«, fuhr Lord Winsley fort. »Es ist nicht der Friedhof meiner jungen Jahre, ein Mahnmal alter Erinnerungen, an die man nicht rühren dürfte. Jede dieser Gitarren hat eine Geschichte, eine ruhmreiche Geschichte, das kann ich Ihnen versichern. Sie wartet nur darauf, von Zeit zu Zeit erzählt zu werden. Erwecken Sie sie zum Leben oder zu neuem Leben, ich bitte Sie. Die Verstärker sind hier.«
Lord Winsley zeigte in eine Ecke des Raumes, wo Verstärker in allen möglichen Größen standen, der auffälligste davon ein riesiger Marshall-Amp mit Topteil, derselbe, den Jimmy Page beziehungsweise Jimi Hendrix auf Tournee benutzten. Aber womöglich hatte er ihnen ja sogar gehört.
»Entschuldigen Sie mich«, fuhr er fort, »aber ich muss Sie jetzt allein lassen. Ich habe ein paar unerfreuliche Angelegenheiten in der Stadt zu regeln, und meine Haushälterin muss einkaufen gehen. Ich werde so um die Mittagszeit zurück sein«, sagte er noch zum Abschied.
»Danke …«
»Ach, zwei Dinge noch«, fügte er hinzu. »Erstens ist es nicht gestattet, bei mir Fotos oder Aufzeichnungen zu machen.«
»Selbstverständlich.«
»Und zweitens: Sie können wirklich alle ausprobieren, nur von Petes rate ich ab.« Dabei zeigte er auf die halbzerstörte Gitarre. »Ansonsten machen Sie einfach, was Sie wollen.« Er zwinkerte mir zu, ehe er verschwand.
Ein paar Minuten betrachtete ich einfach nur die Sammlung und wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Durch das Fenster sah ich, wie der Rolls-Royce das Anwesen verließ. Himmel, war ich wirklich allein auf dem Landsitz von Jimmy Page, umgeben von den phantastischsten Gitarren des Rock ’n’ Roll und durfte sie zwei Stunden lang nach Lust und Laune ausprobieren?
Endlich traf ich eine Entscheidung und griff ganz vorsichtig nach der Gretsch, auf der ich zunächst nur schüchtern herumschrammelte. Sie war ein Gedicht, und als ich ein bisschen beherzter zugriff, vibrierte sie nur so vor Lebendigkeit. Es war an der Zeit, einen Verstärker anzuschließen. Ein Vox AC30 wollte unbedingt ausprobiert werden und fing an zu summen, kaum dass er Strom hatte. Dann wurde das Summen leiser, es konnte losgehen. Als Erstes ertönten die Beatles mit dem guten alten Day Tripper … Das brachte mich zu While My Guitar Gently Weeps und I Want You. Weiter ging es mit dem Solo von Oh Sweet Nothin’ von Velvet Underground, einem meiner Lieblingssongs, und dem von Thank You von Jimmy Page während seines BBC-Konzerts. Dafür brauchte ich eine Les Paul ’59, was sich ganz gut traf, und warum das Ganze nicht mit dem Marshall-Amp spielen, der sich zu langweilen schien, so ganz allein in der Ecke? Ich stellte die Gretsch zurück, schaltete den anderen Verstärker ein und nahm die Gibson. Dazed And Confused für den Anfang. Bestimmt würden verdammt viele Gitarristen gerade liebend gern mit mir tauschen! So wenig Zeit und noch so viele Gitarren, die ausprobiert werden wollten. Mit den Verstärkern und den Gitarren hier konnte man den Sound von fast allen Künstlern der fünfziger und sechziger Jahre erklingen lassen, und ich hatte wirklich den Eindruck, dort zu sein, wie Arnie Cunningham in seinem rotweiß lackierten Plymouth Fury in Christine.
Alle Gitarren waren gut eingestellt. Kein verzogener Hals, keine schnarrende Saite, kein kratzendes Poti. Die Bundstäbchen saßen perfekt oder waren perfekt justiert worden, der Korpus sorgfältig poliert, kein Fingerabdruck auf dem Lack, die Hälse rochen angenehm nach Mandelöl. Ganz offensichtlich wurden die Gitarren regelmäßig und sorgfältig von einer äußerst fachkundigen Person gewartet.
Unnötig zu erwähnen, dass die zwei Stunden wie im Flug vergingen und ich nicht einmal die Hälfte der Gitarren ausprobiert hatte.
Ich weiß noch, dass ich auf der Stratocaster L-Series Hey Joe spielte, das erste Stück überhaupt, das ich gelernt hatte, und auf einer phantastischen ES-345 ein höllisches Riff hinlegte. Gerade war ich dabei, selbst etwas auf ihr zu komponieren, da hörte ich, dass der Rolls zurückkam, und ich spielte noch immer, als Lord Winsley kurz darauf erschien.
»Ach, die 345! Das ist auch einer meiner Lieblinge. Hilton Valentine von The Animals hat sie mir 1966 gegen keine Ahnung was eingetauscht. Haben Sie sie im Stereomodus ausprobiert?«
»Nein, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen.«
»Tun Sie es, mein Freund, tun Sie es.«
Ich kam seiner Aufforderung nach und spielte ein paar Akkorde mit dem neuen Sound.
»Lauter, mein Freund, lauter! Ich höre Sie ja kaum.«
Ich stellte die Lautstärke so hoch wie in einem kleinen Konzertsaal.
»Und nur keine Bange, lassen Sie sie erzittern. Diese Gitarre ist ein reinrassiger Araber, die kauft man nicht, um nur damit zu traben.«
Ich musste über seine Ratschläge schmunzeln. Für einen Moment fand ich mich in der peinlichen Lage eines Gitarrenspielers wieder, der nicht weiß, was er spielen soll. Meine Hände waren feucht. Dann spielten sie plötzlich ohne Vorwarnung die ersten Akkorde von Gimme Shelter, gefolgt von dem Solo, das sich gegen Ende mit dem Solo aus Sympathy For The Devil mischte. Lord Winsley schloss die Augen und klopfte den Rhythmus auf den Schenkeln mit. Er wirkte entrückt, ich glaube, ich habe noch nie so gut gespielt wie an diesem Tag. Die Lämpchen waren gerade noch im grünen Bereich, und die Gitarre schien das, was ich spielte, im Output noch zu verdoppeln. Verdammt, was für ein göttlicher Sound! Aber ich musste allmählich wieder runterkommen und schloss mit den letzten Akkorden von Thank You, als Huldigung für den Hausherrn.
»Wie herrlich, Live-Musik zu hören! Sie besitzen echtes Talent, mein Lieber, und einen guten Geschmack. Ich hatte mich nicht getäuscht.«
»Ich könnte ganze Tage hier verbringen.«
»Wer weiß, vielleicht bekommen Sie dazu ja noch Gelegenheit …«, meinte Lord Winsley nur. Und nach einem kurzen Zögern: »Kommen Sie, ich muss Ihnen etwas zeigen. Dann müssen Sie sich aber hier losreißen.«
Ich erhob mich.
»Stellen Sie sich bitte hinter mich. Und könnten Sie auch gleich noch diesen Hocker zur Seite schieben?«
Kaum war ich seiner Bitte nachgekommen, fuhr Lord Winsley in die Ecke des Raumes, wo die Verstärker standen. Er holte eine Fernbedienung aus der Hosentasche und drückte auf einen Knopf. Der riesige Marshall öffnete sich wie eine Tür, hinter der eine Nische in der Wand zum Vorschein kam. Lord Winsley rollte hinein und bat mich, ihm zu folgen.
Es war eine Art Aufzugskabine, kaum breiter als der Rollstuhl von Lord Winsley. Er legte seinen Zeigefinger auf einen Sensor, die Tür schloss sich, und wir waren in völlige Dunkelheit gehüllt. Die Luft roch schal, kein Sauerstoff zum Atmen, da öffnete sich mir gegenüber eine Tür, ohne dass wir uns bewegt hätten: Dies hier war kein Aufzug, sondern eine Sicherheitsschleuse. Licht flammte auf, und ein rettender Ventilator sprang surrend an. Wir betraten einen winzigen, fensterlosen Raum, der vom Boden bis zur Decke mit schwerem altrosafarbenem Samt ausgeschlagen war, derselbe Farbton wie in … den alten Gitarrenkoffern von Gibson. In diesem Raum gab es nur zwei Gitarren, die mit dem Kopf an der Wand aufgehängt waren. An den geometrischen Formen erkannte ich diese besonderen Modelle sofort: die Flying V und die Explorer. Mechaniken, Potiknöpfe und alle anderen Metallteile waren golden. Das zart marmorierte Holz ihrer Korpusse wirkte sehr hell, es unterschied sich deutlich von der naturbelassenen Ausführung in Mahagoni, wie man sie bei Gibson vorfindet. Da fiel mir wieder ein, dass die ersten Exemplare dieser mythischen Gitarren aus einem exotischen Holz mit außergewöhnlichen Klangqualitäten gebaut worden waren.
Ganz offensichtlich handelte es sich hier um zwei Originale, die um 1958 hergestellt worden waren. Sie wurden teurer geschätzt als alles, was an E-Gitarren sonst noch auf dem Markt war. Meine Begeisterung war umso größer, als ich ein riesiger Fan der Flying V bin. Ich hatte viele glückliche Stunden bei Alain mit einer späteren und qualitativ minderwertigeren Version dieser Gitarre zugebracht, identisch mit denen, die Hendrix in der letzten Phase seines viel zu kurzen Lebens gespielt hatte.
Wortlos drehte ich mich zu Lord Winsley um, doch mein Gesichtsausdruck amüsierte ihn wohl, denn er lächelte mir wohlwollend zu.
Dann fiel mir der Name dieser äußerst seltenen Holzart wieder ein, und ich fragte: »Sind das die berühmten Exemplare aus Korina?«
»Ganz genau, unter dem Namen Korina wurde das Holz des afrikanischen Limbabaums vertrieben. Terminalia superba, eine zur damaligen Zeit äußerst seltene Holzart, die zum ersten Mal bei diesen Gitarren Verwendung fand.«
»Soweit ich weiß, wurden nur sehr wenige davon hergestellt …«
»Alles in allem hundertzwanzig Stück. Viele sind verschollen. Aber die Exemplare, die Sie hier vor sich haben, sind noch seltener, es handelt sich nämlich um die Prototypen. Pro Modell gibt es davon nur drei oder vier, und alle unterscheiden sich leicht voneinander. Es handelt sich also um höchst gefragte Unikate, die kurz vor der Modernistic-Reihe 1958 hergestellt wurden. Man darf sie durchaus als die gelungensten bezeichnen. Und wie Sie sich überzeugen können, sind diese Gitarren, obwohl es sich nur um Prototypen handelt, perfekt formvollendet und spielbar.«
»Ich glaube, ich sehe nicht recht …«
»Na, na! Gerade noch meinten Sie, sehen zu müssen, um zu glauben, und auf einmal reicht selbst das nicht mehr. Thomas, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Und doch haben Sie sie vor der Nase, selbst wenn das Wichtigste fehlt.«
»Was wollen Sie damit sagen?«
Lord Winsleys Miene verfinsterte sich. »Das Herzstück der Sammlung fehlt. Was Sie hier gerade bewundern, ist ein unvollständiges Triptychon.«
Erst da bemerkte ich den leeren Wandhalter zwischen den beiden anderen Gitarren, und die Geschichte dieser legendären Reihe fiel mir wieder ein: Damals hatte es nicht nur jene beiden berühmten Modelle gegeben, die heutzutage zu Hunderttausenden hergestellt werden, sondern noch ein drittes, von dem meines Wissens nie mehr als eine Zeichnung existiert hatte. Diese Gitarre war nie über das Projektstadium hinausgekommen, aber alle sagten, wäre sie hergestellt worden, dann wäre sie die seltenste, rätselhafteste und vermutlich teuerste Gitarre der Welt. Der Heilige Gral der Vintage-Gitarren.
»Die Moderne …«, murmelte ich.
»Ja, die Moderne.«
Und mit einem Mal verstand ich, weshalb Alain de Chévigné hierher eingeladen worden war. Der Schlussstein dieser beeindruckenden Sammlung fehlte, Lord Winsley wollte um jeden Preis an eine Moderne herankommen. Doch die Sache hatte einen Haken. Mir gegenüber hatte Alain immer so getan, als sei diese Gitarre ein Mythos. Als sei sie genauso real wie … das Monster vom Loch Ness. Jedenfalls hatte er sich nie ernsthaft auf ein Gespräch darüber eingelassen.
»Aber diese Gitarre hat es niemals gegeben, fürchte ich …«
»Oh doch, die gab es sehr wohl. Ja, ich sehe sie regelrecht vor mir, während ich diesen entsetzlich leeren Fleck anstarre. Denn vor zwei Wochen hing sie noch hier.«
4
Immer noch am selben Ort
Ich war vollkommen baff. »Sie hatten eine Moderne?«
»So wahr ich noch diese beiden Originalprototypen besitze. Ich habe die Moderne 1964 zusammen mit den beiden anderen gekauft, lange bevor sie zum Mythos wurde. Damals krähte kein Hahn nach dieser Gitarre.«
»Und haben nie jemandem von ihr erzählt? Haben sie nie jemandem gezeigt, nicht einmal ein Foto davon?«
»Ich habe tatsächlich versucht, das Geheimnis für mich zu behalten. Und solange es eins war, gab es auch keine Probleme. Bis ich dann leider eines Tages einen Fehler beging. Aber essen wir lieber erst mal zu Mittag, es ist schon spät, und dieser Raum, der für mich bis vor kurzem eine Insel des Friedens war, ist heute mein Fegefeuer.«
Wir gingen durch die Sicherheitsschleuse zurück in den Raum mit der Hauptsammlung. Die Gitarren waren noch genauso wundervoll, doch mir wollte nicht mehr aus dem Kopf, was ich gerade gesehen hatte oder vielmehr nicht mehr hatte sehen können.
Der Tisch war für das Mittagessen gedeckt. Ich hatte die Wahl, das weiß ich noch ganz genau. Lord Winsley schlug mir für den Nachmittag einen Bootsausflug vor, bei dem wir uns über Loch Ness, das Leben in Schottland und was weiß ich noch alles hätten unterhalten können. Aber ich hatte zu viel oder vielleicht auch noch nicht genug gesehen, um an etwas anderes als an die Moderne zu denken. Ganz sicher steckte hinter diesem Traum von einem Instrument eine Story. Meine Musiker- und Journalistenseele brannte nur auf eines: sie ausfindig zu machen und zu erzählen.
Ich bat Lord Winsley also, mir ganz genau zu erzählen, wie er seine Moderne gefunden und erworben hatte und was dann mit ihr passiert war. Lord Winsley kam dieser Bitte mit sichtlichem Vergnügen nach. Er erläuterte mir, dass Ted McCarty, damals Leiter der Gibson Company, 1957 die Idee hatte, eine Serie von Gitarren in futuristischem Stil herauszubringen, um das Image der Marke aufzupolieren. Die Instrumente der Firma besaßen zwar unbestritten Spitzenqualität, sahen aber von der Form her für die Generation der Draufgänger, wie es die Rocker der Fünfziger waren, zu klassisch, um nicht zu sagen: zu altmodisch aus.
Ted McCarty wählte persönlich die Entwürfe für drei Gitarren aus, wie man sie damals noch nie gesehen hatte: eine in Form eines V, die Flying V, eine in X-Form, die Futura, die schnell in Explorer umgetauft wurde, und eine dritte mit einer noch eigenartigeren Form, eine Art K, mit einem eher plumpen, asymmetrischen Kopf: die Moderne.
Aber nur die beiden ersten Modelle, die Flying V und die Explorer, wurden 1957 in Form von Prototypen auf der jährlichen Messe der National Association of Music Merchants in Chicago präsentiert. Diese Gitarren, die ihrer Zeit voraus waren, sorgten für großes Aufsehen. Aber genau wie Kunstwerke, die einen schockieren und aufwühlen, die man sich aber unabhängig vom Preis keinesfalls ins Wohnzimmer hängen will, fanden sie nicht viele Abnehmer. Die Bilanz der Bestellungen war katastrophal: weniger als zehn für die Flying V und ein oder zwei für die Explorer. Gibson gab die Idee der Serienproduktion auf und lieferte im Laufe der Jahre 1958 und ’59 den Aufzeichnungen nach nur 98 Exemplare der Flying V und 22 der Explorer aus, dann wurde die Serie eingestellt. Die Moderne wiederum tauchte weder in irgendeinem Verkaufsregister noch in einem Katalog der damaligen Zeit auf, und alles deutet darauf hin, dass man dieses Projekt aufgab, bevor sie überhaupt gebaut wurde.
Gibson erholte sich problemlos von dieser Schlappe, da man zur gleichen Zeit andere, konventionellere Modelle auf den Markt gebracht hatte, die sehr erfolgreich waren. Die Modernistic-Reihe war ein Flop, und mit der bemerkenswerten Ausnahme von Lonnie Mack und Albert King – später eins der größten Vorbilder von Jimi Hendrix – spielte kein bekannter Künstler die seltsamen Instrumente. Was dazu führte, dass niemand oder fast niemand überhaupt von ihnen wusste.
Auch Lord Winsley nicht, der seit 1962 im Londoner Rock-’n’-Roll-Milieu unterwegs war. Zuerst als Gitarrist und Leader einer Band, deren Namen er mir nicht nennen wollte, dann als nur kurzzeitig erfolgreicher Produzent und schließlich als Konzertveranstalter, seine lukrativste Tätigkeit. Immer wieder kam es zu Unstimmigkeiten mit den Musikern, bei denen es meistens ums Geld ging. Eines Tages schenkte Lord Winsley einem Rocker als Wiedergutmachung eine Gitarre aus seiner erst seit kurzem begonnenen Sammlung. Jener war hocherfreut über das Geschenk, und Lord Winsley stellte fest, dass sich bestimmte Konflikte auf diese Weise hervorragend lösen ließen. Solange eine Gitarre nur selten oder irgendwie besonders war, kurzum, anders als die des Nachbarn, wurde selbst der großspurigste Gitarrist zum sanften Lamm. Von da an kaufte Lord Winsley zahlreiche Gitarren, verschenkte sie oder tauschte sie gegen eine von diesem oder jenem Star der damaligen Zeit. Stets war er auf der Suche nach Modellen mit besonderen Details, in wenig gebräuchlichen Farben oder mit außergewöhnlichen Eigenschaften. Als er 1963





























