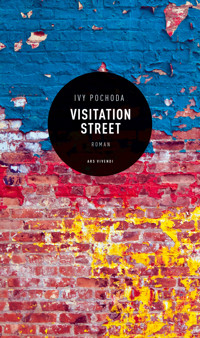
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ars vivendi Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Red Hook, Brooklyn/New York: ein Arbeiterviertel kurz vor der Gentrifizierung. Es ist Sommer. Die Hitze drückt. Aus Langeweile beschließen die beiden Teenager June und Val, auf einem Plastikfloß aufs Meer hinauszupaddeln. In der Schwärze der Nacht gehen sie verloren, und nur Val überlebt. Halb bewusstlos und verletzt wird sie an Land gespült.Das tragische Ereignis geht nicht spurlos an den Bewohnern des Viertels vorbei. Unter ihnen Cree, ein aus der Spur geratener Jugendlicher, der sich zum Hauptverdächtigen der Polizei macht, Fadi, ein aufstrebender libanesischer Bodega-Besitzer, der aus der Trauersituation Profit schlagen will, und Jonathan, ein gescheiterter Musiker, der mit seinen zerstörten Träumen und den Sünden seiner Vergangenheit zu kämpfen hat. In einer kristallklaren Sprache erzählt Ivy Pochoda von der menschlichen Zerbrechlichkeit und Widerstandskraft, von Hoffnungsschimmern in der Trostlosigkeit – und einem dunklen Geheimnis, das Visitation Street bis zur letzten Seite zum hoch spannenden Thriller macht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Aus dem amerikanischen Englisch von
Barbara Heller
ars vivendi
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel
Visitation Street bei ecco/HarperCollins Publishers.
Copyright © 2013 by Ivy Pochoda
Die Arbeit der Übersetzerin an diesem Buch wurde durch ein Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e. V. gefördert.
Vollständige eBook-Ausgabe der im ars vivendi verlag erschienenen Deutschen Originalausgabe (1. Auflage August 2020
© 2020 by ars vivendi verlag GmbH & Co. KG, Bauhof 1, 90556 Cadolzburg
Alle Rechte vorbehalten
www.arsvivendi.com
Covergestaltung: FYFF, Nürnberg
Motivauswahl: ars vivendi
Coverfoto: © Alamy / John Anderson
Datenkonvertierung eBook: ars vivendi verlag
eISBN 978-3-7472-0164-0
Für Justin Ames Nowell
inhalt
eins
zwei
drei
vier
fünf
sechs
sieben
acht
neun
zehn
elf
zwölf
dreizehn
vierzehn
fünfzehn
sechzehn
siebzehn
achtzehn
neunzehn
zwanzig
einundzwanzig
zweiundzwanzig
dreiundzwanzig
danksagung
die autorin – die übersetzerin
eins
Der Sommer ist die Party der anderen. Er gehört den Hipstern, die man in ausgelatschten Sneakers und farbbespritzten Jeans neuerdings aus der Bar ein paar Häuser weiter kommen sieht. Er gehört den puerto-ricanischen Familien mit ihren Aluschalen voll Fleisch, ihren Holzkohlengrills, von denen Rauchsignale aufsteigen, er gehört sogar den alten Männern, die vor dem Veteranentreff VFW sitzen und das Viertel an sich vorüberziehen lassen.
Val und June liegen im ersten Stock von Vals Elternhaus in der Visitation Street auf dem Bett. Sie schauen zu den gepflegten zweistöckigen Backsteinreihenhäusern hinüber und warten darauf, dass der Abend Gestalt annimmt.
June hat die Nummern von zwanzig Jungs in ihrem Handy – zehn würde sie selbst gern küssen, zehn, schwört sie, sind scharf drauf, sie zu küssen –, und trotzdem sind die Mädchen allein. June scrollt durch ihr Telefonbuch, ob sie nicht jemanden vergessen hat; ihr lackierter Fingernagel klickt auf das Display. Wenn sie so weitermacht, ist der Akku bis Mitternacht leer – hofft Val.
Die beiden haben in der Kinderkrippe der Kirche Visitation of the Blessed Virgin Mary wieder den ganzen Tag Babys betreut und nichts vom Sommer gehabt. Sie haben den Gemeinschaftspool und die offenen Hydranten verpasst. Sie haben erneut die Gelegenheit verpasst, im Bikini auf der Vordertreppe zu sitzen. Sie haben den langsamen Übergang vom Nachmittag zum Abend, vom Rumhängen zum Rausgehen verpasst. Aber wenigstens haben sie ein bisschen Geld verdient, für später, wenn sie alt genug sind, um es für etwas Interessantes auszugeben. Mit ihren fünfzehn Jahren ist alles Interessante für sie noch außer Reichweite.
Die Visitation Street ist eine der schönsten in Red Hook, eine von Bäumen gesäumte Wohnstraße im überwiegend weißen, am Wasser gelegenen Teil des Viertels. Red Hook, durch den Expressway von Carroll Gardens mit seinen prächtigen Brownstone-Straßenzügen abgeschnitten, liegt auf einer anderthalb Kilometer langen Landzunge an der Südspitze Brooklyns, dort, wo der East River in die Bucht mündet. Der Coffey Park in der Mitte des Viertels trennt das »Vorn«, den verfallenden, aufgegebenen Teil am Wasser, von der Festung des »Hinten« mit den Sozialbauten und Billigsupermärkten.
Überall ringsum heizt sich der Abend auf. Die Vordertreppen füllen sich, manche mit neu Zugezogenen in Secondhandklamotten, andere mit grauhaarigen Männern, die die Luft durch die Zähne ziehen, als könnten sie sich damit Kühlung verschaffen. Es ist ein heißer Abend nach einer ganzen Reihe heißer Wochen. Der Gemeinschaftspool war den Tag über brechend voll, die Betoneinfassung ein Mosaik aus bunten Handtüchern. Die Männer von der Feuerwehr, die Red Hook Raiders und die Happy Hookers, haben Überstunden gemacht und sind durch die Straßen gefahren, um unerlaubt geöffnete Hydranten zu schließen und den Kindern zu sagen, sie sollen sich woanders abkühlen. Die Leute sind sich aus dem Weg gegangen, so gut sie konnten. Inzwischen hat jeder seine eigenen Abkühlungsgewohnheiten entwickelt – ein nasses Durag für den Kopf, ein Miniventilator direkt vor der Nase, ein kaltes Bier noch vor dem Mittagessen.
Hinter dem Haus haben Vals Schwester Rita und ihre Clique den Gartenpool in Beschlag genommen und feiern noch immer ihren Highschoolabschluss vor zwei Monaten. Der asphaltierte Hof ist mit Coors-Light-Bierdosen und herumrollenden Flaschen hochprozentiger Alcopops übersät. Val und June haben eine Weile am Rand gestanden und zugeschaut. Als die Gespräche auf Themen kamen, die nicht für ihre Ohren bestimmt waren, hat Rita sie ins Haus geschickt.
»Der Typ in dem Liegestuhl«, sagte June, als sie die Treppe hinaufstiegen. »Der hat mir an den Arsch gegrapscht. Aber wie!« Doch bei aller Empörung strahlte sie.
»Dein Hintern ist ihm in die Hand gefallen, so war’s«, sagte Val.
Junes Kurven sind neuerdings überall, besonders da, wo sie nicht hingehören. Sie sprengen die Knöpfe ihrer Schuluniform, quellen aus ihren zu kurzen Shorts. Die beiden Mädchen, die einander einmal so ähnlich waren, scheinen inzwischen wie aus verschiedenem Stoff gemacht: Val, deren helle Haut keine Sonne verträgt, aus Schilf und Zweigen – wie die traurigen jungen Bäumchen im Park, die zwar in die Höhe schießen, aber dann nicht ausschlagen – und June, die selbst im Winter mit einem olivfarbenen Teint gesegnet ist, aus etwas Weichem, Geschmeidigem, aus Lehm vielleicht oder aus Plätzchenteig.
Irgendwo anders, vermutet Val, gibt es vielleicht Jungs, die ihre langgliedrige Gestalt bewundern, aber in Red Hook stehen alle auf Junes üppige Rundungen, ihren elastischen Hintern, ihre Brüste, die June jede Nacht neu zu modellieren scheint, damit man im Viertel immer wieder was Frisches zu sehen bekommt. Selbst ihre braunen Haare haben etwas Mutwilliges, so wie sie wippen und sich kringeln. Vals eigenem, unscheinbar strohfarbenem Haar fehlt es an Enthusiasmus, findet sie.
Sie weiß, dass die Zeit für Kinderkram knapp wird. Wenn die Schule wieder anfängt, wird man von ihnen erwarten, dass sie perfekt gestylt auf Partys erscheinen. Aber manchmal kann Val ihre Albernheit nicht zügeln. Nachdem sie tagsüber in der Kinderkrippe eingesperrt waren, will sie sich jetzt austoben. Nicht auf eine direkte, offenkundige Art, etwa indem sie eine Flasche mit etwas Süßem, Alkoholischem mitgehen lässt oder heimlich eine Zigarette raucht. Sie ist auf etwas anderes aus, einen Streich, ein Geheimnis, das sie und June irgendwann mal, wenn sie beschwipst oder sogar high bei einem Jungen auf dem Sofa sitzen, preisgeben können.
Das Fenster steht weit offen. June hat sich dort in Stellung gebracht und springt jedes Mal auf, wenn sie draußen Schritte hört. Mit ausgebreiteten Armen stützt sie sich am Fensterrahmen ab.
»Heut Abend will ich’s wissen«, sagt sie so laut, dass man es auf der Straße hören kann. »Heut mach ich einen drauf.« Sie lässt die Hüften kreisen und drückt die Brust heraus. Ihre Shorts spannen an den Nähten. Wenn sie ihren Rücken noch einen Zentimeter weiter durchbiegt, platzt die ganze Packung, fürchtet Val. »Denen zeig ich’s.«
Irgendwie erinnert Junes Pose Val an eine Tüte Mikrowellenpopcorn. Sie lässt sich aufs Bett zurückfallen, und ihr Lachen schallt bis auf die Straße hinaus.
»Baby«, sagt June, »du lachst wie ein Baby.« Sie tritt vom Fenster zurück und lässt sich ebenfalls aufs Bett plumpsen, hält aber Abstand zu Val. Sie mustert ihre Fingernägel, dann holt sie ihr Handy hervor. »Lass uns irgendwas machen.«
»Wir könnten oben auf dem Dach schlafen«, sagt Val.
June sieht nicht auf.
»Oder einen Film schauen.«
»Damit alle denken, wir bleiben ewig Babys?«
»Was ist so schlecht dran, einen Film zu schauen?«
June steht auf. »Ich hol uns was zu trinken.«
Fünf Minuten später kommt sie mit einer halb vollen Alcopopflasche zurück. »Hat das jemand übrig gelassen?«, fragt Val.
»Ich hab die Hälfte auf dem Weg hier rauf getrunken.«
»Wir könnten das Schlauchboot rausholen«, schlägt Val vor. »Das wär doch was.«
June trinkt die Flasche aus. »Bescheuerte Ideen hast du manchmal.«
»Deine einzige Idee war, meiner Schwester eine halb volle Flasche zu klauen.«
»Dann hol eben das Scheißboot.« June legt den Kopf in den Nacken, schüttelt ihr Haar und bläst den Rauch einer unsichtbaren Zigarette aus.
»Hör auf rumzuzicken«, sagt Val.
Das Gummiboot ist ein Geschenk von ein paar älteren Jungs, die sie schon länger aufgezogen und gereizt und sich schließlich letztes Wochenende am Pool an sie rangemacht haben. Val und June hatten keine Ahnung, was sie mit dem knallrosa Boot anfangen sollten, haben es aber trotzdem angenommen. Und heute – ihr ist heiß, und die Decke fällt ihr auf den Kopf – entscheidet Val, was sie damit machen: in die Bucht rausfahren, sich abkühlen, sehen, was auf dem Wasser passiert.
Die Mädchen machen sich auf den Weg. Das Boot schlägt ihnen beim Gehen an die Beine. »Es ist dein Boot, also trag du’s allein«, sagt June und setzt ihr Ende ab.
Spätsommergerüche hängen in der Luft: Gullygestank, Grilldüfte und der Geruch von brackigem Wasser, der sich in Red Hook zu jeder Jahreszeit hält. Die Nacht hallt wider vom Lärm der anderen: Gelächter, das aus Fenstern fällt, das Call and Response rivalisierender Gettoblaster. Die Mädchen nähern sich dem Coffey Park am Rand der Sozialsiedlung, des Red Hook Housing Project. June geht voraus, hält ein paar Schritte Abstand zwischen sich und Val mit dem Boot. Val lässt sie vorangehen, weiß nicht recht, was sie davon halten soll, dass June die Hüften schwingt und ihre Mähne wie ein Zirkuspferd schüttelt. Am einen Ende des Parks liegt die zu Lofts umgebaute alte Kofferfabrik, am anderen das erste der Sozialhochhäuser und dazwischen ein Platz, auf dem Basketball- und Barbecue-Schlachten geschlagen werden.
Die Parkbänke sind voll besetzt. Viele davon sind in Bühnen für Newbie-Rapper umfunktioniert, deren Reime ab und zu von den wummernden Bässen aus vorbeifahrenden Autos übertönt werden. Mädchen, in ihren engen Glitzerklamotten wie Geschenke verpackt, bumpen und dippen im Rhythmus mit. June und Val beneiden sie um ihre Doorknockerohrringe, ihre lässige Sprache, ihre straff sitzenden Haltertops, die hautengen Shorts. Darum, dass sie hier spätabends ihren Spaß haben.
Nach dem sonntäglichen Gottesdienst mit ihren Eltern in der Visitation of the Blessed Virgin Mary stehlen sich June und Val manchmal davon. Bei Tageslicht haben sie keine Angst, durchqueren den Coffey Park und gehen mitten durch die Projects bis zum Red Hook Gospel Tabernacle, einer kleinen Ladenkirche in einer Seitenstraße, in der man sie möglicherweise nicht gern sieht. Im Frühjahr und Sommer stehen die Türen offen, und sie können einen Blick in den kleinen, neonerleuchteten Raum mit seinen Klappstühlen und dem Linoleumboden werfen. Val und June kennen einige aus dem Chor noch von der Grundschule, bevor sie in die katholische Schule auf der anderen Seite des Expressway geschickt wurden.
Aber jetzt, bei Nacht, trauen sie sich nicht in den Park. Sie gehen am Rand entlang. June schlägt den Bund ihrer Shorts um, damit sie höher sitzen.
»Du kannst einfach alles tragen. An dir würde sogar eine Papiertüte scharf aussehen«, hat sie neulich zu Val gesagt. »Aber ich hab da so meine Probleme.« Sie umfasste ihre Brüste. »Du weißt schon, meine Schwergewichte.«
Im Moment scheint ihr Körper sie nicht allzu sehr zu belasten. Sie trödelt vor jeder Bank herum, löst Haarsträhnen aus ihren silbernen Kreolen, zieht ihr Bikinioberteil unter dem T-Shirt zurecht. Val bleibt dann ein paar Schritte zurück, halb im gelben Lichtschein einer Laterne, ihr schmaler Schatten vor ihr auf dem Boden.
June kennt eines der Mädchen noch aus ihren ersten Schuljahren. Monique sitzt auf der Lehne einer Bank nicht weit vom Parkeingang. Damals hat sie oft mit Val und June im Keller der Marinos aus kaputten Möbeln Burgen, Raumfahrzeuge und Schiffe gebaut. Sie zogen Ritas Kleider an, stöckelten in Ritas Schuhen durch den Keller, schmierten sich ihr Make-up ins Gesicht. Manchmal gingen sie auch zu June, um das Orangeneis am Stiel zu essen, das ihre Großmutter machte, oder um Kirschkerne aus dem Fenster im ersten Stock zu spucken. Zu Monique, die in den Projects wohnte, gingen sie nie.
»Hey, Monique!«, ruft June. »Monique!«
»Da will jemand was von dir, Mo«, sagt einer der Jungs auf der Bank. Er schwenkt eine Bierflasche und wischt sich die verschwitzte Hand an seinen weiten Basketballshorts ab. Monique mustert June und Val. »Willst du deine Freundinnen nicht herholen?«, fragt der Junge und stupst Monique mit der Flasche an.
»Nein.« Monique wendet sich ab.
June rührt sich nicht vom Fleck, aber Val geht weiter, stößt sie mit dem Boot an.
»Pass doch auf«, sagt June.
Der Junge hält ihnen die Flasche hin. »Auch n Schluck?«
June zögert, tritt von einem Fuß auf den anderen. Val weiß, dass sie Moniques Blick sucht, um zu sehen, ob das hier cool ist. Aber Monique schaut nicht her, sie lacht mit ein paar älteren Mädchen.
»Auch n Schluck?«, fragt der Junge noch einmal, trinkt selbst und hält ihnen erneut die Flasche hin. Er leckt sich die Lippen, dann zeigt er Val und June seine Zähne. Zwei sind golden überkront und mit Diamantsplittern besetzt, die das Licht einfangen und ihm das Lächeln einer Halloweenlaterne verleihen. Er schüttelt den Kopf. »Na ja. Hätt ich mir denken können.« Er lässt die leere Flasche ins Gras fallen.
»Hast du mir nichts übrig gelassen?«, fragt Monique und klatscht ihm mit der Hand aufs Bein.
»Woher soll ich wissen, dass du was willst?« Die beiden starren Val und June an.
»Komm weiter«, sagt Val.
»Was hast du’s denn so eilig?«, fragt June.
Val fasst sie am Handgelenk. Monique und ihre Crew werden gleich losprusten, das weiß sie. Sie zieht June vom Park weg.
»Hast du gesehen, wie der uns angeschaut hat?«, fragt June.
Val hängt sich bei ihr ein. »Klar.«
Im Weitergehen versuchen sie sich so lässig zu geben wie Monique und ihre Crew. Probieren nervös Wörter aus, die sie zu Hause oder in der Schule nie in den Mund nehmen würden. Nennen einander »Schlampe« und warten auf die Konsequenzen, die aber ausbleiben, weil niemand in der Nähe ist. Sie gehen am Rand der Projects entlang und nähern sich auf dunklen, kopfsteingepflasterten Straßen dem Wasser. Außer ihnen sind da nur ausgebrannte Straßenlaternen und leer stehende Lagerhäuser.
Der Vollmond steht hoch am Himmel. Die letzten Lichter der Wohnblocks bleiben hinter ihnen zurück. Die Sommergeräusche und das Stimmengewirr des Parks sind verebbt, und die Mädchen sprechen jetzt lauter, sprechen gegen die Stille an. Sie schwenken die Arme, machen ausladende Gesten, drängen die Schatten zurück, die aus verlassenen Hauseingängen und zerbrochenen Fenstern kriechen. Sie kennen die Gerüchte, versuchen sie zu ignorieren: die tollwütigen, verwilderten Hunde, die sich in der verlassenen Zuckerraffinerie paaren, die rastlosen Junkies, die Obdachlosen, die Verrückten.
Ein paar Blocks vom Wasser entfernt liegt ein mit Abfällen übersätes, kniehoch von Unkraut überwuchertes Gelände. In der Mitte ist ein verfallenes Fischerboot im Müll vertäut. Das Unkraut raschelt, und die Mädchen gehen schneller. Von dem Boot her ertönt ein Pfiff. Sie drehen sich um. Cree James, ein Junge aus den Projects, sitzt mit baumelnden Beinen auf dem Bug. Cree hat viel Zeit mit Rita verbracht, bis Vals Eltern der Freundschaft ein Ende machten. Er sieht gut aus – rundes Gesicht, große Augen, hohe Wangenknochen. In den heißen Sommermonaten lässt er sich den Kopf kahl rasieren.
»Wo wollt ihr hin?«
»Irgendwohin«, antwortet June.
»Wieso sitzt du hier ganz allein?«, fragt Val.
»Ich hab hier was zu tun.«
»Sieht aber nicht so aus«, sagen beide Mädchen gleichzeitig.
»Was wisst ihr schon?«
»Einiges«, antwortet Val.
»Zum Beispiel?«
»Mehr, als du denkst«, sagt June.
»Ach ja?« Cree trommelt mit den Füßen gegen den Rumpf des Bootes.
»Ja.« June hakt die Finger in den Maschendrahtzaun, der das Gelände gegen die Straße abschirmt. »Komm her und find’s raus.«
Val knufft sie in die Seite.
»Große Klappe für eine Vierzehnjährige«, sagt Cree.
»Fünfzehn.«
»Trotzdem große Klappe.«
»Du willst also nicht mit uns abhängen?«, fragt June.
Cree schüttelt den Kopf. »Ich muss noch wohin.«
»Schade. Wir wissen nämlich, wo die Party abgeht«, sagt Val. Normalerweise würde es sie nervös machen, mit einem Achtzehnjährigen zu flirten, wenn auch nur zum Spaß. Aber hier, auf fremdem Terrain, traut sie sich.
»Ja, klar«, sagt Cree.
»Wir könnten eine Menge Spaß haben«, sagt June.
Die Mädchen setzen sich wieder in Bewegung. Junes Stimme hat jetzt nicht mehr diesen aufreizenden Unterton. Val spürt, dass sie sich entspannt und sich mit dem gemeinsamen Abenteuer anfreundet.
»Wir wissen, was Sache ist«, sagt Val.
»Wir kennen uns aus.«
»Wir wissen Bescheid.«
Cree sieht den Mädchen nach, die mit dem pinkfarbenen Schlauchboot zwischen sich auf der dunklen Straße verschwinden. Als Kinder haben sie oft mit Crees Cousine Monique gespielt, damals, als er mit Rita befreundet war, bis ihre Eltern sagten, die Kids aus den Red Hook Houses seien für Mädchen aus dem Uferviertel tabu. Nie hätte er gedacht, dass Val und June einmal in diesem Teil von Red Hook aufkreuzen würden, schon gar nicht so spät. Nachts hat er die Ecke hier normalerweise für sich allein. Selbst Leute aus den Projects meiden diese Straßen nach Einbruch der Dunkelheit. Und niemand achtet groß auf ein im Unkraut vertäutes Boot, eine der alten Red-Hook-Geschichten aus der versunkenen Welt der Hafenarbeiter.
Aber dieses verrottende Fischerboot hat nie einem der Typen gehört, die sich im VFW oder in der letzten noch existierenden Hafenkneipe treffen. Es hat Crees Vater Marcus gehört, einem Gefängniswärter, der es auf einem Schrottplatz in Jersey gekauft hatte. Später wurde es an Land gebracht, nachdem Marcus von einer Kugel getroffen worden war, die niemand Bestimmtem gegolten hatte – ein Kollateralschaden im mittlerweile ruhenden Drogenkrieg. In Crees Augen gehört das Boot jetzt ihm.
Crees Mom Gloria glaubt, dass Marcus’ Geist sich noch bei der Bank im Hof aufhält, wo ihr Mann gestorben ist. Oft lässt sie sich dort mit einer Thermoskanne Eistee nieder. Aber Cree weiß es besser. Kein Geist, schon gar nicht der seines Vaters, würde um eine Bank herumspuken. Ein Kapitän kehrt immer zu seinem Schiff zurück. Cree hofft, dass er das Boot irgendwann wieder zu Wasser lassen und mit Marcus weiter hinausfahren kann, als dieser zu Lebzeiten je gekommen ist.
In manchen Nächten redet Cree sich ein, er könne die schattenhafte Gestalt seines Vaters durch das Unkraut stapfen und an Bord steigen sehen. Er stellt sich vor, wie Marcus in das kleine Deckshaus schlüpft und ans Steuerrad tritt. Dann tut er so, als würden sie zusammen durch die Upper Bay nach New Jersey fahren, wo sie einmal durch die Kopfsteinpflasterstraßen eines anderen verlassenen Hafenviertels gewandert sind. Der gleiche Geruch nach Schlick und Wasser hing dort in der Luft, und der Wind peitschte die leer stehenden Gebäude mit dem gleichen Geräusch. Aber im Hafengebiet von Jersey gab es keine Projects, und niemand warf ihnen Blicke zu, die ihnen sagten, dass sie nicht hierhergehörten.
Auf der Rückfahrt nach Red Hook hat Cree versucht, über die Upper Bay hinweg seinen Wohnblock in der grauen Masse Brooklyns auszumachen. Seltsam, dass der Ort, an dem er wohnte, schon nach einem so kurzen Trip für ihn nicht wiederzuerkennen war. Als hätte er nichts mit ihm zu tun.
Heute kann sich Cree nicht genug konzentrieren, um Marcus zu beschwören. Vielleicht haben ihn auch die Mädchen vertrieben. Cree springt vom Bug des Bootes ins staubige Gras, nimmt Eimer und Angelrute, die er daneben deponiert hat, und macht sich auf den Weg. Seine Schritte verdrängen die Echos, die Val und June hinterlassen haben.
Er geht langsam, mit hängenden Schultern, als wäre die Schwerkraft zu stark. Am Ende der Columbia Street steigt ihm der Geruch des Wassers in die Nase, eine Mischung aus Diesel und Fisch. Er betritt den Pier, der in stumpfem Winkel ins Erie Basin ragt. Er passiert die beschlagnahmten Autos auf dem Polizeigelände und geht bis zu der Stelle, wo der Pier Richtung Ufer abknickt. Er setzt sich hin, lässt die Beine über dem Wasser baumeln und schaut über die hier vertäuten Schlepper hinweg zu der aufgegebenen Schiffswerft und der Ruine der Zuckerraffinerie hinüber, die bereits vor seiner Geburt abgebrannt ist.
An diesem Ort entsteht in ihm das Gefühl, das er so mag: Als befände er sich am Ende der Welt, als ginge es hier nicht mehr weiter und als würde ihn niemand je finden. Das Scheppern der Bojen, das Plätschern des Wassers, das Fehlen von Stimmen und Straßenlaternen und der riesige Mond, der alles in sein Licht taucht – das alles ist so weit weg von der Stadt, wie Cree es sich nur vorstellen kann. Von hier kann er auf sein Viertel schauen, ohne es zu sehen.
Früher, wenn sein Vater mit ihm in die Bucht hinausgefahren ist, hat er oft von den Orten geträumt, an die das Wasser ihn führen könnte. Aber in letzter Zeit fällt es ihm schwer, sich die Welt jenseits der beiden Brücken vorzustellen, die seinen Horizont begrenzen: der Verrazano Bridge mit dem Zwillings-M und der Bayonne Bridge mit ihrem Buckel.
Er wirft die Leine aus. Hier draußen hat er bereits Bekanntschaft mit der verborgenen Nachtseite von Red Hook gemacht. Er hat gesehen, wie ein brennendes Auto ins Wasser geschoben wurde, und er könnte schwören, einen abgetrennten Arm vorübertreiben gesehen zu haben, verschrumpelt und blau, einem Meerestier ähnlich. Er hat gesehen, wie Leute Fische fingen und sie in einer rostigen Mülltonne brieten. Er hat Frauen gesehen, die in einem Ruderboot Freier abfertigten, und er hat zwei Asiaten in Neoprenanzügen mit Harpunen schnorcheln sehen. Er hat alle möglichen aus Treibholz und irgendwelchen Brettern zusammengezimmerten Wasserfahrzeuge gesehen.
Er zieht die Angelschnur durchs Wasser, weg von einem am Pier schaukelnden Geflecht aus Tang und Müll. Seinen Fang wirft er stets ins Wasser zurück. Diesmal aber haben die Fische sich für die Nacht freigenommen, und das Wasser sieht schmutzig und träge aus. Schmieriger Schaum bedeckt die Felsen zu Crees Füßen. Selbst die Schlepper klingen traurig, ihre Maschinen stottern, finden keinen Rhythmus.
Doch wo nur die Geräusche des Wassers und das Tuckern der Schlepper hätten sein sollen, hört Cree Stimmen. Er holt die Leine ein und stellt sich vor, Val und June seien in der Nähe und hielten ihn zum Narren. Er steht auf und vollführt eine halbe Drehung, als würde er zu einem Sprungwurf ansetzen. Dann sind die Stimmen wieder weg, und er steht da, starrt ins Dunkel und fragt sich, ob er überhaupt etwas gehört hat.
Die Mädchen wählen eine Stelle zwischen dem Beard Street Pier und der verfallenen Fabrik, wo ein Zweimastsegler allmählich im trüben Hafenbecken versinkt. Das Wasser ist schmutzig, und sie sind nicht die besten Schwimmerinnen, aber das stört sie nicht. Auch nicht, dass sie mit den Händen durch die Brühe paddeln müssen. Sie wollen diesen Pier und auch die nächsten beiden umrunden, um schließlich an dem kleinen Strand beim Valentino Pier an Land zu gehen. Eine halbe Stunde, länger dürften sie nicht dafür brauchen.
Es ist stockdunkel am Wasser. Ihre Schritte hallen von den Lagerhäusern wider. Von zu Hause bis hierher sind es nur zehn Minuten, aber sie waren noch nie nachts in dieser Gegend. Und an diesem Abschnitt des Ufers waren sie überhaupt noch nie. Bis das Wasser in Sicht kam, haben sie sich eingeredet, die Warnungen ihrer Eltern seien kompletter Blödsinn, aber jetzt scheint sich in jedem dunklen Winkel etwas zu verbergen, etwas, das Schutt und Müll verstreut. Wie sollten sie auch die Einzigen hier sein? Bestimmt lauert jemand hinter der gesprungenen Windschutzscheibe des verrosteten Kombis, bestimmt beobachtet sie jemand aus der Ruine der Zuckerraffinerie.
Das Ufer ächzt und kommt wieder zur Ruhe – das Knarren von moderndem Holz ist ein geisterhaftes Stöhnen, das rhythmische Anstoßen eines Bootes am Pier sind näher kommende Schritte.
Etwas rasselt die verfallene Schütte der Raffinerie hinunter und plumpst ins Wasser. Die Mädchen fassen sich an den Händen und fangen an zu singen, machen Lärm, wollen übertönen, was da heruntergefallen ist, versuchen das Dunkel zu bezwingen. Aber das Backsteinlagerhaus und das Hafenbecken werfen ihren Gesang zurück und verzerren ihre Stimmen, sodass sie ihnen selbst fremd vorkommen.
June zeigt auf die Raffinerie. »Ich hab gehört, da spukt’s. Bestimmt ist da jemand drin und beobachtet uns.«
Val wirft einen Blick auf das Skelett der Fabrik.
»Die Gespenster sollten sich besser nicht mit uns anlegen«, sagt June.
»Willst du umkehren?«, fragt Val. In der Raffinerie regt sich etwas, sie ist sich ganz sicher. Irgendetwas – irgendjemand – klappert unter dem hohen Stahlgewölbe.
»Nee.« June dreht dem Gebäude den Rücken zu, aber Val kann den Blick nicht abwenden. Sie sieht genau hin, will wissen, ob die Schütte schwankt.
Die Mädchen drehen auf, singen lauter. Auf Zehenspitzen überqueren sie die mit grünem Flaum überzogenen Felsen und lassen das Boot zu Wasser. June tritt zurück. »Du zuerst.«
Val schüttelt den Kopf.
»Dein Boot. Deine Idee.«
Val geht in die Hocke, versucht, nicht die Steine zu berühren, und lässt sich rückwärts ins Boot fallen. Es sinkt unter ihrem Gewicht ein, und öliges Wasser überspült sie. »Ääh!«
June kneift die Augen zusammen und verzieht das Gesicht, dann steigt sie hinter Val ins Boot. Es taucht unter, und die Mädchen werden bis zur Brust durchnässt. »Verdammt, ist das kalt.« June schüttelt sich, als könnte sie so dem Nass entkommen, und bringt das Boot damit beinahe zum Kentern. Dann richtet es sich wieder auf und balanciert sich aus. Und sie schwimmen.
Das Wasser ist kühl und schleimig. Die Mädchen paddeln mit den Händen, kräftig und ungleichmäßig, schieben den Müll weg, der auf sie zutreibt, und versuchen, nicht in das Dunkel unter der bröckelnden Zuckerfabrik zu schauen. Das Boot schwingt dicht an das halb versunkene Segelboot heran, und die Mädchen paddeln wie wild, um das, was mit dem Boot untergegangen ist, nicht herauszufordern. Das Wasser riecht faulig.
Irgendetwas zieht von unten an ihrem Schlauchboot und versetzt es ins Kreiseln.
»Was ist das?«, fragt Val. Sie spürt, wie das Boot in der Mitte einknickt. Sie hört auf zu paddeln, wartet, bis sich die rosa Gummifläche wieder glättet.
»Das ist wie eine Wasserrutsche«, antwortet June mit zusammengebissenen Zähnen.
»Genau, wie in Coney Island.« Val sucht das Ufer ab, das hinter ihnen rasch zurückweicht.
Mit steifen Fingern klammern sich beide Mädchen an das Boot, nicht bereit loszulassen, außerstande, sich aus dem Strudel zu befreien.
»Pass auf, dass deine Fingernägel kein Loch reinreißen«, sagt Val. Inzwischen sind sie weit draußen, zu weit von der trügerischen Geborgenheit des Ufers entfernt. »Wir müssen paddeln.«
Sie lösen die Hände vom Boot, schlagen wieder ins Wasser. Endlich haben sie den Pier hinter sich und können ihre Arme ausruhen. Sie treiben ins Hafenbecken, wo das Wasser einem gleichmäßigen Rhythmus folgt. Der Mond scheint wie verrückt. Das Boot wird von Welle zu Welle weitergereicht. Links glitzert Staten Island, dessen Häuser die Hügel in rot-weiß-grünes LCD-Licht tauchen. Tanker liegen wie leuchtende Inseln in der Bucht, schwer und reglos. Die Kräne im Hafen von New Jersey sehen aus wie aus einem Jurassic-Fantasyland.
Ein Schlepper fährt vor ihnen vorbei. Die Mädchen schreien auf, beugen sich vor und versuchen das Gleichgewicht zu halten, um nicht von seinem Kielwasser überspült zu werden. Kleine Wellen schwappen ihnen über Beine und Bauch.
So wild hat Val sich die Fahrt nicht vorgestellt. Die Silhouetten von Jersey und der Stadt ragen ringsum auf, das Wasser dehnt sich weit und dunkel. Aber es ist die Stille – nur hin und wieder unterbrochen vom Ruf eines Nebelhorns, vom Brechen einer Welle zwischen den Pfählen, vom rhythmischen Stampfen eines Schiffs irgendwo weiter draußen –, die ihr zusetzt.
Sie treiben am Wrack eines Schleppers vorbei. In einem seiner versunkenen Fenster ist der Mond gefangen, dessen Widerschein sich durchs dunkle Wasser kämpft. Wieder umklammern die Mädchen den Rand des Bootes. Die Bullaugen starren sie mit leerem Blick an. Eine neue Dünung bewegt das Wasser, ein tiefes, beharrliches Ziehen. Wenn Val ausblenden könnte, wie tief die Bucht ist, wäre sie bereit, dieser Strömung überallhin zu folgen.
»Wir könnten ewig so weiterfahren«, sagt sie und dreht sich zu June um. June hält sich nicht mehr fest. Sie lässt die Hände durchs Wasser gleiten. Kleine Wellen kräuseln sich von ihren Fingern fort.
Als sie einen weiteren Pier umrunden, ragt über dem schwarzen Buckel von Governors Island plötzlich die Skyline von Manhattan auf. Die Gebäude kratzen am Himmel, als suchten sie verzweifelt zu entkommen. Die frische Strömung des Buttermilk Channel zieht die Mädchen vorwärts, aber es kommt ihnen vor, als würden sie von der City eingesogen.
»Da gehören wir hin«, sagt June. Sie hebt die Arme und schnippt mit den Fingern. »Wird auch Zeit.«
»Hör auf damit«, sagt Val. Sie schaut nicht zur City hinüber, sondern betrachtet deren Spiegelung, die sich vor ihnen auf dem Wasser entfaltet. »Hör auf.«
Cree versteckt Eimer und Leine und macht sich am Ufer entlang auf den Weg. An der Raffinerie geht er unter der Schütte durch, über die einst Zuckerrohrreste ins Wasser gekippt wurden. Er umrundet den Beard Street Pier und balanciert über die spitzen Felsen am Ende. Von dort sieht er das rosa Schlauchboot mitten in der Bucht auf den Wellen schaukeln.
Die Stimmen der Mädchen dringen herüber, ihr Lachen setzt das einsame Wasser unter Strom. Mit ihrem Spielzeugboot erobern sie das düstere Hafenbecken, erkunden Strömungen und Tiefen, die Cree seit dem Tod seines Vaters verschlossen sind. Er fragt sich, wie weit sie sich vorwagen werden.
Sie umrunden den nächsten Pier und schaukeln außer Sicht.
Cree klettert rasch weiter. Er möchte die Mädchen nicht aus den Augen verlieren. Irgendwo draußen in der Bucht zerreißt ein Nebelhorn die Stille. Sein tiefes Stöhnen läuft wie ein Schaudern übers Wasser.
Zwischen den nächsten beiden Piers ragt eine Felsnase ins Wasser. Ein großes Lagerhaus versperrt Cree den Blick. Er stolpert und schlägt sich an einem Betonpfeiler das Knie auf. Zwischen den Felsen stehen Pfützen. Cree hält seine Hand über die Wunde, um sie vor dem schmutzigen Schaum zu schützen.
Auf dem nächsten Pier hört er die Mädchen wieder. Ihre Worte sind kaum zu verstehen. Dann taucht das Schlauchboot auf, treibt Richtung Manhattan. Cree macht kehrt und rennt zum Valentino Pier, der mittlerweile zu einer Uferpromenade für alte Fischer und junge Paare geworden ist. Zu dieser späten Stunde wird er ihn für sich allein haben.
Das Boot kommt näher, und er hört die Mädchen erneut. Er durchquert den kleinen Park, der zum Pier führt, und läuft bis ans Ende des Betonwegs. Das Boot fährt an ihm vorbei, die Mädchen zwei dunkle Silhouetten vor den fernen Docks von Jersey.
Dann sind sie verschwunden.
zwei
Hätte man Jonathan Sprouse danach gefragt, hätte er sein Leben als Erdrutsch, als eine einzige Serie von Talfahrten bezeichnet. Sein bestes Jahr hatte er mit zwölf, als er für die Hauptrolle in einem Broadwaymusical ausgewählt wurde, einem glitzernden Mix aus Grimms Märchen. Es wurde ein Flop, eines jener spektakulären Great-White-Way-Desaster, die es einen Lidschlag lang auf die Titelseiten schaffen, wenn die ganze Stadt wie gebannt das Spektakel einer angekündigten Show verfolgt, die dann noch vor der Premiere abgesetzt wird.
Im Jahr nach diesem Beinahe-Erfolg wurde Jonathan vom potenziellen Broadwaystar zum unbedeutenden Chorsänger. Später folgte der Abstieg von der Juilliard School auf eine staatliche Highschool für darstellende Künste, von der Carnegie Hall in ständig wechselnde Übungsräume. Nach dem College zog er von der Upper East Side auf die Lower East Side, dann von Brooklyn Heights nach Red Hook, ein Viertel, das unter dem Meeresspiegel liegt und weiter absinkt.
Als Kind hätte er sich nie vorstellen können, später einmal nicht erfolgreich zu sein. Sein Vater Donald Sprouse hatte genug Geld, um Häuser in den ersten Seebädern und Wintersportorten zu sammeln und sich Jonathans Mutter, einen angesehenen Broadwaystar, zu angeln. Eden Farrow verlieh einer Premiere zwar nicht den Glanz einer Bernadette Peters oder einer Patti LuPone, aber niemand beklagte sich, als sie in die Fußstapfen der beiden trat, nachdem sie ihre Laufbahnen beendet hatten.
Das Familienvermögen der Sprouses sowie Edens bescheidene Berühmtheit verschafften Jonathan Einladungen zu wichtigen Castings und weckten das Interesse einiger Konservatorien. Er hatte die besten Gesangs- und Musiklehrer. Zu den Castings erschien er in einem Matrosenanzug, den seine Mutter in der Lexington Avenue hatte maßschneidern lassen, mit dazu passender Mütze.
Als Jugendlicher war er weniger für sein Talent bekannt gewesen als vielmehr für die häufige Abwesenheit seiner Eltern und deren weitläufige Wohnung. Die Sprouse-Farrows hatten eine gut bestückte Bar und einen wohlgefüllten Kühlschrank, und der Doorman ließ sich mit einem Hunderter problemlos schmieren. Alkoholische Getränke für Jonathans minderjährige Freunde wurden über den Dienstboteneingang angeliefert. Jonathan gehörte zu den New Yorker Kids, die jeder kennt. Er hatte Kumpels sowohl unter der Upper-West-Elite als auch unter den Village-Kids und sogar den Jungs aus Harlem ein paar Blocks weiter nördlich, die er der bunten Mischung halber ins Penthouse der Familie einlud.
Obwohl seine kurze Broadwaykarriere im Sande verlaufen war, nahm Jonathan noch mit Anfang zwanzig an Castings teil: Klassik, Jazz, Off-Broadway. Er war ein Ersatzmann, der nie eingesetzt wurde. Das Konservatorium hielt er nicht durch. Die Castings hörten auf. Edens Agent ließ ihn fallen. Er sang in einigen Bands und spielte Keyboard. Er war Teil eines Quartetts, das im New Yorker besprochen wurde. Doch dann starb Eden – oder weil Eden starb, trennte sich das Quartett von ihm. Jonathan floh aus dem Rampenlicht, das ihn für kurze Zeit anzustrahlen gedroht hatte.
Nach Edens Tod legte er den Namen seiner Mutter ab und nannte sich wieder Sprouse. Er unterrichtete an der Carnegie Hall, wo er einst Schüler gewesen war. Er unterrichtete an einer privaten Highschool in Lower Manhattan. Er unterrichtete verwöhnte Kinder zu Hause. Er unterrichtete das Fach Jazzband an einer staatlichen Schule, an der es nicht genug Instrumente für alle gab.
Seit er nach Red Hook gezogen ist, gibt er Musikunterricht an der St. Bernardette’s, einer katholischen Mädchenschule knapp außerhalb des Viertels. Außerdem hat er jeden Freitagabend einen Gig in einer schwulen Pianobar in der City, wo er Musicalnummern herunterhämmert, begleitet von einer Dragqueen, die sämtliche Trinkgelder einheimst. Ab und zu schreibt er Werbejingles für Billigmarken. Er ist ein Commercial-Erfolg, sagt er sich.
Manchmal besuchen ihn alte Bekannte aus seiner Highschool-, Konservatoriums- und Broadwayzeit. Sie wissen, dass die Dealer in dieser Gegend lange aufbleiben und Jonathan ihre Telefonnummern hat. Sie lungern bei ihm herum, warten auf ihre Lieferung und tun so, als wären sie seinetwegen gekommen.
Sein Einzimmerapartment liegt direkt über der Dockyard Bar mit ihren ungesunden Öffnungszeiten. Er hat die Wahl: Entweder bekommt er den Lärm durch die losen Dielenbretter gefiltert oder aus erster Hand in der Bar mit.
Eigentlich wollte er nur auf ein paar Drinks im Dockyard vorbeischauen, aber inzwischen ist er von einem guten Platz in der Mitte der Bar in eine dunkle Ecke gewandert und von teurem Whisky zu Fusel übergegangen. Anfangs hat er mit den Stammgästen gelacht, jetzt lachen sie über ihn. Lil, die Barfrau, fordert ihn immer wieder auf, den Mund zu halten. Schon mehrmals hat sie ihm nahegelegt, nach Hause zu gehen, dabei ist es erst ein Uhr.
Jonathan kann sich nicht erinnern, wann der Abend aus dem Ruder gelaufen ist. Vielleicht hat er sich abfällig über Lils Honky-Tonk-Musik geäußert. Lil ist etwas zu alt für den Job hier. Ihr Haar ist feuerrot gefärbt, und ihre verblassten Tattoos sehen aus wie blaue Flecken. Ihre grauen Augen verengen sich mit fortschreitender Nacht zu Schlitzen. Bei Kneipenschluss sehen sie aus wie zwei Schraubenköpfe.
Der Sex mit Lil war nichts Weltbewegendes gewesen und gehörte zu der Art nächtlicher Irrtümer, von denen Jonathan einfach nicht loskommt. Irgendwie erinnerte ihn die ganze Sache an eine Pferderennbahn: das Klappern von Lils Cowboystiefeln, das Klatschen seiner Hand auf ihre üppige Flanke, ihr erschöpftes Wiehern danach.
Die Wände des Dockyard sind mit Bojen, Rettungsringen und unscharfen Fotos von Dampfern und Schleppern gepflastert. Aufgerollte Seile hängen neben kaputten Hummerfallen, Fliegen und Schnüre neben Ködern und anderem Angelgerät. Die ausgestopften Forellen und Barsche haben keine Augen und verlieren Schuppen. Die Bar soll ein Ort der Nostalgie sein, eine Erinnerungsstätte für das vor Leben sprühende Hafenviertel von einst, aber in Wahrheit ist sie ein Schiffswrack. Mit ihren grünen Lichterketten sieht sie aus, als wäre sie im schmutzigen Hafenbecken ein paar Straßen weiter versunken. Die gesprungene Schiffsuhr hilft den Stammgästen, die Zeit zu vergessen und weiterzutrinken.
Spitznamen spielen hier eine große Rolle. Es hat ein paar Wochen gedauert, bis Jonathan wusste, wer wer ist. Da gibt es Guitar Mike und Biker Mike, Whisky Bill und Pirate Bill, Old Steve und New Steve. Von den Frauen hat keine einen Spitznamen.
Jonathan wird von allen »Maestro« genannt, doch er bezweifelt, dass irgendjemand glaubt, er würde tatsächlich Musik schreiben. Aber eines Tages wird er sie alle überraschen. Er hat den Kopf voller Riffs, die aus den Geräuschen der Umgebung entstanden sind. Meist beruhen sie auf etwas Einfachem, den quietschenden Türangeln des Dockyard etwa, dem einsamen Schwirren der Telefondrähte in der Van Brunt, dem ungleichmäßigen metallischen Scheppern, wenn ein Fahrrad mit lockeren Schutzblechen über das Kopfsteinpflaster fährt.
In Red Hook vergehen die Tage wie Kompositionen. Mal sind es Fugen, mal Sonaten. Die wildesten Tage – wenn es vom Atlantik her stürmt und das Wasser bis in die Van Brunt steigt – sind natürlich Sinfonien. Aber Jonathan versucht gar nicht erst, das den Stammgästen der Bar zu erklären.
Lil gibt sich zugeknöpft, kramt in ihren Schallplatten, ignoriert die Zeichen, die er ihr macht. »Ich dachte, du gibst heute mal Ruhe, Maestro«, sagt sie. Sie schenkt ihm nicht nach. »Hab ich jedenfalls gehofft.«
»Es ist zu heiß, um raufzugehen«, antwortet er. »Ich hab mir gedacht, ich bleib hier und bezahl dich dafür, dass du mit mir plauderst.«
Lil trägt ein Schnapsglas an einer Kette um den Hals. Bei der Arbeit baumelt es gegen ihre Brüste. Anstelle von Trinkgeld können die Gäste ihr einen Schnaps spendieren – die beste Methode, ihre Gunst zu gewinnen.
Jonathan greift nach dem Glas. »Ich geb dir einen aus.«
Lils T-Shirt ist feucht vom Tresenwischen und Gläserspülen. Sie macht sich los. »Nein danke, Mister.«
»Ist mein Geld nicht gut genug?«
»Lass dein Geld an der Bar.«
Er nervt Lil in letzter Zeit häufig, besonders wenn er charmant sein will. »Ich dachte, einen Gratisdrink lehnt hier niemand ab. Der Schnaps hält dich doch bei der Stange, damit du uns bei Laune hältst.«
»Du redest zu viel, Jonathan.«
Er legt einen Zwanziger neben sein Glas, um ihr zu zeigen, dass es ihm ernst ist.
Die Bar ist voll, trotz der Hitzewelle. Einige Gäste sind alteingesessene Bewohner des Viertels, knorrige Typen, Kriminaler im Ruhestand. Aber die meisten sind neu hier, Künstler, Köche und der eine oder andere Handwerker. Männer mit Baseballmützen von Verlierermannschaften. Frauen in Clogs oder Cowboystiefeln. Heute Abend sind jede Menge Frauen da. Sogar im Hochsommer tragen sie Cowboystiefel. Jonathan fühlt sich alt, wenn er sie so sieht, dabei ist er noch keine dreißig.
Er hat versucht, sich mit einigen dieser Frauen zu unterhalten, aber inzwischen halten sie Abstand. Er weiß nicht recht, was schiefgelaufen ist. Vielleicht waren sie sauer, als er eine Runde ausgegeben und behauptet hat, Frauen würden Whisky nur trinken, um Männer zu beeindrucken. Jetzt schauen sie demonstrativ weg. Seit einem Jahr beobachtet er sie, registriert ihre verstrubbelten Kurzhaarfrisuren und ihre neuen Tattoos. Er sieht, dass sie mehr trinken und weniger schlafen als früher und sich an den toughen Posen des alten Hafenviertels versuchen.
Je später der Abend, desto grungyer und sexyer werden die Frauen. Schon bald haben sie keine Ähnlichkeit mehr mit den Pendlerinnen, die sich montagmorgens in die Bushäuschen an der Van Brunt quetschen, geschniegelt und gebügelt, halbwegs präsentabel für die Welt außerhalb Red Hooks. Die Nacht verschleißt sie, zerzaust ihre Haare, bricht ihre Nägel ab. Färbt ihre Sprache. Nachts sieht man, dass sie Hunderte solcher Nächte hinter sich haben. Ihre hohlen Wangen und ihr schnelles Sprechen verraten es. Jonathan fragt sich, wie lange es dauert, bis ihre Verkleidungen zu ihren Kleidern, ihre Tattoos zu ihren Muttermalen werden. Wann wird ihnen die Außenwelt entgleiten, wann werden sie vergessen, sie zurückzuholen?
Der neue Drink schlägt ihm schnell auf den Magen, ein Zeichen dafür, dass er Schluss machen sollte. Um wieder nüchtern zu werden, dreht er eine Runde durch die Bar. In der Nische ganz hinten sitzen zwei Betrunkene. Einer von ihnen ist bereits seit der Happy Hour weggetreten. Die Stammgäste verzieren sein Gesicht und seine Kleider abwechselnd mit Filzmarker. Jemand knöpft sein Hemd auf und zieht zwei Kratzspuren über seine Brust.
»Hast du nen Song für uns, Maestro?«, fragt eine Frau, doch bevor er antworten kann, wendet sie sich ab.
Er lässt sich auf ein Knie nieder und nimmt ihre Hand. Sie will sich losmachen, aber er hält sie fest. Der Song, der ihm in den Sinn kommt, ist Irving Berlins Let’s Face the Music and Dance. Die anderen lachen über ihn, aber das kümmert Jonathan nicht. Er singt laut, übertönt den Rockabilly aus den Lautsprechern. Er wirft den Arm zurück und trifft eine der Frauen in den Bauch. Eine raue Hand schließt sich um sein Handgelenk. Lils fester Griff fühlt sich gut an. »Raus«, sagt sie.
Sie bringt ihn die paar Meter bis zu seiner Haustür und überzeugt sich davon, dass er auch wirklich hineingeht. Jonathan bleibt in der Tür stehen und lauscht dem rhythmischen Klappern ihrer Cowboystiefel auf dem Asphalt. Zu heiß. Zu spät.
Oben öffnet er das Fenster, lässt die verrauchte Luft hinaus und mit den nächtlichen Geräuschen noch mehr Hitze herein. Auf dem Boden liegen die Storyboards für einen neuen Werbespot, Schwarz-Weiß-Zeichnungen tanzender Softdrinkdosen, die auf eine Melodie warten.
Er zündet sich eine Zigarette an, stützt sich mit den Ellenbogen aufs Fensterbrett und bläst den Rauch in die stickige Luft hinaus. Vor ein paar Tagen kam ihm in der Pianobar im West Village eine Idee für den Jingle. Die ersten Takte entstanden in dem Augenblick, als Dawn Perignon, seine Dragqueen-Partnerin, ungeniert die Konturen ihrer Lippen mit einem colafarbenen Stift nachzog und dann mit Kirschgloss ausfüllte. Er warf rasch ein paar Noten auf eine Serviette und steckte sie ein.
Da Jonathan nur schwarze Jeans trägt, findet er nicht gleich die Hose, die er an dem Abend getragen hat. Er stülpt die Taschen seiner gesamten Garderobe nach außen. Er fördert Streichholzbriefchen zutage, Telefonnummern von Frauen, die er nicht anzurufen gedenkt, und ein paar zerknüllte Servietten aus dem Cock ’n Bulls, auf die aber nur Strichmännchen gekritzelt sind.
Er legt sich aufs Sofa und sieht sich die Storyboards an. Das Einzige, was ihm dazu einfällt, ist Karussellmusik, wie man sie auf Rummelplätzen hört.
Er greift zum Telefon und ruft Dawn an, in der Hoffnung, ihre Stimme könnte ihm in Erinnerung rufen, wozu ihre zweifarbigen Lippen ihn inspiriert haben.
Nach dem dritten Klingeln meldet sie sich. Im Hintergrund dröhnt House.
»Hallo?«
Jonathan ist immer wieder überrascht, dass Dawn abseits der Bühne mit ganz normalem Jersey-Akzent spricht. Sie hat eine tiefe Stimme voller Gutturallaute und schwerer Konsonanten, ganz anders als ihr melodischer Tonfall auf der Bühne.
»Hallo? Sagst du vielleicht mal was?«, blafft Dawn ins Telefon, dann schaltet sie auf ihre Bühnenstimme um. »Jonathan, Baby, hat’s dir die Sprache verschlagen?«
»Vergiss es, Dawn. Ich hatte nur eine Frage. Ist nicht wichtig.«
»Sag bloß, das ist ein Booty Call, nach all den Jahren. Bist du einsam heut Nacht?«
»Ach, leck mich.«
»Mit Vergnügen.«
Jonathan legt auf. Er hat sich schon immer gefragt, ob Dawn nicht ein bisschen scharf auf ihn ist.
Er schaut zu der Bodega hinüber, die dem Libanesen gehört. Hätte sie nicht geschlossen, würde er jetzt rübergehen. Er drückt seine Zigarette aus und schnippt sie auf die Straße, nimmt zwei Tylenol PM und spült sie mit Whisky hinunter. Dann legt er eine Calypso-Platte auf; vielleicht lassen sich die tanzenden Dosen ja von den tropischen Rhythmen inspirieren.
Jonathan wacht meist auf, wenn es unten im Dockyard ruhiger wird. Der Lärm fließt nach und nach auf die Straße ab, und dann ist Lil allein in der Bar, das weiß er. Sie stellt die Musik leiser, und er hört sie hin und her gehen, während sie Gläser abräumt und den Tresen wischt.
Lil singt nach Kneipenschluss – ein einsamer Auftritt vor halb leeren Flaschen und überquellenden Aschenbechern. Sie hat eine ganz gute Stimme mit einem etwas angerauten Südstaatenakzent. Jonathan sieht sie vor sich, wie sie an der Bar sitzt, die Füße auf einem Hocker, und den vergilbten Seekarten und Fotos alter Kapitäne ein Ständchen bringt.
Sie hört auf zu singen, geht hinaus und zieht den Metallrollladen herunter. Das Vorhängeschloss knallt dagegen.
Jonathan steckt den Kopf aus dem Fenster. »Hey, Lil!«
»Du bist noch auf?« Sie hat eine Whiskyflasche in der Hand.
»Wollen wir uns die teilen? Ich könnte ein bisschen Inspiration gebrauchen.«
Lil hält die Flasche am Hals und schwenkt sie wie ein Pendel hin und her. »Ich teile meine Inspiration nicht mit dir.«
Jonathan sieht ihr nach. Es ist Viertel nach fünf. Um diese Zeit geben die vier Läden an der Kreuzung Van Brunt und Visitation – zwei Bodegas, ein Schnellimbiss und das Dockyard – ihr tägliches Öffnungs- und Schließkonzert, und das Scheppern und Knirschen des Metalls begrüßt den neuen Tag.
Der Grieche kämpft bereits mit seinen Metallrollläden. Er hat den kleinen Penner aufgeschreckt, der im Eingang seines Lokals zu schlafen pflegt. Der Penner lässt ihn nicht aus den Augen. Ein Rollladen klemmt – rechts lässt er sich nicht weiter als einen Meter hochschieben. Der Grieche rüttelt daran. Der Penner schlurft hin und her, will helfen. Er bricht einen toten Zweig von einem Baum und hält ihn dem Griechen hin.
Jonathan hat noch nie bei dem Griechen gegessen. Ehemalige Hafenarbeiter verkehren dort, Nachtschichtpersonal von der Mautstelle am Tunnel und die ersten Patienten der Methadonambulanz.
Die Stimme des Penners dringt an Jonathans Ohr – misstönend, Dur und Moll, die Worte sind kaum zu verstehen. Der Mann wirkt erwartungsvoll, bereit, irgendwelche Hilfsarbeiten zu erfinden, um sich dann vom Griechen dafür bezahlen zu lassen, dass er verschwindet. Der Grieche rüttelt ein letztes Mal an dem Rollladen, dann geht er hinein und wirft den Grill an, macht Kaffee und legt den Hackbraten von gestern ins Fenster.
Jonathan lässt das Rollo herunter, aber nur so weit, dass das Licht schräg ins Zimmer fallen kann, wenn es Tag wird.
Zum Schlafen ist es zu spät. Der erste Morgenbus rumpelt über die holprige Straße, nimmt jedes Schlagloch mit und jeden Riss, der durch die neuen Abwasserrohre entstanden ist.





























