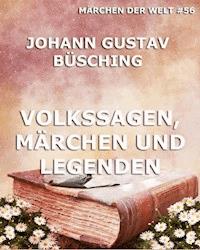
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erleben Sie die Märchen und Sagen aus aller Welt in dieser Serie "Märchen der Welt". Von den Ländern Europas über die Kontinente bis zu vergangenen Kulturen und noch heute existierenden Völkern: "Märchen der Welt" bietet Ihnen stundenlange Abwechslung. Ein Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis dieses Buches: Vorwort. 1. Geschichte des Grafen Walther und der Helgunda. 2. Die heidnische Jungfrau im Schlosse zu Glatz. 3. Die große Linde bei Eisersdorf in der Grafschaft Glatz, nicht weit von der Stadt Glatz. 4. Das Bild des Bären und der Jungfrau auf dem Zobtenberge. 5. Das Bild des Mönchs und Wolfs an dem Fuß des Zobten. 6. Wie das Kloster Trebnitz von Heinrich I., Herzoge von Schlesien, erbaut worden und seinen Namen erhielt. 7. Die Ermordung der Tartarischen Kaiserin zu Neumarkt im Jahre 1240. 8. Fräulein Kunigunde von Kynast. 9. Das Innere des Zobtenberges. 10. Erzählungen vom Rübezahl. 11. Der diebische Rathsherr zu Schweidnitz. 12. Die beiden steinernen Bilder beim alten Rathhause zu Breslau. 13. Die Gott geweihte Nonne zu Löwenberg. 14. Die große Braupfanne beim Dorfe Warthau. 15. Rechenberg's Knecht. 16. Der schwarze Friedrich zu Liegnitz. 17. Libussa. 18. Wlasta. 19. Das Roß des Horymirz. 20. Die verrätherischen Weiberohren. 21. Der ungetreue Vormund. 22. Der Heilige im Walde. 23. Die Strafe des Gottesläugners bei Altbunzlau. 24. Die Erscheinung des heiligen Mathias. 25. Das verborgene Schloß im Walde. 26. Die entführte Nonne. 27. Der Böhmische Zauberer Zython. 28. Junker Ludwig bei Eger. 29. Die weiße Frau. 30. Die Jungfrau auf dem Schloß Parenstein in Mähren. 31. Die Braut Christi zu Groß-Wardein in Ungern. 32. Schloß Greifenstein. 33. Die Gründung des Klosters Schlägel. 34. Der wandelnde Geist zu Rauhenek. 35. Der große Stein bei Görlitz. 36.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 450
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Volkssagen, Märchen und Legenden
Johann Gustav Büsching
Inhalt:
Johann Gustav Büsching – Biografie und Bibliografie
Bibliographie der Sage
Vorwort.
I. Schlesische Sagen und Mährchen.
1. Geschichte des Grafen Walther und der Helgunda.
2. Die heidnische Jungfrau im Schlosse zu Glatz.
3. Die große Linde bei Eisersdorf in der Grafschaft Glatz, nicht weit von der Stadt Glatz.
4. Das Bild des Bären und der Jungfrau auf dem Zobtenberge.
5. Das Bild des Mönchs und Wolfs an dem Fuß des Zobten.
6. Wie das Kloster Trebnitz von Heinrich I., Herzoge von Schlesien, erbaut worden und seinen Namen erhielt.
7. Die Ermordung der Tartarischen Kaiserin zu Neumarkt im Jahre 1240.
8. Fräulein Kunigunde von Kynast.
9. Das Innere des Zobtenberges.
10. Erzählungen vom Rübezahl.
1. Rübezahl verwandelt sich in einen Esel.
2. Rübezahl narrt einen Junker.
3. Rübezahl verkauft Schweine.
4. Rübezahl zaubert etlichen Kuh- und Ochsenköpfe an.
5. Rübezahl läßt ein Kleid machen.
6. Rübezahl wird ein Holzhacker.
7. Rübezahl verwandelt sich in einen Botenspieß.
8. Rübezahl verwandelt Blätter in Dukaten.
11. Der diebische Rathsherr zu Schweidnitz.
12. Die beiden steinernen Bilder beim alten Rathhause zu Breslau.
13. Die Gott geweihte Nonne zu Löwenberg.
14. Die große Braupfanne beim Dorfe Warthau.
15. Rechenberg's Knecht.
16. Der schwarze Friedrich zu Liegnitz.
II. Sagen und Mährchen aus Böhmen, Mähren, Ungarn und Oesterreich.
17. Libussa.
18. Wlasta.
19. Das Roß des Horymirz.
20. Die verrätherischen Weiberohren.
21. Der ungetreue Vormund.
22. Der Heilige im Walde.
23. Die Strafe des Gottesläugners bei Altbunzlau.
24. Die Erscheinung des heiligen Mathias.
25. Das verborgene Schloß im Walde.
26. Die entführte Nonne.
27. Der Böhmische Zauberer Zython.
28. Junker Ludwig bei Eger.
29. Die weiße Frau.
30. Die Jungfrau auf dem Schloß Parenstein in Mähren.
31. Die Braut Christi zu Groß-Wardein in Ungern.
32. Schloß Greifenstein.
33. Die Gründung des Klosters Schlägel.
34. Der wandelnde Geist zu Rauhenek.
III. Sagen und Mährchen aus der Lausitz, Sachsen und Thüringen.
35. Der große Stein bei Görlitz.
36. Jakob Böhme sieht den Schatz in der Landeskrone.
37. Der Mädchensprung auf dem Oybin.
38. Der Tod des heiligen Beneda.
39. Wie das Bergwerk zu St. Annaberg 'gefunden ward.
40. Ursprung der Burg Hohen Schwarm oder der Sorbenburg bei Salfeld.
41. Der Hörselberg bei Eisenach.
42. Landgraf Ludwig der Eiserne und der Schmidt.
43. Die Frau von Weissenburg.
44. Ludwig der Springer.
45. Der Schatz zu Kloster Walkenried.
IV. Märkische, Pommersche und Mecklenburgische Mährchen.
46. Das Wunderblut zu Belitz.
47. Der Wunderring im Hause derer von Alvensleben.
48. Vom Wunderblute zu Zehdenick.
49. Die Teufelsmauer bei Lieberose.
50. Die tugendhafte Nonne.
51. Das Wunderblut zu Wilsnack in der Priegnitz.
52. Der bestrafte Mönchs Geitz.
53. Der durch einen Poltergeist getödtete Knabe.
54. Die wunderthätige Hostie zu Doberan.
55. Wundervolle Entdeckung eines Mordbrenners.
V. Heinrich der Löwe, Herzog von Braunschweig.
56. Historie und Geschichte von Herzog Heinrich dem Löwen.
VI. Kindermährchen.
57. Von dem Mahandel Bohm.
58. Von den Fischer un syne Fru.
59. Das Mährchen vom Popanz.
60. Das Mährchen von der Padde.
61. Die Geschichte des Bauer Kibitz.
VII. Sagen und Mährchen vom Harz.
62. Vom König Laurin.
63. Vom Ilsung.
64. Die Zwerghöhlen.
65. Der Creful.
66. Roßtrapp.
67. Das Nadelöhr bei Kloster Ilefeld.
68. Der Hochstädtische See und die schwimmende Insel.
69. Der Kyffhäuser.
1. Der Ritterkeller auf dem Kyffhäuser.
2. Die goldenen Flachsknoten.
3. Die Wunderblume.
4. Der Ziegenhirt.
5. Das gealterte Brautpaar.
6. Der verzauberte Kaiser.
a) Der Schäfer und der Kaiser.
b) Der Kaiser und die Musikanten.
c) Der verzauberte Kaiser.
70. Der Brocken (Blocksberg)
71. Der treue Burggeist zu Scharzfeld am Harz.
72. Die Dummburg.
73. Mönch und Nonne zu Schloß Mansfeld.
74. Die Tidianshöle bei Schloß Falkenstein am Harz.
75. Die Daneels-Höle.
76. Der Engel Gottes leitet aus der Baumannshöle.
VIII. Sagen und Mährchen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands.
77. Das wüthende Heer und Frau Venus Berg.
78. Das Oldenburger Horn.
79. Die Tanzenden zu Kolbeck bei Magdeburg.
80. Kobold Hütchen zu Hildesheim.
81. Das stille Volk.
82. Der Wink Gottes.
83. Vordeutungen des Todes.
1. Zu Kloster Corvey.
2. In der Stiftskirche zu Merseburg.
3. In der Domkirche zu Lübeck.
4. Im Dom zu Breslau.
84. Kleinere Sagen.
1. Warum die Kreuzschnabel kreuzförmige Schnäbel haben.
2. Es fliegt ein Engel durch's Zimmer.
3. Die Sage vom Rothkehlchen.
Anmerkungen.
Einleitung.
Anmerkungen.
I. Schlesische Sagen.
II. Sagen aus Böhmen, Mähren, Ungarn und Oesterreich.
III. Sagen und Mährchen aus der Lausitz, Sachsen und Thüringen.
IV. Märkische, Pommer'sche und Mecklenburgische Mährchen.
V. Heinrich der Löwe, Herzog von Braunschweig
VI. Kindermährchen.
VII. Harz-Sagen und Mährchen.
VIII. Sagen und Mährchen aus verschiedenen Gegenden Deutschlands.
Literarische Uebersicht der Bücher, welche Deutsche Volkssagen und Mährchen ausschließend enthalten.
Nachschrift.
Volkssagen, Märchen und Legenden, J. G. Büsching
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN: 9783849602925
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Johann Gustav Büsching – Biografie und Bibliografie
Ein um die altdeutsche Literatur sowie um die deutsche Kunst und Altertumskunde verdienter Schriftsteller, Sohn des vorigen, geb. 19. Sept. 1783 in Berlin, gest. 4. Mai 1829 in Breslau, studierte in Halle und Erlangen die Rechte und wurde 1806 Referendar bei der Regierung in Berlin. 1810 erhielt er den Auftrag, die säkularisierten Klöster Schlesiens zu bereisen, um die darin verborgenen wissenschaftlichen und Kunstschätze aus Licht zu ziehen. Er wurde 1811 Archivar in Breslau, habilitierte sich 1816 an der dortigen Universität und erhielt 1817 eine außerordentliche und 1823 die ordentliche Professur der Altertumswissenschaften. Von seinen Publikationen sind zu erwähnen: »Deutsche Gedichte des Mittelalters« (Berl. 1808–25, 3 Tle.), »Sammlung deutscher Volkslieder« (mit Melodien, das. 1807), »Buch der Liebe« (das. 1809, Bd. 1, »Tristan und Isolde«, »Fierrabras« etc. enthaltend), sämtlich in Gemeinschaft mit H. v. d. Hagen herausgegeben, »Museum für altdeutsche Literatur und Kunst« (mit v. d. Hagen und Doeen, das. 1809–11,3 Hefte); »Grundriß zur Geschichte der deutschen Poesie« (mit v. d. Hagen, das. 1812); »Erzählungen, Dichtungen, Fastnachtsspiele und Schwänke des Mittelalters« (Bresl. 1814, 3 Bde.); »Ritterzeit und Ritterwesen« (Leipz. 1823, 2 Bde.).
Bibliographie der Sage
Eine Sage istim allgemeinen alles, was gesagt und von Mund zu Mund weiter erzählt wird, also soviel wie Gerücht; im engeren Sinn eine im Volke mündlich fortgepflanzte Erzählung von irgendeiner Begebenheit. Knüpft sich die S. an geschichtliche Personen und Handlungen, indem sie die im Volke fortlebenden Erinnerungen an geschichtliche Zustände, Persönlichkeiten, dunkel gewordene Taten zu vollständigen Erzählungen ausbildet, so entsteht die geschichtliche S. und, sofern sie sich auf die alten Helden des Volkes erstreckt, die Heldensage; sind aber die Götter mit ihren Zuständen, Handlungen und Erlebnissen Gegenstand der S., so entsteht die Göttersage oder der Mythus (s. Mythologie) und auf dem Gebiet monotheistischer dogmatischer Religion die Legende (s. d.). Hastet die Erzählung an bestimmten Örtlichkeiten, so spricht man von örtlichen Sagen. Noch eine Sagengattung bildet endlich die Tiersage, die von dem Leben und Treiben der Tiere, und zwar fast ausschließlich der ungezähmten, berichtet, die man sich mit Sprache und Denkkraft ausgerüstet vorstellt. Ost hat sich um eine besonders bevorzugte Persönlichkeit, wie z. B. König Artus, Dietrich von Bern, Attila, Karl d. Gr. etc., und deren Umgebung eine ganze Menge von Sagen gelagert, die nach Ursprung und Inhalt sehr verschieden sein können, aber doch unter sich in Zusammenhang stehen, und es bilden sich dadurch Sagenkreise, wie deren im Mittelalter in germanischen wie romanischen Ländern mehrere bestanden und zahlreiche Epen hervorgerufen haben (vgl. Heldensage). Die echte S. erscheint somit als aus dem Drang des dichterischen Volksgeistes entsprungen. Wie alle Volkspoesie blüht sie am prächtigsten in der ältern Zeit, aber auch bei höherer Kultur verstummt sie nicht ganz; vielmehr ist der Volksgeist noch heute tätig, bedeutende Vorgänge und Persönlichkeiten mit dem Schmuck der S. zu umkleiden. Die Anknüpfung an ein gewisses Wirkliches ist hauptsächlich das Merkmal, das die S. vom Märchen (s. d.) unterscheidet. Wie das Märchen, liebt sie das Wunderbare und Übernatürliche, obwohl es ihr nicht unentbehrlich ist. Am häufigsten heftet sie sich an Burg- und Klosterruinen, an Quellen, Seen, an Klüfte, an Kreuzwege etc., und zwar findet sich ein und dieselbe S. nicht selten an mehreren Orten wieder. Um die Erhaltung der deutschen S. haben sich zuerst die Brüder Grimm verdient gemacht durch ihre reiche Sammlung: »Deutsche Sagen« (Berl. 1816–18, 2 Bde.; 3. Aufl. 1891). Nächst diesen sind die Sammlungen von A. Kuhn und Schwartz (»Norddeutsche Sagen«, Leipz. 1848), J. W. Wolf (»Deutsche Märchen und Sagen«, das. 1845), Panzer (»Bayrische Sagen«, Münch. 1848, 2 Bde.), Grässe (»Sagenbuch des preußischen Staats«, Glogau 1871) und Klee (Gütersloh 1885) als besonders reichhaltige Quellen zu nennen. Als Sammler von Sagen einzelner Länder, Gegenden und Örtlichkeiten waren außerdem zahlreiche Forscher tätig, so für Mecklenburg: Studemund (1851), Niederhöffer (1857) und Bartsch (1879); für Pommern und Rügen: U. Jahn (2. Aufl. 1890), Haas (Rügen 1899, Usedom u. Wollin 1903); für Schleswig-Holst ein: Müllenhoff (1845); für Niedersachsen: Harrys (1840), Schambach und Müller (1855); für Hamburg: Beneke (1854); für Lübeck: Deecke (1852); für Oldenburg: Strackerjan (1868); für den Harz: Pröhle (2. Aufl. 1886); für Mansfeld: Giebel hausen (1850); für Westfalen: Kuhn (1859) und Krüger (1845), Weddigen und Hartmann (1884); für die Altmark: Temme (1839); für Brandenburg: Kuhn (1843) und W. Schwartz (4. Aufl. 1903); für Sachsen: Grässe (1874) und A. Meiche (1903); für das Vogtland: Köhler (1867) und Eifel (1871); für das Erzgebirge: J. A. Köhler (1886); für die Lausitz: Haupt (1862) und Gander (1894); für Thüringen: Bechstein (1835, 1898), Börner (Orlagau, 1838), Sommer (1846), Wucke (Werragegend, 1864), Witzschel (1866), Richter (1877); für Schlesien. Kern (1867), Philo vom Walde (1333); für Ostpreußen etc.: Tettau (183f) und Reusch (Samland, 1863); für Posen: Knoop (1894); für den Rhein: Simrock (9. Aufl. 1883), Geib (3. Aufl. 1858), Kiefer (4. Aufl. 1876), Kurs (1881), Schell (Bergische S., 1897), Hessel (1904); für Luxemburg: Steffen (1853) und Warker (1894); für die Eifel: P. Stolz (1888); für Franken etc.: Bechstein (1842), Janssen (1852), Heerlein (Spessart, 2. Aufl. 1885), Enslin (Frankfurt 1856), Kaufmann (Mainz 1853); für Hessen: Kant (1846), Wolf (1853), Lynker (1854), Bindewald (1873), Hessler (1889); für Bayern: Maßmann (1831), Schöppner (1851–1853), v. Leoprechting (Lechrain, 1855), Schönwerth (Oberpfalz, 1858), Sepp (1876), Haushofer (1890); für Schwaben: Meier (1852) und Birlinger (1861–1862), Reiser (Algäu, 1895); für Baden: Baader (1851), Schönhut (1861–65), Waibel und Flamm (1899); für das Elsaß: August St ob er (1852, 1895), Lawert (1861), Hertz (1872); für die Niederlande: Wolf (1843), Welters (1875–76); für Rumänien: Schuller (1857); für die Schweiz: Rochholz (1856), Lütolf (1862), Herzog (1871, 1882); für Tirol. [417] Meyer (2. Aufl. 1884), Zingerle (1859), Schneller (1867), Gleirscher (1878), Heyl (1897); für Vorarlberg: Vonbun (1847 u. 1890); für Österreich: Bechstein (1846), Gebhart (1862), Dreisauff (1879), Leed (Niederösterreich, 1892); für Mähren: Schüller (1888); für Kärnten: Rappold (1887); für Steiermark: Krainz (1880), Schlossar (1881); für Böhmen: Grohmann (1863), Gradl (Egerland, 1893); für die Alpen: Vernaleken (1858), Alpenburg (1861) und Zillner (Untersberg, 1861); für Siebenbürgen: Müller (2. Aufl. 1885), Haltrich (1885). Die Sagen Islands sammelten Maurer (1860) und Poestion (1884), der Norweger: Asbjörnson (deutsch 1881), der Südslawen: Krauß (1884), der Litauer: Langkusch (1879) und Veckenstedt (1883), der Esten: Jannsen (1888), der Lappländer: Poestion (1885), der Russen: Goldschmidt (1882), der Armenier: Chalatianz (1887), die der Indianer Amerikas: Amara George (1856), Knortz (1871), Boas (1895); indische Sagen Beyer (1871), japanische Brauns (1884), altfranzösische A. v. Keller (2. Aufl. 1876); deutsche Pflanzensagen Perger (1864), die deutschen Kaisersagen Falkenstein (1847), Nebelsagen Laistner (1879) etc. Die Sagen bilden mit den im Volk umlaufenden Märchen, Legenden, Sprichwörtern etc. den Inhalt der Volkskunde (s. d.), die seit neuerer Zeit Gegenstand reger wissenschaftlicher Forschung ist. Vgl. L. Bechstein, Mythe, S., Märe und Fabel im Leben und Bewußtsein des deutschen Volkes (Leipz. 1854, 3 Tle.); J. Braun, Die Naturgeschichte der S. (Münch. 1864–65, 2 Bde.); Uhland, Schriften zur Geschichte und S., Bd. 1 u. 7 (Stuttg. 1865–68); Henne am Rhyn, Die deutsche Volkssage im Verhältnis zu den Mythen aller Völker (2. Aufl., Wien 1879); v. Bayder, Die deutsche Philologie im Grundriß (Paderb. 1883); Paul, Grundriß der germanischen Philologie, Bd. 2, 1. Abt. (2. Aufl., Straßb. 1901) und die Bibliographie in der »Zeitschrift des Vereins für Volkskunde«; Grünbaum, Gesammelte Aufsätze zur Sprach- und Sagenkunde (Berl. 1901).
Vorwort.
Sagen und Mährchen werden gemeiniglich in früher Jugend den Kindern vorgeführt, es ist gleichsam eine süßere und mildere Speise, die man ihnen einflößt, da sie die härtere und rauhere, welche das wirkliche Leben und seine Geschichte uns giebt, nicht ertragen können. Ein rosenrother Morgenhimmel geht dem Kinde auf, es lebt in einer Welt unschuldiger Träume, und es wird wohl nicht leicht einer von uns so unglücklich gewesen sein, daß ihm diese Freude der Kindheit ganz entgangen ist. Späterhin kehren wir stets mit Lust und Liebe wieder dahin zurück, und das Erzählen der Mährchen den Kindern, die nun auf unsere Stimme lauschen, wie wir einst auf die Töne der Erzähler, ist nicht bloß Wohlgefallen, die Kinder zu erfreuen, (da lassen wir uns oft manche Fehler zu Schulden kommen), sondern die ewig rege und unwandelbare Liebe am Mährchen selbst, die in uns wohnt und der wir Freiheit geben.
Es sei mir erlaubt, zum Eingange dieses Buches zu erzählen, wie die Mährchen und Sagen in mein Leben eintraten. Mancher wird glauben, ich wiederhohle das, was in seinem Innern vorging; denn die ersten Empfindungen der Kinder sind sehr gleichmäßig und einfach, es herrscht ein allgemeiner Grundakkord, aus dem sich die andern erst entwickeln. Diesen Bildungsverwandten ist das Büchlein besonders gewidmet, so wie allen geliebten Personen und lieben Freunden, die meinem Treiben nicht abhold sind. Andern, die einen verschiedenen Weg gingen, mögen diese Erzählung als ein Mährchen betrachten, das ich zum Eingange ihnen darbiete; denn es mag auch wohl ein halbes Mährchen sein, da der kindischen Tage duftige Nebelzeit mir wieder klar werden muß. Sie mögen die kleinen Gestalten, die durch meine Phantasie zogen und sie belebten, als das stille Volk betrachten, das einst die einsamen Vesten Deutschlands durchwandelten, und Freude mir, wenn diese Gebilde ihnen nicht ganz unlieblich erscheinen.
Wie die Lust an Mährchen sich in mir entwickelte, oder die Geschichte der Entstehung dieses Büchleins.
Meinen Eltern geboren, um sie einigermaßen über den Tod eines innigst und höchst geliebten Töchterleins, der wenige Zeit nach meiner Geburt erfolgte, zu trösten, mit der ich zugleich alle jüngern Geschwister verlor, gingen meine ersten Entwickelungsjahre einsam hin. Das Kind fühlt dies noch nicht, die nährende Amme, die mit ihm tändelnden und scherzenden Eltern sind ihm genug. Aber schon um mein drittes Jahr erinnere ich mich einer großen Sehnsucht nach einem Gefährten und Gespielen, und wohl weiß ich noch die Freude, die ich hatte, als mir ein Brüderlein geboren ward. Die Lust dauerte nicht lange, mein Brüderchen starb bald wieder und versetzte mich, das Kind, in eine nicht geringere Klage, als meine Eltern, und wohl weiß ich noch, wie ich am Fenster des Zimmers stand, worin mein kleiner Bruder entweder starb, oder sein Leichnam lag, und mich durch die Tröstungen der Wärterin kaum beruhigen, kaum meine Thränen anhalten konnte. Das Kind vergaß diesen Schmerz bald.
Nun war ich wieder allein, die Lust an Gesellschaft, an gemeinschaftlichem Spiele erwachte immer mehr, die Besuche der Nachbarskinder genügten mir nicht, auch entstand unter den verschieden gestimmten häufig Streit und Zank, alle Freude ward zerrissen und dann war ich auch, nach meinen Wünschen, viel zu oft allein. Eine treue Wärterin, eine sorgfältige, stets bemühte Tante, eine mich über alles liebende Mutter spielten wohl mit mir, und selbst der Vater versagte es mir nicht, Abends, nach seiner Arbeit, Soldat und dergleichen zu spielen, und mit einem Stocke Schildwach zu stehen; aber alles genügte mir nicht und da es immer nicht das Rechte war, was meine Seele wünschte, so ward ich oft im Spiele unartig und das Spielen war vorbei. Die Leute waren mir alle zu groß, ich wollte kleine Persönchen haben, so groß wie ich; mit denen ließ sich besser spielen, hier spielte ich nur, und man spielte mit mir; es ging nicht so recht vom Herzen.
Da sing ich nun an, meine Mutter angelegentlichst zu bitten, sie möchte mir ein Brüderchen oder Schwesterchen verschaffen, darin erkannte ich das einige Heil. Man verwies mich zur Ruhe; ich bat wieder, dringender und ward mit der Nachricht beschwichtigt, wenn ich recht artig wäre, sollten meine Wünsche erfüllt werden. Das versprach ich; aber ich muß nie so artig gewesen sein, denn meine Wünsche wurden nicht erfüllt. Von jener Zeit mag auch wohl die Wurzel eines für mich unendlich peinigenden Gedankens in meine Seele gelegt sein, des Gedankens: allein in der Welt zu stehen, eine Idee, die mich immer mit gräßlicher Beängstigung befällt, wenn eine geliebte Person aus meinem Kreise gerissen wird. Ich muß etwas haben, woran ich mich halte im Leben.
Meine Puppen, meine Baukasten, meine Thiere gefielen mir gar wohl; zu Weihnachten marschirten gar artiges Fußvolk und Reiter auf, alles ging anfangs gut, bis ich immer wieder dahinter kam, daß ich alles that und die unglücklichen Puppen gar nichts. Keine rührte einen Arm oder ein Bein. Im Unmuth wurden sie daher oft gar zu sehr gestoßen, verloren das, was sie rühren sollten, und den Kopf noch oben drein. An Schelten fehlte es nicht. Meine kleinen Freunde bewegten papierne Puppen, an Drähten und Faden, ich that es auch, sie mußten sogar Komödie spielen, die ich aufführte, obgleich ich nur die höchst dürftigste und mangelhafteste Idee davon hatte; denn erst in meinem zehnten Jahre sah ich die Bühne. Anfangs ging es gut, meine beiden Hände arbeiteten munter und es schien doch eine freiwillige Bewegung in den Puppen zu sein. Aber die Faden verwickelten sich, meine Koulissen, Bücher aus meines Vaters Bibliothek, fielen um, fielen auf die Wachsstöckchen, es brannten Löcher hinein, da nicht schleunig alles gerettet werden konnte, und die ernste Weisung erfolgte: solche Narrenspossen zu lassen; ich sollte nun etwas lernen, das wäre besser. – Es wollte mir gar nicht in den Kopf.
Was mir das Leben nicht gab, sollte mir die Phantasie ersetzen, und in ihr sollte mir ein Leben aufgehen, das mich Stunden lang beschäftigen konnte, mir jetzt noch Anlaß giebt, öffentlich davon zu sprechen. Die goldenen Mährchen kamen auch zu mir herüber, ich ging durch eine ziemliche Reihe, aber vor allen erschien mir die Person des Däumchen gar wunder lieblich und hübsch, es war das lebendige Püppchen, das ich mir wünschte, zierlich, gewandt, verständig, meine Freundchen waren mir oft zu täppisch und ungeschickt und gingen selten in meine Ideen ein, und doch zum Spielen gar zu schön zu brauchen. Die kleinen Freunde, die zu mir kamen, waren recht angenehm, sie kamen aber zu selten, wir wurden nicht vertraut, darum erfuhren sie auch nichts von den Bildern, die ich mir machte, wovon ich gleich erzählen werde. Einem, glaube ich, sagte ich einmal ein Wort davon, er lachte mich aus, denn ich nahm die Sache in der Wahrheit: es müßte ein Däumchen geben; und nun war mein Mund verschlossen, die Welt meiner Phantasie bewahrt.
Aus dem einen Däumchen wurden bald mehrere, es ward eine kleine zierliche Familie, die mir vor der Phantasie vorjaukelte und mit der ich mich in Gedanken spielend beschäftigte, indem ich vor meiner Seele die kleinen Gestalten das thun sah, was ich wünschte. Bald ward es ein Völkchen und ich machte mir selbst die Geschichte des stillen Volks, ohne davon etwas gehört zu haben. Mährchen hörte ich nun gar zu gerne und mein zweiter Bruder konnte mich durch ein solches gewaltig erfreuen. Besonders liebte ich von ihm zu hören die Mähre von funfzig Räubern, in dem sich öffnenden und schließenden Berge, da sie gar zu heimlich und schauerlich war, so wie die Geschichte vom Bauer Kiebitz. Wie ein ächter und wahrer Mährchenerzähler thun muß, stand der Gang der Geschichte stets unwandelbar fest und ich konnte mich nicht satt hören, wenn mich auch bisweilen die Frage, mitten im Erzählen, ob ich den Nachtwächter wohl hörte und ob ich die Männer wohl bemerkte, unbedeutende Worte, die mir aber immer einen Schauer einflößten, ohne mich eigentlich furchtsam zu machen, sehr erschreckte.
Ich hatte aber auch Mährchen, die ich wirklich haßte, vor allem die Geschichte, mit der auch Sancho Pansa seinen Herrn nicht wenig erzürnt, mit der Erzählung von dem Hirten, der die vielen tausend Schafe einzeln über den Fluß setzen muß, das gar zu hübsch anfängt und gar zu kurz ist; denn man glaubt, daß jenseits des Stromes ein herrliches Mährchenland liegen muß, da alle andere Mährchen zu einem Ziele führen, nur dies nicht. Immer hoffte ich zu erharren, daß das letzte Lamm hinüber wäre und nun die Geschichte begönne, aber immer ward ich auf fernere Zeit verwiesen; er sei noch nicht hinüber und so harre ich noch. Doch ward ich ein paarmal mit der Geschichte angeführt.
Das stille Volk in meinem Innern ward mir stündlich werther, täglich mehrte sich der keine Roman, der in meiner Seele sich entspann, aber ich betrachtete es immer als eine Welt außer mir, die ich nicht festzustellen im Stande war. Desto lieber ward mir aber die Idee selbst, klein zu seyn, und es setzte sich eine Lust an kleinen Personen fest, welche wohl einen tiefen Eindruck in meine Phantasie gemacht haben muß, denn noch jetzt würde man mir eine sehr große und bedeutende Vorliebe für kleine, zierlich und lieblich gebaute Personen mit vieler Deutlichkeit nachweisen können. Vor allem bemühte ich mich, so klein mich zu machen, daß ich Dinge unternehmen möchte, die mein kleines Volk leicht thun könnte. So kugelte ich mich in einen Korb zusammen, in dem die nächtliche Wäsche des Abends ins Zimmer gebracht ward. Mein doch zu großer Körper drohte ihn zu zersprengen, er knackte und knarrte verrätherisch laut und die haushälterische Mutter vertrieb mich mit einigen Drohworten aus dem gewünschten Häuslein, wohin ich nur sehr verstohlen zurückkehren durfte und in kurzem ganz vergebens. Dann lag ich auch gerne hinter Mutter und Großmutter in der Ecke des Sophas, dicht wie ein Knäul gedrängt und ließ mich von der Bewegung, die das Spinnen dem Sopha mittheilte, schaukeln; denn damals gab es noch Deutsche Frauen, die spannen, und der Spinnrocken ist ja der eigentliche Signalstern der Mährchenwelt.
Der Tod meines Vaters brachte mir ein anderes Sein. Zwar blieb ich in meiner Vaterstadt, aber meine Mutter bezog eine weit entfernte Gegend der Stadt, meine Freunde und Gespielen blieben zurück, nur mein liebes stilles Volk begleitete mich und ward desto inniger von mir umfangen. Je mehr ich heranwuchs, je mehr Wahrheit bekamen die Gestalten und wurden äußerlich; ich fing immer mehr an zu glauben: es gäbe wirklich so ein Volk. Gulliver's Reisen fielen mir in die Hände, ich las einiges darin, das Zwergenvolk, wie es mir meine Phantasie gab, war darin beschrieben, es waltete kein Zweifel mehr ob, es gab solche Männlein und nun fehlte nur die Kunst, – sie zu entdecken.
Daß mein Völkchen Häuser baute, Geräthschaften und Thiere hatte, so zierlich und nett und klein wie sie selbst, das war keiner Frage unterworfen. Besonders dachte ich sie mir gar stattlich und freudig auf ihren kleinen Rossen und noch kann ich aus Göthe's Romanze die Verse nicht hören:
Es kommen drei Reiter, sie reiten hervor,
Die unter dem Bette gehalten,
ohne daß auch meine ganze Jugendreiterschaar wieder beweglich wird und sich im Galopp daran schließt, in zierlichen Kreisen die Pferdlein taumelnd. Daß sie im freien Felde nahe an der Straße wohnen würden, glaubte ich nicht; ein Wald mußte sie beherbergen. Sparsam die umliegende Gegend besuchend, gemeinhin, wenn wenig andere dort waren, erhielt selbst die Umgebung von Berlin mir ein fremdartiges, einsameres Ansehen, das ich durch Bilder dichter, schauerlicher, alter Wälder, von denen ich las und hörte, vergrößerte.
Gar furchtsamlich erschien mir daher ein sehr lichtes Gehölz, das der Gegend, wo ich jetzt wohnte, nahe lag und das ich manchmal vom Thore aus sah. Bald glaubte ich, dort wohne mein kleines Volk, und wünschte nun nichts sehnlichers, als einmal hinausgehen und suchen zu können. Ich dachte es mir gar zu süß, wenn ich mir so ein paar kleine Freunde mitnehmen könnte, die dann in meinem Zimmer wohnen sollten und mich durch ihre artigen Geberden und Sprache, denn Deutsch sprachen sie wie ich, zu erfreuen sich bemühten. Endlich kam ich einmal hinaus. Ich suchte und suchte verstohlen, so viel ich konnte, und fand, wie natürlich, nichts. Aber eine düsterere Spitze des Gebüsches, wohin ich nicht kam, zog mich an sich und schien mir Gewährung zuzuwinken. Späterhin kam ich auch dorthin, wieder nichts. Nun glaubte ich sie mir nicht mehr so nahe, ich setzte sie ferner; der mir ganz unbekannte Grunewald trat an die Stelle der nur zu bekannt gewordenen Hasenheide und mein Glaube war nicht gestört, nur stand alles weiter vor mir und ich verzweifelte für jetzt, die niedlichen Männlein zu sehen, zu sprechen, mich ihrer Gesellschaft zu erfreuen.
Weit in mein Knabenalter nahm ich diese Phantasien mit hinein und nur langsam verflogen sie bei andern Geschäften. Schon beinahe in das Jünglingsalter getreten, nahm mein Geist eine ganz eigene Richtung und die alten Bilder traten wieder hervor. Die Liebe zum Mittelalter, zur Deutschen Vorzeit, erwachte, auf der Schule noch, in mir, auf eine eigene Art, deren Erzählung, so wie ihre Ausbildung, nicht hierher gehört. Im Widerstreit, der sogar zuletzt offenbar ward, von allen, die mich umgaben, mehr oder minder selbst verhöhnt, denn keiner wußte, was ich suchte und fand, bildete sich diese Liebe fort, und da ich mancher andern Arbeit ein Stündchen abstahl, litten diese wohl, wie nicht zu läugnen, aber ich tröstete mich schon damals mit dem Spruche: man könne nicht Alles sein, wenn man nur Eins recht zu sein sich bemühte, man möchte nun das Ziel erreichen oder nicht. Auf den ernstlichen und guten Willen hielt ich gar viel.
Wie ward mir, als mir in Deutscher Vorzeit eine neue Mährchenwelt aufging; denn wie ein Mährchen mußte es mir erscheinen, in einer mir so dunkel geschilderten Zeit hellleuchtende Sterne zu sehen, in öden Gegenden Blumen wachsen zu finden, die dann doch auch recht zierlich waren und gar zu bekannt und heimisch. Mühsam arbeitete ich mich durch den verwachsenen Pfad, auf dieser, auf jener Seite konnte ich nicht weiter, ich machte fester auf einer die Probe und sie gelang. Nur sehr langsam und allmälig konnte ich vorschreiten, die großen, erhabenen Gestalten der Nibelungen, die überkräftigen und bis zur Riesengröße gesteigerten Recken Karls des Großen, die wackern und zierlichen Degen des Hofes, den König Artus beherrschte, traten mir, in wunderbare Sagen verflochten, entgegen, und Bragur breitete dann auch die noch unendlichere und tief begründete Nordische Götterwelt vor mir aus. Eine solche neue Welt, in der Sage und Geschichte neben einander schwebten, und in einander verbunden waren, mußte den Jüngling gewaltig ergreifen und ihn für immer bestimmen; also geschah es auch. Wie die Mährchen in der frühen Kindheit seine Phantasie angezogen und belebt hatten, selbst den Knaben noch beschäftigend, so sollten die alten Mähren dem Jünglinge und Manne eine stets unerschöpfliche Quelle von Forschungen werden.
Nun kamen die alten Sagen auch wieder hervor, die ich in der Jugend gehört, bei vielen zeigte sich eine tiefere Quelle, ein unendlich bewunderungswürdiges Fortschreiten und verschwistert sein. Geschichte, Religion, Liebe und Dichtkunst verflochten sich so wunderbar, daß jede neue Erkenntniß höher reitzte. – Da ward mir auch Musäus bekannter. Das Mährchen, in dem die zierlichen Zwerge so treu die geliebte Herrin in dem gläsernen Sarge bewachten, zog mich, wegen seiner Lieblichkeit, besonders an, aber auch die drei Schwestern gefielen mir sehr wohl, so wie der Anfang der Libussa, Rolands Knappen und andere, doch war mir schon damals etwas in ihnen, was mir nicht recht behagte. Späterhin erkannte ich sehr wohl, was dies sei: ein ihm oftmals gemachter Vorwurf.
Tiecks Mährchen mußten mir über alles gefallen; denn in ihnen möchte am wahrsten der Weg getroffen sein, wie Mährchen erzählt werden müssen, wenn sie in der Bearbeitung ein neues Sein erhalten sollen, aber dennoch behalten die neuen Volksmährchen der Deutschen, von Mdme. Naubert, weniges abgerechnet, stets den Vorrang bei mir und sind mir immer die liebsten und werthesten. Nicht allein wegen der reichen, herrlichen Stoffe, sondern auch vorzüglich wegen der sinnigen Bearbeitung, oft auch wegen der lieblichen Verflechtungen mehrerer Mährchen in eines. Wer wird nicht von dem stillen Volke, der lieblichen Erzählung von der Mutter Hulla, in dem Mährchen vom kurzen Mantel, wie die Hulla so treu sorgsam sitzt und am Rocken der Freundin spinnt, die ihre Geduld so auf die Probe setzte, wer wird von dem ganz herrlichen Rübezahl'schen Mährchen, Erdmann und Maria, so wie von dem schauerlichen, der weißen Frau, nicht auf mannichfache Art, wie ich, ergriffen worden sein? – Auf diese Weise war ich befriedigt und das andere Heer der Mährchensammlungen, so schlecht es mitunter war, konnte meinen Mißmuth nicht erregen, da ich sie als ganz verfehlte Ansichten dieser lustigen und schönen Welt gleich zurückschob. So gingen alle Sammlungen bei mir vorbei, nur eine, Volksmährchen von Gustav, habe ich nie erhalten können, welches mir um so unangenehmer ist, da in meiner Familie der Glaube war, ich sei der Verfasser, da nahe, mir liebe Plätze, bei meiner Vaterstadt, der Tummelplatz waren und gleicher Vorname leicht zu solcher Annahme berechtigen konnte.
Je mehr die Mährchenwelt mich anzog, je mehr Lust hatte auch ich, mich darin zu versuchen, aber ich fühlte nicht die Kraft in mir, ein liebliches Mährchen, aus einem nur oft hingeworfenen Stoffe, zu bearbeiten, und in meinem Innern war eine Stimme, die mir immer zu sagen schien, es gäbe einen andern Weg, der meinem ganzen geistigen Streben angemessen und noch jetzt fast gar nicht betreten sei. Die Volkssagen, nacherzählt von Otmar (Nachtigall), zeigten mir den Weg, den ich einzuschlagen hätte, wenn ich, meinem ganzen Triebe folgend, einen zweckmäßigen Gebrauch von meiner kommenden Sammlung in der Folge machen wollte. Ein inneres Drängen und Treiben zu literarischen Forschungen, selbst bei so leicht beweglichen Dingen, wie die Lieder, Sagen und Mährchen des Volks, kann ich nicht abläugnen; denn ich habe es, durch mehrere Arbeiten, zu sehr bekundet. Man hat es manchmal getadelt und ein mit mir gleich gesinnter Freund theilt mit mir gleiche Rüge.
Ein weites Feld hierzu boten mir die Sagen, Mährchen und Legenden in ihren verschiedenen Verzweigungen, in ihren Abweichungen und in ihren gegenseitigen Verbindungen anderer Seits. Manches schien mir hierbei unumgänglich nöthig zu erinnern, besonders, da so viel Historisches durch sie alle geht. Wahre Historiker, ich nenne nur das Haupt aller, unsern Johannes von Müller, haben uns gelehrt, daß man die Sage nicht als ein nichtiges Fabelwesen niedertreten und verwerfen müsse, sondern daß auch sie, klug benutzt, in die Geschichte einzutreten vermöge und so sollte wohl der Blick aller mehr auf diese Sagengebilde geschärft werden.
Ein jedes Land hat seine Sagen und Mährchen. Erstere schließen sich an die Geschichte an, sind oft selbst an Orte des Landes geknüpft und mit ihnen, durch den Mund des Volks, selbst bei der Ruine, noch unwandelbar verbunden. Eigene, wahrhafte Mährchen führen diese zweifelhaften Gebilde ganz in das heitere Reich der Dichtkunst und die Legenden, Sagen, Mährchen und Religion so wundersam oft verschlingend, will nothwendig mitgenommen sein, wenn eines oder das andere ganz verstanden werden soll. So wurden auch diese drei von mir verbunden, nach den Völkern, so viel es ging, geordnet, und ihnen im Innern wieder eine chronologische Stellung gegeben, da oft, nicht gering gewichtig, der ganze hohe und gefallene Sinn des Volkes sich in den frühsten und späteren Mährchen, wie in den Liedern, ausspricht.
Einige Sagen und Mährchen schwebten frei, sie gehörten keinem Volke und möchten dann wohl meistentheils großes Gemeingut des mächtigen Mittelalters sein. Andere wiederhohlen sich unter mehrern Volksstämmen mehrfach und sollen bald hier, bald dort geschehen sein. Gewöhnlich liegt ihnen eine religiöse oder moralische Tendenz zum Grunde und jedem Hörer waren sie daher gerecht, sie in seine Nähe zu verlegen und dadurch eindringlicher zu machen; denn ein nahes Unglück oder ein Gräuel im benachbarten Orte erschreckt die Gemüther immer mehr, als eines im ferneren Lande.
Wie die Chronik, wie dies und jenes Buch, wie der Mund des Volks, oder der Freunde, wie die eigene Erinnerung mir die Sage und das Mährchen einfach gab, so stellte ich sie auch hin. Gerne vermied ich die reiche Gelegenheit bogenlanger Anmerkungen, mich nur kurz begnügend den historischen Zusammenhang, die literarischen Nachweisungen, Abweichungen, Uebereinstimmungen verschiedener Stämme oder auch Uebereinstimmung mit fremden Sagen anzugeben, da sich so vieles von selbst giebt und fügt, manches aber auch durchaus überflüssig gewesen sein würde, vielleicht schon jetzt ist.
So hat denn ein neues Mährchenreich in meiner Phantasie ein lustiges Lager aufgeschlagen. Die Lieder, Gesänge und Sagen der Altvordern haben es gegründet und im bunten Kreise bewegt sich jene Welt des Mittelalters vor mir. Schon einigemale wagte ich es, diese Welt auch anderen zu eröffnen; Freunde erfreuten mich durch Beifall, halbe Freunde betrachteten vornehm und mit einer gewissen Wichtigkeit, immer sich meinem Standpunkte entgegen, niemals in ihn, stellend, meine Erzeugnisse und beurtheilten so halb, daß mir die dritte Klasse derjenigen, die ihr Verdammungsurtheil rein aussprach, bei weitem lieber war. Sie haben doch eine Ansicht, und geben sie, wie sie dieselbe haben.
In neuem Felde trete ich diesen Dreien entgegen, sie freundlich begrüßend und bittend, wenn ihnen diese Sagen und Mährchen, die schon mannichfach einst durch ihre Jugend gingen, gefallen, auch auf den Sammler einen heitern Blick zu werfen und ihn vor allem zu neuem Hervortreten durch Stoff zu erfreuen, ihm die Mährchen ihrer Umgebungen zu senden, die immer mehr und mehr jetzt in dem Strudel der Zeit verschwinden. Auch mögen sie mit nicht gar zu bösen Blicken dieses Vorwort betrachten, das eben so anspruchslos, wie die folgenden Mährchen, gemeint ist. So werden wir eine lustige Gesellschaft bilden, wie sie einst die alte Zeit, zur Erzählung der Mährchen, sah, und der, der eine Sage in der wahrhaft richtigen Bearbeitungsart dem Erzähler einst einmal wieder giebt, wird ihm eben so lieb sein, als der Freund, der ihm eine neue bringt, und dieser Freunde wünscht er sich recht viele.
Breslau, den 23. Novbr. 1811.
Büsching.
I. Schlesische Sagen und Mährchen.
1. Geschichte des Grafen Walther und der Helgunda.
Es war in alten Zeiten eine sehr berühmte Stadt in Pohlen, von hohen Mauern eingeschlossen, Wislicz genannt, deren Herrscher einst, zur Zeit des Heidenthums, Wislaw der Schöne gewesen war, abstammend von der Familie des Königs Pepol. Diesen nun soll ein Graf, auch desselben Stammes, mächtig an Kräften, daher Walther der Starke genannt (welches auf Pohlnisch heißt: Wdaly Walgerzs), dessen Schloß Tyniez Krakau benachbart lag, wo jetzt die Abtei St. Benedikti, durch Kasimir den Mönch, König der Pohlen, gegründet, steht, in einer Fehde gefangen, den Gefangenen in Fesseln gelegt und in einen Thurm in feste Wacht gelegt haben. Dieser hatte eine Edle, Helgunda genannt, die Tochter eines Königs der Franken, zur Gemahlin, die Walther, wie man sagt, heimlich, nicht ohne große Gefahr seines Leibes, gen Pohlen führte.
Eines Alemannischen Königes Sohn ward, an dem Hofe des Königs der Franken, dem Vater der Helgunda, mit großer Gunst gehalten, auf daß er ritterliche Sitten erlerne. Und Waltherus, der im Geiste durchschauend und listig war, da er bemerkte, daß Helgunda, die Tochter des Königs, sich in Liebe zu dem Sohne des Königs von Alemannien gewendet habe, bestieg in einer Nacht die Zinnen des Schlosses, bestach den Wächter, damit er ihn nicht auf irgend eine Weise hindern möchte und fing an, so süße Gesänge zu singen, daß die Tochter des Königs, aus dem Schlafe geweckt von den angenehmen Tönen, vom Lager aufsprang und mit ihren übrigen Gespielinnen, die Ruhe des Schlafs verscheuchend, auf den bezaubernden Gesang aufmerksam blieben, so lange der Sänger seine wohltönende Stimme erschallen ließ.
Früh aber befahl Helgunda dem Wächter, vor ihr zu kommen, sorgsam forschend, wer jener gewesen sein möchte, der in der vergangenen Nacht so süß gesungen; aber dieser, sich gänzlich unwissend stellend, wagte es nicht, den Walther zu verrathen. Da in den beiden folgenden Nächten Walther der Jüngling mit gleicher Schlauheit verfuhr, wollte Helgunda nicht mehr die Verstellung dulden, sondern trieb den Wächter durch Drohungen und Schrecknisse, daß er den Sänger nenne. Als er ihn noch nicht verrathen wollte, befahl sie ihm das Leben zu nehmen; nun nannte der Wächter Walthern als den Sänger und gegen ihn entbrannte Helgunda sogleich voll Liebe, gab sich ganz seinen Wünschen hin und vergaß den Alemannischen Prinzen.
Dieser, als er sich so schimpflich von der Helgunda zurückgesetzt und Walthern dagegen in dem vollen Genuß ihrer Liebe sah, wurde von heftigem Zorn gegen ihn entbrannt und nahm, in sein Vaterland kehrend, alle Zölle am Rhein in Besitz. Er befahl strenge zu wachen, daß niemand mit einer Jungfrau übergesetzt werde, er zahle dann eine Mark Goldes. Einige Zeit hernach suchten Walther und Helgunda Gelegenheit zu entfliehen und fanden sie. An dem bestimmten Tage entrannen sie; aber als sie an die ihnen erwünschten Ufer des Rheins kamen, verlangten die Schiffer für die Ueberfahrt eine Mark Goldes, welche sie erhielten, aber von dem Uebergange ihn abzuhalten suchten, bis der Sohn des Königs käme. Walther aber, merkend aus dem Verzuge die Gefahr, bestieg bald sein Roß und befahl der Helgunda, sich hinter ihn zu setzen, und in den Fluß springend, setzte er schneller als ein Pfeil über. Als er sich kaum von dem Fluße Rhein entfernt hatte, hörte er ein Geschrei hinter seinem Rücken von dem ihn verfolgenden Alemannischen Prinzen, der mit heftiger Stimme rief: »Treuloser, mit der Tochter des Königs entflohst du heimlich, und ohne Zoll zu entrichten setztest du über den Rhein! Halte an deine Schritte, halt, daß ich mit dir einen Zweikampf beginne und wer Sieger sein wird, soll das Pferd des Besiegten und die Waffen und Helgunda haben.« Diesem Geschrei antwortete Walther unerschrocken und sprach: Was sprichst du von der Königstochter? die Mark Goldes habe ich gezahlt und die Tochter des Königs nicht durch Gewalt erhalten, sondern freiwillig mir folgen wollend, habe ich sie in meiner Gesellschaft.
Dies gesprochen, ging einer auf den andern mit eingelegter Lanze erbittert los und als diese zersplittert, zogen sie die Schwerdter und übten mannlich die Kräfte. Und weil der Alemanne, von der Gegenseite kommend, Helgunden im Auge hatte, ward er so durch ihren Anblick ermuthigt, daß er den Walther zum Weichen nöthigte, bis dieser, zurückschreitend, auch die Helgunda erblickte. Kaum erblickte er sie, als er von Scham und großer Liebe zu ihr ergriffen, mit gesammelten Kräften auf den Alemannen stark eindrang und ihn sogleich tödtete. Pferd und Waffen desselben nahm er, setzte seine Reise fort und kam mit doppeltem Triumpf gekrönt bei seiner Helgunda wieder an. Auf seine Burg Tyniez gelangt, nach glücklich vollbrachtem Abentheuer, ergab er sich einige Zeit lang der Ruhe, um sich zu erhohlen. Da erfuhr er aus den Klagen der Seinen, daß Wislaw der Schöne, Herrscher von Wislicz, in seiner Abwesenheit seine Leute beleidigt habe. Dies drückte schwer sein Gemüth, er suchte Ursachen, um sich an Wislaw zu rächen; endlich griff er ihn an, besiegte ihn und legte den Besiegten, wie oben gesagt worden ist, in einen tiefen Thurm des Schlosses Tyniez, um ihn als Gefangenen zu bewahren.
Einige Zeit darauf aber, um kriegerische Abentheuer zu suchen und nach ritterlicher Sitte zu leben, durchirrte er entfernte Gegenden. Und als so das Jahr schon zweimal seinen Kreislauf vollendet hatte, ward Helgunda über die Abwesenheit ihres Gemahls nicht gering mißmüthig und dahin gebracht, einer ihrer vertrauten Kammerjungfrauen mit niedergeschlagenen Augen zu sagen: »ich bin nicht Wittwe und nicht verheirathet;« und dabei dachte sie an diejenigen, welche mit tapfern und streitbaren Männern ehelich verbunden sind.
Die Vertraute, welcher der traurige und verlassene Zustand ihrer Herrin zu Herzen ging, enthüllte ihr, indem sie sich aller weiblichen Schamhaftigkeit entäußerte, daß Fürst Wislaw, von schöner Gestalt und Adel des Körpers, so wie von lieblichem Anblick, in dem Thurme gefangen liege und die Unglückliche rieth, daß sie beföhle, ihn in stiller Nacht aus dem Thurme zu ziehen und, wenn sie sich lieblicher Umarmungen erfreut hätte, ihn sicher wieder in den untersten Theil des Thurmes zu bringen.
Jene war den Reden der Vertrauten günstig geneigt, und obgleich von ängstlicher Furcht beklemmt, fürchtete sie sich doch nicht, Leben und Ruf der Ehre preiß zu geben, befahl, den Wislaw aus dem Innern des Kerkers herbei zu führen, und durch seinen Anblick und den Adel seines Aeußern, welche sie bewunderte, ward sie erfreut. Nun wollte sie ihn nicht mehr in den Kerker werfen lassen, sondern vielmehr, mit ihm durch die innigsten Fesseln verknüpft und durch unauflöslicher Liebe Banden verkettet, floh sie nach Wislicz, das Ehebette ihres Mannes verlassend. So kehrte Wislaw in sein Eigenthum zurück, indem er glaubte, einen doppelten Triumpf errungen zu haben, der aber in dem wankelmüthigen Ausgange, durch den Tod beider, sich endete.
Denn kurze Zeit hernach, als Walther zu seiner Heimath zurückkehrte, fragte er seine Lehnsleute: warum ihm nicht Helgunda, bei seiner erfreulichen Ankunft, bis vor die Thore des Schlosses entgegen käme? Ihm erwiederten die Lehnsmannen, wie Wislaw aus der Wacht des tiefsten Thurmes, durch Hülfe der Helgunda, sei befreit worden und sie mit sich hinweggeführt habe. Sogleich, von mächtiger Wuth erfüllt, eilte Walther gegen Wislicz, nicht fürchtend, sich und das Seine ungewissen Erfolgen auszusetzen. Unvermuthet kam er in der Stadt Wislicz an, als Wislaw außerhalb der Stadt mit Jagen sich beschäftigte.
Kaum erblickte ihn Helgunda in der Stadt, so eilte sie sogleich zu ihm, fiel auf ihre Knie nieder und beklagte sich heftig über Wislaw, der sie mit Gewalt geraubt habe, den Walther beredend, daß er mit ihr in die innern Gemächer des Hauses käme, versprechend, ihm den Wislaw auf seinen Wink sogleich in seine Gewalt zu geben. Dieser glaubte den verführerischen Ueberredungen der Täuscherin, ging mit ihr in die feste Wohnung, wo sie ihn dem Wislaw als einen Gefangenen vorführte. Wislaw und Helgunda freueten sich höchlich über den glücklichen Erfolg, nicht daran denkend, daß einer so großen Freude oft ein tödliches Leid folgt.
Er wollte den Walther nicht in gewöhnlicher Kerkerhaft behalten, sondern wollte ihn mit mehr, als mit den Schauern eines Verließes quälen. Er ließ ihn nehmlich an die Wand des Speisesaals mit ausgespannten Armen, aufgerichteten Halse und Füßen, durch eiserne Klammern aufrecht anschmieden. Dorthin ließ er ein Ruhebettlein bringen, worauf er im Sommer mit der Helgunda in zärtlichen Spielen mittäglich zubrachte.
Wislaw hatte eine leibliche Schwester, welche, wegen besonderer Häßlichkeit, niemand zum Weibe begehrte, deren Bewachung Wislaw, vor andern Hütern, den Walther anvertraute. Ihr gingen die Leiden Walthers sehr zu Herzen und sie fragte ihn, gänzlich jungfräuliche Sittsamkeit verläugnend: »ob er sie wohl zum Weibe nehmen wolle?« dann wolle sie seinen Leiden Erleichterung verschaffen und ihn von seinen Ketten befreien. Er versprach ihr und bekräftigte mit einem Eid, daß er sie mit ehelicher Liebe, so lange sie lebten, behandeln wolle und mit seinem Schwerdte gegen ihren Bruder Wislaw, das begehrte sie, nie kämpfen wolle. Er bat sie darauf, daß sie sein Schwerdt aus dem Bette ihres Bruders nehmen und ihm bringen möchte, auf daß er mit demselben seine Fesseln lösen könne. Sie brachte ihm sofort das Schwerdt und durchhieb, wie ihr Walther befahl, ein jedes Band der eisernen Schienen und Ketten, und verbarg hierauf zwischen dem Rücken Walthers und der Wand das Schwerdt, daß er zu seiner gelegen ergriffenen Zeit sicher davon gehen könne.
Jener wartete bis auf die Nachmittagsstunde des folgenden Tages, da Wislaw mit der Helgunda wieder auf dem Ruhebette, sich umarmend, waren. Da redete sie Walther, gegen seine Gewohnheit, an und sagte: »wie würde euch sein, wenn ich, befreit von den Fesseln, mein gezogenes Schwerdt in den Händen, vor eurem Ruhebette stände, und drohte für eure Schandthaten Rache zu nehmen?« Bei diesen Worten klopfte das Herz der Helgunda und zitternd sagte sie zu Wislaw: »wehe! Herr, sein Schwerdt fand ich heute nicht in unserem Bette und über dein Kosen habe ich vergessen, es dir zu entdecken.« Wislaw entgegnete ihr: wenn er auch zehn Schwerdter hätte, könne er ihnen nichts thun, wegen der Eisengebände, die er nur durch Kunst eines Schmides zu lösen vermöchte.
Als jene so unter sich schwatzten, sprang Walther frei von den Ketten, und sie sahen ihn mit geschwungenem Schwerdte vor dem Bette stehen, und nachdem er sie geschmäht hatte, hob er die Hand mit dem Schwerdte und ließ es auf beide herabstürzen. Fallend hieb es beide mitten von einander. So schloß sich beider verächtliches Leben durch ein unseliges Ende. Noch zeigt man das Grab der Helgunda im Schlosse zu Wislicz allen denen, die es zu sehen wünschen, in Stein gehauen, bis auf den heutigen Tag. (d.h. um 1253.)
2. Die heidnische Jungfrau im Schlosse zu Glatz.
Als die Grafschaft Glatz noch heidnisch war, lebte auf dem Schlosse zu Glatz eine Jungfrau, deren Namen uns die Sage nicht aufbewahrt hat, Heidin und versenkt in die größten Ueppigkeiten und Wollüste, dabei eine mächtige Zauberin. Bei ihr lebte ihr Bruder, den sie, wie die Sage geht, sich selbst als Gemahlin verbunden habe.
Mit wunderbarer Stärke begabt, vermochte sie mit ihrem Bogen vom Schlosse zu Glatz bis zu der großen Linde bei Eisersdorf, an der Gränze, zu schießen. Einst wettete sie mit ihrem Bruder, wer mit dem Bogen am weitesten schießen würde, und der Pfeil ihres Bruders erreichte kaum den halben Weg, sie aber reichte mit ihrem Pfeile aus dem Schlosse fast noch einmal so weit, bis zu dem gedachten Baume, der großen Linde bei Eisersdorf, und gewann so die Wette. Zum Zeichen soll man zwei spitze Steine errichtet haben, die man noch vor weniger Zeit gesehen. Außerdem zauberte sie auch und zerriß oft, zur Kurzweile, mit ihren Händen ein starkes Hufeisen; und weil sie eine Zauberin gewesen, ist es gekommen, daß, ob man ihr gleich zum besten nachgetrachtet, man sie dennoch eine Zeitlang nicht hat fangen können; denn durch ihre Zauberkünste ist sie immer wieder entronnen. Doch als man sie zuletzt erhascht, hat man sie in einem großen Saal, welcher sein soll beim Thore, dadurch man aus dem Niederschloß ins Oberschloß gehen kann, fest vermauert und darin umkommen lassen. Zu ewig währendem Gedächtniß ihres Todes und des Orts, allda sie elendiglich umgekommen ist, hat man an der Mauer über dem tiefen Graben, wenn man hinauf geht, zur linken Hand desselben Thores, bei welchem sich das Ober- und Niederschloß unterscheiden, ihr Bildniß, in einem Stein ausgehauen, eingemauert. Diesen ausgehauenen und eingemauerten Stein zeigt man noch bis auf diesen Tag allen fremden Leuten, welche gen Glatz kommen und das Schloß besuchen.
Von dieser heidnischen Jungfrau ist auch fast noch mehr denkwürdig anzuzeigen, daß ihr Bildniß auf dem grünen Saale im Schlosse zu Glatz zu etlichen Malen gar sauber und schön gemahlt gestanden hat. Dann, daß in dem heidnischen Kirchlein auf dem Schloß den fremden Leuten, welche dahin gekommen, solche zu besichtigen, der heidnischen Jungfrauen schönes gelbes Haar, an einem eisernen Nagel in der Wand hangend, gezeigt wird. Es hängt aber so hoch, daß es ein großer Mann, auf der Erde stehend, mit der Hand erreichen kann. Zuletzt erzählt man, daß sie in ihrer Gestalt und Kleidung, wie sie pflegt abgemahlt zu werden, noch öfters im Schlosse zu erscheinen pflegt. Solches Gespenst thut aber niemand etwas, es sei denn, daß jemand spöttisch und höhnisch von ihr redet. Wie man denn sagt, daß dies Gespenst einstmals zu einem Soldaten, der Schildwacht gestanden, gekommen sei und ihm einen Backenstreich mit einer kalten Hand gegeben habe, da er höhnisch von ihr geredet. Auch hat im Jahre 1621 ein Soldat das Haar der heidnischen Jungfrau aus der Kirche weggenommen, worauf das Gespenst in der Nacht zu ihm gekommen ist, in seiner gewöhnlichen Gestalt und hat ihn bis nahe an den Tod geschlagen, gekneipt und gekratzt, bis daß sein Rottgeselle das Haar, auf sein Begehren und Anhalten, wieder an den rechten Ort getragen hat.
3. Die große Linde bei Eisersdorf in der Grafschaft Glatz, nicht weit von der Stadt Glatz.
Von dieser Linde werden viele Fabeln erzählt, nehmlich, daß sie so alt sei, als der heidnische Thurm bei Glatz, und obgleich sie ein und das andere Mal verdorrt, wäre sie doch immer wieder ausgeschlagen. Auch Sibylla soll einst darauf gesessen und von der Stadt Glatz viel zukünftige Dinge geweissagt haben, wobei sie unter andern gesagt: die Türken würden bis gegen Glatz kommen und allda, durch die steinerne Brücke, hinein auf den großen Ring ihren Einzug halten, dort würden sie aber eine große Niederlage erleiden, da ihnen die Christen aus dem Schlosse herunter entgegen ziehen und sie auf dem Marktplatz daselbst erlegen würden. Solches würde aber nicht eher geschehen, es sei denn vorher eine große Menge Kraniche durch die Brodbänke geflogen.
4. Das Bild des Bären und der Jungfrau auf dem Zobtenberge.
Einst wohnten in sehr frühen Zeiten, als noch eine Burg auf dem Zobtenberge stand, eine Fürstin dort, die einen zahm gemachten Bären zu ihrem Zeitvertreib unterhielt und ganz frei umher gehen ließ. Dieser Bär ward einst krank und man rieth der Fürstin, ihm einen Hecht zu essen zu geben, dann würde er wieder gesunden. Die Fürstin, welche mit ihrem armen Kranken ein großes Mitleiden hatte, schickte bald eine von ihren Mägden nach Zobten, um den Hecht zu hohlen. Während dem lief der Bär fort und trift das Mädchen mit dem Hechte am Wege, vom Städtchen Zobten heraus, fällt sie an und beißt ihr den Kopf ab. Die herzueilenden Leute tödten ihn darauf.
5. Das Bild des Mönchs und Wolfs an dem Fuß des Zobten.
Ein Mönch aus dem Kloster des Berges wollte im tiefsten Winter in Berufssachen nach dem Dorfe Groß-Mohnan gehen, ward aber in der damals noch ganz mit Wald bedeckten Gegend, am Fuße des Berges, von einem hungrigen Wolfe angegriffen. Nichts hatte er zu seiner Vertheidigung bei sich, als ein Federmesser, und mit diesem begann der Kampf zwischen Hunger und Verzweiflung. Das wüthende Thier erlag, obgleich im Verfolgen begriffen, der ungleichen Waffe an der Stelle, die sein Bild bezeichnet, das ist etwa eine halbe Meile vom Fuß des Berges. Der unglücklich zerfleischte Mönch schleppte sich noch etwa eine halbe Meile weiter, bis an den Fuß des Hügels, auf dem der Busch von Kiefendorf steht, und gab erst hier seinen Geist auf. Das Andenken seines Heldenmuthes ward in dem Stein verewigt und pflanzt sich noch jetzt in dem Munde der Bewohner der Gegend fort.
6. Wie das Kloster Trebnitz von Heinrich I., Herzoge von Schlesien, erbaut worden und seinen Namen erhielt.
Herzog Heinrich der erste, auch mit dem Barte genannt, der Gemahl der frommen Hedwige, die in die Zahl der Heiligen versetzt und die Schutzpatronin Schlesiens ward, das sie einst milde beherrschte, ritt in den waldigen Höhen, dort wo jetzt im Thale Trebnitz liegt, um zu jagen. Entfernt von seinem Gefolge, kam er in das Thal hinab und stürzte unvermuthet mit seinem Pferde in einen Sumpf; keine Möglichkeit sich zu retten vor sich sehend, wandte er sich, im inbrünstigen Gebet, an seinen Gott und Vater. Und der Engel des Herrn, gehüllt in die Tracht eines Köhlers, trat zu ihm, reichte ihm einen Baumast und rettete ihn. Da kniete der Herzog hin, dankte Gott und gelobte, ein Kloster an dieser Stelle zu bauen. So entstand das Jungfrauenkloster Trebnitz, das so reichlich beschenkt und begabt ward von dem milden Herzoge und seiner frommen Gemahlin, daß, als er die Nonnen fragte: »ob sie noch etwas verlangten?« sie antworteten: »wir bedürfen nichts,« und davon erhielt es seinen, dies auf Pohlnisch bedeutenden, Namen Trebnitz. Man sang einst ein altes Volkslied über diesen Vorfall, das da lautet:
Der edle Herzog Heinrich zu Pferd'
Stürzt in den Sumpf gar tief, tief, tief.
Seines Lebens er sich schier verwehrt',
Als Gott seinem Engel rief, rief, rief.
Der Engel nahm ein' Köhlertracht
Und trat zum Sumpf hinan, an, an,
Und schnell dem Herrn ein Aestlein bracht:
»Da halte der Herr sich dran, dran, dran.«
Und als der Herzog g'rettet war,
Da kniet' er freudig hin, hin, hin:
»O Herr, wie ist es wunderbar,
Daß ich gerettet bin, bin, bin!«
»Und bin ich dann gerettet nu,
Bau ich ein Kloster dir, dir, dir;
Daß man dir dien' in Fried und Ruh
Auf diesem Flecklein hier, hier, hier.«
Das Kloster war gar schön gebaut,
Deß freut' sich, wer es sah, sah, sah.
Und manche fromme Gottesbraut
Kam hin von fern und nah, nah, nah.
»Was b'gehrt ihr edle Jungfraun mehr?«
Der Herzog fragt sie dann, dann, dann.
»Wir b'dürfen nichts und nimmermehr,
Dieweil wir alles ha'n, ha'n, ha'n.«
»Und weil euch denn nichts Noth mehr ist,
So sei denn dieser Nam', Nam', Nam':
Trebnitz, das heißt: wir b'dürfen nichts:«
Den Namen es bekam, kam, kam.
7. Die Ermordung der Tartarischen Kaiserin zu Neumarkt im Jahre 1240.
Bei denselbigen Zeiten da regierte ein mächtiger und reicher Tartarischer Kaiser in dem Aufgang der Sonnen. Derselbige unter ihm viel Könige, Fürsten und Herren hatte; welcher mit dem Namen Batus geheißen war. Dieser Kaiser hatte auch ein Gemahl, welche ihm vertraut war nach Weise und Gewohnheit der Tartaren. Diese Tartarische Kaiserin hörte sagen oft und vielmal von ihren Herren und Ritterschaften, von den Sitten und Gewohnheiten der Christenlande, wie die gar löblich und ehrlich wären. Auch desgleichen von der Großmächtigkeit ihrer Fürsten, Herren und Ritterschaften, wie allerwegen dieselbigen bereit wären zu verfechten denselbigen, ihren christlichen Glauben, nicht allein bis auf die Vergießung ihres Blutes, sondern auch bis in den Tod.
Da diese Kaiserin oftmals hatte gehört von den Ihren solch groß Lob der christlichen Fürsten und Ritterschaft, auch von den löblichen und ehrlichen Gewohnheiten derselbigen Lande und Städte, ward sie entzündet aus großer hitziger Liebe und inbrünstiger Begier, solche Land und Städte, desgleichen die Ritterschaft der Christenheit, persönlich zu beschauen. Demnach lag sie ihrem Herrn, dem Kaiser, mit fleißiger und stäter Bitte an, ihr solches zu erlauben, daß sie möchte erfahren die Dinge, welche ihr hatten gesaget ihre Herren und Ritterschaft. Aber der Kaiser allewege ihr die Bitte versagete und abschlug. Aber wiewohl er nicht erlauben wollte ihr Begehren, ließ sie doch nicht ab von solchem Vornehmen und von ihrer Bitte, also lang, bis zuletzt derselbige Kaiser, ihr Gemahl, ihr solche ihre Bitte zusagete und erlaubte, von deswegen sie aus dermaßen sehr erfreut ward, in ihrem Herzen und Gemüthe.





























