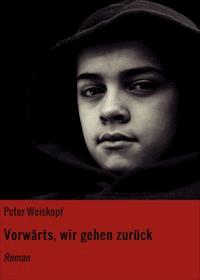
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gegen Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts sprach man noch von Gastarbeitern. Fremdenfeindlichkeit, die sich bis zum Hass steigern konnte, grassierte auch zu jener Zeit in Deutschland. Der intelligente Thomas Bunzlau gründet eine Jugendbande, von ihm und seinen Kameraden Heimatschutzverein genannt. Durch eine Verkettung von Zufällen, die er gnadenlos durch Erpressung ausnutzt, gelangt er zu Geld, das er zum Nutzen seines Ansehens bei seinen Kameraden und zum Machtaufbau verwendet. Beeinflusst durch seinen Großvater, einen Altnazi, entwickelt er eine verhängnisvolle Verehrung für Adolf Hitler. Er bildet sich ein, seine Heimatstadt, eine Kleinstadt im Ruhrgebiet, von Ausländern "reinigen" zu müssen. Mit kaltblütiger Gerissenheit und Cleverness verleumdet er selbst und lässt durch seine Kameraden, die ihm fast hörig sind, ausländische Mitbürger falsch beschuldigen und denunzieren. Bald ist ein nicht unerheblicher Teil der deutschen Bürger der Stadt Gerüchten folgend infiziert vom Gift des Fremdenhasses. Dann taucht ein Mann auf, der sich Thomas Bunzlau entgegenstellt, ihn bedroht und demütigt. Nun steigert sich der Hass des Jungen ins Unermessliche. Es kommt zur Katastrophe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Weiskopf
Vorwärts, wir gehen zurück
Roman
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ERSTER TEIL
ZWEITER TEIL
DRITTER TEIL
VIERTER TEIL
FÜNFTER TEIL
Impressum neobooks
ERSTER TEIL
1
Der Fahrer des LKWs stieg aus dem Führerhaus. Er zitterte. Er hat etwas zu verbergen, dachte der Vopo. Ich glaube, wir haben da etwas entdeckt, das uns Lob einbringen wird. Der andere Vopo hielt seine Maschinenpistole in Anschlag und forderte den Fahrer auf, sich ruhig hinzustellen.
Kurz darauf hob der Vopo, der in das Führerhaus gestiegen war, die Decke hoch, die etwas unordentlich auf der Schlafkoje des LKWs lag. Seine Augen weiteten sich, als er den Mann sah, der darunter verborgen lag. Er forderte ihn auf auszusteigen. Der Mann war nassgeschwitzt, und in seinen Augen konnte man die Angst sehen, die ein Mann hat, der glaubt, dass sein Leben zu Ende gehen müsse. So vieles ging ihm jetzt durch den Kopf. Entweder, so dachte er, werden sie mich sofort erschießen, oder ich schaffe es wegzulaufen. Der ursprüngliche Plan, sich den Behörden zu stellen und um Asyl zu bitten, spielte jetzt keine Rolle mehr. Sie würden ihm sowieso nicht glauben, dass er beabsichtigt hatte, sich freiwillig zu stellen. Sie würden ihn an die Bundesrepublik Deutschland ausliefern und das würde lebenslängliche Haft bedeuten. Es gab jetzt nur noch eines: Er musste versuchen wegzukommen. Es war vollkommen sinnlos, aber er versuchte es trotzdem. Kaum stand er mit beiden Beinen auf dem Erdboden, rannte er los wie nie in seinem Leben. Er wartete auf die Schüsse, Aber sie kamen nicht — noch nicht.
„Bleiben Sie stehen, bleiben Sie sofort stehen“, rief einer der Vopos. Aber der Mann lief einfach weiter. Werde ich die Schüsse hören, dachte der Mann oder werde ich zunächst die Einschläge spüren? Im nächsten Augenblick bekam er die Antwort: Beides drang gleichzeitig in sein Bewusstsein.
Er hörte das hässliche Rattern einer Maschinenpistole und im selben Augenblick zerriss ein wahnsinniger Schmerz seinen Rücken, Alles dauerte höchstens eine Sekunde, dann hörte und fühlte er nichts mehr.
2
Anton Bunzlau hatte in den letzten Tagen schon mehrere Artikel aus den Zeitungen ausgeschnitten. Jetzt schnitt er auch diesen aus. Er las ihn immer wieder:
„...ist kurz hinter dem Grenzübergang Boizenberg von DDR-Volkspolizisten auf einen Mann geschossen worden, der in einem aus der Bundesrepublik gekommenen LKW entdeckt worden war. Wie die Nachrichtenagentur Reuter mitteilte, hatte der Mann zu flüchten versucht, nachdem er ausgestiegen war. Ob der Mann die Schüsse aus einer Maschinenpistole überlebt hat, ist immer noch unklar. Ebenso ist seine Identität noch nicht geklärt. Die DDR-Behörden schweigen sich noch aus. Bei den westlichen Behörden wird aber vermutet, dass es sich um den mutmaßlichen „Friedhofsmörder“ handeln könnte, nach welchem die Polizei seit einigen Tagen fieberhaft fahndet...“
Anton Bunzlau las auch die früheren Artikel noch einmal durch:
„...konnte bisher noch nicht mit Sicherheit festgestellt werden, aus welchen Gründen sich das zehnjährige Mädchen in die Kapelle begeben hatte, in der es auf so grauenhafte Weise ums Leben kam. Die Polizei vermutet einen Mord hinter dem mysteriösen Tod des Mädchens, räumt aber ein, dass ihr bisher noch jeglicher Beweis fehle...“
„...hält die Polizei neuesten Ermittlungsergebnissen zufolge für möglich, dass es sich bei dem erschreckend grausamen Tod des zehnjährigen Mädchens (wir berichteten darüber) um einen Ritualmord einer Kinderbande handeln könnte, als deren Anführer ein hochintelligenter elfjähriger Junge angenommen wird...“
3
„Oh nein, ich kann das nicht verstehen, warum tut denn niemand etwas, warum lässt man das einfach so geschehen?“
Die Frau in den Fünfzigern mit dem ärmlichen Mantel stand zwischen einigen acht- bis zwölfjährigen Jungen und stieß diese Worte fast schrill aus, als wäre sie der Panik nahe. Aber niemand wollte Notiz von ihr nehmen.
Ein gut gekleideter Herr mit angegrauten Schläfen, der neben der Frau stehen blieb, legte beruhigend seine gepflegte Hand auf den Arm der Frau und sagte in fast mitleidigem Ton: „Doch, gnädige Frau, das ist menschlich. Das ist ja das Traurige.“ Die Frau sah ihn erstaunt an.
„Aber ich bitte Sie, mein Herr, können Sie denn da nicht einschreiten? Man kann doch nicht einfach zusehen.“ Die Frau war den Tränen nahe, sie konnte nicht recht begreifen, was sie sah.
Der elegante Herr begann sich einen Weg durch die Ansammlung von vielleicht acht Jungen zu bahnen und schritt fest und sicher auf die beiden Kampfhähne zu. Der Größere, Überlegenere der beiden war etwa zwölf Jahre alt, der Kleinere vielleicht sieben Jahre, aber er war mindestens einen Kopf kleiner und zehn Kilogramm leichter als sein Gegner. Mit einem festen Griff fasste der Mann den großen Jungen am Kragen und zog ihn zurück.
Fauchend und um sich schlagend hing der Bengel wie ein Kaninchen an der harten Faust des eleganten Herrn.
„Was – was wollen Sie? Lassen Sie mich sofort los!“ giftete er den Mann an, in dessen Gewalt er sich nun zu seinem ungeheuren Erstaunen befand.
„Du wirst jetzt aufhören, auf dem Kleinen herumzuschlagen“, sagte der Mann mit seiner ruhigen Stimme, „oder ich bringe dich zur Polizei.“ Der quirlige kleine Schläger schien es nicht fassen zu wollen, dass ein so gepflegt aussehender Mensch eine solche Kraft besaß. Das junge fleischige Milchgesicht des Bengels begann nun seine Farbe zu wechseln. Seine Züge drückten abgrundtiefen Hass aus. Allein die Frau mit dem ärmlichen Mantel schien den Hass des Jungen zu erkennen, der von ihm ausging. Sie konnte ihn geradezu fühlen. Die Gedanken der Frau wirbelten um die Frage, wieso ein Kind einen solchen Hass entwickeln könne. Sie fühlte Angst vor diesem Kind.
„Wenn Sie mich nicht sofort loslassen“, keifte der Junge, wobei seine Stimme die Heiserkeit des Zorns zu überwinden suchte, „dann passiert ein Unglück. Sie dürfen mich nicht anfassen, niemand darf das, niemand, verflucht, lassen Sie mich los.“
Der Junge trat und boxte nun nach allen Seiten. Wie es so oft ist, wenn es um das gewaltsam ehrgeizige Erreichen eines Zieles geht, richtete sich das Streben des Bengels in die verkehrte Richtung und bewirkte so das Gegenteil. Der elegante Herr, der eigentlich nur den kleineren Jungen von dem größeren befreien wollte, sah sich gezwungen, seinen Griff zu verstärken und seinen anderen Arm mit ins Gefecht zu bringen, indem er das linke Handgelenk des Jungen umfasste, um so wenigstens einem Teil der Attacken zu begegnen, denen er nun selbst ausgesetzt war. Einige neugierig zusehende Passanten, die mittlerweile von der Auseinandersetzung angelockt worden waren und durch Ihr verspätetes Eintreffen den eigentlichen Ursprung der Auseinandersetzung nicht objektiv erfassen konnten, begannen zu murmeln und vereinzelte Bemerkungen von sich zu geben, die den Tatsachen nicht gerecht werden konnten. Denn vor ihren Augen spielte sich genau das ab, was vorher den eleganten Herrn veranlasst hatte einzuschreiten. Stimmen, die den nun gar nicht mehr so elegant aussehenden Herrn aufforderten, sich doch nicht an einem kleinen Jungen zu vergreifen, wurden vernehmbar. Aber auch besser informierte Bemerkungen, man solle doch den Mund halten, der Mann wisse schon was er tue, ließen nicht auf sich warten. Der Herr begann nun, das Fatale der Situation zu ahnen. Den Jungen loszulassen, schien ihm nicht mehr möglich. Wie unter einem magischen Zwang wurden seine Hände und Arme zu schier unüberwindlichen Zangen.
„Hör auf zu schlagen, dann lasse ich dich los“, sagte er selbst schon etwas außer Atem gekommen. Der Junge hatte ein furienhaftes Stadium, den Höhepunkt der Raserei erreicht, in dem der Mensch, bar jeder noch so infantilen Vernunft, seinem urinstinktiven Aggressions- und Vernichtungswillen erliegt.
„Du Bastard, du Hund, ich bringe dich um“, schrie er das distanzierende Sie vergessend mit hysterischer Stimme. Irgendwie gelang es dem Jungen, seinen linken Arm, um dessen Handgelenk die stählerne Faust seines überlegenen Gegners gepresst war, in die Höhe seines Gesichtes zu bringen und seine Zähne in die weiche Stelle des Handrückens zu schlagen. Mit affenhafter Vehemenz biss er zu und spürte fast im gleichen Moment den widerlichen Geschmack von rohem Fleisch in seinem Mund, zersetzt mit der ekelhaft lauen Wärme des fremden Blutes.
Der Besitzer der geschundenen Hand, schockiert von dem stechenden Schmerz, stieß einen lauten Schrei hervor und löste im selben Moment seinen Griff. Er musste seine Hand regelrecht aus dem Gesicht des Jungen herausreißen, wobei durch dessen satanisch zähes Festhalten eine offene Wunde entstand. Nun geriet auch der Mann, der bis dahin einen Rest seiner Distinguiertheit bewahrt hatte, in impulsive Wut. Ohne groß auszuholen, aber trotzdem mit gehöriger Wucht, gab er dem Bengel eine Ohrfeige, dass es voll und satt klatschte. Der Junge drehte sich halb um seine eigene Achse, als wolle er sehen, was hinter ihm vorging, und fiel über seine eigenen Beine in den Staub des Bürgersteigs, auf dem sich die ganze Szenerie entwickelt hatte.
Aus der Traube von Zuschauern, die sich inzwischen noch um einiges vergrößert hatte, löste sich plötzlich ein junger Mann mit kurzem Haarschnitt und militantem Auftreten. Er schritt, Kampflust in den Augen, auf den verletzten, vermeintlichen Kindesmißhandler zu. Es war der Bruder des wilden Jungen, der während seiner Mittagspause von seiner Arbeitsstelle, einem Sportgeschäft auf derselben Straße, nach Hause ging. Er war von der Menschenansammlung angezogen worden und hatte in der wütenden Furie seinen Bruder erkannt. Mit einer schnellen Bewegung umklammerte er von hinten den angeschlagenen, aber noch immer gepflegt wirkenden Herrn und rief seinem Bruder, der längst wieder auf den Beinen wer, eindeutige Aufforderungen zu:
„Los Thomas, mach ihn fertig, ich halte das Schwein fest! Na los, gib‘s ihm!“
Noch ehe jemand einschreiten konnte, versetzte der vor Wut und Hass schäumende Junge dem momentan perplexen und wehrlosen Mann einen Tritt in den Unterleib. Der so gequälte, ursprüngliche Schlichter eines Streites, stöhnte schwer getroffen auf und sackte in den Armen des großen Bruders zusammen. Sein Oberkörper hing schlaff nach vorn und es sah aus, als ob er das Bewusstsein verloren hätte, was bei einem solchen Tritt auch niemand hätte wundernehmen können. Der kleine Teufel witterte seine Chance zur vernichtenden Rache. Wie herbeigezaubert hatte er plötzlich einen gänseeigroßen Stein in der Hand, mit dem er sich nun anschickte, auf den Kopf des Gegenstandes seines Hasses einzuschlagen. Welch wundersame Fügung jedoch, die nun endlich die sensationslüsterne Stimmung der Zuschauenden in einen Zustand der Besorgnis umwandelte. Plötzlich schienen die Leute die Gefahr zu spüren, die von dem Kinde ausging. Buchstäblich im letzten Augenblick gelang es einem alten Mann, mit einem Spazierstock dem Bengel den Stein aus der Hand zu schlagen, wobei er den Unterarm des Jungen aufs Empfindlichste traf. Dieser schrie auf und wollte sich nun auf den alten Mann stürzen. Geistesgegenwärtig hob der alte Mann seinen Stock zum zweiten Male und versetzte dem Angreifer einen Schlag auf die rechte Schulter. Unterdessen hatte der große Bruder der kleinen Furie den schlaffen Körper des gequälten Widersachers fallen lassen. Er forderte seinen Bruder, dessen Arm schlaff herabhing und der unfähig zu jeder Angriffsaktion geworden war, auf, den Ort des Geschehens jetzt flugs zu verlassen. Denn er spürte sehr wohl, dass inzwischen alle Sympathien der Zuschauer umschlugen und sich gegen ihn und seinen Bruder richteten.
„Komm wir verschwinden!“ rief er und begann im Laufschritt den Kampfplatz hinter sich zu lassen, wobei der Kleine hinter ihm her trabte.
„Mensch, Horst, gut, dass du gekommen bist. Dieser Hund hatte eine tierische Kraft“, keuchte Thomas seinem älteren Bruder zu, während sie nunmehr nebeneinander die Straße entlang in Richtung auf ihr Elternhaus zu hasteten .
„Auf jeden Fall hat der Türke genug, Den hast du voll getroffen, Tommy“, gab Horst zu bedenken, „der steht so schnell nicht wieder auf.“
„Was sagst du, Türke, wieso Türke?“ Tommy stutzte und verminderte unversehens seinen Laufschritt.
„Ich kenne ihn“, sagte Horst, indem er nun gemäßigten Schrittes seinen Weg neben seinem Bruder fortsetzte. „Er hat ein Restaurant in der Bebelstraße. Gar kein schlechter Laden, aber eben ein Stinktürke. Ich würde da nicht essen gehen.“ Er zog dabei ein Gesicht, das Verachtung ausdrücken sollte. „Aber sag mal“, wollte er nun wissen, „wie bist du mit dem Kerl zusammengerasselt, was hast du mit dem zu tun?“ Tommys Wut schien wieder aufflackern zu wollen. Seine Augen blitzten bei dem Gedanken an das Auftauchen des Mannes.
„Dieses Schwein“, begann er seine Erklärung, „hat sich einfach eingemischt, als ich so eine Kröte aus unserer Schule vermachen wollte. Gerade wollte ich der Rotznase den Rest geben, weil sie mich beleidigt hatte, da war auf einmal der Kerl hinter mir und zog mich am Kragen zurück.“ Er habe im ersten Moment gar keine Luft mehr bekommen, setzte er seinen Bericht fort, und die Kröte, die ihn zu beleidigen gewagt habe, sei natürlich auf und davon. Aber um den wolle er sich noch kümmern das habe Zeit. „Und den Türken, den nehme ich mir auch nochmal vor“, erklärte Tommy seinem Bruder, „der wird noch an mich denken. Wo kommen wir denn da hin, wenn wir uns von jedem anfassen lassen, und noch dazu von einem dreckigen Türken?“ Er holte tief Atem. „Mann“, stieß er hervor, „das hätte ich wissen müssen, dass das ein Türke ist. Die Eier hätte ich ihm abgerissen. Aber der wird noch bereuen, dass er mir begegnet ist!“
4
Inzwischen hatte sich die Menschenansammlung aufgelöst, wie bei einem plötzlichen Stimmverlust eines Propagandisten. Man erinnerte sich daran, dass man schließlich Besseres zu tun habe, als in der Gegend herumzustehen und sich Zänkereien anzusehen.
Nur die Frau mit dem ärmlichen Mantel, die den eleganten Herrn gebeten hatte, dieser brutalen Auseinandersetzung ein Ende zu machen, war noch am Ort des Geschehens und sprach hilflos, sich für die verhängnisvolle Entwicklung der Auseinandersetzung verantwortlich fühlend, auf den arg traktierten Mann ein. Dieser hatte sich aber schon wieder ganz gut erholt; er schien überhaupt über eine gute Konstitution zu verfügen. War er doch unmittelbar nach dem Verschwinden seiner brutalen Gegner von den schmutzigen Steinfliesen des Bürgersteigs aufgestanden, um fast fidel seine Kleidung von dem haftengebliebenen Staub zu befreien.
„Bitte, verzeihen Sie mir, mein Herr, aber ich konnte ja nicht wissen, dass so etwas - ach - dass so etwas passieren würde. Oh mein Gott, ich hätte Sie dann doch nie gebeten, dem Jungen zu helfen.“ Die Tränen standen der Frau im Gesicht und es hatte etwas Rührendes, wie sie sich um den Mann sorgte und ihm half, seinen Anzug zu reinigen. „Und Ihre Hand! Um Himmels Willen, sie muss behandelt werden. Sie müssen ins Krankenhaus.“ Der Mann zeigte ein freundliches Lächeln.
„Aber, ich bitte Sie, liebe Frau, das kommt schon alles wieder in Ordnung!“ Die Frau hatte sich etwas beruhigt. Vielleicht, weil die angenehme Stimme des Herrn eine wohltuende Wirkung auf sie ausübte. „Übrigens, mein Name ist Murat Kazir“, sagte der nun wieder geradezu vornehm wirkende Herr.
Ach, ob er Ausländer sei, fragte die Frau ganz verblüfft, das habe sie gar nicht gemerkt.
„Ich bin Türke“, gab Murat Kazir zu verstehen, und er habe in der Bebelstraße ein kleines Lokal. Ob sie es vielleicht kenne? In Deutschland lebe er schon seit 15 Jahren, daher habe er also genügend Gelegenheit gehabt, die deutsche Sprache zu erlernen. Es freue ihn, dass sie ihn für einen Deutschen gehalten habe. „Ich versuche immer ordentlich zu sprechen, man hat es dann als Ausländer leichter in Deutschland.“ Ein sympathisches Lächeln forderte seinen Platz in seinem Gesicht. Murat Kazir war ein stattlicher Mann von 45 Jahren, die man ihm aber nicht ansah.
„Aber ja, aber ja, wie Recht Sie haben“, stimmte die Frau von ganzem Herzen zu, vergessend, dass man sich bei solchen Gelegenheiten ebenfalls vorzustellen pflegt.
„Sie sind wirklich sehr liebenswürdig... eh — hm — liebe Frau.“ Murat vermied es, die Frau nach ihrem Namen zu fragen. Er war sich nicht sicher, ob sie absichtlich ihren Namen nicht genannt hatte. So ganz würde er die Deutschen wohl nie kennenlernen, obwohl er seit elf Jahren mit einer deutschen Frau verheiratet war. Aber die liebenswürdige ältere Dame hatte wirklich einfach vergessen, sich den üblichen Gepflogenheiten entsprechend vorzustellen.
„Jetzt muss ich aber gehen“, die Frau sah auf ihre Armbanduhr. „Mein Mann wartet sicher schon, Er legt nämlich großen Wert darauf“ dass wir pünktlich zu Mittag essen.“
„Ich würde mich sehr freuen“, sagte Murat Kazir, „wenn ich Sie und Ihren Mann einmal als Gäste in meinem Lokal begrüßen könnte.“ Er gab der besorgten Frau die Hand, „Auf Wiedersehen“, sagte er. Die Frau hielt seine Hand einen Augenblick fest. Er solle auf jeden Fall die Hand behandeln lassen, legte sie ihm mit fast bittendem Ton ans Herz, sie und ihr Mann würden bestimmt einmal nachsehen, kommen, das sei ein Versprechen.
5
Der Regen prasselte an die Fensterscheiben des Reihenhauses am Rande der kleinen Stadt, als wäre er erbost darüber, dass man ihn nicht hereinließ. Wenigstens spülte er den Staub von den Häuserwänden, der wegen des Zementwerkes, das am Stadtrand produzierte, in reichlichem Maße vorhanden war. Es war ein trüber Tag, einer von denen, die Depressionen erzeugen konnten, selbst bei Menschen, die sonst mit einer regelrechten Frohnatur gesegnet waren.
Thomas und Horst saßen im Wohnzimmer ihres elterlichen Hauses und sahen auf den Fernsehschirm. Jeder hing seinen eigenen Gedanken nach und registrierte kaum, was sich vor seinen Augen abspielte. Seit vor drei Jahren ihre Mutter gestorben war, empfand Horst die elterliche Wohnung als noch trostloser denn je. Die beiden Brüder lebten mit ihrem Vater und dessen Vater in der Wohnung, die ohne ihre Mutter immer zu groß und unaufgeräumt schien. Sowohl Thomas wie auch Horst verstanden sich mit ihrem Vater nicht gut. Es hatte immer ein gespanntes Verhältnis bestanden und das nicht erst seit dem Tode der Mutter; eigentlich schon so lange wie sie denken konnten. Sie liebten beide ihren Großvater. Er war ein alter Kriegsveteran und konnte sie immer wieder mit Kriegsgeschichten und überhaupt mit Geschichten aus dem Dritten Reich begeistern. Stundenlang konnten sie ihm zuhören. Großvater verstand es ausgezeichnet, die Phantasie der Jungen mit seinen Erzählungen anzuregen. War er doch selbst immer wieder von Rührung ergriffen, wenn die alten Bilder von der Machtergreifung vor ihm auftauchten, und er sich in der Uniform eines Feldwebels der Wehrmacht wiedersah. Thomas und Horst träumten sich oft in diese Zeit hinein und sahen sich als Generalstabsoffiziere im Dunstkreis des „Führers“, ohne jedoch zu ahnen, dass der Geist des Generalstabs gar nicht immer so sehr mit dem des Führers übereingestimmt hatte.
An diesem Nachmittag waren die Brüder allein zu Haus. Vater und Großvater waren auf dem Friedhof am Stadtrand, um ihre Frauen zu versorgen, wie sie es zu nennen pflegten. Horst hatte seinen freien Nachmittag. Mit seiner Laune stand es nicht zum Besten, und sie wurde auch dadurch nicht gerade gehoben, wenn er daran dachte, dass sein Vater wieder betrunken nach Hause kommen könnte. Dieser war durch einen Zechenunfall unter Tage Rentner geworden. Seitdem trank er noch mehr als vorher und auch Großvater konnte ihn nicht davon abhalten, dem Friedhofsbesuch einen Kneipenbesuch folgen zu lassen. Die Gedanken der beiden Brüder wurden jäh von der Klingel des Telefons unterbrochen:
„Mach mal den Kasten aus, Tommy, man versteht sonst kein Wort“, sagte Horst, indem er auf das Telefontischchen in der Ecke des Wohnzimmers zuging.
„Wahrscheinlich dein Busenfreund“, gab Tommy mit einem Hauch von Sarkasmus in der Stimme zu verstehen.
„Ich trete dir in den Arsch, wenn du dir deine dämlichen Bemerkungen nicht abgewöhnst“, fauchte Horst, der an seiner empfindlichsten Stelle getroffen war. Tommy hatte Übung darin, kleine sarkastische Spitzen gegen seinen Bruder abzuschießen.
„Spar dir das für deinen Freund, der hat es verdient, und ich glaube, er mag es sogar.“
Horst nahm verärgert den Hörer ab.
„Bunzlau:“
„Tag Hotte. Du, ich kann heute nicht, ich muss mit meinem Vater nach Düsseldorf zu einer Besprechung“, kam es aus dem Hörer zurück. Es war Horsts Freund Axel Wagner.
„Kann er denn nicht allein fahren, verdammt nochmal?“ fragte Horst in die Sprechmuschel. Aber es war eine rein rhetorische Frage, Horst wusste das.
„Wir wollen nicht wieder darüber streiten“, kam die Antwort,
„wir sehen uns morgen.“ Es knackte in der Leitung, Axel hatte aufgelegt.
„Tommy, einmal platzt mir der Kragen, dann haue ich dir den Kopf viereckig!“ Horst war sauer. Seine Laune war auf dem Tiefpunkt. Tommy sah seinen Bruder verschmitzt an.
„Das wirst du hübsch bleiben lassen Bruderherz, und du weißt warum!“
Horst hatte manchmal das Gefühl, er wäre elf Jahre alt, und sein Bruder 21 — eine Umkehrung der wahren Verhältnisse. Tommy war geradezu ungewöhnlich intelligent, spitzfindig und beängstigend schlau und gerissen. Ein elfjähriger Junge, der manchmal seinem 21-jährigen Bruder so überlegen war, dass Horst immer darauf bedacht sein musste, sich mit ihm gutzustellen. Tommy war obendrein nachtragend, bösartig, so schien es Horst, und er war absolut unfähig zu jeglichem Mitgefühl. Ein enfant terrible par exelence! Verwandte der Familie, die hin und wieder, wenn auch selten, in das so friedlich anmutende Reihenhaus mit dem vom Großvater mit Hingabe gepflegten Garten kamen, konnten sich des Eindrucks einer Terrorherrschaft des kleinen Tommy über die Familie nicht erwehren. Das hatte sie denn auch veranlasst, sich immer mehr zurückzuziehen, und die Besuche nach und nach einzustellen.
Walter Bunzlau, der Vater der Jungen, wusste nur zu gut, dass er für seine Söhne keine Autorität darstellte und vor allem Tommy immer zynischer und unberechenbarer wurde. So rutschte ihm auch nur noch dann die Hand aus, wenn er vor Zorn die Beherrschung verlor, um im Übrigen darauf bedacht zu sein, Frieden zu halten mit der „Viper“, wie er seinen Sohn Thomas in Gedanken nannte. Oft stellte sich Walter Bunzlau die Frage, wie es seinem Vater, dem Großvater seiner Söhne, gelang, einen so beständigen Frieden mit den beiden zu halten, wobei Horst ja eigentlich gar kein Problem darstellte. Aber eben auch Tommy war seinem Großvater gegenüber rücksichtsvoll, ja fast zuvorkommend und höflich. Lag es nur an den Geschichten, die der Alte so hinreißend zu erzählen vermochte, so dass er, Walter Bunzlau, selbst zuweilen fasziniert zuhörte, oder war es seine energische, virile Ausstrahlung, die getragen von einer militärischen Haltung trotz seiner 72 Jahre voll zur Geltung kam? Diese wurde von einer Stimme unterstrichen, die selbst bittend noch zu befehlen schien. Anton Bunzlau war sich seiner männlichen Ausstrahlung voll bewusst. Er sah gern in den Spiegel und zwirbelte seinen Schnurrbart, den er nach dem Vorbild des Kaisers Wilhelm II. hegte und pflegte. Kaiser Wilhelm II. war so lange sein Idealbild gewesen, was Haltung und Gesinnung anbelangte, bis jener Mann über Deutschland kam wie Blitz und Donner über eine Horde augenkranker Kaninchen, und Kommunisten, Demokraten, Zentrum und was sonst noch herumkroch in dem „Rattennest“, das sich Weimarer Republik nannte, das Fürchten lehrte. Sein altes Kaiser Wilhelm II.-Bild musste verblassen bei dem Eindruck, den dieser Mann auf ihn machte. Nannte der doch die Dinge beim Namen und fasste das Übel an der Wurzel.
„Ein Mann muss hart sein, unnachgiebig und zielbewusst“, war einer von Großvaters axiomatischen Sätzen, die von seinen Enkeln und ganz besonders von Tommy aufgesogen wurden und längst zu ihrer Maxime geworden waren.
Walter Bunzlau war es nie gelungen, ein rechtes Verhältnis zu seinem Vater herzustellen. Seit eh und je nörgelte der Alte an ihm herum, zieh ihn des zähflüssigen Denkens und nannte ihn oft einen Weichling, mit dem kein Krieg zu gewinnen sei. Mit 16 Jahren hatte Walter Bunzlau angefangen, sich für die Oberweiten und die weiße Glätte der Schenkel des weiblichen Geschlechtes zu interessieren und hatte sich, selbst von stattlicher Physiognomie und nennenswerter Vitalität, zu einem Schürzenjäger entwickelt. Das blieb er, bis der Tod seiner Frau vor drei Jahren, die ihm mehr bedeutet hatte, als er sich vorher bewusst gewesen war, ihn die Liebe zu einem anderen Partner lehrte: Zum Alkohol.
Anton Bunzlau, der stattliche Großvater, billigte die Haltung seines Enkels Tommy, die dieser seinem Vater gegenüber an den Tag legte, manchmal unterstützte er sie sogar. Horst, zu dem der Großvater eigentlich überhaupt keine Beziehung hatte, weil er der Meinung war, man wisse nie, ob dieser Fisch oder Fleisch sei, konnte bei allen Bemühungen niemals dieses Maß an Zuneigung und Wohlwollen des Großvaters erreichen wie es Tommy möglich war, obwohl ihm sehr viel daran lag. Diese Tatsache ließ Horst oft neidisch auf seinen Bruder sein, was Tommy mit seinem ausgeprägten Sinn für menschliche Schwächen merkte, und es ihn genießen ließ.
Seit zwei Wochen hatte Tommy ein Wissen — und damit Macht — über Horst erlangt, wofür er dem Zufall dankbar war. Tommy wusste, dass er mit diesem Wissen das kleine Quäntchen Achtung, das Horst sich bei ihrem Großvater sprichwörtlich erkämpft hatte, vernichten konnte — und voraussichtlich nicht nur die Achtung des Großvaters. Horsts Gedanken kreisten um den einen Punkt: Wie komme ich bloß aus diesem Schlamassel wieder heraus? Abgesehen davon, dass er seinem Bruder ständig Geld zustecken musste, war zu fürchten, dass Tommy ihn, früher oder später, auch noch zu anderen Dingen erpressen würde. Er kannte seinen Bruder. Nach dem Telefongespräch war der Fernseher ausgeschaltet geblieben, und umso deutlicher war das Prasseln des Regens zu hören. Horst war in Weltuntergangsstimmung.
„Was hast du denn Brüderchen?“ fragte Tommy spöttisch. „Bist du traurig, dass dein Freund nicht kommen kann?“ Horst warf ihm einen gequälten Blick zu.
„Heute bist du wieder oben auf, aber gestern hättest du schlecht ausgesehen, wenn ich nicht dazu gekommen wäre; hast du das schon vergessen?“ Tommy blinzelte seinen Bruder an. „Der Türke hätte Hackfleisch aus dir gemacht“, setzte Horst noch hinzu. Tommy grinste zurück.
„Hat er aber nun mal nicht. Aber warte ab, was ich noch mit ihm mache. Ausländerpack!“
„Pass lieber auf, dass du dir nicht die Finger verbrennst“, mahnte Horst, „der ist kein kleiner Junge wie dieser Martin, der dich beleidigt hatte.“
„Er hat Addi beleidigt, aber das kommt aufs Gleiche raus. Wer meine Freunde beleidigt, der beleidigt mich.“
„Manchmal tust du so, als würdest du ihn persönlich kennen“, sagte Horst, „und außerdem, glaubst du denn, er wäre damit einverstanden, von dir Addi genannt zu werden?“
Tommy gab seinem Ton eine Nuance von Wichtigkeit: „Soll jeder wissen, von wem ich spreche? Ich wüsste schon, wie ich ihm gegenübertreten müsste. Ich kenne 'Mein Kampf' rauf und runter.“
„Ich weiß, ich weiß“, lenkte Horst ein, „ich schließlich auch.“ Er fragte sich, ob Tommy wirklich alles verstanden hatte, was in diesem Buch stand. Aber andererseits kannte er die Auffassungsgabe seines Bruders, die ihm schon oft unheimlich erschienen war.
„Hotte.“
„Mmh.“
„Ich habe es mir überlegt, ich will gar nicht mehr in eurem Heimatschutzverein aufgenommen werden; ihr mit euren Statuten: Mindestens 14 Jahre alt und was nicht alles; ihr könnt mich mal, ich baue mir meine eigene Truppe auf!“
„Das traue Ich dir zu“, meinte Horst, „bei Gott, das traue ich dir zu.“
„Das darfst du auch“, Tommy tat selbstsicher, „und wenn die Truppe steht, dann bringe ich dieses lahme Provinznest auf Vordermann!“ Nach einigen Minuten des Schweigens nahm Tommy den Faden wieder auf: „Sag mal Hotte, was da neulich in der Zeitung gestanden hat, das war doch wohl reichlich übertrieben, oder? 'Rowdygruppe macht Stadt unsicher', nur weil ihr auf der Kirmes ein wenig herumgeballert habt“
Horst grinste amüsiert. „Bei dem Blatt ist das doch kein Wunder. Na ja, sind Gott seit' Dank nicht alle gegen uns. Wir haben mit den Schießbudenknarren ein wenig auf die Raupenfahrer geschossen, aber da sitzt ja nichts hinter. Nur Scheiße, dass Robert unbedingt die Fahne rausholen musste. Jetzt weiß natürlich jeder, dass wir damit zu tun hatten.“
6
Ein junger Journalist, der sich vorgenommen hatte, Näheres über den Heimatschutzverein zu erfahren, traf eines der Mitglieder in einer Gaststätte, die ein bekannter Treffpunkt des Vereins war. Auf gut Glück sprach er Robert einfach an.
Journalist: „Kann ich Sie einen Moment sprechen?“
Robert: „Was wollen Sie?“
Journalist: „Nun, Sie sind offensichtlich ein führendes Mitglied des hiesigen Heimatschutzvereins. So ein Mann ist für die Zeitung immer interessant.“
Robert, der sich geschmeichelt fühlte: „O.K., schießen Sie los.“
Journalist: „Hatten Sie mit der Schießerei auf der Kirmes etwas zu tun?“
Robert: „Kein Kommentar.“
Journalist: „Ich sehe, Sie lesen die 'Deutsche Nationalzeitung'?“
Robert: „Im Moment trage ich sie nur unter dem Arm, aber davon abgesehen, ich lese sie auch.“
Journalist: „Würden Sie mir sagen, woraus unter anderem die Hauptbeschäftigung in ihrem Verein besteht?“
Robert: „Mann, weißt du, dass du ein ziemlich neugieriges Bürschchen bist? Aber, na gut: wir gehen ins Gelände und härten uns ab, und wir machen Heimatabende.“
Journalist: „Und was gefällt Ihnen am besten in Ihrem Verein?“
Robert: „Na die Kameradschaft, und dass wir nicht so schlapp sind wie die Typen, die in Discos rumhängen. Klar?“
Journalist: „Es kann doch sicher jeder bei Ihnen aufgenommen werden?“
Robert: „Mensch, bei uns zählt jeder gleich; da kommt’s nur drauf an, was für ein Kerl du bist. Ob du gehorchst! Bedingungs- los! Wenn mit dir was anzufangen ist, dann bist du ganz schnell oben, dann befiehlst du.“
Journalist: „Würden Sie mir sagen, wie Sie zur Bundesrepublik stehen...?“
Robert: „Pass auf Mann, Deutschland muss wieder das Alte in den Grenzen von 1914 werden, aber mit der Ostmark und dem Sudetengau! Das Altreich haben uns die Finanzsäcke in England und Amerika und die Juden und die Kommunisten in zwei Weltkriegen geklaut. Solange wir das nicht wiederhaben, ist alles Scheiße hier!“
Journalist: „Hm - kann schon sein, aber was werden die Russen und die Polen, und weiß der Himmel wer noch alles dazu sagen?“
Robert: „Mann, wollen Sie mich flachsen? Was redest du für einen Blödsinn? Was soll'n die sagen. Logisch, dass denen das nicht passt, dazu müssen wir sie eben zwingen!“
Journalist: „Zwin... eh - nun.- ich meine, wie denn das?“
Robert: „Na, es müssen sich alle nationalen Menschen in allen Ländern zusammentun. Klar? Ja, und dann müssen wir gegen die Bonzen aufstehen und unsere Forderungen stellen; und wenn die nicht wollen, dann werden sie an die Wand gestellt! Klar?“
Journalist: „Natürlich, vollkommen klar. Eh - meinen Sie, dass alle Mitglieder Ihrer Gruppe so denken?“
Robert: „Ich will dir was sagen: Wir haben ein Programm, das bekennt sich zum uneingeschränkten Führerprinzip, zur Volks- und Arterhaltung, und zu der Forderung nach Lebensraum.“
Journalist: „Interessant. Und Sie glauben wirklich, dass sich Ihr Programm realisieren lässt?“
Robert: „Mann, wenn den Leuten der Dreck erst mal wieder richtig bis zum Hals steht, dann schreien die von ganz allein nach dem Führer. Und den werden wir dann stellen; darauf sind wir vorbereitet.“
Journalist: „Wer ist wir?“
Robert: „Na, wir eben, wir wenigen wachen. Junge, Sie dürfen doch nicht glauben, dass wir die einzige Organisation sind. Was glaubst du, Mann, wir sind in ganz Deutschland vertreten.“
Journalist: „Das hatte ich auch nicht bezweifelt. Stimmt es, dass Sie, das heißt Ihre Gruppe, Waffen, militärisches Gerät und sogar Sprengstoff horten?“
Robert mit einem süffisanten Lächeln: „Fragen Sie mich doch mal.“
Journalist: „Denken Sie gar nicht an die Verbrechen, die der letzte Führer begangen hat?“
Robert: „Reden Sie doch nicht so einen Stuss, Mann. Das ist doch alles Propaganda, alles Lügen, die von den Siegermächten in unsere Geschichtsbücher geschrieben worden sind!“
Journalist: „Ja, meinen Sie denn nicht, dass wir unsere Geschichtsbücher selbst schreiben können, und dies auch tun?“
Robert: „Was... was weiß ich, Mann; was gehen mich...!“
Journalist: „Und der Krieg?“
Robert: „Den hat Hitler nicht gewollt; der ist uns aufgezwungen worden von der internationalen Großfinanz. Vorher war alles in bester Ordnung. Das deutsche Volk hat nie freier gelebt als unterm Nationalsozialismus!“
Robert redete, als hätte er seine Antworten vorher auswendig gelernt.
Journalist: „U n t e r ihm?“
Robert: „Unter wem?“
Journalist: „Ehm - schon gut - ich meine, Sie glauben also nicht an Judenverfolgung und Judenvergasung?“
Robert: „Ach, was Sie reden; vergast worden ist kein einziger. Ein Paar sind erschossen worden, nämlich die, die gegen und gearbeitet haben. Die Gasduschen haben die Sieger nach dem Krieg gebaut, damit sie uns was anhängen können.“
Journalist: „De fällt mir gerade etwas ein. Haben Sie vor einiger Zeit die Geschehnisse in Südostasien etwas verfolgt?“
Robert: „Ein wenig, aber es interessiert mich nicht; warum?“
Journalist: „Nun, mir ist da gerade etwas aufgefallen. Es dürfte Ihnen doch sicher bekannt sein, dass dort sehr viele Menschen starben, ja geradezu hingeschlachtet wurden oder immer noch werden. Das aus Kambodscha von den Vietnamesen vertriebene Pol Pot—Regime, das heißt, die Roten Khmer, die ja in die Berge geflüchtet sind, haben ihre eigenen Landsleute ermordet, die aus Kambodscha zu flüchten versuchten.“
Robert: „Das haben Sie jetzt aber wirklich schön aufgesagt; wenn ich nur wüsste, was das soll.“
Journalist: „Ich komme sofort darauf. Der frühere Außenminister unter Pol Pot, Ieng Sary, der selbst von den Kardomom-Bergen aus dem Partisanenkampf dirigiert, behauptet, der Genocid am eigenen Volke sei nichts als ein Greuelmärchen, das die Vietnamesen in die Welt gesetzt hätten; es hätten wohl manche sterben müssen, aber das wären vietnamesische Agenten gewesen, die vom Volk entlarvt und getötet worden wären. Die Pol Pot—Regierung hätte nichts damit zu tun. Finden Sie nicht auch, dass das eine sehr durchsichtige Verteidigungsrede ist?“
Robert: „Mag sein. Und?“
Journalist: „Sie haben eben fast das Gleiche gesagt.“
Robert: „Sagen Sie mal, was wissen Sie denn, was dahinten los ist, oder war; waren Sie dabei?“
Journalist: „Nein — Sie denn im Dritten Reich?“
Robert: „Ich muss sagen, Sie gehen mir langsam auf den Wecker.“
Journalist: „Oh, verzeihen Sie, das war keinesfalls meine Absicht. Wenn Sie mir gestatten, möchte ich noch einmal kurz zu unserem Thema zurückkommen. Sind Sie der Meinung, dass die Juden Deutschland ausgesaugt haben, und dass es eine jüdische Weltverschwörung gab und immer noch gibt?“
Robert: „Entschieden ja!“ Journalist: „Das ist aber ein Widerspruch.“ Robert: „Was für ein Widerspruch?“
Journalist: „Nun, eben haben Sie noch gesagt, dass es nur ein paar waren, die erschossen worden sind, weil sie gegen uns gearbeitet haben.“
Robert (aufbrausend): „Ach lecken Sie... hab ich sie etwa gezählt, Mann?“ Journalist: „Eben, das haben Sie nicht. Vorhin hätte man glauben können, Sie hätten.“ Robert: „Ich hab jetzt keine Zeit mehr.“
Journalist: „Ich danke Ihnen für des Gespräch. Ach bitte, gestatten Sie mir nach eine letzte Frage: Haben Sie in Hobby?“
Robert: „Mein Hobby ist Deutschland. Und noch was! Bald ist Schluss! Wir haben gute Verbindungen! Es dauert nicht mehr lange, dann werdet ihr was erleben!
„Du und dein Verein, ihr seid ein Haufen dummer Raufbolde, dachte der Journalist. „Aber das dachten vor 50 Jahren auch mal einige Leute von einem Verein“, sagte er im Weggehen leise zu sich selbst. Das Interview wurde nicht gedruckt. Es erschien dem Chefredakteur nicht opportun.
7
Walter Bunzlau befand sich gerade im Keller, um sich eine Flasche Bier heraufzuholen, als die Türglocke anschlug. Großvater hielt sich im Garten auf, Horst und Tommy waren eben—falls nicht anwesend. Es war gegen Mittag. Also hastete er nach oben. Es war der Briefträger. Ein Brief von Tommys Lehrer: Was wollte denn der schon wieder? Hatte Tommy wieder einmal den Unterricht gestört, indem er den Lehrer aufgefordert hatte, er möge doch bitte mit den ernsten Fächern beginnen?
„...und möchte ich Sie bitten, mich noch vor dem Beginn der großen Schulferien in meinem Dienstzimmer der hiesigen Marienschule am besten in der Zeit von...“
Zwei Tage später saß Walter Bunzlau dem Lehrer seines Sohnes gegenüber.
„Herr Bunzlau, mir bleibt keine Wahl, ich muss Sie diesmal mit äußerstem Nachdruck bitten, Ihren Sohn zur Räson zu bringen. Ich weiß nicht mehr, wie ich mit ihm im Rahmen meiner Möglichkeiten fertig werden soll“, sagte der Lehrer.
Walter Bunzlau sah den Lehrer mit einem müden Blick an.
„Ich werde ihn mir ganz gehörig vornehmen, Herr Hasenfeld. Diesmal kann er was erleben.“
Was weißt du von meinem Sohn, dachte er, wenn du Feierabend hast, bist du ihn los, du brauchst nicht mit ihm unter einem Dach zu leben. Hauptlehrer Hasenfeld setzte seine Klagen fort:
„Sehen Sie Herr Bunzlau, Jungen in dem Alter sind keine Engel, das weiß ich als Lehrer am besten. Aber Thomas prügelt sich nicht wie andere Kinder; er schlägt, um zu vernichten. Ja, ich muss es so nennen. Der kleine Martin Sarkowski aus der zweiten Klasse musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Nasenbein ist gebrochen, die linke Augenbraue ist aufgeplatzt, und er muss einen bösen Tritt in den Unterleib bekommen haben, sagte mir der behandelnde Arzt. Herr Bunzlau, das geht nicht, das geht einfach nicht! Ach, und das Schlimmste ist ja die Nichtigkeit des Anlasses. Ich besuchte den kleinen Sarkowski an seinem Krankenbett, und er sagte mir, alles, was er zu Ihrem Sohn gesagt habe, sei 'Hitler ist ein', verzeihen Sie den Ausdruck, 'Arschloch'. Ich kann nicht verstehen, wie Ihr Sohn das zum Grund für eine solche Misshandlung nehmen kann. Neulich auf der Matthias Claudius-Straße muss etwas Ähnliches passiert sein.“
So, das kannst du nicht verstehen, du Musterbild von einem Lehrer, dachte Walter Bunzlau, du kennst ja auch meinen Vater nicht. Und ihr hier, tut ihr denn überhaupt etwas, um die Kinder aufzuklären, in eurem Geschichtsunterricht? Macht ihr in eurer so geistreichen, ästhetischen Didaktik überhaupt einen Unterschied zwischen Karl dem Großen und Hitler? Sind die Kinder bei der Behandlung des Dritten Reiches etwa mehr beeindruckt, oder gar erschüttert, als bei der Behandlung des Preußischen Reiches? Nehmt ihr es denn in Kauf, ihr braven Lehrer, euren Schülern klarzumachen, dass es keinen Grund gibt, stolz zu sein auf die jüngste deutsche Geschichte? Ja, dass sie zumindest das R e c h t haben, sich gelegentlich zu schämen? Ich weiß doch, wie es gerade hier zugeht, in eurer verdammten Schule. Und du, du bist doch bestimmt auch schon 60. Was weiß ich denn, wie's in deinem Kopf aussieht? Vielleicht bist du gar nicht fähig, meinem Jungen beizubringen, dass sein Idol nicht wert ist, Idol zu sein, weil du eben gar nicht dieser Meinung bist. Vielleicht regst du dich jetzt über das gebrochene Nasenbein eines Kindes mehr auf, als damals über...
Als könnte Lehrer Hasenfeld Gedanken lesen, sagte er:
„Herr Bunzlau, es scheint alles für die Tatsache zu sprechen, dass Ihr Sohn sich den ehemaligen Reichsführer Adolf Hitler zum Vorbild auserkoren hat. Ich möchte das als bedauerlich bezeichnen, wobei ich annehmen darf, dass Sie diesbezüglich sicherlich meine Meinung teilen. Da Thomas offensichtlich eines Vorbildes bedarf“, er räusperte sich etwas verlegen, „missverstehen Sie mich bitte nicht, ich meine natürlich eines geschichtlichen Vorbildes, - Thomas ist geschichtlich unverhältnismäßig interessiert, und, Sie können das seinen Zeugnissen entnehmen, außerordentlich bewandert. Da er also, wie gesagt, eines solchen bedarf, möchte ich Vorschlagen, dass wir, ich meine Sie in Ihrer Eigenschaft als Vater, und ich in meiner Eigenschaft als Lehrer, und eh, ich möchte es einmal so nennen, als Miterzieher, dass wir uns also mit Ihrem Sohn bezüglich seiner, sagen wir etwas verworrenen und fehlgeleiteten Anschauung gewisser Dinge ins Benehmen setzen. Zu unserem Glück haben wir es in Ihrem Sohn ja mit einem geradezu ungemein intelligenten und erkenntnisfähigen jungen Menschen zu tun, welchen in empfehlenswertere geistige Bahnen zu lenken wohl kaum allzu schwierig sein dürfte...“ (Wenn du fertig bist, sag Bescheid, du Pharisäer. Jesus, wäre ich doch bloß zu Hause geblieben.) „Wie ich bei dieser Gelegenheit noch einmal ganz ausdrücklich betonen möchte, dass Ihrem Sohn meiner Meinung nach, eine ganz beachtliche Palette von Möglichkeiten offensteht, die es nur zu nutzen gilt, wobei man ihm unbedingt mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zur Seite stehen sollte. Wissen Sie, Herr Bunzlau, ich darf Ihnen ganz im Vertrauen einmal sagen, dass Ihr Sohn mich zuweilen an den jungen Napoleon erinnert. Er ist mit einer ganz hervorragenden Begabung gesegnet...“ (was ist denn jetzt los?), „...die einmal in politischen Regionen ganz außerordentlich vorteilhaft zur Entfaltung kommen könnte. Ja, ich erkenne da als erfahrener Pädagoge ein Charisma...“ (komm wieder runter du Trottel, sonst trete ich dir in deinen ganz außerordentlichen Arsch), „...von dem weiß Gott nur ganz wenige Menschen behaupten können, sie besäßen es.“ Hauptlehrer Hasenfeld musste tief Atem holen. „Nur“, er zog ein Gesicht, als wolle er zu weinen beginnen, „die zuweilen auftretende Neigung zur Brutalität...“ (jetzt ist er wieder unten) „...sollten Sie und ich, mein lieber verehrter Herr Bunzlau, ganz unbedingt zum Anlass nehmen, wohlwollend aber streng...“, dabei erhob er seinen Zeigefinger,“...unseren, ich darf wohl sagen autoritären Einfluss wirken zu lassen.“
Walter Bunzlau überlegte, ob er einmal seinen Vater zu diesem Herrn Hasenfeld schicken sollte. Er hatte das Gefühl, die beiden würden sich gut vertragen. Er sagte: „Herr Hasenfeld, wie ich bereits angeführt habe, werde ich mir Thomas vornehmen und mit ihm Fraktur reden. Wir werden ihn schon auf die richtige Bahn, äh - dings äh — ja, lenken.“
Hauptlehrer Hasenfeld stand auf und gab seinem 'Gesprächspartner' die Hand. „Auf Wiedersehen, Herr Bunzlau. Hat mich gefreut, mal wieder mit Ihnen geplaudert zu haben. Nun, übermorgen beginnen ja die großen Ferien, und danach — wir werden das schon in Ordnung bringen mit Ihrem Sohn. Also in diesem Sinne, kommen Sie gut nach Hause.“
„Auf Wiedersehen“, sagte Walter Bunzlau und war froh, dass er das Zimmer verlassen konnte. Jetzt hatte er sich ein Bier und einen Korn redlich verdient. Es war nicht das erste Mal, dass er diesen Minipestalozzi über sich hatte ergehen lassen müssen. Das nächste Mal würde er seinem Vater das Vergnügen überlassen. Wahrscheinlich würden sie von alten Zeiten sprechen und sich ihre Kriegsauszeichnungen unter die Nasen halten. Walter Bunzlau hatte längst aufgegeben, auf seinen Sohn Einfluss nehmen zu wollen. In den letzten Wochen waren in Großvaters Erzählungen immer öfter die Wörter 'Überfremdung' durch Gastarbeiter und 'Verfall' der deutschen Kultur aufgetaucht und von Thomas und Horst aufgesaugt worden, als seien ihre Hirne ausgetrocknete Schwämme. Ich kann dieses Virus nicht aus ihrem Gehirn prügeln, redete er sich immer wieder ein. Wie soll, ich das Gift, das zu Hause versprüht wird, bekämpfen?
Walter Bunzlau war ein Mann ohne große Überzeugungskraft.
8
Der letzte Schultag vor den großen Ferien war, wie wohl überall in der Welt, ein Tag, der von den Schülern mit Freude und Überschwang begrüßt wurde. Zudem kam, dass die Sonne den klaren, blauen Himmel ganz für sich allein in Anspruch nehmen konnte, und man sich der Hoffnung hingeben durfte, nun nach einer Regenperiode, die fast den ganzen Juni angedauert hatte, doch noch einem warmen und sonnigen Sommer entgegenblicken zu können. Die kleine Stadt, die kaum mehr als 25.000 Einwohner zählte, lag ruhig und friedlich unter der Obhut von Zechenförderungsgerüsten und Industrietürmen, von denen sie aber nicht direkt berührt war, sondern nur wie aus sicherer Entfernung von ihnen bewacht zu werden schien. Außerhalb der Peripherie der Stadt erging sich die Natur in Feldern, Wäldern und Wiesen, die gar nicht so recht zu dem fast krankhaft industrialisiert anmutenden Ruhrgebiet passen wollten.
Ferien! Was für ein zauberhaftes Wort, wenn man es träge im saftigen Gras liegend, den Stiel einer Butterblume im Mund in die Sonne blinzelnd aussprechen konnte, ohne dabei an Leistung denken zu müssen. Auch Thomas freute sich auf die Ferien, wenn auch aus einem anderen Grund als die meisten seiner Klassenkameraden. Er hatte große Pläne, für die er nun endlich Zeit finden würde. Für den größten Teil seiner Freunde war er längst so eine Art Leithammel geworden. Sie akzeptierten ihn, weil er der Schlauste von ihnen war, und weil er so klug, fast wie die Erwachsenen, daherreden konnte, jedoch logischerweise Kinderinteressen vertrat, und für so manch einen schon einige überaus brauchbare Notlügen fabriziert hatte. Außerdem imponierte er ihnen mit seinem Mut, den er mehr als einmal schon unter Beweis gestellt hatte, indem er gegen Schüler der oberen Klassen nicht nur mit dem Mundwerk, sondern auch mit den Fäusten antrat und nicht selten eine Entscheidung für sich verbuchen konnte. Ungeduldig wurde das Klingelzeichen in der Klasse 5b erwartet.
„Liebe Jungen und Mädchen, ich möchte nicht versäumen, euch und euren Eltern angenehme Ferien und gegebenenfalls einen erholsamen Urlaub an irgendeinem fremdem Ort zu wünschen“, sagte Hauptlehrer Hasenfeld. „Ich hoffe, ich kann euch alle in sechs Wochen wieder frisch und munter hier begrüßen und ehm... da ist ja schon das Zeichen. Also bitte nicht so wild, ihr kommt ja noch früh genug hinaus. Nun also denn - viel Spaß Kinder.“
Thomas, dem das stürmische Gedränge zu albern war, blieb noch ein paar Minuten sitzen, bis das Klassenzimmer fast leer war. Erst dann erhob er sich, um den Raum mäßigen Schrittes zu verlassen. Draußen, in der Halle des Schulgebäudes traf er auf Stefan, der ihn fast umgerannt hätte, aber im letzten Moment seinen eiligen Schritt noch bremsen konnte.
„Ach d-da bist d-du ja, ha-hab sch-schon auf dich g-gewartet.“ Stefan war Thomas' Freund, das heißt, eigentlich mehr sein Vertrauter und ergebener Verbündeter, der fast alles tat und auch für richtig hielt, was Thomas ihn hieß. Stefan war einen Kopf kleiner als Thomas und von zartem, schmächtigem Körperbau. Seine roten Haare, die man schon von weitem leuchten sehen konnte, wurden von seinem blassen, fast weißen Teint noch verstärkt. Obendrein hatte er einen Sprachfehler, der, unterstrichen von seiner unfeinen Ausdrucksweise, die man schlicht als „Kohlenpottslang“ bezeichnen konnte, nicht eben dazu beitrug, ihn bei seinen Schulkameraden Ansehen genießen zu lassen. Unter diesen Umständen hatte Stefan stets zu leiden gehabt, bis Thomas einmal einen zwölfjährigen Jungen arg verprügelt hatte, der sich über Stefans Sprachfehler lustig zu machen immer wieder erdreistet hatte. Seitdem war Stefan Thomas' treuester Freund und Diener, was Thomas wohl vorausgesehen hatte, und was auch der Grund für seine Hilfe gewesen war. Niemand hatte auch seither wieder gewagt, sich über Stefan, „Thomas' Schatten“, wie seine Mitschüler ihn in seiner Abwesenheit nannten, lustig zu machen.
„Wa-watt hasse d-denn n-noch gem-gemacht? Die wa-aten doch schon alle. Du wolltes d-doch noch wwatt sagen.“
„Dann warten sie eben.“ Thomas sprach lässig.
„Ha-hasse a-auch wieder r-recht, s-sollnse w-w-aten.“
Die beiden überquerten die Hauptstraße, an der die Schule lag, und kamen zwischen zwei Reihenhähern durch gehend auf den nahegelegenen Spielplatz, wo sich an ihrem Treffpunkt an den Schaukeln, etwa 15 Jungen aus ihrer Klasse versammelt hattet. Mit einem erhabenen Gefühl schritt Thomas auf die Wartenden zu, die ihm, geduldig auf ihn wartend, entgegenblickten. Hatte Thomas doch gesagt, dass er etwas mit ihnen zu besprechen habe, was von großer Wichtigkeit sei. Und seine Andeutung über den Heimatschutzverein, den er für einen lahmen Haufen hielt, und deshalb selbst einen Verein gründen wolle, der zum Schutze der Heimat diene, machte sie natürlich alle neugierig. Sie trauten ihrem gewitzten Tommy, der sogar schon die Lehrerin in Verlegenheit gebracht hatte, allerhand zu.
„Also Leute“, begann Thomas, nachdem er eine von den ihm angebotenen Zigaretten genommen und sie genussvoll in Brand gesetzt hatte (das Rauchen war seit ein paar Wochen zur Gewohnheit fast der ganzen Klasse geworden), „also ich habe euch ja schon angedeutet, dass ich einen Verein gründen will. Wer will mitmachen?“
Es gab keinen, der nicht dabei sein wollte. Thomas blickte zufrieden in die Runde. Jeder hatte eine Hand gehobene Der eine oder andere würde sich noch als Lusche herausstellen, aber der würde dann schnell ausgeschlossen, das sollte kein Problem für Thomas sein. Er fuhr fort:
„Ihr kennt ja wohl alle die Katerina Kazir in der Klasse, diese eingebildete Ziege, die immer die Beste sein will, und die sich zu schön dafür ist, mit einem von uns ins Kino zu gehen.“
„Ach die schwarze Ziege mit dem komischen Namen“, rief einer der Jungen.
„Genau die. Und jetzt ratet mal, warum die einen so komischen Namen hat. — Weil ihr Vater ein Türke ist. Ich weiß das von meinem Bruder, der kennt den Türken. Das ist genau der, der mir neulich an die Wäsche gegangen ist. Dieser miese Hund! Was sagt ihr dazu?“
„D—datt Schw—Schwein!“ war Stefans Kommentar. Thomas legte ihm die Hand auf die Schulter. Derartige Gesten machten Stefan immer glücklich. Bernd, ein dicker aufgeschwemmter Junge, trat einen Schritt auf Thomas zu, so dass dieser die Sommersprossen in dessen rosigem Gesicht zählen konnte und mit seiner kieksigen Kastratenstimme:
„Sollen wir uns die Ziege nicht mal vornehmen? Sie ist doch auch manchmal hier auf dem Spielplatz. Ich würde ihr gerne mal die Hose runterziehen!“ Er grinste in Knabenhafter Lüsternheit.
„Früher oder später schnappen wir sie uns, das hat Zeit“ ,gab Tommy zu verstehen. „Es gibt auch sonst noch einiges zutun.“ Tommy sprach nun Bernd direkt an: „Du hast doch gesagt, dass dein Vater sich schon seit Monaten weigert, dir ein neues Fahrrad zu kaufen, obwohl deine Kiste schrottreif ist, stimmts?“
„Ja, aber was hat das...?“
„Abwarten! Was meinst du, warum er dir kein neues Rad kauft, he?“ Der dicke Bernd sah Tommy ganz erstaunt an.
„Na, er sagt, er hat dafür kein Geld, weil er schon seit Monaten arbeitslos ist. Bei Opel am Fließband kann er nicht mehr arbeiten; sie haben ihn entlassen, weil er so oft wegen seiner Bandscheibe krankfeiern musste und hier im der Stadtkann er keine Arbeit finden, weil...“
„Aha“, unterbrach ihn Tommy und wars zufrieden. „Hier kann er also nicht arbeiten, weil er eben keine Arbeit findet, obwohl hier das große Zementwerk von dem Wagner ist. Soll ich dir denn mal sagen, warum er da nicht arbeiten kann? Weil der Wagner hauptsächlich Türken einstellt und deshalb alle Arbeitsplätze besetzt sind. Wenn dein Vater da arbeiten könnte, hätte er Geld und du ein neues Fahrrad.“
Von so viel Logik war Bernd überwältigt. Er stand da, mit offenem Mund und wusste nicht, was er sagen sollte. „Scheiße!“ fiel ihm endlich ein.
„Die Sch-Schweine!“ bemerkte Stefan lakonisch. Die übrigen Jungen sahen Tommy mit großen Augen an. Man konnte sehen, wie es in ihren Hirnen arbeitete, Was Tommy da gesagt hatte, war nicht zu widerlegen. Hatten nicht die meisten ihrer Väter sich selbst schon darüber mokiert, dass die besten Arbeitsplätze hier am Ort von Türken besetzt waren und sie selbst in der Nachbarstadt arbeiten mussten? Die Bewunderung der Jungen für Tommy begann immer mehr zu wachsen. Es war ja stadtbekannt, dass so viele Türken hier lebten und es denen eigentlich viel zu gut ging. Warum bleiben die eigentlich nicht zu Hause, anstatt hier mit ihrem Knoblauchgeruch die Luft zu verpesten? Noch nicht einmal richtig sprechen konnten die. Und an den Holzbaracken, die eigens für die bei Wagner beschäftigten Türken gebaut worden waren, konnte man sich auch kaum vorbeitrauen. Türken haben ja immer Messer bei sich und sind gefährliche Burschen. Und was war mit den beiden Kinos in der Stadt? Lungerten da nicht immer jede Menge Türken herum und pfiffen den Mädchen nach die sich einen Film ansehen wollten? Ganz zu schweigen von der Eisdiele, in der jetzt die junge Türkin servierte. Ob die wohl immer saubere Finger hatte, wenn sie einem die Bananenmilch brachte?
Tommy registrierte mit der ihm eigenen Empfänglichkeit für Stimmungen, dass er auf dem richtigen Dampfer war.
„Mein Großvater hat gesagt, dass es uns hier und überhaupt allen Deutschen besser ginge, wenn wir keine Gastarbeiter hätten. Die Schlimmsten von ihnen sind die Türken, die haben am wenigsten Kultur, sagt mein Großvater, und der muss es ja wohl wissen, der war General im letzten Krieg!“ Das war klar, das saß. Ein General muss so etwas wissen, das musste jedem einleuchten.
Pille, ein schlaksiger Junge mit wildem braunem Lockenkopf, der eigentlich Udo Senfroth hieß, aber von allen nur Pille gerufen wurde, weil er vor jeder Klassenarbeit Beruhigungspillen schluckte, die er sich aus der Apotheke seines Vaters heimlich organisierte, wandte sich an Tommy und machte ein wichtiges Gesicht: „Ich hab' kürzlich gehört, wie Onkel Ferdi zu meinem Vater sagte, dass er ein Kündigungsschreiben von seinem Vermieter bekommen hat, der die Wohnung an Türken vermieten will, weil das mehr Miete einbringt. Ist das nicht eine Sauerei?“
Tommy hätte keine günstigere Mitteilung erwarten können. „Und ob das eine Sauerei ist“, sagte er mit Genugtuung, „ich bin froh, dass wir ein eigenes Haus haben und uns so etwas nicht passieren kann. Aber jeder, der kein eigenes Haus hat, muss damit rechnen. Das hat mein Großvater nämlich auch gesagt. Aber das können und müssen wir irgendwie verhindern, oder?“
Nun war die Stimmung perfekt. Ein Raunen fuhr durch die Burschen, und sie wurden immer unruhiger. Man konnte ihnen ansehen, dass sie am liebsten sofort losgerannt wären, um die Türken zu vertreiben. Tatendurst spiegelte sich in ihren Augen. Aber wie — wo — was sollte man machen? Hach, zum Teufel! Gar nicht so einfach die Geschichte, da musste man sich erst einmal was einfallen lassen.
„Sollen wir nicht doch mal die Ziege aus der Klasse verhauen?“ fragte Bernd, und die Schweißperlen standen ihm auf der rosigen Stirn. Eine unschuldige Lüsternheit spielte in seinen Augenwinkeln.
„Verhauen, verhauen“, äffte Tommy ihm nach, „als ob es damit getan wäre. Meinst du, wegen der Ziege hauen gleich alle Türken ab? Nun mal ruhig, wir müssen die Sache mit Bedacht anfassen und mit System. Wir haben doch Zeit, die ganzen Ferienliegen vor uns. Man soll nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen! Hat mein Großvater gesagt.“
Was das mit Kanonen und Spatzen zu tun hatte, war zwar nicht auf Anhieb klar, aber Tommy hatte auf jeden Fall Recht. Wie der das immer so drauf hatte, die Dinge richtig zu sehen, das war schon ein dolles Ding. Aber er hatte ja schließlich einen General als Großvater, da war das auch kein Wunder.
Erwin Brinkmann, der größte, und nach Tommy der angesehenste der Klasse, hatte die ganze Zeit etwas verbissen geschwiegen. Es wurmte ihn, dass Tommy sich immer öfter und wirkungsvoller als Tonangeber in der Klasse aufspielte. Überhaupt hatte ihm Tommy zu viel Einfluss auf die Kameraden. Schließlich war er zwei Zentimeter größer, wenn auch nicht ganz so stabil wie Tommy, und dumm war er auch nicht. Nur zu gern hätte er Tommy die Führerrolle streitig gemacht, hatte sich aber bis jetzt nie so richtig getraut, etwas zu unternehmen. Und jetzt - die Idee, einen Verein zu gründen, gefiel ihm auch. Zu dumm aber auch, dass er nicht selbst auf den Gedanken gekommen war. Wenn er jetzt nicht aufpasste, würde er ewig die zweite Geige spielen. Erwin wusste ganz genau, dass er nicht in der Lage war, Tommy das Wasser zu reichen. Sei es nun in körperlicher oder auch in geistiger Hinsicht. Das hatten schon andere versucht, und immer wieder konnte Tommy durch Überlegenheit imponieren. Nein, es gab nur eines: Er musste versuchen, Tommy, egal wie, wenigstens einmal Umzuhauen. Jetzt oder nie, ich muss ihn herausfordern, dachte Erwin.
„Wie willst du denn den Türken Angst machen Tommy? Etwa mit deinem Opa?“
Erwins Versuch, lässig dabei zu grinsen, verunglückte etwas. Tommy zuckte, fast unmerklich, zusammen. Er spürte, dass etwas in der Luft lag. Das hatte er Erwins Tonfall entnehmen können. Und das Wort „Opa“ klang für ihn ohnehin wie eine Beleidigung. Er wusste genau, wenn er sich diese Bemerkung gefallen ließe, nähme ihn keiner mehr so ernst wie bisher. Mit blitzenden Augen sah er Erwin ins Gesicht.
„Soll ich dir zeigen, wie man anderen Leuten Angst macht?“
„Dass ich nicht lache“, kam es zurück. Die allen nur zu bekannte plötzliche Wut, die Tommy unberechenbar machte, wallte auf.
„Du eingebildeter Fatzke“, knirschte er und stürzte sich auf seinen Kontrahenten. Erwin war darauf vorbereitet und versuchte einen Faustschlag mitten in Tommys Gesicht zu landen. Aber er streifte nur dessen Ohr. Der brennende Schmerz machte Tommy noch wütender. Wie eine Katze sprang er den etwas größeren Erwin an und krallte seine Finger in dessen Haar. Mit aller Gewalt zog er Erwins Kopf herunter, so dass es aussah, als wolle dieser einen Diener vor ihm machen, und stieß sein rechtes Knie hochreißend, genau zwischen Erwins Augen. Erwins Nase wurde in Mitleidenschaft gezogen und im nächsten Moment floss das Blut aus ihr auf Tommys Hose. Erwin hatte das Gefühl, als explodiere sein Kopf, und die Knie wurden ihm weich. Er sackte zusammen und fiel auf den Boden, gerade noch fähig zu verhindern, dass er sein Gesicht in den weichen Sand tauchen musste. Stöhnend blieb er liegen.
„Hast du jetzt genug du Ratte?“ Tommys Stimme klang krächzend. Er sah die anderen an. „Möchte sonst noch jemand eine Abreibung?“
Stefan meldete sich: „Hat k-keiner n-ne Cha-Chance gegen dich, Tommy!“
Die übrigen Jungen sahen etwas betreten in die Runde. Keiner wusste so recht, was er sagen sollte. Tommy setzte sich in die Hocke zu dem Verletzten, der sich bemühte, die Tränen aus seinen Augen zu wischen.
„Dir ist doch wohl klar, dass du in unserem Verein nicht gebraucht wirst?“
Udo Senfroth, genannt Pille, mischte sich, seinen Lockenkopf kraulend, ein: „Warum soll er ausgeschlossen werden? Er gehört zu uns, und außerdem haben wir ja noch gar keinen Verein gegründet.“
„Ja, ich möchte dabei sein, wenn ein Verein gegründet wird“, brachte Erwin ein Stöhnen unterdrückend hervor. Und etwas lauter sagte er: „Ich schlage Tommy als Chef vor. Ich sehe ein, dass er der Beste ist!“ Seine Gedanken straften seine Zunge lügen, aber das konnte niemand sehen.
„Ich nehme dieses Friedensangebot an“; erklärte Tommy. Und Stolz schwellte in seiner Brust. „Hat jemand etwas dagegen, wenn ich ab sofort die Führung übernehme?“
Durch beifälliges Murmeln gaben die Jungen zu verstehen, dass sie einverstanden waren.
„W-war d-doch klar T-Tommy“, musste Stefan seinen Senf dazugeben.
Tommy dachte nach. Wie zum Teufel gründet man einen Verein? Gab es da etwas Besonderes zu bedenken? Plötzlich fiel ihm, wieso oft, eine der vielen Geschichten seines Großvaters ein.
„Wenn man einen Verein gründen will“, ließ er sich mit ernster Stimme vernehmen, „dann müssen alle Beteiligten auf den Führer schwören, dass sie ihm treu ergeben sind und gehorchen bis in den To... äh... bis zum Äußersten.“ Er sah aufmerksam in die Gesichter der ihn umstehenden Kameraden. Dann fuhr er fort: „Aber so etwas macht man nicht auf einem Kinderspielplatz. Das ist eine ernste Sache. Ihr kennt doch alle die kleine Kapelle hinter dem Werk bei den paar Bäumen? Ich schlage vor, wir treffen uns da heute Nachmittag um 16 Uhr. Ordentlich gewaschen und gekämmt! Wir werden die Kapelle zu unserem Hauptquartier machen. Die Tür ist immer offen und es ist nie jemand da.“ Ein Gedanke war ihm noch gekommen: „Wenn alle den Eid geleistet haben, und wir eine geschworene Gesellschaft sind, dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Ich werde euch zeigen, dass ich auch was für meine Leute tun kann.“
Stefan holte tief Luft: „Unser Führer äh—Führer le—lebe hoch...! jubilierte er und war ganz verwundert darüber, dass er die bei— den Worte „Unser Führer“ so ohne Stottern herausgebracht hatte. Immer, wenn ihm das passierte, wiederholte er ganz erstaunt, was ihm so leicht von den Lippen gegangen war, als wolle er es nicht wahr haben.
„Spar dir das für später“, sagte Tommy. Er wusste, dass seine Leute später eher dazu bereit sein würden. Heute Nachmittag werden sie alle jubeln, dachte er.
9
An diesem Tag konnte man schon von weitem riechen, dass es etwas Gutes zu essen gab. Im Hause Bunzlau verbreitete sich ein Geruch, der sogar Vegetarier hätte schwach machen können. Das war meistens so, wenn Großvater kochte. Walter und Anton Bunzlau hatten es seit dem Tod der Hausfrau immer so gehalten, dass sie sich jede Woche abwechselten. Zu Anfang konnte weder Vater noch Großvater kochen, aber man hatte es halt gelernt, weil man musste. Großvater hatte sich inzwischen zu einem Meisterkoch entwickelt. Tommy, der eben das Wohnzimmer betreten hatte, schmiss seine Schultasche in die Ecke. Walter Bunzlau saß in seinem Sessel und las die Zeitung.
„Tag Vater“, grüßte Tommy. Seit einiger Zeit hatte er sich abgewöhnt, „Papa“ zu sagen, weil ihm das plötzlich zu kindisch erschienen war. „Ist Horst noch nicht zu Hause?“ Er sah seinen Vater fragend an.
„Nein, er ist noch nicht hier. Du weißt doch ganz genau, dass er erst um 13 Uhr kommt. Aber sag mal, musst du deine Schultasche immer so in die Ecke schmeißen? Und wieso hast du schon wieder Blut an deiner Hose?“ Etwas verärgert blinzelte Walter Bunzlau zu seinem Sohn hinüber. Er musste daran denken, dass er nun sechs Wochen lang nicht einmal mehr morgens seine Ruhe haben würde. Ohne eine Antwort abzuwarten fuhr er fort: „Ich habe nachher mit dir zu reden...“
„Ach, ich weiß schon“, unterbrach ihn Tommy, „du warst ja vorgestern in der Schule. Wundert mich, dass du jetzt erst damit kommst.“
Ich wundere mich, dass ich überhaupt damit komme, dachte Walter Bunzlau, es hat ja ohnehin keinen Sinn. Tommy wollte es hinter sich bringen, nachher würde er keine Zeit mehr haben. Er sagte noch, ohne seinen Vater weiter zu Wort kommen zu lassen:
„Es geht bestimmt um diese Ratte, die ich vermöbelt habe. Stimmt’s? Warum sollen wir warten, sag mir jetzt, was du zu sagen hast.“
Walter Bunzlau hatte Mühe, sich zu beherrschen. Der Ton seines Sohnes konnte ihn immer wieder wütend machen.
„Jeder, der dir nicht in den Kram passt, ist für dich eine Ratte“, sagte er etwas heftig. „Der Junge hat einen Namen, er heißt Martin Sarkowski, und er liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Schämst du dich gar nicht? Was hast du dir dabei gedacht!?“
„Dass ich ihm das nächste Mal auch noch die Zähne raushaue!“
„Ich werde dich...“
„Was regst du dich auf, er hatte es verdient!“
„Du sollst mich nicht dauernd unterbrechen!“
„Schön. Ich tu ihm nichts mehr. Zufrieden?“
Walter Bunzlau schrie: „Du bist ein unverschämter Bengel! Wie sprichst du mit deinem Vater? Du gehörst in eine Erziehungsanstalt; ich werde...!“
„Was schreist du denn wieder mit dem Jungen?“ Anton Bunzlau war aus der Küche gekommen. Er hatte eine bunte Hausfrauenschürze umgebunden, an der er sich die Finger abwischte.





























