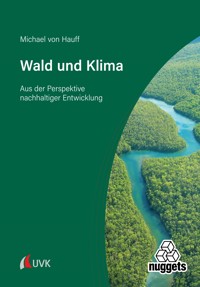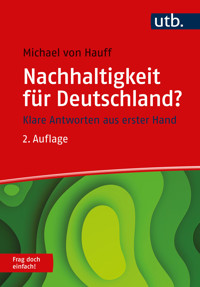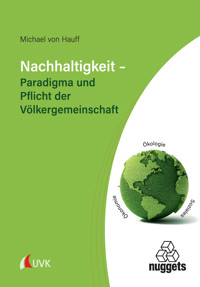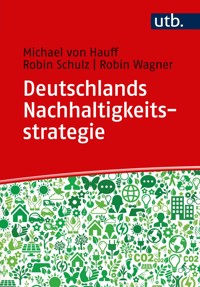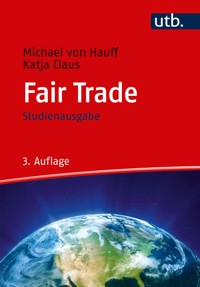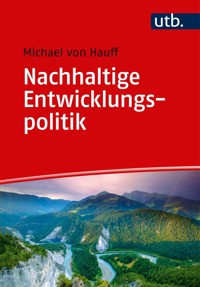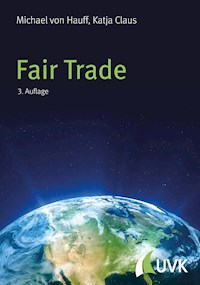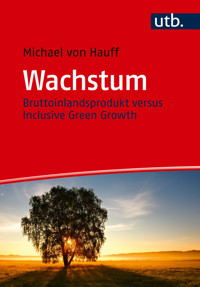
23,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Wirtschaftswachstum wird sowohl in dem Mainstream der Wirtschaftswissenschaften als auch in der Wirtschaftspolitik eine herausragende Bedeutung beigemessen. Das wird damit begründet, dass Wirtschaftswachstum über die Leistungsfähigkeit bzw. Dynamik einer Volkswirtschaft Auskunft gibt. Der Indikator Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt Auskunft über den Wohlstand einer Gesellschaft. Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass Wirtschaftswachstum auch Kosten verursacht, indem es die Umwelt belastet, worunter auch die Gesundheit der Menschen leidet. Es gibt auch Belege, dass trotz Wachstum die Ungleichverteilung zunimmt. Wir befinden uns demnach in einem Dilemma bzw. in einer intensiven Kontroverse. Lassen sich die Probleme nur über ein Nullwachstum lösen? Oder bietet Inclusive Green Growth einen Ausweg aus dem Dilemma? Das ist die zentrale Frage des Buches.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Michael von Hauff
Wachstum
Bruttoinlandsprodukt versus Inclusive Green Growth
Prof. Dr. Michael von Hauff war Inhaber des Lehrstuhls für Volkswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftspolitik und internationale Wirtschaftsbeziehungen an der TU Kaiserslautern.
Seine Forschungsschwerpunkte liegen in der Nachhaltigkeits- und Entwicklungsökonomie. Er hat eine Vielzahl von Arbeiten über den Zusammenhang von Ökologie und Ökonomie und über die ökonomische und ökologische Entwicklung von Entwicklungsländern wie Indien, Vietnam und Myanmar publiziert.
In den letzten Jahren hat er sich besonders dem Leitbild Nachhaltiger Entwicklung im Rahmen von Publikationen und Forschungsprojekten zugewandt. Der Studiengang „Nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit“ am Fernstudienzentrum der TU Kaiserslautern geht auf seine Initiative zurück.
Umschlagabbildung: © Umschlagbild AVTG · iStockphoto
DOI: https://doi.org/10.36198/9783838564685
© UVK Verlag 2025— Ein Unternehmen der Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
Einbandgestaltung: siegel konzeption | gestaltung
utb-Nr. 6468
ISBN 978-3-8252-6468-0 (Print)
ISBN 978-3-8463-6468-0 (ePub)
Inhalt
Vorwort
Wirtschaftswachstum wird sowohl im Mainstream der Wirtschaftswissenschaften als auch in der Wirtschaftspolitik global eine herausragende Bedeutung beigemessen. Das wird damit begründet, dass die Entwicklung des Wirtschaftswachstums über die Leistungsfähigkeit bzw. Dynamik einer Volkswirtschaft Auskunft gibt. Daraus wird auch der Wohlstand einer Gesellschaft abgeleitet. Daher sind Politikerinnen und Politiker bemüht steigende Wachstumsraten zu fördern bzw. zu erhalten. Ein wichtiger Indikator ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das in vielen Ländern tendenziell gestiegen ist und somit den wirtschaftlichen Wohlstand erhöht hat.
Dadurch wurde entsprechend der ökonomischen Lehrmeinung ein wichtiges Ziel wirtschaftlichen Handels erreicht. Die wirtschaftliche, aber auch gesellschaftliche Relevanz von Wachstum wird durch weitere Argumente gestärkt: es hat positive Effekte auf den Arbeitsmarkt, indem die Beschäftigung stabilisiert wird oder auch zu einer Erhöhung der Beschäftigung beiträgt. Wachstum trägt auch zu einer Stabilisierung sozialer Sicherungssysteme bei. Es wird auch positiv bewertet, dass Wachstum zu einer Erhöhung des staatlichen Budgets beiträgt, wodurch sich der Handlungsspielraum für den Staat vergrößert. Schließlich wird auch angeführt, dass Wachstum den Verteilungsspielraum vergrößert.
Dem wird entgegengehalten, dass Wachstum auch Kosten verursacht, wie u. a. Victor feststellt. Die Kosten von Wachstum können in Umweltkosten und soziale Kosten untergliedert werden. Zu den Umweltkosten sind die negativen Auswirkungen der Ressourcengewinnung aber auch des Ressourcenverbrauchs, der Entstehung von Abfällen und des Verlustes von Lebensraum und Arten im Kontext der Biodiversität zu nennen. Hinzu kommen verschiedenartige Emissionen die u. a. den Klimawandel verursachen. Bei den sozialen Kosten besteht auch die Gefahr des Auseinanderbrechens von Gemeinschaften, Entfremdung und Kriminalität. Hinzu kommt die Ungleichheit zwischen Menschen, die in einer Stadt oder verschiedenen Regionen eines Landes leben. Am gravierendsten ist die Ungleichheit zwischen verschiedenen Ländern, indem das Wirtschaftswachstum in einigen Ländern auf Kosten von Ausbeutung und Unterdrückung in anderen Ländern stattgefunden hat bzw. stattfindet (Victor 2019, S. 243).
Daher befindet sich die Bewertung von Wirtschaftswachstum in einem Dilemma, das eine intensive Kontroverse auslöste und zu der Frage führte, wie diese überwunden werden kann. Negative Auswirkungen des Wachstums wie die Umweltbelastungen, aber auch eine Ungleichverteilung bzw. wachsende Einkommensdisparitäten trotz wirtschaftlichen Wachstums fanden in vielen Ländern aber auch auf globaler Ebene in zunehmendem Maße eine wachsende Beachtung. Das führte dazu, dass besonders der Indikator des Bruttosozialproduktes kritisch reflektiert und alternative Indikatoren zur Messung der Lebensqualität entwickelt wurden. Dennoch werden Wachstum, Umwelt und Ungleichverteilung bis heute überwiegend getrennt behandelt. Daher stellt sich die Frage, wie diese drei Bereiche zusammengeführt werden können. Hierzu bietet sich der Ansatz inclusive green growth an. In dem Buch geht es also primär darum, den Pfad vom Bruttoinlandsprodukt zu inclusive green growth aufzuzeigen und die Gegensätzlichkeit zu klären.
Die Kritik am Wirtschaftswachstum und seinen negativen Folgen wurde durch das Paradigma der nachhaltigen Entwicklung, zu dem sich die Völkergemeinschaft 1992 auf der Konferenz in Rio de Janeiro bekannte, verstärkt. Das Novum nachhaltiger Entwicklung ist die Dreidimensionalität, wonach sich Ökologie, Ökonomie und Soziales in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander entwickeln sollen. Damit wurde das einseitige Dogma des Wachstums als stabilisierendem Faktor wirtschaftlicher Entwicklung in Frage gestellt und entgegnet: ohne stabile ökologische Systeme ist langfristig keine wirtschaftlich und gesellschaftlich stabile Entwicklung möglich und eine wachsende Ungleichverteilung trägt zur gesellschaftlichen, aber auch wirtschaftlichen Instabilität bei.
Im Rahmen der Kritik gibt es jedoch unterschiedliche Begründungen. Vielfach wurde bezweifelt, dass steigende Wachstumsraten und der Schutz der Ökologie in einer harmonischen Beziehung zusammengeführt werden können. Im Rahmen des 1992 globalen Paradigmas der nachhaltigen Entwicklung und der folgenden Konferenzen, die zu dem Rioprozess führten, kam es zu Ansätzen wie der „green economy“ oder des „green growth“ die jedoch die Wachstumskontroverse nicht auflösen bzw. überwinden konnten. Die Realisierung eines grünen Wachstums zur Lösung der herausragenden Umweltprobleme wie dem Klimawandel und der Verringerung der Biodiversität wird bis heute vielfach bezweifelt. Hinzu kommt, dass neben einem green growth im Kontext nachhaltiger Entwicklung auch soziale Herausforderungen, d. h. das Gerechtigkeitsgefälle im Rahmen des inclusive growth verringert werden soll. Die Zusammenführung von green growth und inclusive growth führte schließlich zu inclusive green growth, das auf dem Paradigma nachhaltiger Entwicklung basiert und zu einem neuen Wachstumsverständnis führte.
In dem folgenden Kapitel werden zunächst einige Grundlagen zum Verständnis wirtschaftlichen Wachstums aufgezeigt, was verdeutlicht, dass Wachstum ein komplexes Konstrukt ist. Die kurze Einführung macht die Wachstumskontroverse verständlicher. Anschließend werden einige Ursachen für wirtschaftliches Wachstum und Entwicklungstendenzen des Wachstums erläutert. Auf den Grundlagen wirtschaftlichen Wachstums lässt sich dann die Wachstumskontroverse aufzeigen. Sie untergliedert sich in mehrere Argumentationslinien bzw. Ansätze, wobei sich im Prinzip die Wachstumsbefürworter und Wachstumsgegner (Befürworter eines Nullwachstums) gegenüberstehen. Es kann jedoch festgestellt werden, dass teilweise gewisse Annäherungen zwischen den konträren Positionen erkennbar sind.
In Kapitel 3 geht es sowohl auf theoretischer Ebene um den Versuch der Überwindung der Kontroverse als auch im Zusammenhang des Rio Prozesses im Rahmen der Diskussion eines grünen Wachstums (green growth). Die Förderung eines green growth wird besonders von internationalen Organisationen wie der OECD, der Weltbank aber auch der UNESCO gefordert. Für die Mehrzahl der Wachstumsgegner ist green growth jedoch kein Lösungsansatz, sondern nur eine Verschleierung des Konfliktes zwischen Wachstum und Umwelt. Sie fordern im Rahmen eines großen Transformationsprozesses einen grundlegenden Struktur- bzw. Systemwandel. Im Rahmen dieser Diskussion werden von den Wachstumsgegnern jedoch eine Reihe von Hemmnissen bei der Umsetzung von green growth und deren Beseitigung vernachlässigt. Daher besteht noch Potenzial einer Annäherung zwischen Wachstumsgegnern und -befürwortern.
In Kapitel 4 werden die Hemmnisse für ein green growth exemplarisch vorgestellt und Möglichkeiten ihrer Überwindung diskutiert. Dabei werden zunächst konzeptionelle Grenzen wie die Pfadabhängigkeit und der Rebound-Effekt vorgestellt. Hiervon zu unterscheiden sind politökonomische Widerstände wie der Einfluss der Bürokratie und des Lobbyismus. Grundsätzlich geht es bei Hemmnissen um die Widerstände bei der Entkopplung von Wachstum und Umwelt die näher analysiert werden.
Inclusive growth basiert auf der sozialen Dimension nachhaltiger Entwicklung und zielt auf eine Partizipation der Menschen am Wachstum ab. Daher wird in Kapitel fünf zunächst aufgezeigt, ob bzw. welchen Beitrag Wachstum für Gerechtigkeit bzw. die Verringerung von Ungleichheit leistet. Die theoretische Begründung von Gerechtigkeit erfolgt auf dem Ansatz von Amartya Sen. Der Capability-Ansatz von Sen bietet einen theoretischen Rahmen, der sich auf die positive Freiheit konzentriert. Dabei geht es um die tatsächliche Fähigkeit einer Person etwas zu sein oder zu tun. Anschließend geht es um empirische Erkenntnisse zu der Beziehung von Wachstum und Gerechtigkeit. Abschließend folgt eine Erläuterung der Relevanz von inclusive growth für Deutschland.
In Kapitel 6 wird das Konzept des inclusive growth vorgestellt und diskutiert. Zunächst werden die Anforderungen an und die Bedeutung von Innovationen für inclusive growth aufgezeigt und begründet. Es folgt die Darstellung der Operationalisierung von inclusive growth, wobei für die Messung von Ungleichheit Kennzahlen erforderlich sind. Wichtig hierbei sind die Verfügbarkeit und die Qualität der Kennzahlen. Die Kennzahlen ermöglichen es die Wirkung von Maßnahmen zu überprüfen. Betrachtet man die Maßnahmen zur Förderung von inclusive growth, so haben hierzu besonders die OECD und die EU konkrete Konzepte vorgelegt, die vorgestellt werden.
Abschließend geht es in Kapitel 7 darum inclusive und green growth in dem Ansatz inclusive green growth zusammen zu führen. In diesem Ansatz, der besonders im asiatischen Raum breite Aufmerksamkeit erreichte und Anwendung fand geht es darum, einen neuen umfassenden Indikator nachhaltigen Wachstums, in dem die drei Dimensionen der ökologischen, der ökonomischen und der sozialen Nachhaltigkeit, einschließlich Klimawandel und Klimaanpassung berücksichtigt werden, zu entwerfen und umzusetzen.
Der Inclusive Green Growth Index (IGGI) ermöglicht es Fortschritte aber auch mögliche Defizite bei der Verwirklichung der in internationalen Vereinbarungen festgelegten Entwicklungsagenden umfassend zu messen und zu überwachen. Der IGGI soll im Einklang mit dem zentralen Grundsatz der Agenda 2030 „leave no one behind“ stehen. Der Indikator zielt darauf ab politische Entscheidungsträger dabei zu unterstützen, Entscheidungen über die Priorisierung u. a. von Infrastrukturinvestitionen und Finanzzuweisungen zu treffen, um damit eine ausgewogenere bzw. nachhaltige Wachstumsqualität zu erreichen.
Eine Vielzahl von Literaturquellen ermöglicht es dem interessierten Leser, einzelne Themenschwerpunkte zu vertiefen.
Stuttgart Juni 2025
Michael von Hauff
1Wirtschaftswachstum – Jenseits von Ökologie und Verteilung
Wirtschaftswachstum wird besonders in der Politik vielfach auf die Entwicklung des Indikators Bruttoinlandsprodukt (BIP) reduziert. Daher stellt sich die Frage, ob ein Blick auf die entsprechenden Statistiken ausreicht. Es besteht heute Konsens, dass diese enge Betrachtung unzureichend ist: wirtschaftliches Wachstum zeichnet sich durch eine Vielzahl von Phänomenen aus, woraus sich eine sehr komplexe Situation für die konkrete Lebenssituation der Menschheit begründet. Es gibt eine sehr breite und umfassende wissenschaftliche Literatur zu Wachstum die sich inhaltlich auch durch gegensätzliche Positionen auszeichnet, wie in Kapitel zwei ausführlich erläutert wird. Daher ist es unzureichend Wachstum auf den Indikator Bruttoinlandsprodukt, d. h. auf die Zu- oder Abnahme wirtschaftlichen Wachstum zu beschränken. Die Ausführungen dieses Kapitels konzentrieren sich auf wesentliche Grundlagen des Mainstreams zum Wirtschaftswachstum.
Nach einem kurzen und exemplarischen Überblick über verschiedene Phänomene wirtschaftlichen Wachstums, wenden sich die folgenden Ausführungen dem Wachstum der Produktion von Gütern und Dienstleistungen zu. Sie wird in der Regel an der intertemporalen Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes gemessen. Dabei wird der Gesamtwert von Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Jahres hergestellt werden, monetär gemessen. In diesem Verständnis gibt das Bruttoinlandsprodukt Auskunft über die Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft. Dieses Verständnis von Leistungsfähigkeit vernachlässigt jedoch eine Vielzahl von Leistungen wie ehrenamtliche Tätigkeiten und Pflege besonders im familiären Umfeld die für eine Gesellschafft von großer Bedeutung sind. Hinzu kommen noch Leistung, die der Schwarzarbeit zuzurechnen sind. Insofern ist die gesamte Leistung deutlich höher als sie durch das Bruttoinlandsprodukt gemessen wird.
Umweltbelastungen wie Emissionen durch den Verkehr, durch Haushalte und durch die Produktion von Gütern und Dienstleistungen aber auch Verteilungsfragen bleiben bei der Berechnung des Bruttoinlandsproduktes unberücksichtigt. Dieses enge Verständnis und die ausschließlich monetäre Messung von Leistungsfähigkeit, wird seit vielen Jahren kritisiert. Aus diesem Grund wurde von einigen Ökonomen wie Binswanger aber auch von der OECD gefordert ein qualitatives Wachstum einzuführen. Dies hat sich jedoch nicht durchgesetzt. Das wird damit begründet, dass sich der Indikator Bruttoinlandprodukt zur Messung der Leistungsfähigkeit von Volkswirtschaften weltweit etabliert hat und so die Möglichkeit des internationalen Vergleiches von Nationen möglich ist.
1.1Die Relevanz von Wirtschaftswachstum im Verständnis des Mainstreams
Eine weit verbreitete Aussage, die besonders in der Politik geäußert wird, ist: die Wirtschaft wächst bzw. die Wirtschaft schrumpft oder stagniert. Diese Aussage ist zu pauschal, da immer nur einige Sektoren entweder wachsen, schrumpfen oder stagnieren. Somit kann sich eine Wirtschaft auch dadurch auszeichnen, dass einige Sektoren wachsen und andere schrumpfen bzw. stagnierten. Dabei gilt zu berücksichtigen, dass die Wirtschaftssektoren für die Bevölkerung teilweise eine unterschiedliche Bedeutung haben. So führte beispielsweise das Wachstum im medizinischen und pharmazeutischen Bereich dazu, dass fast jeder Bürger davon profitierte, was dazu führte, dass die Menschen vielfach länger und gesünder als beispielsweise im 19. Jahrhundert leben können.
Allgemein bedeutet ein Mangel an Wachstum besonders in Entwicklungsländern, dass die Lebensbedingungen von vielen Millionen Menschen, gemessen an den Standards der reichen Länder, völlig unzureichend sind. In vielen Ländern ist das pro-Kopf-Einkommen im 21. Jahrhundert geringer als jenes in Europa im 19. Jahrhundert. Die Folgen lassen sich an einem ausgewählten Indikator verdeutlichen: entsprechend dem Welthunger Index hungerten 2024 weltweit 733 Millionen Menschen. Seit 2016 konnten in diesem Zusammenhang kaum Fortschritte erzielt werden. In 22 Ländern hat der Hunger zugenommen wogegen in 20 Ländern es zu Erfolgen bzw. zum Stillstand gekommen ist. Um zu verstehen, warum die Ungleichheit des Wohlstandes von Menschen weltweit so ausgeprägt ist, muss man die Treiber von Wirtschaftswachstum kennen.
Ein häufig vorgetragenes Argument ist, dass Wachstum zur Verringerung von Armut beitragen kann. Deaton und Drèze haben in einer Studie aufgezeigt, dass Indien nach einer langen Phase geringen Wachstums besonders nach der Wirtschaftsreform von 1990 das Wachstum deutlich anstieg. Dadurch hat sich der Anteil der indischen Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze lebte, wesentlich verringert (Deaton, Drèze 2002). Die Wachstumsdynamik hat sich in Indien besonders in Städten fortgesetzt. 2011/2012 hatte Indien unter allen großen Volkswirtschaften nach China das zweitschnellste Wachstum weltweit. Eine ähnliche Entwicklung konnte auch in China festgestellt werden.
Zur Erklärung gibt es eine Reihe von Faktoren wie die Liberalisierung und die Öffnung der Wirtschaft. Ein weiteres Beispiel: Südkorea gehörte nach dem Ende des Koreakrieges 1953 zu den ärmsten Ländern weltweit. In den folgenden Jahrzehnten kam es jedoch zu einer starken Belebung des Wirtschaftswachstums, das dazu führte, dass Südkorea in den südostasiatischen „Konvergenzclub“ aufstieg. Heute zählt Südkorea zu der Gruppe der wirtschaftlich hochentwickelten Länder. Dagegen hatten andere Länder auf dem asiatischen Kontinent wie Laos und Nepal eine deutlich geringere Wachstumsdynamik, was das deutlich geringere Pro-Kopf-Einkommen erklärt.
Ein weiteres Phänomen auf nationaler als auch internationaler Ebene ist die Ungleichheit. Hierzu lässt sich feststellen, dass es teilweise zu einer Reduzierung der weltweiten Ungleichheit bei den Einkommen auf individueller Ebene gekommen ist. Viele Menschen in Ländern wie Indien und China konnten bei ihren Einkommen gegenüber den Ländern des globalen Nordens aufholen. Daraus ergibt sich für Aghion und Howitt die Frage, ob Wachstum die Ungleichheit reduziert oder ob eine reduzierte Ungleichheit das Wirtschaftswachstum senkt (Aghion, Howitt 2015, S. 4). Zunächst ging man davon aus, dass in Ländern mit beginnender Industrialisierung die Ungleichheit wuchs, jedoch bei einer späteren Wachstumsphase sich die Einkommensverteilung verdichtete. Zu der Beziehung Wachstum und Ungleichheit folgte die Erkenntnis, dass in wirtschaftlich hochentwickelten Ländern die Entlohnung qualifizierter Arbeitskräfte schneller stieg als jene der gering qualifizierten Arbeitskräfte.
Ein weiteres Phänomen ist die Beziehung von Wachstum und dem Finanzsektor. Die entscheidende Frage hierbei ist, ob die Finanzierungsbedingungen Ursache oder ein Symptom des Wachstums sind. Die These hierbei ist, dass industrielles Wachstum mit der finanziellen Entwicklung korreliert. Somit stellt sich die Frage, ob die finanzielle Entwicklung eines Landes ein schnelleres Wachstum erlaubt, oder ob Länder die schnell wachsen auch eine große Menge an Finanzmitteln einsetzen.
„Natürlich spielt diese Frage eine große Rolle, denn wenn das Finanzwesen Wachstum bedingt, dann sollte ein Land, das schneller wachsen möchte, eventuell seine Finanzinstitutionen reformieren, wenn aber das Finanzwesen nur ein Symptom ist, dann verursachen Finanzreformen die Fallstricke des Wachstums, ohne das Wachstum zu realisieren.“ (Aghion, Howitt 2015, S. 5)
Abschließend ist im Kontext von Wachstumspolitik noch zu klären, welche Relevanz Wettbewerb und Bildung haben. Zunächst ging man von einem Trade-off zwischen Wettbewerb und Wachstum aus, der auf Schumpeter zurück geht. Ausgangspunkt dabei ist, dass Innovationen eine bedeutende Quelle für langfristiges Wachstum sind. Die Begründung des Trade-off zwischen Wettbewerb und Wachstum wurde wie folgt begründet: eine stärkere Wettbewerbspolitik führt dazu, dass Innovationen nicht zu den gewünschten Vorteilen – man spricht hier auch von Monopolgewinnen – führen. Die Folge wäre, dass es zu einer Verringerung von Innovationen käme, was zu einer Senkung langfristigen Wachstums führen würde. Ökonomen haben diese Argumentation jedoch verworfen. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass Unternehmen bzw. Branchen mit mehr Wettbewerb zunächst dazu tendieren stärker zu wachsen als ihre kompetitiven Konkurrenten. Bei einem hohen Wettbewerbsniveau tritt dann jedoch der Schumpeterianische Trade-off ein.
Betrachtet man die Relevanz von Bildung für Wachstum, so gibt es hier einen großen Konsens. Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive fördert Bildung das Wirtschaftswachstum. Die Begründung ist, dass Bildung die gesamtwirtschaftliche Produktivität erhöht. In diesem Zusammenhang ist es jedoch wichtig, Bildung in die geläufige primäre, sekundäre und tertiäre Bildung zu differenzieren. Bei hochentwickelten Ländern geht man davon aus, dass die Investition in die tertiäre Bildung zu einem höheren Wachstum führt. Das erklärt sich daraus, dass tertiäre Bildung für die Entstehung von Innovationen und technischem Fortschritt besonders förderlich ist. Tertiäre Bildung trägt jedoch in weniger entwickelten Ländern weniger zum Wachstum bei, da sie oft kein adäquates Forschungsumfeld haben. Daher ist es wichtig, dass Länder ihr Bildungssystem so organisieren, dass ein Maximum an Wachstum erzielt werden kann (Aghion, Howitt 2015, S. 8).
Die Beziehung Wachstum und Umwelt, die in den beiden folgenden Kapiteln noch ausführlich behandelt wird, zeichnet sich durch einen hohen Grad an Komplexität aus und wird vielfach durch eine konfliktäre Beziehung gekennzeichnet. Die weit verbreitete These ist, dass Wachstum grundsätzlich zu Umweltbelastungen bzw. -schäden wie dem Klimawandel führt. Daher ist zu analysieren, wie sich die Entwicklung von Wachstum in einem Land darstellt. In der folgenden Abbildung werden die Entwicklungen des Bruttoinlandsproduktes (BIP) und der Treibhausgasemissionen dargestellt. Es zeigt sich, dass das Wachstum seit 1991 gestiegen ist, während die Treibhausgasemissionen gesunken sind. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob die Treibhausgasemissionen in dem Maß gesunken sind, wie die Bundesregierung dies im Kontext des Paris Abkommens intendiert hat.
Entwicklung des realen BIP und der Treibhausgasemissionen in Deutschland von 1991-2022
Quelle: in Anlehnung an Statistisches Bundesamt (Destatis) 2023 und Umweltbundesamt 2023 für die Treibhausgasemissionen
Wachstum belastet durch Emissionen die Umwelt, was den Klimawandel verursacht, als auch die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt. Exemplarisch sind der Film von Al Gore „An Inconveniente Truth” aber auch der Stern Report „Review on the Economics of Climate Change” aus dem Jahr 2006 zu nennen, die vor den enormen Kosten einer nicht ausreichenden Berücksichtigung der CO2 Emissionen warnten, was zu einer gewissen Aufmerksamkeit des Problems führte. Auch das „Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC“ (Weltklimarat) hat in mehreren Gutachten darauf hingewiesen, dass Wachstum zu Umweltbelastungen führt. Eine konfliktäre Beziehung zwischen Wachstum und Umwelt besteht auch dann, wenn Wachstum den Bedarf von Ressourcen, die beispielsweise für die Produktion zukunftsorientier Technologien benötigt werden, beschleunigt (v. Hauff 2024, S. 27). Die negativen Auswirkungen von Wachstum auf die Umwelt führt zu der Frage, ob es zu einer Entkopplung von Wachstum und Umweltbelastungen kommen kann, was in Kapitel 4 diskutiert wird.
1.2Begriffliche Grundlagen
Ausgangspunkt ist das Sozialprodukt, das eine deutsche Sprachschöpfung ist, während in der übrigen Welt der Begriff Nationalprodukt Verwendung fand. Der Begriff Sozialprodukt wurde primär von dem österreichischen Ökonom Joseph Schumpeter geprägt und wurde durch mehrere Publikationen von ihm populär. Er verstand darunter „die Summe alles dessen, was in einer Volkswirtschaft in einer Wirtschaftsperiode produziert und auf den Markt gebracht wird.“ (Schumpeter 1911, S. 8). Erst nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Begriff Bruttosozialprodukt eingeführt. Er wurde gemeinsam mit dem Volkseinkommen in den 1990er Jahren offiziell durch die Konzepte und Begriffe des europäischen Systems volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen weiterentwickelt. Die Vielschichtigkeit von Wachstum wird jedoch erst dann deutlich, wenn man es nicht nur auf diesen einen Indikator begrenzt.
Eine erste wichtige Differenzierung ist jene in Bruttosozialprodukt und Bruttoinlandsprodukt.
Das Bruttosozialprodukt (BSP) misst den Gesamtwert aller Güter und Dienstleistungen die von den Einwohnern eines Landes weltweit, d. h. im eigenen Land aber auch in anderen Ländern, hergestellt werden.
Das BruttoinlandsproduktBruttoinlandsprodukt (BIP) misst dagegen nur die im Inland von Inländern und Ausländern hergestellten Güter und Dienstleistungen.
Daher wird heute eher der Indikator Bruttoinlandsprodukt verwendet, um damit die wirtschaftliche Leistung eines Landes zu messen. Dagegen wird das Bruttosozialprodukt eher auf das Einkommen der Beschäftigten ausgerichtet. Als Indikator wird das Bruttosozialprodukt pro Kopf verwendet. Weiterhin wird noch das Bruttonationaleinkommen (BNE) unterschieden, welches alle von Inländern erwirtschafteten Einkommen misst. Dabei bleibt unberücksichtigt, ob sich die Produktionsfaktoren (Kapital, Arbeit und Boden) im Besitz der Inländer befinden.
Der Begriff des wirtschaftlichen WachstumsWachstum wird allgemein als dauerhafte, d. h. langfristige Zunahme des realen Bruttoinlandsproduktes interpretiert. Oder anders formuliert: Der kontinuierliche
„Anstieg der Gesamtproduktion spiegelt eines der Grundprinzipien der Volkswirtschaftslehre wider: eine steigende Leistungsfähigkeit der Volkswirtschaft führt im Laufe der Zeit zu wirtschaftlichem Wachstum.“ (Krugman, Wells, 2023, S. 654).
Hiervon zu unterscheiden sind die kurzfristigen, konjunkturell bedingten Veränderungen des Sozialproduktes, die hier jedoch vernachlässigt werden. Eine weitere Differenzierung ist das tatsächlich erarbeitete Sozialprodukt einer Volkswirtschaft von dem Produktionspotenzial zu unterscheiden, das erwirtschaftet werden könnte, wenn der vorhandene Bestand an Sachkapitel und Arbeitskräften im Produktionsprozess voll ausgelastet wären.
Einige weitere Differenzierungen sind für das Verständnis und die Bewertung von Wirtschaftswachstum von Bedeutung.
Zunächst ist zwischen nominalem und realem Wirtschaftswachstum zu unterscheiden. Die Methoden unterscheiden sich in der Bewertung der Wertschöpfung. Das reale Wachstum wird um Preisveränderungen, d. h. durch die Inflation bereinigt. Es bedeutet also die Zunahme des Inlandsproduktes in Preisen eines Basisjahres. Nach diesem Konzept geht es um die reale Leistungsentwicklung der Gesamtwirtschaft (preisbereinigt). Das nominale Wachstum wird direkt über die Preise bewertet. Eventuelle Änderungen der Marktpreise durch Inflation oder auch Deflation können so zu einem Anstieg oder Rückgang des Wachstums führen. Eine weitere Unterscheidung ist jene in absolutes und relatives Wachstum. Absolutes Wachstum zeigt die Veränderung des Bruttoinlandsproduktes in absoluten Zahlen gegenüber dem Vorjahr an. 2022 betrug das Bruttoinlandsprodukt € 3.876,81 Milliarden und stieg 2023 auf 4.122,21 Milliarden €. Das relative Wachstum beschreibt die Wachstumsrate prozentual: 2022 betrug die Wachstumsrate 1,8 % und 2023 -0,3 %.
Die bisherigen Ausführungen zu Wachstum haben, wie schon erwähnt, gezeigt, dass Wachstum über den Indikator des Bruttoinlandsprodukts Auskunft zur Leistungsfähigkeit einer Volkswirtschaft gibt. Dagegen bleiben Umweltbelastungen und Verteilungsfragen unberücksichtigt. Über viele Jahrzehnte wurde somit aus politischer Sicht Wirtschaftswachstum aus einer quantitativen Perspektive betrachtet (Schmelzer 2016). Seit einiger Zeit wird jedoch innerhalb der OECD verstärkt die Relevanz qualitativen Wachstums wahrgenommen.1 Die Unterscheidung in quantitatives und qualitatives Wachstum zeigt im Prinzip schon den Kern der Wachstumskontroverse auf, die im zweiten Kapitel vertieft wird.
Quantitatives Wachstum spiegelt das rein mengenmäßige Wachstum wider. Die politische Intension dabei ist, „sämtliche wirtschaftlichen, sozialen und politischen Probleme vor allem mit Wirtschaftswachstum“ zu lösen. (Steurer 2010, S. 424).
Qualitatives Wachstum, das ganz wesentlich durch Binswanger geprägt wurde, zielt dagegen auf eine Steigerung bzw. möglichst hohe Lebensqualität und Wirtschaftlichkeit, sowie eine verringerte Belastung der Umwelt und einem geringeren Verbrauch von Rohstoffen ab (Binswanger 1978). Die UNESCO erweiterte qualitatives Wachstum, indem sie zusätzlich Kulturschutzgüter2, hochwertige Bildung, kulturelle Vielfalt und sozialen Zusammenhalt in bewaffneten Konflikten mit einbezieht (Hosagrahar 2017).
Hiervon wird wiederum immaterielles Wachstum abgegrenzt, indem es vom industriellen Sektor in den Dienstleistungs- und Informationssektor verlagert wird. Weiterhin kann es durch umwelttechnischen Fortschritt wie Recycling oder Miniaturisierung zu einer Entkopplung von Wachstum und der Nutzung natürlicher Ressourcen bzw. der Natur als Senke kommen. Danach kann Umweltbelastung durch Wachstum zumindest reduziert werden. Eine der zentralen Fragen in diesem Kontext ist, ob es grundsätzlich zu einer Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung kommen kann.
Das European Environmental Bureau kommt in ihrer Megastudie zu dem Ergebnis, dass es hierzu bisher keinen empirischen Beweis gibt. Die wenigen Untersuchungen, die eine Entkopplung aufzeigen, seien methodisch nicht ausreichend fundiert und hätten nur eine temporär und räumlich begrenzte Entkopplung nachgewiesen (The European Environmental Bureau).
1.3Ursachen des Wirtschaftswachstums
Langfristiges Wirtschaftswachstum wird wesentlich von steigender Produktivität gefördert. Die Arbeitsproduktivität wirkt sich dabei wesentlich auf die Entwicklung des materiellen Wohlstands aus.
Die Arbeitsproduktivität lässt sich dadurch kennzeichnen, dass die Produktionsmenge eines Arbeitnehmers steigt. Es geht also um den Output je Arbeitnehmer pro Arbeitsstunde. Somit ergibt sich die ProduktivitätProduktivität einer Volkswirtschaft aus dem Quotienten des realen Bruttoinlandsprodukts und der Anzahl der Arbeitskräfte. Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb ein Arbeitnehmer heute mehr produziert als beispielsweise in den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg. Ein Durchschnittsarbeitnehmer verfügt heute über mehr Produktionskapital wie Maschinen bzw. eine moderne Büroausstattung. Hinzu kommt eine bessere Ausbildung vieler Arbeitnehmer, d. h. der durchschnittliche Arbeitnehmer besitzt heute ein höheres Humankapital. Die Arbeitsproduktivität wird in geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigen berechnet, womit verschiedene Formen von Teilzeitarbeit aber auch Kurzarbeit Berücksichtigung finden.
Eine wesentliche Ursache für die langfristig gestiegene Produktivität ist schließlich der technische Fortschritt, der vielfach als wichtigster Einflussfaktor für das Produktivitätswachstum bezeichnet wird. Bei aller Bedeutung des technischen Fortschritts für die Entwicklung der Produktivität lässt sich jedoch ein widersprüchliches Phänomen beobachten. Die technologische Entwicklung hat nach dem zweiten Weltkrieg zu einem enormen Anstieg der totalen Faktorproduktivität geführt. In der jüngeren Vergangenheit hat das Wachstum der totalen Faktorproduktivität1 jedoch deutlich nachgelassen, obwohl der technische Fortschritt besonders im Rahmen der Digitalisierung weiterhin stark zugenommen hat.
Dieses Phänomen wird in der Ökonomie als ProduktivitätsparadoxonProduktivitätsparadoxon bezeichnet, das zu einer Abkopplung des starken technischen Fortschritts von der tatsächlichen Produktivitätsentwicklung geführt hat. Hierzu gibt es in der Ökonomie keine eindeutige Begründung. Schließlich ist noch zu erwähnen, dass bei der Erläuterung des technischen Fortschritts der umwelttechnische Fortschritt in der Regel keine explizite Berücksichtigung findet.
Die Betrachtung der aufgeführten Einflussfaktoren sollte sich jedoch nicht nur auf die einzelnen Einflussfaktoren beschränken, sondern auf die Kombination der Einflussfaktoren ausrichten. So stehen, wie schon erwähnt, den Arbeitskräften beispielsweise mehr bzw. effizientere Maschinen zur Verfügung, Arbeitskräfte werden immer besser ausgebildet und Arbeitskräfte profitieren von neuen technologischen Verfahren und neuen technologischen Anlagen (Krugman, Wells 2023, S. 726). Generell kann man davon ausgehen, dass in allen drei Sektoren die Produktivität wächst, wobei es große Unterschiede in den einzelnen Branchen gibt. Ein besonders großes Wachstum der Produktivität lässt sich in der IT-Branche beobachten.
Führt man die Produktionsfaktoren zusammen, spricht man von der totalen Faktorproduktivität. Eine Wirtschaft kann bei steigender totaler Faktorproduktivität mit derselben Ausstattung an physischem Kapital, Humankapital und Arbeit mehr produzieren. Dabei gehen Ökonomen davon aus, dass bei den Zuwächsen der totalen Faktorproduktivität die Wirkungen des technischen Fortschritts miterfasst werden. In einer differenzierten Betrachtung kann also zwischen Arbeitsproduktivität und in einer erweiterten Betrachtung die totale Faktorproduktivität unterschieden werden.
In vielen entwickelten Volkswirtschaften lässt sich jedoch ein rückläufiges Trendwachstum der Arbeitsproduktivität beobachten, was gerade in Deutschland mit seiner perspektivisch abnehmenden Erwerbsbevölkerung nicht zu unterschätzen ist: die Arbeitsproduktivität verliert seit einiger Zeit an Dynamik. Betrachtet man sich den Verlauf der Produktivität, so haben jedoch alle EU-Länder außer Spanien in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre ihr höchstes Produktivitätswachstum erreicht. In Deutschland erklären sich die hohen Zuwachsraten von deutlich über 2 % ganz wesentlich aus dem Boom nach der deutschen Einheit. Danach setzte ein starker Rückgang in der EU ein, was auch für Deutschland gilt. In dem Zeitraum von 1995 bis 2018 verzeichnete Deutschland einen Zuwachs von 1,1 %, während der Durchschnitt in der EU bei 1,3 % lag. Dieser Anstieg erklärt sich aus dem überdurchschnittlichen Zuwachs der Produktivität in den osteuropäischen Ländern (Kuntze, Mai 2020, S. 14).
Im Rahmen der Finanzkrise brach 2009 die Arbeitsproduktivität um -2,6 % deutlich ein. In den vergangenen Jahren betrug sie 0,6 %. Auch die totale Faktorproduktivität hatte seit Beginn der 1990er Jahre einen rückläufigen Trend. Während sie in den 1990er Jahren noch über 1 % stieg, ging sie nach der Jahrtausendwende auf 0,6 % pro Jahr zurück und fiel seit 2014 auf 0,4 %.
Somit ist für die Arbeitsproduktivität und die totale Faktorproduktivität ein weitgehend ähnlicher Verlauf zu beobachten. Betrachtet man die sektorale Produktivitätsentwicklung, so gingen besonders von den Sektoren Produzierendes Gewerbe, Handel, Verkehr und Gastgewerbe, sowie Information und Kommunikation ein Zuwachs zur gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung aus (Bundesministerium für Finanzen 2017). Neben dem aufgezeigten Trend können auch für die Produktivität Schwankungen festgestellt werden, die sich auch im Wachstum widerspiegeln.
Die inhaltliche Konkretisierung der Produktivität zeigte, dass im Mainstream der Ökonomie Umwelt- und Verteilungsaspekte unberücksichtigt bleiben. Dabei kann ein Produktivitätswachstum zu Umweltschäden aber auch zu einer verstärkten Ungleichverteilung führen. Weiterhin lässt sich nicht erkennen, ob bzw. in welchem Maße besonders bei einem Wachstum der Arbeitsproduktivität die Arbeitskräfte entsprechend beteiligt werden. So stellte bereits 2010 Ortlieb fest:
„Da sich in den letzten 30-40 Jahren die Produktivität verdoppelt hat, in derselben Arbeitszeit sich also die doppelte Menge an Gütern herstellen lässt wie noch in den 1970er Jahren, müssten wir folglich seither dem guten Leben einen großen Schritt nähergekommen sein. Wer das freilich heute angesichts der gleichzeitig sich auftürmenden Umwelt-, Ressourcen-, Wirtschafts- und Finanzkrisen behaupten wollte, würde zurecht als Phantast gelten. Irgendetwas kann an der Rechnung und dem in ihr enthaltenen Versprechen also nicht stimmen.“ (Ortlieb 2010, S. 1)
In diesem Kontext entstand der „grüne Produktivitätsindex (Green Productivity Index)“ der von Aufderheide entwickelt wurde. Dabei ging sie von folgender Problemstellung aus: ein Unternehmen, das viel produziert und dabei die Umwelt stark belastet, kann aus ökonomischer Sicht gute Kennzahlen erzielen, da es einen positiven Wachstumseffekt hat. Der Indikator rückt dagegen die Umweltbelastung in den Fokus. Dieser Index bietet die Möglichkeit, die Nachhaltigkeit von Produkten und Produktionsprozessen zu beurteilen. Dieser Index eignet sich somit zur Steuerung von Produktionsprozessen, um Umweltschäden zu verringern oder zu vermeiden. Weiterhin kann er für nachhaltigkeitsorientierte Kaufentscheidungen eine wichtige Basis sein.
Der Green Productivity Index kann die Umweltbelastung durch umweltfördernde Maßnahmen wie Recycling ausgleichen (v. Hauff 2024). Weiterhin können Produktivität und Umweltwirkungen in einer neuen Formel über einen Faktor gewichtet werden. Daher wäre es nach Aufderheide und Steven wünschenswert, dass Unternehmen den Indikator für ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung nutzen. Dadurch könnte ein Unternehmen berechnen, ob es im Zeitverlauf durch bestimmte Maßnahmen nachhaltiger wird. Der Index bietet auch die Möglichkeit Vergleiche zwischen Unternehmen einer Branche vorzunehmen (Aufderheide, Steven 2021).