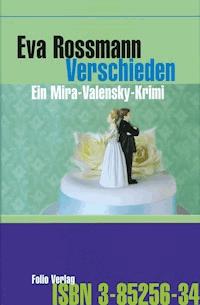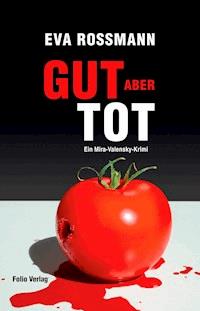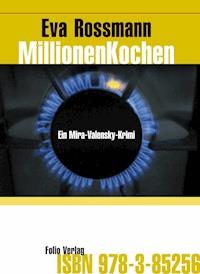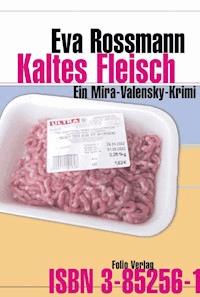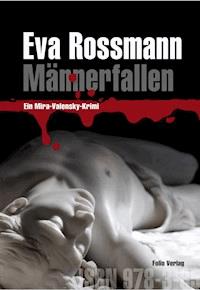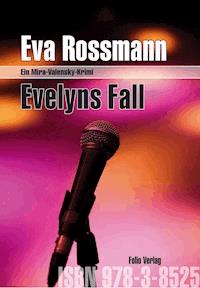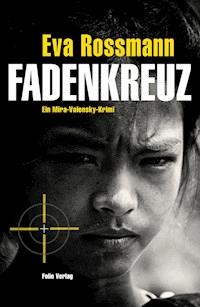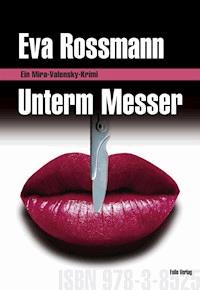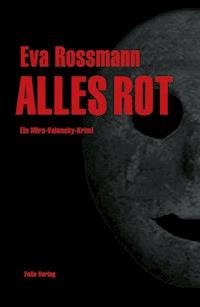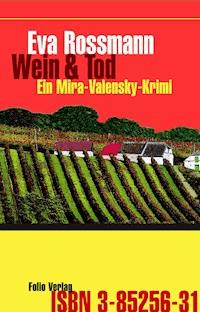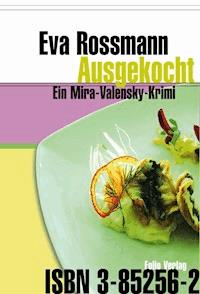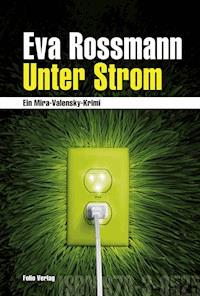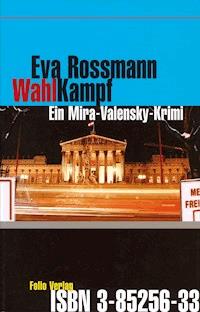
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio
- Kategorie: Krimi
- Serie: Mira-Valensky-Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Präsidentschaftskandidat Wolfgang A. Vogl kann nur gewinnen: Die großen Parteien stehen hinter ihm, ein professionelles Team formt sein Image, und die Wahlkampfkasse ist gefüllt. Die Lifestyle-Journalistin Mira Valensky interessiert sich eigentlich wenig für Politik, doch sie soll über das "Menschliche" im Wahlkampf berichten. Der angebliche Selbstmord eines Wahlkampfmitarbeiters bringt sie auf die Spur dubioser Machenschaften. Alle lächeln, wirken vertrauenswürdig, reden über Bürgernähe und Transparenz. Können das dieselben Leute sein, die der Journalistin in der Nacht auflauern, um ihre Neugier zu stoppen? Gemeinsam mit ihrer bosnischen Putzfrau, einem abgebrühten Star-Kolumnisten und ihrer Katze Gismo erfährt Mira Valensky, wie weit der Kampf um Macht und um das Präsidentenamt geht ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wahlkampf
Ein Mira-Valensky-Krimi
Lektorat: Karin Unger-Astelbauer, Wolfgang Astelbauer
Zweite Auflage 2006
© FOLIO Verlag, Wien • Bozen 1999
Alle Rechte vorbehalten
Graphische Gestaltung: Dall’O & Freunde
© Umschlagfoto: APA-IMAGES/APA/Robert Jäger
Druckvorbereitung: Graphic Line, Bozen
Druck: Dipdruck, Bruneck
ISBN 10: 3-85256-332-1
ISBN 13: 978-3-85256-332-9
eISBN: 978-3-99037-000-1
www.folioverlag.com
[ 1 ]
Der Tag hatte so schön begonnen. Gismo gähnte mich vom Fußende des Bettes her an. Es war noch warm in Wien. Die Sonnenstrahlen, die durch das vierteilige hohe Schlafzimmerfenster fielen, zeichneten ein Muster auf die weiße Wand.
Ich kletterte aus dem Bett und lockte die Schildpattkatze mit fünf schwarzen Oliven. Sie streckte sich majestätisch und raste dann ganz unmajestätisch zu mir in die Küche. Ihr beige-orange-schwarzes Fell kam mir heute wieder einmal besonders seidig vor. Sie tanzte um mich herum, unfähig, noch länger über die fünf einsamen Tage beleidigt zu sein. Erst nachdem sie die Oliven verschlungen hatte, zog sie sich in eine Ecke des Vorzimmers zurück und starrte mit ihren gelben Augen abwechselnd mich und meine ungeöffnete Reisetasche an. Von ihren Augen bis zur Nase leuchtete ein flammend oranger Streifen, ein zweiter über ihrer rechten Braue. Wie bei einem urzeitlichen Krieger, der nicht ganz fertig bemalt ist. Um in den Kampf zu ziehen? Um Freudentänze aufzuführen? Das konnte man bei Gismo nie so recht wissen. Ich hatte sie auf der Straße aufgelesen. Solche Katzen findet man, die sucht man sich nicht aus.
Die Waage zeigte heute Morgen 81 Kilo. Kein Grund, sich die Stimmung verderben zu lassen. Vor meiner Abfahrt waren es 80 Kilo gewesen. Bei einer Größe von einem Meter zweiundsiebzig konnte man das kaum als Übergewicht bezeichnen. Bloß ein Kilo mehr nach fünf Urlaubstagen mit köstlichem Essen, vielen faulen Stunden und reichlich Alkohol – das war beinahe wie ein Geschenk. Ich duschte, schlüpfte in bequeme Jeans, und entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten machte ich mir bloß rasch einen Cappuccino.
Ich seufzte und streckte mich. Wunderbares Veneto. Hätte ich die Chance gehabt … Es gab sie aber nicht. Dabei mochte ich meine Wohnung in dem Gründerzeithaus mit den hohen weitläufigen Räumen, den knarrenden Parkettböden und den bereits etwas abgenutzten Flügeltüren, die bei mir immer offenstanden. Möglichst viel Platz und Raum. Ich hasse es, mich eingesperrt zu fühlen.
Ich lief die drei Stockwerke nach unten und hatte gerade die erste Weinschachtel aus dem Kofferraum meines Autos gehievt, als mir in der Haustür Vesna begegnete. Vesna Krajner war meine Putzfrau. Die Bezeichnung Putzfrau war mir lieber als der gängige Wiener Ausdruck »Bedienerin«. Vesna bediente nicht, sie putzte den Dreck weg, den ich nicht wegputzen wollte. Vesna nickte, als sie mich sah. »Mira Valensky, wie geht es dir?«, fragte sie. Ich hatte mich schon lange damit abgefunden, dass Vesna zwar als Kompromiss mit den herkömmlichen Konventionen auf mein Du eingegangen war, mich aber immer mit Vor- und Nachnamen ansprach. »Ich helfe«, sagte Vesna und wollte mir den Karton abnehmen.
»Es sind noch ein paar mehr da«, ächzte ich und stellte den Karton auf die Stufen. Gemeinsam gingen wir zum Auto zurück. Vesnas Blick verriet, dass sie das für untertrieben hielt. Na ja, es war eben eine gute Gelegenheit gewesen. Sieben Schachteln mit Wein, darüber einige große und kleine Plastiksäcke voller köstlicher Dinge. Beachtlich, was alles in einen kleinen Fiat passte. Vesna hob einen Weinkarton hoch. Sie war fast einen Kopf kleiner als ich, stämmig, aber ohne ein Gramm Fett. Vom ewigen Putzen hatte sie zähe Muskeln bekommen. Sie keuchte nicht einmal, als sie oben anlangte. Wahrscheinlich sollte ich doch wieder Sport betreiben. Früher einmal war ich recht sportlich gewesen. Im Abstellraum standen eine Reihe staubbedeckter Pokale. Speerwerfen, Laufen, Schwimmen – ich war ein Allroundtalent gewesen –, und das, obwohl ich nie die ideale Figur für eine Sportlerin gehabt hatte. Aber Laufen hatte mir allemal besser gefallen als Mathematik. Das alles lag allerdings 20 Jahre zurück.
Eine halbe Stunde später türmten sich im Vorzimmer alle meine Schätze. Gismo umschlich sie misstrauisch. Sie schlug die Krallen in einen Sack und starrte auf die Kaffeebohnen, die herausquollen.
Ich fauchte. Gismo sah mich mit großen Augen an. Die Katze war nicht zu erziehen, sie war bestenfalls zu bestechen. Ich nahm die Säcke und stellte sie auf den Küchentisch. Vesna hatte inzwischen damit begonnen, die Wohnung aufzuräumen. Ich widmete mich meinem Weinkühlschrank. Zur Wohnung gehörte zwar ein kleiner Keller, aber dort war es zu warm, um gute Weine zu lagern. Also hatte ich mir diesen sündteuren Weinschrank geleistet. Keinen einfachen, einen doppeltürigen. Er hatte so viel gekostet wie ein guter gebrauchter Kleinwagen. Man muss eben Prioritäten setzen …
»Vesna!«, rief ich. »Wie bist du heute hergekommen?« Gleich würde ich wissen, ob es wirklich ein guter Tag war.
»Mit der Straßenbahn, natürlich«, rief Vesna zurück.
Es war ein guter Tag. Vesna war eine vernünftige und praktische Frau. Aber sie hatte eine Leidenschaft: ihr Motorrad. Ein Motorrad der besonderen Art. Ihr Lieblingsbruder war Mechaniker, und noch in Bosnien hatte sie mit ihm dieses Motorrad konstruiert. Vesna hatte damals schon einen Motorradführerschein gehabt, und nach Meisterung vieler bürokratischer Hürden war es ihr sogar gelungen, ihn in einen in Österreich gültigen umzuwandeln. Aber es war unmöglich, für dieses Motorrad einen Typenschein zu bekommen. Es bestand aus den unterschiedlichsten Teilen, und ich hatte den Verdacht, dass nicht einmal alle Teile von einem Motorrad stammten. Der Motor jedenfalls war zu stark, und der Lärm war ohrenbetäubend. Vesna war durch ihre Mischmaschine schon einige Male in Schwierigkeiten gekommen. Der Aufenthaltsstatus der Bosnierin war eher schwebend, und es war besser, nicht mit der Polizei in Konflikt zu kommen. Noch hatte ich sie immer heraushauen können. Mit Journalistinnen legte sich die Polizei nicht ganz so gerne an. Vesna versprach regelmäßig, sich mit ihrem Gerät nicht mehr blicken zu lassen. Aber stets brach sie ihr Versprechen. »Spaß, der Mensch braucht Spaß«, sagte sie dann zerknirscht.
Heute war Vesna trotz Schönwetters mit der Straßenbahn gekommen. Wunderbar. Meine Putzfrau würde mir erhalten bleiben. Ich sah mit gerunzelter Stirn auf die neu erworbenen Flaschen und auf meinen Weinschrank. Egal, wie ich die Flaschen schlichtete, ich würde nicht alle unterbringen.
Vesna wischte gerade mit einem feuchten Tuch die Küchenregale ab. »Ein so großer Kühlschrank, und nur für Mira Valensky«, sagte sie. Vorräte beruhigen mich, so ist das nun einmal. Jeder braucht einen Halt im Leben. Und immerhin würde ich die nächsten zwei, drei Monate nicht mehr ins Veneto kommen. Arbeit war angesagt, das Minus auf meinem Konto musste erst wieder ausgeglichen werden.
Vesna erzählte von ihren Zwillingen. Sie waren Klassenbeste und hatten so den Spott einiger Mitschüler auf sich gezogen. »Ich sage ihnen: Nicht zuerst hinhauen, aber wenn sie euch hauen, zurückhauen. Wehren! Das muss man.« Vesna hatte die linke Hand zur Faust geballt, und mit der anderen fuhr sie weiter über die Regale.
Ich schüttelte den Kopf. »Es sind nicht alle mutig. Bin ich auch nicht.«
»Ah, so?« Vesna sah mich ungläubig an.
»Ich bin feig, war ich immer schon.«
»Ich nicht«, sagte Vesna stolz. Ja, das war klar.
Wut war das einzige, was mich meine Feigheit vergessen ließ. Ich erinnerte mich an meinen um einige Jahre älteren Cousin. Als er in dem Alter gewesen war, in dem er nicht wusste, ob er Mädchen verprügeln oder verführen sollte – im Zweifel entschied er sich für das erstere –, hat er mich verspottet. »Elefant, Elefant«, hat er gejault, »groß und schwer wie ein alter Bär, groß und dumm schaut die Kuh herum!« Da bin ich ausgerastet und habe ihn mit bloßen Fäusten verprügelt, bis er weinend davongelaufen ist. Mein starker Cousin, für den ich eigentlich eine Schwäche gehabt hatte. Aber das hatte meine Wut nur noch größer gemacht. Jetzt war er irgendwo Oberarzt, und er hatte vor langem entschieden, dass es doch angenehmer war, Frauen zu verführen, als sie zu verdreschen. Ein eitler Affe mit manikürten Fingernägeln. Wenn, dann war seine Brutalität jetzt anderer Art.
»Außer man macht mich wütend«, sagte ich. Vesna sah irritiert auf. Sie war mit ihren Gedanken schon ganz woanders.
Ich ging ins Wohnzimmer. Der große weiß gestrichene Raum wird von einem alten langen Holztisch dominiert. Dort esse und arbeite ich. An einem Ende stapelte sich Papier. Darunter mussten meine Unterlagen für heute Nachmittag sein. Mal sehen. Ja, hier waren sie.
Ich hätte es ohne weiteres noch einige Wochen ohne Arbeit ausgehalten. Wahrscheinlich würde ich es überhaupt ohne Arbeit aushalten. Aber ich verdiente auf eine bequeme Art und Weise mein Geld. Und diesen Nachmittag konnte es sogar interessant werden. Ich sollte den neuen Star der Schweizer Literaturszene interviewen. Der junge Mann hatte in letzter Zeit nicht nur durch seine Bücher, sondern auch durch kritische Aussagen über seine Heimat, Politik, das Militär und den Papst für Aufsehen gesorgt.
In meinem Interview sollte es allerdings mehr um den Menschen als um seine politischen Ansichten gehen. So jedenfalls lautete der Auftrag meines Ressortchefs. Mir war es recht. Politik war mir ohnehin zuwider. Lifestyle, in diesem Ressort war ich gelandet, weil ich viel über das Leben in New York erzählen konnte. Immerhin: Ich arbeite beim größten Wochenmagazin des Landes. Und unter die Rubrik Lifestyle fällt heute vieles. Ich würde den Schweizer fragen, warum er sich mit nichts Interessanterem als mit Politik oder gar Politikern beschäftigte.
Ich dachte kurz an meinen Vater. Er war Obmann des Pensionistenverbandes und fuhr von einer Versammlung zum nächsten Begräbnis und von dort zu Unterstützungsaktionen für irgendwelche Abgeordneten. Mein Vater war Landesrat gewesen. Ich kannte ihn nicht wirklich gut. Mehr aus den Medien, aber das hatte mich seltsamerweise nie gestört. Gestört hatte mich nur der Auftrieb, der einige Male im Jahr durchgestanden werden musste und bei dem der Herr Landesrat seine Familie in der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Meine Mutter war immer schon Tage zuvor nervös gewesen. Und ich war als Kind von diversen Männern und Frauen in die Wangen gekniffen worden, in späteren Jahren dann von diversen Männern in diverse andere Körperteile. Irgendwann habe ich angefangen zurückzukneifen.
Affentheater. Ich sollte wieder einmal Mutter anrufen. Ich dachte schnell an etwas anderes. Kein Grund, sich die gute Stimmung verderben zu lassen. Die Familie war weit weg. Und mit Politik hatte ich nichts zu tun.
In der Redaktion war es stickig heiß. Offenbar funktionierte die Klimaanlage nicht, und niemand war auf die Idee gekommen, wenigstens die Fenster aufzumachen. 21 Schreibtische standen in dem Großraumbüro, das sich die Redaktionen Lifestyle, Sport und Kultur teilten. Aber wahrscheinlich war es besser, die Fenster geschlossen zu halten. Auch draußen war es heiß – erstaunlich heiß für Ende August, und es stank nach Abgasen. Ich dachte an die Pinie, unter der ich im Park des Hotels die meisten Tage verbracht hatte. Gianni hatte mir seinen Spezialdrink serviert: Prosecco, Mineralwasser, viel Eis und ein Spritzer Campari.
Ich teilte mir mit zwei Kollegen einen Schreibtisch und ein Telefon. Sie waren wie ich fixe freie Mitarbeiter. Beide waren unterwegs. Gut, so hatte ich den Schreibtisch für mich allein. Fix frei, wie paradox. Dauernd da, dauernd bereit, Aufträge entgegenzunehmen, und dennoch nicht fix bezahlt, sondern bloß pro abgeliefertem Artikel. Fix bezog sich auf die Dienstverpflichtungen, frei auf die Bezahlung. So what? Die Bezahlung war nicht übel.
Ich sah mein Postfach durch. Ende August, da sammelte sich in einer Woche nicht so viel an wie sonst. Zwei Dutzend Presseaussendungen, darunter eine von einer Werbeagentur, die Motorräder speziell für Ladies anpries. Vielleicht etwas für Vesna. Ein Stapel Einladungen. Darunter eine für die Präsentation des Buches »So werde ich erfolgreich« von Chloe Fischer. Das war doch die Tussi, die schon … Ja, da stand es, die schon »So setze ich mich durch« geschrieben hatte. Geschraubte Gesellschaftsgurke, die sich als Powerfrau feiern ließ. Aber Erfolg hatte sie, das musste man ihr lassen. Vielleicht sollte ich auch ein Buch schreiben und berühmt werden und dann im Veneto … Ach ja, Chloe Fischer managte jetzt den Wahlkampf von Wolfgang A. Vogl. Auch so ein peinlicher Typ, der Präsidentschaftskandidat. Aalglatt und ziemlich beliebt. Ständig lächelnd. Er galt als modern. Auch sehr erfolgreich. Danke.
Ich bereitete mich auf mein Interview vor. Einige Artikel des Autors hatte ich mir zur Seite gelegt, und sein letztes Buch »Kühle. Nächte.« hatte ich mit großer Freude und ganz freiwillig gelesen. Obwohl ich den Punkt nach »Kühle« und »Nächte« affig fand. Nicht, dass ich mir immer so viel antat. Ich hatte sehr schnell herausgefunden, wie leicht man ohne viel Vorwissen dennoch die richtigen Fragen stellen konnte. Es kam meiner Faulheit und auch einem gewissen Spieltrieb entgegen, wenn sich erst während eines Gesprächs für mich herausstellte, worum es überhaupt ging. Machte die Sache irgendwie spannender.
Ich begann mich auf das Treffen zu freuen. Ich würde mir mehr Mühe geben als sonst. Vielleicht brauchte ich bald keine Aufträge für die Klatsch- und Tratschseite mehr anzunehmen. Langwierige Abendtermine mit Leuten, die sich als Creme de la Creme der Gesellschaft sahen. Aber vielleicht war der Autor auch ein Langweiler, der sich längst für so wichtig hielt, dass er an einem Gespräch gar nicht mehr interessiert war, sondern bloß an simpler Selbstinszenierung. War schon vorgekommen.
Das Telefon läutete. Es war die Chefsekretärin, die Wert darauf legte, als Chefsekretärin bezeichnet zu werden. Mit ihrer Kollegin war ich fast befreundet. Ich sollte sofort zum Chefredakteur kommen. »Sofort«, wiederholte die Chefsekretärin in einem Ton, der ins Sadistische ging, was ihr sehr gut zu gefallen schien.
Ich machte mich auf den Weg. Normalerweise sprach man mit dem Chefredakteur in, vor oder nach Redaktionssitzungen. Oder wenn er durch die Großraumbüros schlenderte. »Mira, die Tochter«, nannte er mich gerne in Anspielung auf meinen prominenten Vater. Dabei war er gerade ein Jahr älter als ich. Wie sehr ich das schätzte, war klar. »Er fürchtet sich vor dir«, behaupteten meine beiden Tischkollegen. »Du bist ihm zu viel.« Ich wollte trotzdem Mira oder Frau Valensky genannt werden.
Der Chefredakteur lag ganz hinten in seinem Chefredakteurlederschreibtischsessel. Er sah mich schweigend an. Ich sah ihn schweigend an. Im Schweigen war ich gut. Der Chefredakteur zwinkerte, kippte nach vorne und schaute mich aggressiv an, wie er es in diversen Seminaren für Führungskräfte gelernt hatte. »Sie haben Mist gebaut.«
Ich war mir keiner Schuld bewusst. Was war meine letzte Story gewesen? Ich konnte mich im Moment nicht daran erinnern. »Aber …«, sagte ich und ärgerte mich über mein Verstummen.
Der Chefredakteur hob die letzte Nummer des »Magazins« hoch und ließ sie wieder auf den Schreibtisch fallen. Ich spähte auf die aufgeschlagene Seite. Klatsch und Tratsch. Da war bloß meine kleine Geschichte über eine alternde Diva abgedruckt.
»Mehrere hundert Jahre hatten sich an einem Tisch versammelt. Da war die Diva selbst, mit Jahresringen am Hals wie eine alte Eiche und ebenso vielen Diamantringen an den Fingern, da war ihr ehemaliger Partner, der sich barmherzigerweise schon vor einigen Jahren in den Ruhestand begeben hatte, einige Verehrer, die die Diva noch aus ihren Jugendtagen kannte, und ein weit jüngerer Mann, der – es ist wahr – eine Samtmasche trug, wie weiland schmachtende Verehrer. Es …«
»Na ja«, sagte ich, »wenn Sie das gesehen hätten …«
»Und wenn der Junge bis auf seine Masche nackt gewesen wäre! Und wenn der Alte auf dem Tisch Tango getanzt hätte und die Diva schon nach Formalin gestunken hätte! Ihrem Mann gehört Mega-Kauf! Mega-Kauf!« Er starrte mich erwartungsvoll an. Über den Fernsehschirm flimmerten Teletext-Nachrichten. Ich konnte sie auf die Entfernung nicht lesen. »Ich weiß«, sagte ich. »Er kam erst später.«
»Sind Sie wirklich so naiv?«, fragte der Chefredakteur.
Ich begann etwas zu zittern. Tränen traten mir in die Augen. Warum schaffte es dieses Weichei, mich dermaßen wütend und hilflos zugleich zu machen? Ich hasste solche Situationen. Verdammt. Meine Stimme klang trotzdem kühl: »Sie wollten, dass ich der Tratsch- und Klatschseite etwas Pfeffer gebe, und das tue ich. Und wenn Sie …«
»Mega-Kauf ist unser zweitgrößter Anzeigenkunde!« Das war beinahe gebrüllt.
»Hat man sich beschwert?«, fragte ich.
»Noch nicht, aber ich will auch gar nicht, dass es so weit kommt.«
Dieser feige Hammel. Ich hörte auf zu zittern. So ein lächerlicher feiger Typ.
»Gesellschaftsreportagen wirken vielleicht harmlos, aber sie sind hochexplosiv. Hochexplosiv! Ohne das nötige Feingefühl kann man großen Schaden anrichten.«
Gefühl für wen oder was?
»Ich will Ihnen noch eine Chance geben. Sie bekommen sogar eine Sonderaufgabe. Sie werden die menschlichen Seiten des Präsidentschaftswahlkampfes schildern, den Favoriten begleiten, das Fleisch zur trockenen Politik liefern. Eine neue Perspektive, lifestyleartig aufgemischt. Exklusiv von Mira, der Tochter.«
Ich starrte ihn an. Das war das Letzte. Wahlkampf. Das Menschliche daran. Ich dachte an mein überzogenes Konto. Ich hätte im Veneto doch nicht jeden Abend das große Menü bei Armando essen sollen. »Okay«, sagte ich.
»Politik. Da können Sie – was Anzeigenkunden betrifft – nichts anrichten. Die sind auf uns angewiesen und nicht umgekehrt. Und …«, er lächelte beinahe gütig, »… Sie haben ja einen hübschen Schreibstil. Beobachten Sie. Kümmern Sie sich um Details. Aber ohne Giftspritze! Vielleicht hie und da mit einem Augenzwinkern, das unsere Unabhängigkeit erkennen lässt.«
Er scheuchte mich mit einer Handbewegung zur Tür und brachte mich dann durch eine großartige Geste wieder dazu stehenzubleiben. Verdammte Seminartricks. »Und besprechen Sie mit Droch, was zu tun ist.«
Droch, auch das noch. Droch war Chefkommentator und Chef der politischen Redaktion. Ein wichtiger Mann der politischen Szene, schon seit Jahrzehnten. Berüchtigt wegen seiner Kommentare auch während der Redaktionssitzungen. Berühmt für seinen Spott. Er durfte spotten. Menschlichen Regungen und Gefühlen verpasste er gerne eine eiskalte Dusche. Er war ein Profi, bereits ewig im Geschäft und beinahe ebenso lange im Rollstuhl. Folgen eines Einsatzes als Kriegsberichterstatter. Typisch. Ein Held, wie er in alten Filmen vorkam. Ich kannte ihn kaum und wollte ihn auch nicht kennenlernen. Erst vor einigen Wochen, als ich eine Reportage über den Alltag von Bosnierinnen in Wien angeregt hatte, war seine Antwort gewesen: »Wusste gar nicht, dass Soziales zum Lifestyle gehört. Eine schicke Sache, Bosnierinnen.« Und alle hatten gelacht. Mist.
Ich ging mit steinernem Gesicht an der Chefsekretärin vorbei, der wollte ich nun wirklich nichts gönnen. Da öffnete der Chefredakteur seine Tür und rief mir nach: »Für das Interview heute Nachmittag habe ich schon jemand anderen eingeteilt, bevor Sie uns noch internationale Verwicklungen bescheren.«
»Ist sein Vater Präsident von Suchard oder von Ciba-Geigy?«
Der Chefredakteur schloss wortlos die Tür. Das hat gut getan.
[ 2 ]
Ich läutete. Eigentlich war Vogls Villa wenig imposant. In der besten Gegend Wiens, das schon. Aber die fantasielose Fassade des zu groß geratenen Einfamilienhauses aus den sechziger Jahren hätte eher zu einem gehobenen Finanzbeamten als zum aussichtsreichsten Kandidaten der kommenden Präsidentschaftswahl gepasst. »Politiker des nächsten Jahrtausends« hatte ihn ein halb vertrottelter, aber sehr populärer Burgtheaterschauspieler aus seinem Prominenten-Unterstützungskomitee öffentlich genannt. Schauspieler sollten sich lieber an ihre Textbücher halten. Ich war müde. Ich läutete noch einmal und konnte mich nicht erinnern, wann ich zum letzten Mal einen Sonnenaufgang erlebt hatte. Ich kann ohne Sonnenaufgänge leben. Gismo war nicht einmal aufgewacht, als ich das Haus verlassen hatte. Wo blieb der verdammte Kandidat?
Mein Fotograf schoss inzwischen Bilder von der Villa. Mir war es immer etwas peinlich, mit welcher Selbstverständlichkeit unsere Fotografen ins Leben anderer Leute platzten. Aber die meisten mochten das sogar. Der Fotograf drückte die Klinke des niedrigen schmiedeeisernen Gartentors. Es ging auf. Ohne ein Wort zu sagen, war er auch schon drin. Verdammt. Sollte ich ihm folgen? Vielleicht funktionierte die Glocke nicht. Langsam ging ich auf dem gepflasterten Weg bis zur Haustüre. Kein Lebenszeichen. Seltsam. Ich wollte gerade den Klingelknopf drücken, als ich eine Frau schreien hörte. »Mörder!«
Eine Tür wurde zugeschlagen. Eine dunkle Männerstimme sagte etwas, aber ich verstand nicht, was.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!