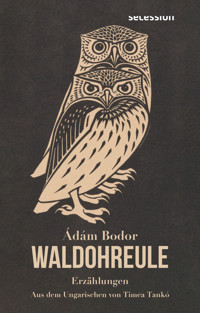
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Secession Verlag Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ádám Bodors atmosphärisch und sprachlich dichte Erzählungen spielen in Vororten, Dörfern, Landstrichen von der Ostsee bis Asien, vor allem aber in uns selbst. Eine junge Frau verbringt einen Tag auf einem Gebirgspass, zwei Männer fahren mit dem Boot durch einen Abwasserkanal, eine Gruppe unterschiedlicher Menschen flicht Körbe, ein Mann hält in einer Bewegung inne und sorgt so für Unruhe. Die Welten, die uns hier begegnen, sind geheimnisvoll, doch die Regungen ihrer Bewohner verblüffend, oft erschütternd bekannt. Das Beschriebene nimmt nicht den Umweg über den Verstand der Lesenden, sondern wirkt unmittelbar, beinahe körperlich. Mit nur wenigen Worten gelingt es Bodor, die verborgensten Winkel menschlicher Empfindungen auszuleuchten, sei es Liebe, Grausamkeit, Einsamkeit oder die Verbundenheit mit der Welt. Seine Protagonisten sind Reisende, Verbannte und Neuanfänger, die sich in elegante, stets passgenaue Sätze gekleidet durch verregnete Straßen, nebelverhangene Wälder, über hitzeflirrende, ins Ungewisse führende Pfade bewegen. Die Verhältnisse sind vergänglich, wie auch immer sie gestaltet sein mögen, das weiß der Autor, und das wissen, spüren auch die, die ihn lesen – vielleicht liegt auch darin der Grund, warum diese Erzählungen so aufrüttelnd und zugleich so tröstlich sind. Ádám Bodor kennt die Fäden, aus denen sich das Leben webt, sehr genau, dies zeigen, neben seinen herausragenden Romanen, auch die in den über fünfzig Jahren seines Schaffens entstandenen Erzählungen. Waldohreule ist eine in Absprache mit dem Autor getroffene Auswahl dieser Texte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ádám Bodor
WALDOHREULE
Erzählungen
Kofinanziert von der Europäischen Union. Die geäußerten Ansichten und Meinungen sind jedoch ausschließlich die der Autorin und spiegeln nicht unbedingt die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die Bewilligungsbehörde können für diese verantwortlich gemacht werden.
Copyright © Ádám Bodor, 1992
German translation rights arranged with Magvető Publishing, Budapest.
Der vorliegende Band ist eine in Absprache mit dem Autor getroffene Auswahl seiner Erzählungen, deren Grundlage der im Original 1992 erschienene Band Vissza a fülesbagolyhoz bildet. Aus Gründen der Aktualität wurden anstelle der Erzählungen Gazdátlan holmi, Vendégmadár, A fapapucs kelendősége, Autóstop, A gázgyár, A krétaszag eredete, Prikulicsok, A buzimacska, Gyergyó éghajlata und Kutyaviadalok Dolinán, Rotundán és Dobrinban die Erzählungen Pitvarszk, Milu und Rebi aus dem 2019 erschienen Band Sehol aufgenommen.
Erste Auflage
© 2025 by ecession Verlag Berlin GmbH
Secession Verlag Berlin
Pannierstr. 13
12047 Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Timea Tankó
Lektorat: Christian Ruzicska
Korrektorat: Hans Hartnack
www.secession-verlag.com
Printed in Germany
e-ISBN 978-3-96639-131-3
INHALTSVERZEICHNIS
DIE HINRICHTUNG
REGEN
DER BARBIER
DER BRUDER DES HEIZERS
DER FÖRSTER UND SEIN GAST
BARBARAFEIER
VERSCHNEITE FUSSSPUREN
NEUE MÖBEL
EIN GRIMMIGER MANN
EIN SCHLECHTER TAG UNSERES FAHRERS
ANKOMMEN IM NORDEN
WIE IST EIGENTLICH EIN GEBIRGSPASS?
EIN SCHWÜLER MORGEN
ZOO
EIN FUCHS
STATT EINER GRABINSCHRIFT
STANDBILD
DAS MÄDCHEN VOM EINÖDHOF
MÜLLDEPONIE
EIN MANN VON UNGUTER ERSCHEINUNG
WOLF
NACHTS AUF DEM TARNICA
EIN ORT, WO KÖRBE GEFLOCHTEN WERDEN
PLUS/MINUS EINEN TAG
REISENDE
DER EUPHRAT BEI BABYLON
GEISTER
KÜCHENGEHEIMNIS
WIEDER DAHEIM
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH
EIN LANGWEILIGES ÖLDEPOT
UND DANN WERDEN WIR UNS SEHEN
DIE MÖGLICHKEITEN DER FREUNDSCHAFT
DIE VERBORGENE SCHWELLE DER EINSAMKEIT
DIE AUSSENSTELLE
WISSENSWERTES ÜBER DIE KÖHLER
HERBSTBEGINN
EIN AUFMERKSAMER SCHIFFSKAPITÄN
EINFÜHRUNG IN EINEN BERUF
EIN ALTER GAST
IMOLAS VERSUCHUNG
ZEUGENAUSSAGE
DIE ABZAHLUNG
DAS GLÜCK DES SÄMANNS
ICH, DER KONDOLENZBESUCHER
BLACK BOX
DAS SANGESUR GEBIRGE
HAFEN, AM ABEND
ZURÜCK ZUR WALDOHREULE
DER GERUCH UNSERER VERWANDTEN
DER FUSSABDRUCK DER MELISSA BOGDANOWITZ
PITVARSZK
MILU
REBI
DIE HINRICHTUNG
»Nein«, sagte der Soldat. »Ohne.«
Der Feldwebel sah ihn für einen Moment verwundert an, ja, verdutzt, und wollte ihm die Augen wieder mit dem schwarzen Tuch verbinden. Der Soldat drehte den Kopf weg, soweit er konnte.
»Nein«, sagte er ruhig, »ich will es sehen.«
»Was zur Hölle willst du sehen? Lass es gut sein.«
Der Soldat konnte sich kaum bewegen, bis auf den Hals. Der Feldwebel ließ langsam die Arme sinken, und sah aus, als wunderte er sich über sich selbst.
Der Hauptmann stand weiter weg, neben der grau gestrichenen Wand, mit dem Rücken zu ihnen, ein Gefreiter putzte ihm die Stiefel.
Der Feldwebel rief ihm zu:
»Er lässt es nicht zu, dass ich ihm die Augen verbinde.«
Der Hauptmann drehte sich nicht um, hob nur ein wenig den Kopf und rief in Richtung der Wand:
»Was soll das heißen: ‚Er lässt es nicht zu?‘«
»Er sagt, er will es sehen.«
»Was diskutieren Sie mit ihm? Sind Sie etwa im Urlaub?«
Der Feldwebel legte dem Soldaten das Tuch erneut auf die Augen und als dieser den Kopf wegdrehte, schlug er ihm mit der Faust ins Gesicht.
»Hast du es nicht gehört?«, sagte er belehrend. »Ich bin nicht im Urlaub.«
Dem Soldaten war etwas schwindelig.
»Es war die Rede von,«, sagte er, öffnete die Augen und spuckte auf den Boden, »also es war die Rede von einem Kopfschuss, aber nicht davon, dass man mich vorher verprügelt. Das ist ein gewaltiger Unterschied.«
Der Hauptmann kam näher.
»Worüber möchten Sie sich beschweren?«, fragte er, als er bei ihnen angekommen war.
»Ich möchte sehen, wie man auf mich schießt«, sagte der Soldat.
»Das ist alles.«
»Sie haben vielleicht Ideen. Und wie man Sie begräbt, wollen Sie nicht sehen? Das kann ja was werden«, sagte der Hauptmann, nun an den Feldwebel gewandt, »die werden immer neugieriger.«
»Ich mag es auch nicht, wenn man mir die Augen verbindet«, scherzte der Feldwebel. »Aber das ist natürlich etwas anderes.«
»Wann hat man Ihnen das letzte Mal die Augen verbunden?«
»Ich weiß nicht. Ist lange her. Einmal beim Spielen.«
»Und Sie mochten es nicht?«
»Es weckt böse Vorahnungen«, sagte der Feldwebel.
»Ich habe ein Recht darauf«, sagte der Soldat. »Es gehört zu meiner Würde, dass ich so lange sehen darf, wie ich sehen kann. Dass ich sehe, was mit mir geschieht.«
»Das verstößt gegen die Vorschriften«, sagte der Hauptmann und breitete bedauernd die Arme aus. »Es ist Krieg.« Er wandte sich um und ging mit langsamen, schwerfälligen Schritten zurück zur Wand, wo er zuvor gestanden hatte.
»Soll ich eine Schleife binden?«, fragte der Feldwebel und zog den Kopf des Soldaten an den Haaren, aber nicht sehr derb zu sich. »Beweg dich jetzt nicht.«
»Du!«, sagte der Soldat. »Fahr doch zur Hölle!«
»Auf einmal duzen wir uns«, rief der Feldwebel dem Hauptmann hinterher. »Hat man so etwas schon mal gesehen?« Wieder an den Soldaten gewandt sagte er jovial: »Lass die dreckigen Sprüche du Unterweltler!«
Der Hauptmann drehte sich um.
»Ich empfehle Ihnen auch, keinen Ärger zu machen.«
»Die Rede war von einer Kugel, ausschließlich von einer Kugel«, sagte der Soldat.
»Die bekommen Sie«, erwiderte der Feldwebel.
»Aber ich will sie sehen. Sagen wir, das ist mein letzter Wunsch.«
Der Hauptmann überlegte.
»Wie spät ist es?«, fragte er.
»Viertel nach fünf«, sagte der Feldwebel.
»Lassen Sie ihn. Lassen Sie es, wenn er es so haben will«, sagte der Hauptmann.
Sie mussten nur noch ein paar Schritte gehen. Der Soldat sah die anderen Soldaten, die im Kreis standen, spürte die morgendliche Kälte der Pflastersteine unter den Füßen. Er dachte an nichts.
»Wie alt bist du?«, fragte der Feldwebel, als sie stehen blieben.
»Dir verrate ich es«, antwortete er. »Sechsundzwanzig.«
»Merke es dir gut«, sagte der Feldwebel mit bitterem Pathos in der Stimme.
Der Soldat lächelte freundlich wie die Sanftmütigen in der Bibel.
»Darf ich mich setzen?«, fragte er.
»Darf er sich setzen?«, brüllte der Feldwebel dem Hauptmann hinterher, der sich mit den anderen Soldaten unterhielt.
Dieser wandte sich den beiden zu und wartete einen Augenblick, um genau zu verstehen, was man ihn gefragt hatte.
»Ja, darf er«, rief er mit fröhlichem Großmut zurück. »Erlauben wir ihm alles. Für einen Moment wird er sowieso aufstehen müssen«, fügte er noch hinzu.
»Bist du erschöpft, mein Sohn?«, fragte der Feldwebel, nachdem sich der Soldat im Schneidersitz auf den Boden gesetzt hatte.
»Warum ich mich setze, willst du wissen?«
»Oh, ich wollte dich nicht kränken«, sagte der Feldwebel. »Ich dachte nur, dass es komisch für dich sein muss, jetzt erschöpft zu sein, und ich frage mich, woher die Erschöpfung kommt. Es sind wohl noch sieben Minuten, fünf davon kannst du noch ganz ruhig sitzen.«
Zwischen den Pflastersteinen schimmerte glattes, schwarzes Wasser, wie ein Spiegel reflektierte es die Farbe der Dämmerung. Im Osten, in Richtung der Wand, wurde es rasch hell wie in einer Kulisse, und aus dem Grau der schwindenden Nacht traten die Wolken hervor. Doch den Soldaten interessierte etwas anderes. Auf den Steinen, im unschuldigen Tau saß reglos eine Spinne, die musterte er. Seine dünne Sommerhose war innerhalb von Sekunden durchweicht, und obwohl er sich über seine sinnlose Eile selbst wunderte, sprang er plötzlich auf, und stand nun mit etwas nach vorn gebeugtem Kopf, den Blick weiterhin neugierig auf die Spinne geheftet, da.
»Was ist da?«, fragte der Feldwebel.
»Eine Spinne«, sagte der Soldat.
»Das frühe Erwachen der Spinne«, sagte der Feldwebel zerstreut.
»Da lernst du noch was.«
»Du könntest mal den Mund halten, das ist meine Meinung«, sagte der Soldat leise, mit Enttäuschung in der Stimme.
»Deine Güte geht mir allmählich auf die Nerven«, sagte der Feldwebel. »Da dich ja alles so sehr interessiert, verrate ich dir, dass bei dem Klicken, das du hören wirst, nur die Verschlüsse entriegelt werden. Dann kannst du noch bis drei zählen oder, wenn du schnell bist, bis fünf. Angeblich zählen in dem Moment alle.«
»Verdammt!«, rief der Soldat, eher zu sich und den Steinen.
»Feldwebel!«, rief der Hauptmann. »Lassen Sie ihn jetzt in Ruhe. Die paar Minuten werden Sie doch wohl auch aushalten.«
Die Soldaten kamen näher, begleiteten den Soldaten zur Wand. Es war nur ein Stück Wand und nicht die Wand von irgendetwas, grau und leer. Er stellte sich so davor, dass sein Körper sie beinahe berührte, das Gesicht den Soldaten zugewandt, die jetzt eine Reihe bildeten. Der Hauptmann stellte sich hinter die Soldaten und sah, wie sich die Läufe auf den Menschen richteten, den man nun auf so seltsam offene Weise, dass er selbst dabei zusah, würde erschießen müssen. Er zog den Hinrichtungsbefehl aus der Tasche und las ihn vor.
Der Himmel über der niedrigen Mauer hinter dem Soldaten war hell, und er blickte nach vorn, man konnte nicht feststellen, wohin. Er hörte das Klicken. Auch den Hauptmann sah er. Er hob die Hände in Schulterhöhe, denn so hatte er es sich vorgestellt, und er wollte sehen, ob er dazu fähig wäre. In dieser Stille war es, als hätte sich das Wasser zwischen den Steinen, mit dem Bild der Wolken darin, mit einem leisen Plätschern bewegt. Der Himmel leuchtete weiß, beinahe milchweiß und plötzlich rann er eiskalt, fast lautlos in seine Ohren, er hätte nicht sagen können, wie lange es dauerte.
»Amen«, sagte der Feldwebel.
Der Hauptmann saß auf dem Boden.
»Das war doch etwas für Sie«, sagte er, aber als er bemerkte, dass der Feldwebel ihm nicht zuhörte, sprach er nicht weiter.
REGEN
Eines Nachmittags erschienen Flugameisen über den flachen, warmen Steinen, auf denen die Blaubeeren lagen, die aussortiert werden sollten. Sie schwirrten über jedem einzelnen Stein, ließen sich nicht verscheuchen. Der Schäfer sagte, sie würden Regen bringen.
Es war ein guter Tag, vom Morgen an waren wir in Hemdsärmeln draußen, wir spürten den Duft der Tannennadeln auf unserer Haut, nur am Fuß der Felsen war es kühl geblieben. Eilig sammelten wir die ausgekippten Blaubeeren ein, zwischen dem zerdrückten Rest sahen wir noch die Ameisen, die mit den Flügeln an den Steinen klebten, dort, wo die ersten schweren Tropfen sie getroffen hatten. Bisher hatten wir nur einen halben Eimer Blaubeeren gepflückt, konnten aber noch ein paar Tage bleiben. Am Abend kamen die Schafe durchnässt zurück. Es regnete und regnete, aber die Hirten beeilten sich nicht. Als sie mit dem Melken fertig waren, standen sie noch eine Weile vor der Schafhürde, an ihren braunen Hälsen rann Wasser hinab.
Ioana war auch bei ihnen, sie war aus dem Tal heraufgekommen, um etwas Käse zu holen, sie betrachtete den Regen. Sie konnte sich nur schwer zum Aufbruch durchringen, obgleich es schon recht spät war. Man hatte ihr ein Pferd gegeben, um den Käse zu transportieren. Auf dem steinigen Weg wollte das Pferd nicht losgehen. Ioana versuchte, es an der Kruppe anzuschieben und sagte, es sei kein gutes Pferd. Der Schäfer sagte, sie solle lieber vorangehen. Daraufhin setzte sich auch das Pferd in Bewegung, es ging zwischen den Tannen, wo die Erde weicher ist. Sie verschwanden schnell, an dem Tag brach die Dunkelheit eher herein. Der Rauch haftete am Feuer, löste sich allmählich, schlängelte sich zwischen unseren Beinen hindurch, kroch aufwärts, hielt sich an den Balken fest und spannte sich in den Rissen der Dachschindel auf wie ein Spinnennetz. Jetzt aßen auch wir mit den Hirten zu Abend. Zum Schluss bekamen die Hunde zu fressen. Große, weiße, undurchschaubare Tiere, es war schwer, sich an so viele Hunde zu gewöhnen. Einer, er hieß Balan, mochte uns nicht. Nachdem er gefressen hatte, ging er hinaus in die Dunkelheit und bellte dort bis zum Morgen.
Die Schafe wurden bei ordentlichem Wetter hinausgetrieben und zum Melken zurückgebracht. Über die Blätter des Ampfers rann den ganzen Tag über der Regen. Wir standen unter dem verwitterten Dach. Ich gab einem der Hirten meinen Mantel. Er zog ihn über, ging ein bisschen hinaus, kam zurück und zog ihn wieder aus. Es regnete, wir wussten nicht, seit wie vielen Tagen. Ich schlug Göb vor, noch ein paar Blaubeeren zu sammeln, aber er wollte nicht. Der Nebel strömte seit Stunden vom Taleingang zu uns hinauf.
Die Hirten verhielten sich ruhig und still. Sie waren nicht in Eile, am Abend sahen sie zu, wie die Hunde fraßen, über ihre braunen Hälse rann ständig das Wasser hinab.
Einmal setzte sich Göb in der Nacht auf. Ich beugte mich zu ihm. Er nahm meine Hand und legte sie dorthin, wo er zuvor gelegen hatte. Auch die Decke war nass. Er schlief bis zum Morgen im Sitzen. Es regnete, aber wir sammelten noch einen halben Eimervoll Blaubeeren. Göb hatte es satt. Dieses Vorhaben sei schiefgegangen, sagte er, aber es mache ihm nichts aus.
Am späten Nachmittag tauchten aus dem Nebel zwei Gestalten auf. Zwischen ihnen taumelte eine dritte: Vasilică, der Junge aus der unteren Schafhürde. Er blutete. Man sah, dass er umfallen würde, wenn sie ihn losließen. Aber sie ließen ihn nicht los, sie blieben nicht einmal stehen, gingen den steinigen Pfad hinab, auf unsere Fragen antworteten sie, drehten sich aber nicht um. Ein Felsen war der Grund für all das Blut an Vasilicăs Körper. Das Regenwasser musste ihn irgendwo weiter oben unterspült haben und er war hinuntergerollt, dorthin, wo Vasilică gestanden hatte. Alles lag im Nebel. Die Hunde bellten den Männern hinterher. Göb sagte, an manchen Stellen sei das Gras voller Blut. Ich ging hinaus, um es mir anzusehen, aber da hatte der Regen es schon weggespült. Beim Aufwachen waren wir vollkommen durchnässt, es tropfte selbst durchs Dach. Göb ging hinaus. Beim Pferch angekommen, wandte er sich um, kam zurück, zog den Mantel aus und ging so in den Regen. Etwas weiter oben blieb er stehen. Hirten, die von der unteren Hürde kamen, gingen an ihm vorbei. Göb sagte später, sie wollten einen Stein holen.
Am Nachmittag tauchten diese Hirten wieder auf und rollten einen großen Stein vor sich her. Sie rollten ihn diesseits des Zauns, bis vor die Hütte. Es muss recht schwer gewesen sein, ihn bis hierher zu rollen, er reichte ihnen bis zum Oberschenkel. Es war ein Stück des Felsens, dessen Rand vom Kamm über das Tal ragt. An einer Seite war er grünlich schwarz, auf der Seite des frischen Bruchs war er von einer weißlichen Äderung überzogen und glänzte vor Feuchtigkeit.
Vasilică sei in der Nacht gestorben, sagten die Hirten. Sein Vater wolle den Stein haben. Sie ließen ihn innerhalb der Umzäunungliegen, sagten, sie würden ihn am nächsten Tagholen und zogen weiter. Göb und ich gingen hinaus, ins obere Kesseltal. Unterwegs sagte er, er habe an dem Blaubeereimer gerochen und glaube, die Beeren würden schon gären, aber dann zuckte er nur mit den Schultern. Das Wasser des Hochmoors vibrierte im Regen, die Linie des Bergkammes vibrierte mit. Göb blieb stehen, pfiff irgendeine warme Melodie von der Meeresküste, aber nur den Anfang, zog sie in die Länge und fing dann immer von vorn an. Es war wie das Signal der Sendepause von irgendwo, wo es nie eine Sendung gibt. Ich bat ihn, damit aufzuhören. Er wandte sich mir zu und pfiff weiter. Ihm rann das Wasser übers Gesicht, über die Stirn, aus den Augen, als würde er heulen, er war triefnass, aber er lächelte. Er pfiff, ich pfiff auch, der Regen prasselte auf die handtellergroßen Pfützen des Moores, prasselte auf unsere Mäntel, die Weiden trieften und klangen wie der Laut S. Und dann zog der Nebel vom Tal herauf und schluckte jedes Geräusch. Es war ein leichter, ruhiger Nachmittag.
Der Stein stand jetzt vor dem Eingang, wir staunten, wie viele Farben ein einfaches Stück Fels haben konnte. Gegen Abend wollten zwei Hirten ihn hinausrollen, aber der Schäfer ließ es nicht zu. Er sagte, was sich innerhalb der Umzäunung befinde, sei dazu bestimmt, bewahrt zu werden. Die Hirten mochten den Stein nicht. Später sagten sie noch, sie wünschten, sie hätten ihn dort gelassen, wo sie ihn gefunden hatten. Dabei wusste man doch, dass die Hirten von der unteren Hürde kommen und nach ihm fragen würden, da Vasilicăs Vater ihn haben wollte.
Göb roch wieder an dem Blaubeereimer und winkte nur ab. In der Nacht sagte er zu mir, es gelinge ihm einfach nicht, an zu Hause zu denken. Er versuche, sich die Decke auf seinem Bett vorzustellen, aber er könne es nicht. Das sei nicht seine Decke, sondern nur irgendeine. Wir blieben noch zwei Tage.
Der Stein wurde erst drei Tage später abgeholt. Vasilicăs Bruder war dabei, er führte ein Pferd. Sie legten den Stein auf drei sehr kurze Rundhölzer, banden ihn daran fest und ließen das Ganze von dem Pferd ziehen. Bergabwärts rutschten die nassen Stämme gut. Am Abend sagte einer der Hirten, er werde am nächsten Tag hinunter ins Tal gehen, wolle sich zu Hause umsehen. Der Schäfer antwortete, er werde nirgendwohin gehen. Ging der Hirte dann auch nicht. Am Morgen schien die Sonne. Den Hirten merkte man nicht an, dass sie sich darüber freuten, und der, der am Abend noch hatte gehen wollte, wollte es nun nicht mehr. Nach dem Melken trieben sie die Schafe hinaus und der Hund namens Balan ging mit. Der Schäfer gab uns ein großes Stück Käse für den Weg. Das machte Göb etwas verlegen, aber dann verstaute er es neben den Blaubeereimer im Rucksack. Er kannte den Schäfer seit langem. Auf dem Weg ins Tal kamen wir an der unteren Hürde vorbei, die Schafe waren oben am Hang. Ein Junge winkte uns zu, doch wir kannten ihn nicht. Wir winkten zurück. Wahrscheinlich arbeitete dieser nun an Vasilicăs Stelle. Neben dem Zaun, mitten im Ampfer, saß ein winziges Kalb, es hatte die Farbe von einem modischen Stoff. Die Sonne sah es wohl zum ersten Mal, es hatte eine Woche geregnet.
Unterwegs hörten wir, dass Vasilicăs Vater den Stein auf seinem Hofzerschlagen hatte, nun würde man auf den Bruchstücken gehen. Im Tal blieben wir stehen. Wir holten den Käse hervor, den wir vom Schäfer als Wegzehrung erhalten hatten.
»Wie fändest du es«, fragte Göb, »wenn wir mit einer klasse Frau bis nach Hause reisen würden?«
»Das wäre nicht schlecht«, sagte ich. Dabei aßen wir den Käse, er war doch noch reif geworden. »Ich meine nur«, sagte Göb, »weil wir gar nicht merken, wie feucht und verraucht unsere Sachen riechen.«
Wir gingen weiter. Einen Eimer mit Blaubeeren hatten wir, die wir hatten verkaufen wollen, doch Göb sagte, die wolle jetzt keiner mehr haben, weil die Beeren gegoren seien, wir sollten sie lieber daheim mit Alkohol übergießen.
DER BARBIER
»Der Nächste, bitte«, sagte Boros und drehte das Kissen auf dem Stuhl um. »Was soll es sein?«, fragte er ein wenig nach vorn, zu dem Kunden gebeugt, nachdem dieser sich gesetzt und es sich bequem gemacht hatte.
»An den Seiten und hinten ein bisschen, oben soll es so bleiben.«
Der Kunde sprach mit breiter Stimme. Er hatte einen großen, roten Kopf, das Haar wuchs ihm tief in die Stirn.
Boros faltete den Umhang auseinander und band ihn dem Mann um. Zwischen das Hemd und die rote Haut legte er etwas Watte und als er sah, dass der Kunde eine Zigarette hervorholte, gab er ihm Feuer. Er nahm die Schere und das Haarschneidegerät aus der Schublade. Seine Schicht hatte gerade begonnen.
»Die gehört Boros«, sagte jemand, woraufhin die Kassiererin ihm eine Illustrierte gab. Er reichte sie an den Kunden weiter und blickte dabei in den Spiegel. Dann betrachtete er den Hals des Kunden, nahm den Haarschneider, stellte ihn auf die Null ein und setzte ihn hinten, über dem Nacken an. Er bewegte ihn langsam den Hinterkopf hinauf, über die Schädeldecke, nach vorn, zur Mitte der Stirn, bis zum Haaransatz.
»Aufhören!«, rief der stämmige rote Kunde und knallte die Zeitschrift ins Waschbecken.
Boros hielt inne. Er hatte den Kopf in einem haarschneiderbreiten Streifen kahl rasiert.
»Was haben Sie gemacht?!«, rief der Kunde und betrachtete sich im Spiegel. Jetzt war er noch röter. Er starrte auf den Streifen, den das Gerät ihm ins Haar gemäht hatte und befühlte ihn.
Boros stand da und sah ihn an. Es war ihm nichts anzumerken. Die anderen Barbiere unterbrachen die Arbeit, um zu sehen, was geschehen war. Zwei von ihnen kamen näher. Einer der beiden war der Verantwortliche.
»Ich weiß es nicht«, sagte Boros.
»Was haben Sie gemacht?«, fragte nun auch der Verantwortliche. Der Kunde stand auf und sah sich um, nur mit den Augen, ohne den Kopf zu drehen. Seine Hand lag immer noch an der Stelle am Kopf, wo jetzt kein Haar mehr war.
Der Barbierlehrling warf einen Blick zur Kassiererin, die ihm gefiel, um zu sehen, was sie dazu sagte. Sie betrachtete Boros.
»Ich weiß es nicht«, sagte Boros. Er zuckte kaum merklich die Achseln, breitete mit einer lockeren Bewegung die Arme aus, wandte sich halb um, ging aber nicht weg.
»Sehen wir es uns mal an«, sagte der Verantwortliche und nahm das Haar des Kunden zwischen die Finger und musterte es. Er ließ die Hand auf dem Haar ruhen und sah Boros an. Er schien ein ruhiger Mensch zu sein.
»Was ist das?«, fragte der Kunde erneut, aber jetzt schrie er nicht mehr. »Was haben Sie mit mir gemacht?«
Der Kunde, der im letzten Stuhl saß, griff sich an den Kopf und blickte zu Boros' Stuhl.
»Sie können es sich ruhig ansehen«, sagte der, der ihm die Haare schnitt und ließ ihn los.
»Wir kümmern uns darum«, sagte der Verantwortliche und bedeutete den anderen, die Arbeit fortzusetzen. »Setzen Sie sich. Lassen Sie mal sehen«, sagte er und drehte den Kopf des Kunden ein wenig. Während man ihm den Kopf drehte, musste sich der Kunde Boros aus nächster Nähe ansehen.
»Sie mache ich fertig«, sagte er.
Dieser stand nur da. Ihm war immer noch nichts anzumerken. Der Verantwortliche wandte sich an ihn.
»So hineinzuschneiden. Und gerade Sie.«
»Machen Sie irgendetwas«, sagte der Kunde. »Und zwar schnell.«
»Man muss die anderen Haare darüberkämmen«, sagte der Barbier, der am Nachbarstuhl arbeitete.
»Sehen Sie es sich genauer an«, sagte ein anderer. Der Raum war wieder vom Klappern der Scheren erfüllt. Alle arbeiteten, nur Boros stand stumm neben seinem Kunden.
»Was willst du darüberkämmen?«, fragte der Verantwortliche und befühlte immer noch das kurze, dichte Haar. »Das hier doch nicht.«
»Jetzt diskutieren Sie noch untereinander?«, fragte der Kunde etwas spitzer.
»Wir können es nicht wieder ankleben«, sagte der Verantwortliche. »Darüberkämmen geht auch nicht. Ihr Haar wird nicht mehr so sein, wie Sie es haben wollten.«
Jemand von der Straße rief herein:
»Muss ich lange warten?«
»Setzen Sie sich, Balázs«, sagte der Verantwortliche.
Der Mann wartete, sah, dass es im Laden ein Problem gab.
»Ich komme später zurück«, sagte er.
»Man kann nichts darüberkämmen«, wiederholte der Verantwortliche. »Hier gibt es nur eine Lösung. Zum Glück ist es warm.«
»Ich gehe weg und zeige es«, sagte der Kunde. »Am besten zeige ich es denen, die es interessiert, wie man hier arbeitet.« Er wollte aufstehen.
»Bitte nicht so«, sagte der Verantwortliche. Er hielt ihn sanft zurück und strich ihm über den Kopf. »Nicht so.« Er sah Boros an, bedeutete ihm, etwas zu sagen. Doch Boros schwieg.
»Er hat sich geirrt«, erklärte der Verantwortliche. »Es falsch verstanden. Er ist unser bester Barbier.«
»Nein«, sagte Boros. »Ich habe es richtig verstanden.«
Der Verantwortliche hob den Blick. Im Spiegel sah er den Kronleuchter.
»Sie sollten wissen«, sagte der Kunde, »dass ich wohl noch nicht wieder ganz zu mir gekommen bin. Ich müsste brüllen, schließlich haben Sie mich verstümmelt.« Er sah Boros an. »Hören Sie? Sie haben mich verstümmelt.« Boros musste gehört haben, dass er den Kunden verstümmelt hatte.
»Wir haben Ihnen eine furchtbare Unannehmlichkeit verursacht«, sagte der Verantwortliche. »Aber es ist ja warm. Wir können nur eines tun, damit es gleichmäßig aussieht.« Nun wollte er die Angelegenheit schnell hinter sich bringen.
»Warten Sie«, sagte der Kunde, stand auf und ging zum Schaufenster. Dann wandte er sich um. »Ich komme herein und dann … Warum bin ich eigentlich hergekommen?«
»Das wächst schnell nach«, sagte der Verantwortliche und bedeutete ihm mit der Hand, sich wieder zu setzen.
Der Kunde ging zurück zum Stuhl.
»Ich sage ja, ich bin noch nicht wieder zu mir gekommen. Wo beginnt das Risiko? Wissen Sie es?«
»Und ob«, war alles, was der Verantwortliche sagte. Es beruhigte ihn, dass sich der Kunde wieder hingesetzt hatte.
Boros stand mit verschränkten Händen neben dem Stuhl. Der Verantwortliche wandte sich an ihn, wollte ihm das Haarschneidegerät geben. Er sah ihn an.
»Schneiden Sie ihm die Haare ab«, bat er ihn leise.
»Ich kann es nicht.«
»Machen Sie es, Boros. Ich bitte Sie.«
Boros verschränkte die Arme hinter dem Rücken.
»Nein. Ich kann ihn nicht berühren.«
Der Verantwortliche ging nach hinten, zu dem mit einem Vorhang abgetrennten Teil des Raumes.
»Kommen Sie mit«, sagte er zu Boros.
Dieser folgte ihm, blieb neben ihm stehen.
»Das müssen Sie machen«, flüsterte der Verantwortliche ihm zu.
»Ich bitte Sie, schneiden Sie ihm die Haare jetzt ab. Nun kann alles ab. Ich bitte Sie.« Seine Stimme war schlicht und warm.
»Ich rühre ihn nicht an«, sagte Boros. »Ich kann nicht.«
Der Verantwortliche kam heraus. Einer der Barbiere war gerade frei, er bedeutete ihm, dem Kunden schnell die Haare abzurasieren.
»Ich nicht«, erwiderte dieser.
»Dann werde ich es machen«, sagte der Verantwortliche.
Er rasierte Boros' Kunden die Haare ab. Inzwischen war Boros zurückgekommen und hatte sich neben seinen Stuhl gestellt. Einige Kunden hatten bezahlt, der Laden war beinahe leer. Der Kunde war jetzt ruhig und blickte ins Leere. Der Verantwortliche nahm ihm den Umhang ab und fegte die Haare vom Mantel.
»Jedenfalls«, sagte er, mehr nicht.
»Es wäre besser gewesen, wenn ich es jemandem gezeigt hätte«, sagte der Kunde sehr leise. »Jetzt habe ich ja nichts, was ich zeigen kann, stimmt's?« Er wirkte nicht wütend, nur traurig.
»Jedenfalls«, sagt der Verantwortliche.
»Nun ja.« Der Kunde wandte sich an Boros. »Aber Sie müssen keine Angst haben«, sagte er leise und ernst. »Schneiden Sie ruhig weiter Haare«, sagte er, nahm seinen Hut und verließ den Laden.
Es war schlimm, dass der große rote Mann so leise sprach. Die Stirn des Verantwortlichen war feucht.
»Hat er bezahlt?«, fragte der Barbier, der dem Kunden an Boros' Stelle nicht hatte das Haar abrasieren wollen. Er trug einen großen schwarzen Schnurrbart.
»Wo denken Sie hin«, sagte die Kassiererin, die mit gesenktem Kopf dasaß.
»Den Hut wird er wohl eine Weile tragen«, sagte der Barbier mit dem Schnurrbart.
»Lassen Sie ihn jetzt«, sagte der Verantwortliche. Es war noch ein Kunde übrig.
»Du«, sagte der mit dem Schnurrbart zu Boros.
»Ich habe doch gesagt, dass Sie ihn jetzt ein bisschen lassen sollen«, sagte der Verantwortliche.
»Ich wollte ihn nur etwas fragen«, erwiderte der Barbier.
Als auch der letzte Kunde gegangen war, nahm der Verantwortliche seine Brille ab und sah Boros an.
»Was war das?«
»Ich weiß nicht.« Es war ihm anzusehen, dass er es tatsächlich nicht wusste.
»Lassen Sie sich untersuchen.«
»Du«, sagte der Kollege mit dem Schnurrbart. »Als du schon dabei warst, hättest du nur anhalten müssen und dann hätte man daraus immer noch einen Boxerschnitt machen können.«
Boros zog die Schultern leicht hoch.
»Hast du nicht gesehen, dass du reingerutscht bist? Als du wieder heruntergekommen bist, musst du es doch bemerkt haben.«
»Ich habe es gesehen«, sagte Boros. »Aber ich konnte nicht aufhören. Ich spürte sogar, wie ich bis ganz nach vorn gehen würde.«
Der Verantwortliche wischte sich über die Stirn und winkte ab, nur für sich selbst, er verstand es nicht.
»Lassen Sie sich untersuchen«, sagte er. »Der wird es anzeigen. Ganz sicher.«
»Er wird mit Hut hingehen«, sagte der Barbier mit dem Schnurrbart.
»Denken Sie nach«, sagte der Verantwortliche zu Boros. »Der geht und zeigt es an.«
»Man wird dich woandershin versetzen. Das ist alles«, sagte der mit dem Schnurrbart. »Damit kannst du rechnen.«
Boros schwieg. Man konnte nicht feststellen, was in ihm vorging, seine Augen erschienen den anderen nicht anders als sonst.
»Keller wurde auch nur versetzt, als er jemandem mit der Schere das Ohr abgeschnitten hatte. Dabei ist das nicht nachgewachsen.«
»Das war etwas ganz anderes«, sagte ein anderer.
Der mit dem Schnurrbart fuhr fort:
»Keller hörte gar nicht auf, er klapperte ihm immer weiter neben dem Kopf mit der Schere herum. Als die Kassiererin, die seine Freundin war, die Haare unter dem Stuhl einsammelte, flüsterte sie ihm zu: ‚Pass auf, das Ohr des Kunden liegt im Korb.‘ Dann fuhr er mit dem Alaunstift über die Stelle und sagte: ‚Ich habe Sie ein bisschen verletzt.‘«
»Woher wissen Sie das?«, fragte der Verantwortliche.
»Hat er erzählt. Er ist mit einer Versetzung davongekommen.«
»Gut. Lassen Sie Boros jetzt ein bisschen in Ruhe«, sagte der Verantwortliche. »Ein Ohr blutet übrigens kaum.«
Der mit dem Schnurrbart ging zur Kassiererin und fragte sie:
»Was sagen Sie dazu?«
Die Kassiererin antwortete nicht. Ihr Kopf war gesenkt. Auch die anderen saßen still da. Sie beobachteten Boros.
Dieser zog langsam seinen Kittel aus und hängte ihn hinter den Vorhang.
»Was machen Sie?«, fragte der Verantwortliche.
»Ich gehe«, antwortete Boros.
»Ich möchte mit Ihnen reden.«
Boros, bereits auf dem Weg zur Tür, blieb stehen.
»Gut.«
»Es wäre besser, wenn Sie jetzt nicht gehen würden.«
Boros wandte sich zu ihm um.
»Ich gehe«, sagte er und zog die Tür hinter sich zu.
DER BRUDER DES HEIZERS
Die Badeanlage bestand lediglich aus drei Gebäuden. Das größte von ihnen sah ganz passabel aus, im Obergeschoss gab es einen breiten, überdachten Rundgang, von dem man zu den Gästezimmern gelangte. Im Erdgeschoss lag der Speisesaal, mit einem kleinen Nebenraum, in dem sich der Ausschank befand. Das andere Gebäude war die eigentliche Badeanstalt, mit dem schäbigen Kesselhaus, von dem aus sich dicke Rohre zu den Badekabinen und den ausgedienten, nach Schwefel riechenden Wannen schlängelten. Das dritte Gebäude war ebenerdig und durch einen kleinen, überdachten Durchgang mit dem Speisesaal verbunden, hier befand sich die Küche.
Jetzt am Abend war von alldem nur der beleuchtete Rundgang zu sehen, wo an einem Tisch drei in Decken gehüllte Männer Klaberjass spielten. Von der Straße her näherte sich ein Mann dem Gebäude und als er in den Lichtkreis der Lampen kam, fand er die Treppe rasch. Er trug einen dunklen Anzug und ein weißes Hemd und in der Hand hielt er eine dicke Aktentasche. Er war vollkommen durchnässt, alles glänzte an ihm glatt und dunkel. Und doch, als fühlte er sich ausgesprochen wohl, trat er in forscher Art an den Tisch.
»Ich suche den Heizer«, sagte er. »Wissen Sie, wo sein Zimmer ist?«
Die Kartenspieler besahen sich diesen Mann, um dessen Füße sich das herunterrinnende Wasser zu einer Pfütze sammelte.
»Den Heizer?«, fragte einer mürrisch. »Gibt es hier einen Heizer? Ich denke, nicht.«
»Wir haben keinen Heizer«, sagte ein anderer.
»Er ist nämlich mein Bruder«, sagte der durchnässte Mann. »Ihn wollte ich besuchen.«
»Mein Herr, wir kennen Ihren Bruder nicht. Selbst wenn er zufällig hier sein sollte.«
»Pff«, sagte der Bruder des gewissen Heizers. »Dabei muss er irgendwo hier sein. Irgendwo muss ich ihn doch finden. Und werde es auch.«
Damit wandte er sich um und ging zurück ins Erdgeschoss. Er ging über den Flur, durch den Speisesaal und den Durchgang, der zur Küche führte und trat durch die offene Tür.
Die Zeit des Abendessens war längst vorbei, jetzt war die Küche von Zimt- und Nelkenduft erfüllt. In einem Milchtopf wurde Glühwein gekocht. Die Frau des Hausverwalters und eine kleine, schrumpelige Köchin unterhielten sich über das Menü des nächsten Tages.
»Ich suche den Heizer«, sagte der durchnässte Mann.
»Den Heizer?«, fragte die Frau des Verwalters. »Was für einen Heizer?«
»Den Heizer des Kesselhauses«, sagte der durchnässte Mann. »Er ist mein Bruder.«
»Sie suchen unseren Maschinisten«, sagte die Frau des Verwalters. »Das ist etwas ganz anderes.«
»Den Heizer«, sagte der durchnässte Mann. »So nennen wir den Beruf untereinander.«
»Na gut«, sagte die Frau des Verwalters. »Wenn Sie sagen, dass er Ihr Bruder ist, werde ich unseren Maschinisten mal suchen. Er geht zeitig ins Bett, um die Zeit schläft er also schon.«
Die Frau des Verwalters warf sich ein großes Baumwolltuch über die Schulter und ging den Maschinisten wecken, dessen Bruder angeblich angekommen war.
»In der Zwischenzeit würde ich gern etwas essen«, sagte der Mann, der behauptete, der Bruder des Heizers zu sein. »Ich bin der Gast meines Bruders.«
Die Köchin hob die Deckel an und nahm aus einem Topf etwas von dem Fett, das von dem Braten des Abends übriggeblieben war, gab es in eine Pfanne und holte Eier. Auf einem Brett schnitt sie eine Zwiebel auf, zwei Tomaten und ein Stück Paprika. Als das Fett heiß war, schlug sie die Eier darauf.
»Ich bin auch Heizer«, sagte der durchnässte Mann und setzte sich an den Tisch.
»Unser Maschinist ist ziemlich neu hier«, sagte die Köchin. »Er bezeichnet sich als Maschinist.«
Die Kartenspieler kamen fröstelnd in die Küche. Die Decken nahmen sie auch jetzt nicht von den Schultern. Sie zogen den Topf mit dem Glühwein zur Seite und stellten zwei kleine Porzellankannen an den Rand des Ofens, damit sie sich aufwärmten.
»Sie haben, wie man so schön sagt, keinen trockenen Faden am Leib«, sagte einer von ihnen.
»Ich werde schon noch trocknen. Ich bleibe ein paar Tage.«
»Essen Sie«, sagte die Köchin. Sie stellte ihm das Rührei hin und, in einem zweiten Teller, den Salat.
Die Kartenspieler gossen den Glühwein in die beiden warmen Kannen und musterten dabei mit Seitenblicken den Bruder des Heizers, der nicht einmal sein nasses Sakko ausgezogen hatte. Dann kam die Frau des Verwalters zurück.
»Unser Maschinist hat keinen Bruder«, sagte sie. »Er sagt, er sei Einzelkind.«
»Pff«, sagte der durchnässte Mann. »So etwas sollte mein Bruder nicht sagen.« Dann aß er ruhig weiter.
»Aber das hat er nun einmal gesagt. Das und sonst nichts. Und er war nicht sehr erfreut darüber, dass ich ihn geweckt habe.«
»Ich werde ihn noch einmal wecken«, sagte der durchnässte Mann etwas verstimmt. »Ich werde doch wohl wissen, wer ich bin und wer er ist. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir sind Brüder.«
»Vielleicht ist er nur ein Namensvetter«, bemerkte die Frau des Verwalters leise. »So etwas kann vorkommen … Wie heißen Sie?«
»Es kann vorkommen? Jetzt wird es mir aber zu bunt. Gleich muss ich lachen. Sagen Sie mir bitte, welches das Zimmer meines Bruders ist. Welches ist das Zimmer des Heizers? Ich komme von weither und würde mich nun gerne hinlegen.«
»Trinken Sie noch ein Glas. Trinken Sie ein bisschen warmen Wein«, sagte einer der Kartenspieler. »Das wird Ihnen auf jeden Fall guttun.«
»Schenken Sie mir welchen ein.«
Die Frau des Verwalters stellte sich in die Tür.
»Sehen Sie die Tür am Ende des Flurs neben den anderen beiden? Die ist es. Es steht keine Nummer darauf, auch nicht Herren oder Damen. Die, an der nichts steht.«
Der Bruder des Heizers trank den Becher Wein aus und nahm seine dicke Aktentasche. »Dann gehe ich mal hinauf«, sagte er.
»Ich werde mich meinem Bruder vorstellen.«
»Er schläft tief und mag es nicht, wenn man ihn dabei stört«, sagte die Frau des Verwalters. »Sie können auch hier irgendwo schlafen. Auch wenn Sie nicht der Bruder unseres Maschinisten sind.«
»Auch wenn ich nicht der Bruder bin … Pff!«, sagte der durchnässte Mann empört und ging.
Nachdem er den Raum verlassen hatte, blickte die Frau des Verwalters erschrocken um sich.
»Sie sehen einander ein bisschen ähnlich«, sagte sie. »Aber ich glaube trotzdem, das wird Ärger geben. Wir haben ja gehört, dass unser Maschinist keinen Bruder hat. Nur der hier hat irgendwo einen.«
»Außerdem sucht er einen Heizer«, sagte einer der Männer. »Und wir haben, wie ich gerade höre, einen Maschinisten.«
»Das nimmt kein gutes Ende«, sagte die Köchin.
Nachdem die Kartenspieler auf den Rundgang zurückgekehrt waren, hatten die Frauen noch eine ganze Weile in der Küche zu tun. Hin und wieder warfen sie einen Blick zu der besagten Tür im Obergeschoss, auf der nichts stand.
»Vielleicht ist er doch eine Art Verwandter«, sagte die Köchin nach einer Weile. »Denn offenbar schläft er tatsächlich dort.«
»Wie es aussieht, schmeißt er ihn nicht hinaus«, sagte die Frau des Verwalters.
»Bei diesem hundsmiserablen Wetter.«
»Sie haben sich wohl irgendwie geeinigt. Schließlich sind sie Menschen.«
Einer der Kartenspieler ging auf die Tür mit der Aufschrift Herren zu. Als er dort ankam, ließ er sie ein bisschen quietschen, aber ging nicht hinein, horchte nur an der Tür daneben. Dann winkte er den anderen zu und zuckte die Schultern. Da drinnen geschah nichts Außergewöhnliches. Es gab kein Theater.
Früh am Morgen stand die Frau des Verwalters bereits in der Küchentür. Sie sah, wie die Tür des Maschinisten geöffnet wurde, dieser in seiner ölverschmierten Arbeitskleidung heraustrat und nach ihm der Mann im Anzug, der von sich behauptet hatte, dessen Bruder zu sein. Leise gingen sie den Rundgang mit dem Bretterboden entlang und dann die Treppe hinunter, bis zum Tor. Dort standen sie mehrere Minuten, klopften sich immer wieder gegenseitig auf die Schulter und gaben sich zum Schluss die Hand. Der Schlafgenosse des Heizers machte sich auf den Weg ins Dorf. Nach dem Frühstück standen die Gäste vor dem Speisesaal. Sie beobachteten den Himmel, in der Hoffnung, heute würde das Wetter endlich etwas besser. Der Mann mit der ölverschmierten Arbeitskleidung ging an ihnen vorbei, in Richtung Kesselhaus. Die Kartenspieler des Vorabends saßen auf einer Bank, und während der eine den anderen um Feuer bat, machte der dritte sie dezent auf den Mann aufmerksam.
»Das wird er sein. Der Meister.«
»Das wird der Maschinist sein.«
»Ich habe ihn bisher nie gesehen. Aber es stimmt auch, dass ich gar nicht so sehr darauf geachtet habe.«
»Es ist gut zu wissen, dass es hier so eine Art Heizer gibt. Falls noch jemand nach ihm suchen sollte.«
Später kam der Maschinist mit langsamen Schritten aus dem Kesselhaus zurück, überquerte den Hof und ging in die Küche. Nach einigen Minuten kam er wieder heraus. Er unterhielt sich mit der Frau des Verwalters, die ihn bis zur Treppe begleitete. Der Maschinist stieg die Treppe hinauf, ging über den Rundgang bis zu seinem Zimmer, an dem nichts stand. Sonst war er genauso zwischen den Gebäuden und Badegästen umhergelaufen, doch hatte man ihn nicht beachtet. Bisher hatte niemand mit ihm sprechen wollen. Bisher hatte man nicht gewusst, dass er Heizer oder Maschinist war.
»Ich erzähle Ihnen gleich etwas«, sagte die Frau des Verwalters zur Köchin. »Helfen Sie mir währenddessen ein bisschen. Heute reisen drei Diätgäste ab und am Morgen sind zwei Apotheker mit großem Appetit angekommen.«
Sie gingen in die Speisekammer und holten einen Korb grüne Paprika, Tomaten und einen Topf saure Sahne. Dann noch Zwiebeln und Öl. Die Frau des Verwalters wusch sich die Hände.
»Er ist weg«, sagte sie.
»Wie bitte?«, fragte die Köchin.
»Der Bruder unseres Maschinisten ist heute gegangen«, sagte die Frau des Verwalters. »Am frühen Morgen.«
»Er ist weg? Das ist nicht gut.«
»In der Tat. Aber Sie wissen nicht, warum.«
Sie kippten die grünen Paprika auf den Tisch und entkernten sie mit kurzen Messern. Sie saßen auf zwei niedrigen Stühlen und legten die Paprika in eine Schüssel.
»Wenn Sie zuhören, erzähle ich weiter«, sagte die Frau des Verwalters. »Sie werden sehen, das ist eine hässliche Geschichte. Ziemlich hässlich.«
»Ich verstehe es nicht«, sagte die Köchin. »Aber wenn Sie es sagen, ist es bestimmt eine hässliche Geschichte.«
»Es ist gar nicht schlimm, wenn Sie es nicht verstehen«, sagte die Frau des Verwalters. »Am besten, Sie wissen von der ganzen Sache gar nichts. Der Maschinist bittet uns auch darum.«
»Das verstehe ich«, sagte die Köchin. »Das ist sonnenklar.«
DER FÖRSTER UND SEIN GAST
Der Fremde saß auf dem Stumpf einer gefällten Tanne, neben ihm, im Gras, lag seine Seitentasche. Er war vor kurzem angekommen. An seinem rechten Bein war die Hose bis zum Knie hochgekrempelt, an die nackte Wade drückte er ein feuchtes Taschentuch. Hinter ihm hing an der abgespaltenen Rinde einer Kiefer sein Gewehr. Er trug keinen Hut, sondern eine Baskenmütze, sah aus wie ein Anfänger unter den Jägern.
Vor ihm, in einer Entfernung von zwei Schritten, brannten zwei große Holzscheite. Der bläuliche Rauch stieg über der schmalen Lichtung zwischen die Wipfel der Bäume, wo er von dem Luftzug des Bachs mitgerissen wurde. Zwischen dem Bach und dem Feuer lief ein Pfad voller Abfallholz, hier lag der Hund, ein langhaariger Kuvasz.
Der Pfad endete bei einer aus Balken gezimmerten Hütte. Es war eine kleine Hütte wie aus einem Märchen. Aus dieser kam der Eigentümer des Hundes, der Förster. Ein gedrungener Mann mit kurzen Beinen, der Sandalen trug. Er hielt ein Tuch und ein kleines Glas in der Hand und ging zum Feuer. Er kniete sich vor dem Fremden ins Gras, nahm das feuchte Tuch von dessen Wade, träufelte aus dem kleinen Glas eine dicke Schicht Honig auf die Wunde, wartete ein bisschen, bis er sich gleichmäßig verteilte, dann legte er das saubere Tuch darauf und verband es locker.
»Haben Sie gesehen, wie es aussieht?«, fragte der Fremde.
»Das wird erst mal helfen, aber gehen Sie zum Arzt und lassen sich eine Impfung geben«, sagte der Förster und ging mit dem Glas zurück zur Hütte.
Nachdem der Fremde allein geblieben war, nahm er den Verband vom Bein und besah sich die Wunde. Die Spuren der Zähne waren auch unter dem glänzenden Honig deutlich zu erkennen, um die Stelle war die Haut rot und geschwollen. Der Hund lag reglos auf dem Pfad, auf der anderen Seite des Feuers.
»Lassen Sie das in Ruhe!«, rief der Förster, der wieder aus der Hütte kam. Er hielt einen Rucksack in der Hand, den er neben das Feuer fallen ließ. Mit einem Kessel schöpfte er Wasser aus dem Bach, setzte sich ins Gras, nahm eine Kartoffel aus dem Rucksack und schälte sie. Die Kartoffelschalen fielen auf seine nackten Füße, als er fertig war, trat er sie ins Feuer. »Lassen Sie es endlich in Frieden«, sagte er. »Sie gehen, holen sich eine Impfung und dann ist gut.«
»Nichts ist gut«, sagte der Fremde. »Sehen Sie sich mal an, was er angestellt hat.«
»Ich habe es gesehen.«
Am Ende des Tales war ein hoher, kahler Berghang, irgendwann musste dort auch ein Wald gewesen sein. Die Sonne beschien einen schmalen Streifen am oberen Rand der Rodung, rutschte dann auch von dort ab, und nun leuchteten nur noch die Wolken. Die Luft um den Bach herum wurde blauer. Der Fremde holte eine dicke Strickjacke aus seiner Tasche, zog sie an und knöpfte sie bis oben zu. Es war eine gekaufte, dünne, rote Strickjacke, am Halsausschnitt lugte das blaue Hemd hervor. Nicht gerade eine Jägerkleidung, aber der Förster trug auch Sandalen.
»Essen Sie ein bisschen Kartoffelsuppe?«, fragte der Förster, nachdem er an die fünf Kartoffeln geschält hatte.
»Ich habe zu essen«, sagte der Fremde und nahm mit langsamen Bewegungen etwas aus der Tasche, das in Zeitungspapier verpackt war.
»Dann reicht es«, sagte der Förster. Er hängte den Kessel über das Feuer und zog die Glut darunter zusammen. Er schnitt eine Zwiebel in zwei Teile und warf diese ebenfalls ins Wasser. »Und nehmen Sie etwas davon?«, fragte er und holte eine Flasche aus dem Rucksack. Darin war eine farblose Flüssigkeit, doch als er sie bewegte, sah man, dass es kein Wasser war. Der Fremde griff danach, roch daran und trank, wobei er den fernen, kahlen Berghang betrachtete.
»Der Magura«, sagte er und deutete nach vorn.
»Nein«, sagte der Förster.
»Was ist es dann?«
»Nur ein Berghang.«
»Und welcher ist dann der Magura?«
»Keiner von denen«, sagte der Förster. »Trinken Sie. Sie haben sich gründlich verirrt. Am Morgen gehen Sie diesen Pfad hinunter.«
Der Förster steckte die Flasche zurück in den Rucksack und stand auf.
»Binden Sie ihn nicht zu?«, fragte der Fremde.
»Das mache ich nie.«
»Binden Sie ihn zu.«
»Nein«, sagte der Förster leise und ging zur Hütte. Vor der Tür lagen dicke, abgesägte Teile eines Stammes. Einen davon stellte er auf und zerteilte ihn mit einem Beil. Er holte unter der Traufe ein breites Messer hervor und zerschnitt die Scheite in dünne Schindel. Diese reihte er an die Hütte gelehnt auf.
Der Fremde holte aus dem Zeitungspapier ein Stück Brot und warf es über dem Feuer dem Hund zu. Dieser kroch auf dem Bauch dorthin, wohin es gefallen war, beschnupperte es und fraß es auf. Dabei sprach der Fremde zu dem Hund, doch dieser rührte sich nicht. Der Förster hielt für eine Weile in der Schindelherstellung inne und beobachtete sie. Er sah, dass der Fremde wieder den Verband vom Bein nahm und in seine Richtung blickte.
»Sehen Sie sich das an«, sagte er. »Sehen Sie sich an, was er angestellt hat.«
»Ich sehe es«, sagte der Förster und kam näher. »Aber lassen Sie es in Ruhe.« Er rührte mit einem Holzlöffel die Suppe um, nahm eine Kartoffel heraus und kostete sie.
»Haben Sie ihn verprügelt?«
»Wann hätte ich ihn denn verprügeln sollen?«
»Na, sehen Sie. Zeigen Sie ihm die Wunde und verprügeln Sie ihn.«
»Das werde ich nicht tun«, sagte der Förster. Er ging zurück zur Hütte und spaltete weiter die Schindeln ab. Es wurde dunkel, die vor der Hütte aufgereihten Schindeln leuchteten. Als er fertig war, holte er einen Löffel und einen Blechteller, in dem etwas saure Sahne war. Er nahm den Kessel vom Feuer, hielt ihn eine Weile in den Bach und als er dachte, dass er ausreichend abgekühlt war, ging er zurück, kippte die Suppe in den Teller und setzte sich, um zu essen.
»Sie haben nichts geschossen«, sagte er und deutete auf die flache Tasche des Fremden. Dieser schwieg.
»Wenn Sie wenigstens etwas geschossen hätten. Wobei die Tasche so leichter ist. Bis zum Bus brauchen Sie gute drei Stunden. Immerhin hatten Sie etwas gute Luft.«
Der Fremde musterte den Hund.
»Hören Sie«, sagte er. »Glauben Sie, dieser Hund würde mit mir kommen?«
»Ob er sich mit Ihnen versöhnen würde? Wenn Sie ihm etwas zu fressen geben, bestimmt. Er würde Sie ein Stück begleiten.«
»Es würde mich interessieren, ob er es tatsächlich macht.«
»Sie müssen viele Patronen haben«, sagte der Förster. Er rief den Hund zu sich und kippte den Rest des Essens vor ihn auf den Boden. Mit dem Kessel holte er Wasser aus dem Bach und goss es aufs Feuer. »Ich habe nur eine Taschenlampe«, sagte er. »Ich bereite drinnen alles vor und dann gehen wir schlafen. Bleiben Sie so lange ruhig hier sitzen.«
Auf dem Weg zur Hütte nahm er das Gewehr des Fremden vom Baum.
»Was haben Sie vor?«, rief der Fremde und sprang auf. Der Hund knurrte ihn an.
»Laci«, sagte der Förster und wartete, bis das Tier zu ihm kam.
»Was wollen Sie damit? Hier ist meine Jagderlaubnis.«
»Morgen früh bekommen Sie es zurück«, sagte der Förster.
Der Hund legte sich vor die Tür. Inzwischen war es vollkommen dunkel.
»Legen wir uns hin«, sagte der Förster nach einer Weile, von der Tür der Hütte aus. »Kommen Sie.« Er hielt den Fuß auf dem Hals des Hundes.
»Wo haben Sie es hingebracht?«, fragte der Fremde, während er sich langsam der Hütte näherte.
»Ich habe doch gesagt: Bevor Sie gehen, bekommen Sie es zurück. Ich weiß nicht, wer Sie sind, ich weiß nur, dass Sie losgezogen sind, um zu schießen. So ist es eine klare Sache.«
»Kein bisschen«, sagte der Fremde. »Sie haben etwas mit mir vor.«
»Kommen Sie. Ich zeige Ihnen Ihr Bett.«
Der Fremde trat ein. Das Licht der Taschenlampe beleuchtete eine schmale Schlafstätte.
»Ich werde dafür sorgen, dass man von Ihnen erfährt«, sagte der Fremde. »Zuerst hetzen Sie Ihren Hund gegen mich auf und dann nehmen Sie mir mein Gewehr weg.«
»Sie werden sich an alles so erinnern, wie Sie wollen«, sagte der Förster. »Wie es Ihnen gefällt. Und das hier ist eine einfache Pritsche. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie so weit sind, dann schalte ich das Licht aus.«
Der Fremde zog die Stiefel aus und legte sich auf die Pritsche. Der Förster zog die Tür zu und warf für sich zwei Decken auf den Boden.
»Sind Sie fertig?«, fragte er nach einer Weile.
»Lassen Sie das Licht an.«
»Das ist eine Taschenlampe«, sagte der Förster und ließ das Licht einmal in dem engen Raum im Kreis wandern.
»Lassen Sie sie trotzdem an.«
Der Förster schaltete die Taschenlampe aus. Er legte sich auf eine der beiden Decken, mit der anderen deckte er sich zu. Der Boden war auch aus Balken gezimmert.
In der Nacht rauschte der Bach, rauschten die Tannen. Gegen Tagesanbruch fing es an zu regnen, dann hörte es wieder auf. Die von den Kiefern fallenden Tropfen klopften noch lange auf das Schindeldach. Der Förster wurde wach. Er hackte Holz und machte in einer Ecke der Hütte, zwischen großen, verrußten Steinen Feuer. Die Balken daneben waren schwarz, der Rauch stieg durch die Ritzen im Dach.
»Es ist Morgen«, sagte er.
Der Fremde stand auf. Er zog seine Stiefel an.
»Was macht Ihr Bein? Wie geht es Ihnen?«
»Mein Gewehr.«
»Ich kann Ihnen noch eine Portion Polenta geben. Von hier bis zur Landstraße sind es drei Stunden.«
»Geben Sie mir das Gewehr.«
Der Förster öffnete die Tür. Es war ein grauer, feuchter Morgen, zwischen den Tannenwipfeln waberte nach dem Regen noch Nebel. Der Förster verschwand irgendwo neben dem Haus, kam mit dem Gewehr zurück und hängte es an die Baumrinde, von wo er es am Abend weggenommen hatte.
»Es hängt dort. Daneben ist der Pfad.«
»Also drei Stunden, sagen Sie?«, fragte der Fremde und machte sich auf den Weg.
»Ja.« Den Kopf des Hundes zwischen die Beine geklemmt, blickte der Förster dem Fremden lange hinterher. »Wenn Sie noch ein paar Tage bleiben, freunden wir uns vielleicht an.«
BARBARAFEIER
Es war keine ausgesprochene Bergbaugegend. Eigentlich war es nur ein Bergbaudörflein, das halb im Wald, halb an den steilen Hängen lag, trotzdem veranstalte man auch hier jedes Jahr die Barbarafeier. Sieben Kilometer entfernt, im Unterdorf, war die Bahnstation, die Verladestelle, auch von hier kamen Arbeiter, sie wurden mit Lastwagen hinaufgefahren. Jetzt hatte man zwischen den beiden Dörfern, dort, wo das Tal etwas breiter war, einen Steg über den Bach gelegt und an den beiden Ufern Zelte und Buden aufgestellt. Die Zimmermänner hatten am Samstagnachmittag im Regen gearbeitet und auch am nächsten Morgen hatte es noch nicht ganz aufgehört. Trotz des kühlen Nieselregens machten sich die Bergleute mit ihren Familien am frühen Vormittag auf den Weg zum Fest.
Das kleine Bergbaudorf hatte Gäste: zwei Theologen. Sie behaupteten, sie seien Juristen. Sie waren am Nachmittag des Vortages angekommen und gleich losgezogen, um sich umzusehen. Nachdem sie eine Weile neben der Kegelbahn gestanden hatten, wollten sie die Schule sehen. Sie sagten jedem, sie seien Juristen, die einen Ausflug machten.
Auch sie nahmen an der Feier teil, sie waren mit der jungen Grundschullehrerin und der jungen Erzieherin gekommen. Als hätten die beiden Frauen nach den langen Abenden in dem engen Tal, nach der vielen einsamen Zeit nur auf dieses Treffen gewartet – in ihre Augen war die Wärme zurückgekehrt, und es war dieser Blick, den sie vor den kalten Regentropfen möglichst zu schützen versuchten, als sie mit den jungen Männern an ihrer Seite durch die dichte Menge der Feiernden gingen. Unter einer großen Kiefer fanden sie einen trockeneren Platz, wo sie sich hinsetzten und Rummikub spielten. Der Boden war sauber, der Bach tritt hier jeden Monat aus seinem Bett und spült allen Müll fort. Nach einer Weile hörten sie auf zu spielen und beobachteten das Geschehen. Dann begann der eine Theologe ein Gespräch mit der Erzieherin und sie spazierten zu den Zelten, wo sie verschwanden. Währenddessen legten sich die anderen beiden auf die Decke. Auch sie unterhielten sich.
Nachdem der Theologe und die Erzieherin zurückgekommen waren, holte die Lehrerin aus einer blauen Kühltasche belegte Brote, legte sie auf die feuchte Innenseite des Deckels, und sie aßen. Die Brote waren in bunte Kinderzeichnungen gewickelt, wie sie an den Wänden von Schulkorridoren zu sehen sind. Auf den beiseitegeworfenen Blättern verwischte der Nieselregen allmählich die Farben und Namen der Schüler.
Inzwischen waren neue Leute angekommen, die während der Nachtschicht gearbeitet hatten.
Sie hatten sich gründlich gewaschen, sich ein wenig ausgeruht und ihre Festtagskleidung angezogen. Sie gaben allen Anwesenden die Hand. Auch alle anderen gaben sich jetzt untereinander die Hand, nun waren die Arbeiter aller drei Schichten präsent. Sie tranken hellen Kornbrand. Mehrere kamen zu den Theologen und stießen mit ihnen an. Die beiden freuten sich, dass man auch mit ihnen anstieß und es offenbar niemanden störte, dass sie mit den Frauen hergekommen waren. Die Bergmänner kümmerten die Frauen kaum, sie wussten, dass im kommenden Jahr eine neue Lehrerin kommen würde. Hier hatte noch keine einzige geheiratet.
Einer der Theologen ging zu dem Zelt, wo es das Bier gab, holte vier Flaschen und stellte sie zum Kühlen in den Bach. Dann spielten sie weiter Rummikub. Sie saßen dicht beieinander, sahen die Steine der anderen, aber das war jetzt nicht wichtig.
Durch den Regenvorhang waren die arglos taumelnden Gestalten um die Buden herum zu erkennen und zu sehen, wie die Hemden durchnässten, die seit zwei oder drei Wochen bereits gebügelt darauf gewartet hatten, von einem gewaschenen, weißen Körper angezogen zu werden. Der Theologe, der diese Beobachtung machte, sagte aber nichts, um seine Gedanken, die sich den Wölbungen der Erzieherin anschmiegten, nicht durch Worte zu unterbrechen. Sie waren auf einem Ausflug. Während das Bier abkühlte, tranken auch sie hellen Korn.
Gegen Mittag gingen plötzlich einige eilig den Weg hinauf. Manche rannten sogar. Viele durchquerten den Bach, da der improvisierte Steg viel zu schmal für alle gewesen wäre. Nicht weit entfernt, in der ersten Kurve, war ein umgekippter Wagen zu sehen, der Pyrit transportiert hatte und nun im Bach lag. Die Straße war rutschig. Der Fahrer wird wohl gedacht haben, diese Ladung würde er noch hinunterbringen, sie abladen, rasch ein weißes Hemd anziehen und sich den Feiernden anschließen. Jetzt stand er neben dem Wagen, bleich, von seinem Mundwinkel führte eine rote Linie bis zum Kinn, wo sie in einem Tropfen endete. Er sagte immer wieder, dass ein Grubenjunge auf der Ladung gesessen habe, der verschwunden sei. Neben dem Wagen, im Bach, lag der herausgekippte schwere Pyrit.
Als der Junge darunter gefunden wurde, drehten viele den Kopf weg: Es war kein Anblick für einen Festtag. Aber die Mutter, die ebenfalls da war, ging ganz nah zu ihm und betrachtete ihn. Sie wollte ihn nicht anfassen, sah ihn nur an. Der Junge war selbst unter den Toten ein stiller Toter, nicht blutig, nur dreckig von dem dunkelgrauen, feuchten Pyrit. Sogar sein weit geöffneter Mund war voll mit dem schweren Eisenkies.
»Er wollte etwas sagen«, sagte die Mutter nach einer Weile. »Warum sonst wäre sein Mund geöffnet gewesen, sodass der Pyrit hineinfallen konnte?«
Viele stimmten ihr zu: Der Junge habe offensichtlich etwas sagen wollen. Dabei aber umfassten sie sie sanft, um ihr zu bedeuten, es sei an der Zeit zu gehen.
»Was er wohl sagen wollte?«, fragte die Mutter und stand so fest an derselben Stelle, dass es so aussah, als würde man sie mit Gewalt fortzerren müssen. Aber dann ging sie doch von allein nach Hause.
Von ihren Fragen ließ sie auch am Abend nicht ab. Sie wohnte gegenüber der Schule, auf der anderen Seite des Baches, ihre Stimme wurde von der feuchten Luft über das Wasser getragen.
Einer der beiden Theologen stand auf und schloss das Fenster. Er sagte, das könne man nicht mit anhören. Im Zimmer war die Luft auch feucht, die Rummikubsteine klebten ständig zusammen. Der andere Theologe öffnete das Fenster wieder, er wollte es hören.
»Was er wohl sagen wollte?«
Sie saßen noch eine Weile so da, dann zog der erste Theologe seine Hand aus der Hand der Erzieherin und stand auf.
»Gottverdammich …«, sagte er sehr leise. Jetzt war sowieso schon alles egal.
»Wir kommen bestimmt noch einmal vorbei«, sagten die beiden Theologen bei ihrem eiligen Abschied.
Sie stellten sich auf die Straße und warteten auf einen Wagen, der sie mit hinunternehmen würde. Sie waren keine schlechten Menschen, hatten sich nur etwas amüsieren wollen. Sie behaupteten, sie seien Juristen, dabei waren sie Theologen. Man sah ihnen von weitem an, dass sie Theologen waren, doch in dieser Gegend hatte man bisher weder Juristen noch Theologen gesehen.
VERSCHNEITE FUSSSPUREN
Auf der Südseite des Puzdra tauchten große, braune, linsenförmige Wolken auf. Düster zogen sie an seinem Gipfel vorbei, manche streiften ihn. Dann riss ein größerer Teil ab, die Wolkenfetzen blieben in der Nähe des Felsens hängen, der die Form eines sitzenden Wolfes zeigte, und trieben durchscheinende Wurzeln zwischen die eisigen Klüfte. Die Wolken strichen um den Gipfel herum, bis sie ihn nach einigen Stunden völlig bedeckten. Offenbar würde es dort oben wieder schneien.
Daran war nichts Ungewöhnliches. Ungewöhnlich war höchstens die Laune der Wolken, sich auf diesen einen Berg festzulegen, an den anderen Gipfeln waren sie hochmütig vorbeigezogen. Sonst umarmten sinkende Wolken ganze Gebirgszüge, blieben in den Schluchten haften, füllten die Nischen der Täler aus; zogen das, was sie verschlangen, in den Himmel.
Diesmal waren die Wolken etwas demütiger, schmiegten sich einfach an den Berg, wodurch dessen Form noch zu erahnen war. Der Anblick beschwor eine erwartungsvolle Stimmung herauf, ähnlich einer Skulptur vor ihrer Enthüllung.
Hier unten, neben den Zäunen des Repedő-Tales lag der Schnee der vergangenen Woche in mehlsackgroßen Haufen, etwas weiter oben war zwischen den Schneeflecken, in ebenso großen Flächen, die mit Ziegenkot gepunktete dunkle Erde zu sehen.
Hinter dem Geröll des Steinbruchs verschmolzen die einzelnen Schneefelder plötzlich zu einer zusammenhängenden Decke.
Hier gab es in nahezu gleichem Abstand voneinander Vertiefungen, die jeweils so groß waren wie das Kochgeschirr bei der Armee. Es waren halb verschneite Fußspuren, unter ihnen plätscherte der Bach, gedämpft durch das bauchige Gefäß seines Bettes. Der Schnee war darüber zu einem Tunnel gefroren, seine Decke hielt dem Gewicht von Menschen recht gut stand, bis das Ganze an einem bestimmten Punkt plötzlich erschreckend dröhnte, hier waren die Schritte nach einer zögerlichen Bewegung nach links und rechts, direkt zwischen die Baumstümpfe der Rodung geeilt. Jemand war hier gewesen und hatte sich erschreckt.
Es war später Nachmittag, die Dunkelheit brach gleichmäßig herein, bis sich hinter dem Felsen in Form eines sitzenden Wolfes eine Wolke bewegte, die grau ins Tal einbog, an ihrer Stelle blieb der Himmel etwas leerer und warf auf die Ränder der Fußspuren gelbliches Licht. Nicht viel später, als der gelbe Schein des Schnees von den Hügeln verflog und eine weitere, hartnäckigere Wolke auftauchte, brach plötzlich die Nacht herein.
Von dem Kamm aus löste sich der Wind mit einem leisen Grollen, plötzlich wurde das Tal lila, als fegte lila Wind über die Berghänge. Der Nebel kroch seitlich entlang der Talöffnung weiß hinauf, weiter oben angekommen, traf er auf Krähen, die von den Windstößen getrieben wurden, durch dieselben Windstöße sank der Nebel schließlich auf den Wald. Wie ein ziemlich großer Schleier, der an dem stacheligen Fell der Erde hängen geblieben war. Als sich der Wind für einen Augenblick legte, blieb der Schleier unbewegt und dann ließ er sich langsam wogend zwischen die Äste der Tannen nieder und setzte sich auf deren Stämme. Eine andere Wolke war auf dem Weg zu der nichts ahnenden Hochebene Lóhavas, hielt einen Augenblick vor dem Talkessel, wurde am Bauch ein wenig eingedrückt, dehnte sich dann mit flunderartigen Bewegungen aus und legte sich auf die Hochebene der drei Seen.
Manchmal lässt sich eine solche linsenförmige Wolke überraschend auf einem Berg nieder, einige Tage rieselt aus ihr sanft der Schnee, und dabei wird es um sie herum Frühling. Trotzdem erkennt man irgendwie, dass dort oben etwas passiert. Die Krähen, die sich in die Höhe wagen, fliegen an den fransigen Rändern der Wolken in den launenhaften Strömungen trotz aller Bemühungen rückwärts.
NEUE MÖBEL
Cservenszki stand früh am Morgen auf, gab dem Hund zu fressen, gab den Kaninchen zu fressen und spannte ein geliehenes Pferd vor den Schlitten. Den ganzen Vormittag über fuhr er warmen Dung auf die schmalen, mageren Felder. Er schaufelte große schwarze Haufen auf den gefrorenen Schnee. Während der Dung dampfte, kreisten über ihm dicke Nebelkrähen, doch mittags war er bereits von Raureif überzogen.
Cservenszki fuhr nach Hause, kippte zwei Eimer lauwarmes Wasser über den unteren Teil des Schlittens und säuberte ihn mit einem Besen. Er zog seine pelzbesetzte Weste an, hängte dem geliehenen Pferd eine Glocke um den Hals, stellte sich hinter ihm auf den Schlitten und fuhr los ins Dorf. Beim Barbier band er das Pferd am Strommast fest und betrat den Laden. Er ließ sich den Nacken rasieren. Der Barbier erwähnte, dass irgendein Lastwagenfahrer nach ihm gefragt habe. Cservenszki machte sich wieder auf den Weg.
Bei der Kurve am Repedő-Bach wurde die Straße etwas breiter. Im Schnee waren die Radspuren eines gewaltigen Lastwagens zu erkennen. Man sah den von den Rädern geschwärzten gefrorenen Schnee, die Z-förmigen Spuren des beschwerlichen Wendeversuchs. Und natürlich standen die glänzenden Möbel im Schnee, die er nach Hause bringen musste. Ein klobiger gelber Schrank aus Eschenholz, ein auseinandergebautes, schweres Bett mit Kopfteil, Stühle, dicke Kissen und Bettdecken und ein riesiger





























