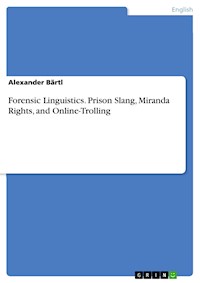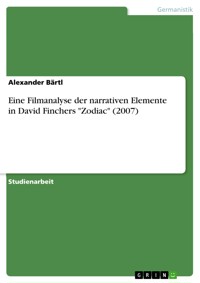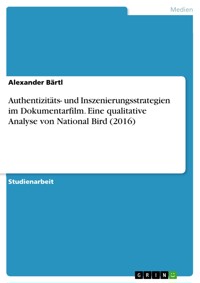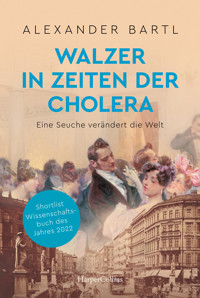
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HarperCollins
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
---Enthält den Text der aktualisierten Taschenbuch-Ausgabe---
Zwischen Tanzlust und Todesangst – eine Epidemie polarisiert die Gesellschaft
Wien, 1873: Die Stadt feiert die Weltausstellung, während sich über Galizien und Ungarn die Cholera nähert. Ein Bergsteiger und ein Schmetterlingssammler wollen Wien mit reinstem Quellwasser vor der Epidemie schützen und die Alpen anzapfen. Sie treffen auf massiven Widerstand, ihr Projekt sei größenwahnsinnig und überflüssig. Doch dann sterben die ersten Gäste …
Der 1873 entbrannte Streit ähnelt den Ereignissen der Gegenwart, selbst die Kampagnenschlagwörter sind die gleichen. Spannend und verblüffend aktuell erzählt Alexander Bartl, wie Seuchen die Gesellschaft verändern.
Ein Buch über Menschen im Ausnahmezustand und die Sehnsucht nach Normalität
»Trotz ihrer Lebensfreude waren die Wiener nicht geschont worden. Trotz der Tragödie tanzten sie weiter. Auch der Vater des Schriftstellers Oscar Wilde, der Arzt William Wilde, der unmittelbar nach der ersten Pandemie bei Josef Skoda im Allgemeinen Krankenhaus hospitierte, staunte über die ›Tanz-Manie‹ in den Wirtshäusern und sogar auf den Straßen. ›Es ist wirklich berauschend für einen Fremden, so viele Dinge um einen herum zu sehen, die sich im Kreis drehen Männer, Frauen und Kinder – […] die Glücklichen und die Melancholischen‹, notierte der junge Mediziner. Kaum ertöne irgendwo ein Walzer, springe der Kutscher von seinem Wagen, lasse die Wäscherin ihren Korb fallen, und Arm in Arm drehten sie sich im Takt.
Der Walzer war in den Jahren der Cholera zu einem der erfolgreichsten Exportprodukte der Monarchie aufgestiegen ...«
»Über Jahrhunderte hatte sich die Medizin damit begnügen müssen, Kranke zu versorgen und im besten Fall zu heilen. Dank neuer Erkenntnisse konnte sie nun darauf hinwirken, dass Gesunde erst gar nicht erkrankten. Je besser die Wissenschaft verstand, wie der Organismus funktionierte, desto genauer wusste sie, was ihn schädigte.
Theoretisch waren viele Wiener die Vermüllung zwar leid, vor allem dann, wenn andere dafür verantwortlich waren. Doch sobald Hygienemaßnahmen den persönlichen Handlungsspielraum einschränkten, sobald womöglich sogar die eigenen Geschäfte darunter litten, sah die Sache anders aus.«
»Alexander Bartl erzählt höchst lesenswerte und überraschend aktuelle Geschichten rund um den Bau der Wiener Hochquellenwasserleitung.« Klaus Taschwer, Der Standard, 29.09.2021
»"Walzer in Zeiten der Cholera" ist bedrückend aktuell.« »Alexander Bartls historisches Werk ist spannend aufbereitet und gibt Hoffnung.« Imogena Doderer, ORF, 27.09.2021
»Minutiös recherchiert und trotzdem stellenweise wie ein Roman erzählt Bartl, mit verschmitztem Humor.« Anne-Catherine Simon, Die Presse, 21.09.2021
»Focus-Textchef Alexander Bartl hat ein Sachbuch geschrieben, das spannend ist wie ein Roman.« G/Geschichte, 17.09.2021
»Tatsächlich ist „Walzer in Zeiten der Cholera“ ein behände zu lesendes Buch über jene Zeit sowie über Menschen im Ausnahmezustand und deren Sehnsucht nach Normalität.« Edgar Schütz, APA, 06.09.2021
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 342
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Originalausgabe © 2021 by HarperCollins in der Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH, Hamburg Covergestaltung von Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich nach einem Entwurf von Büro Jorge Schmidt, München Coverabbildung von akg-images / Imagno, ullstein bild / adoc-photos E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN E-Book 9783749951161www.harpercollins.de
Widmung
Für Mia
Willkommen in Wien! Das Eingangstor der Weltausstellung, 1873
© Wikipedia gemeinfrei; Urheber: Michael Frankenstein,+ 11. Februar 1918, Wiener Photographen-Association
1: Der Brunnen
1
DER BRUNNEN
Wien, 1873
Am Morgen des 24. Oktober kehrte gegen alle Wahrscheinlichkeit der Spätsommer zurück, als wollte er Wien mit ein bisschen Glanz auf den Pfützen für die Verluste entschädigen.
Die Bevölkerung hatte sich längst auf den Winter eingestellt. Fiel der erste Schnee, nahte Silvester, und dann war sie dieses unselige Jahr endlich los. Die vergangenen Monate hatten die österreichische Reichshauptstadt ausgezehrt. Tausende waren verarmt, Hunderte qualvoll gestorben. »Der Blick hebt sich über die unmittelbare Noth der Gegenwart hinaus in bessere Zeiten« 1, schrieb die Tageszeitung Die Presse. Es klang wie ein Wunschtraum. Wenigstens brach die Sonne durch das Grau. Deshalb und weil Träume manchmal in Erfüllung gingen, rafften sich die Wiener auf, um dem Jahr 1873 eine letzte Chance zu geben.
Alle kamen, die Fürsten und Grafen, die Bürger, Handwerker und Habenichtse. Sie versammelten sich auf dem Schwarzenbergplatz. Noch mehr Neugierige drängten nach, von Norden, Osten und Westen, nur nicht von Süden, denn dort stand das Palais Schwarzenberg im Weg. Sie füllten die Seitenstraßen, warteten selbst dort, wo sie den Schauplatz gar nicht mehr einsehen konnten. Die Sehnsucht, anwesend zu sein, wenn Großes geschah, hob die Laune und stimmte sie zuversichtlich. Der Reporter des Illustrirten Wiener Extrablatts versuchte den Überblick zu behalten. Dieser Trubel, diese Menschenmassen – das sei ja »lebensgefährlich«, notierte er, und weiter:
»Der ganze weite Raum zwischen dem Palais Schwarzenberg, der Heumarktkaserne und der Karlskirche, ja bis zur Polytechnik war mit Festtheilnehmern übersät; von dem Gitterthore, das zum Schwarzenbergpalais führt, über den Schwarzenbergplatz bis zur Ringstraße hielt eine lebende, drängende, stoßende, erwartungsvolle Menschenbarriere die Straße umrahmt. […] Auf den Dächern der den Festplatz umgebenden Häuser gab’s Leute in Menge; selbst auf der Höhe der Kuppel der Karlskirche krabbelten menschliche Wesen umher.« 2
Es war voll, es war eng, aber Chaos herrschte nicht. Das Ständebewusstsein saß tief in diesen Tagen, und so sortierten sich die Schaulustigen instinktiv nach ihrem gesellschaftlichen Rang: ganz vorne die prächtigen Kleider, die breitrandigen Hüte und orientalisch gemusterten Gehröcke aus dem Atelier des Wiener Meisterschneiders Joseph Gunkel, hinten die verwaschenen Schürzen und fadenscheinigen Hosen. Wo sich die Ärmsten unter die Reichsten mischten, gingen berittene Wachmänner dazwischen. Ihre kräftigen Pferde flößten Respekt ein.
Der Reporter der Wiener Morgen-Post widmete sich dem Dekor der Veranstaltung:
»Der ganze Festplatz war mit Masten umgeben, an deren Spitzen die österreichischen Adler im reichsten Fahnenschmucke prangten. Die Flaggen trugen die Reichs-, Landes- und Stadtfarben, sowie auch jene des Heimatlandes unserer Monarchin, nämlich die bayerischen Farben. Alle Flaggenmaste hatte man durch Reisigguirlanden miteinander verbunden und der ganze Festraum war mit Blumengewächsen geschmückt.« 3
Außerdem, berichtete der Journalist, hätten an allen vier Ecken weitere Masten gestanden, die »elektrische Sonnen« trugen, um den Platz künftig auch nachts zu erhellen.
Etwas höher gelegen, im Hof des Palais Schwarzenberg, erhob sich das Festzelt des Kaisers. Dort posierten Minister und Generäle neben den Herren des Wiener Gemeinderats im Sonnenlicht. In den Fräcken begann man zu schwitzen. Lichtreflexe tanzten über die Trompeten und Posaunen der Musikkapellen, die zu beiden Seiten Aufstellung genommen hatten. Alles war vorbereitet für den großen Empfang. Doch der Monarch ließ auf sich warten. Der eine oder andere der Honoratioren, der die Zeit mit gepflegter Konversation überbrücken wollte, gab den Versuch bald wieder auf, weil er sein eigenes Wort nicht verstand. Die Zuschauer lärmten, am lautesten diejenigen, die am wenigsten besaßen. Was für ein grandioser Tag!
Allein das Bauwerk, das an diesem Tag vom Kaiser seiner Bestimmung übergeben werden sollte, sah denkbar unspektakulär aus. Ein Bassin, eingefasst in ein gemauertes Rund, das war alles. Ein leerer Springbrunnen! Keine nackten Statuen im römischen Stil, nicht einmal einen winzigen Neptun hatte man in die Mitte gesetzt. Stattdessen lagen dort nur ein paar Felsbrocken, die das Wasserrohr kaschierten. Obwohl sonst noch nichts zu sehen war, wirkten die Zuschauer ziemlich überdreht. Vielleicht sahen sie in ihrer Fantasie schon die Fontäne in den Himmel steigen. Oder sie waren einfach dankbar dafür, dass endlich etwas passierte, das sie ablenkte von der Tristesse.
Das Jahr der Wiener Weltausstellung hatte sich zur Katastrophe entwickelt. Die Hoffnungen waren so groß gewesen. Doch dann geschah ein Unglück nach dem anderen. Erst kollabierte die Wiener Börse, etliche Firmen gingen bankrott, viele Anleger verloren ihr Vermögen, ihre Häuser, ihren Stolz. Und seit dem Sommer wütete die Cholera in der Stadt. Gäste flohen, Menschen starben, die bisher größte Weltausstellung, die erste auf deutschsprachigem Terrain, endete im größten finanziellen Desaster seit Jahrzehnten. Was die meisten nicht ahnten: Alles hing mit allem zusammen. Die Rolle, die Gott und Schicksal spielten, wurde in der Tagespresse jedenfalls maßlos überbewertet.
Pünktlich zur Einweihung des neuen Brunnens aber schien all das vergessen. Zwei Männer standen etwas abseits der übrigen Ehrengäste, schlank der eine, untersetzt und schon etwas älter der andere, auch wenn man seinem vollen Gesicht die Jahre nicht ansah. Eduard Suess war Geologe, Cajetan Felder der Bürgermeister der Stadt Wien. Beide wirkten so angespannt, dass nicht klar war, ob sie wegen der Sonne schwitzten oder vor Aufregung.
Als überflüssig, als sündteuren Irrsinn hatte man ihr Projekt geschmäht. Mit Überzeugungskraft allein wäre dieser Brunnen niemals vollendet worden. Auch Glück hatte eine Rolle gespielt. Genau das machte Suess nun nervös, weil es bedeutete, dass der Zufall zum Gelingen beigetragen hatte, was wiederum hieß: Er hatte nicht alles unter Kontrolle. Eine beunruhigende Erkenntnis für einen Wissenschaftler wie ihn. Zumal, wenn der Kaiser zur Eröffnung kam.
Während das Publikum an diesem Tag vor allem ein Wasserspektakel bewundern wollte, sah Eduard Suess in dem Brunnen das Finale eines großartigen Gesamtwerks. Das Becken markierte das nördliche Ende der spektakulärsten Wasserleitung der Welt. Dabei ging es dem Geologen nicht um Rekorde. Er hätte sich auch mit einer weniger komplexen Anlage begnügt. Für ihn zählte allein die Reinheit des Wassers. Es musste exzellent sein, kühl und klar wie ein Kristall.
Seine Ansprüche waren so hoch, dass viele Wissenschaftler anderer Länder mit Unverständnis, wenn nicht mit sanftem Spott reagierten. War die österreichische Residenzstadt nicht europaweit berüchtigt für die trübe Brühe, die sie ihren Gästen als erfrischenden Trunk vorsetzte? In englischen Zeitungen las man gelegentlich von verzweifelten Gästen, die in Wiener Hotels Eau de Cologne in ihren Tee kippten, damit er nicht so penetrant roch. Und nun peilte die Stadt chemische Werte an, die Wasser in einer Metropole unmöglich erzielen konnte.
Sogar der unschuldigste Bach lagerte Staub ein, sobald er durch bebautes Gebiet floss. Und ein Hauch Ammoniak war ja wohl nicht der Rede wert. Würde man alle Bestandteile herausfiltern, um den Reinheitsgrad zu erreichen, der Eduard Suess vorschwebte, bliebe vom Wasser nichts mehr übrig, hatten preußische Forscher postuliert. Wiens Ambitionen erschienen grotesk.
Selbst viele Einheimische hatten an dem Projekt gezweifelt und behauptet, es gelinge nie. Dennoch umlagerte halb Wien nun diesen Brunnen, um sich vom Gegenteil überzeugen zu lassen. Hätte Paris etwas Vergleichbares gewagt, wäre Wien dem großen Vorbild bereitwillig gefolgt. Frankreich besaß eben dieses unbestechliche Gespür für den Chic der Zeit. Ging es aber darum, eine Pioniertat zu vollbringen, tat sich die k. k. Reichshauptstadt schwer.
Eduard Suess hielt diesen Wesenszug seiner Heimat für eine Marotte, die man ihr austreiben konnte. Dabei hatte er zehn Jahre lang gegen Widerstände kämpfen müssen, lange genug, um die Beharrungskräfte des offiziellen Wiens kennenzulernen und darunter zu leiden. Aber seine Erfolge als Wissenschaftler bestärkten ihn in der Überzeugung, dass er mit seiner Kompromisslosigkeit richtiglag. Letztlich ging es doch darum, nach Neuem zu streben!
Suess blinzelte in die Sonne und wirkte nun wieder fast so selbstsicher wie Feldmarschall Schwarzenberg, dem man auf der anderen Seite des Platzes ein Reiterdenkmal errichtet hatte. Allerdings sah der Geologe besser aus. Seine ausgeprägten Wangenknochen und die schmale, gerade Nase entsprachen dem klassischen Ideal. Die Porträtfotografen seiner Zeit gaben sich jedenfalls alle Mühe, die vorteilhaften Züge optimal in Szene zu setzen. Für Männer mit solch einem Gesicht ließen Frauen in den damals auf Wiener Bühnen beliebten Lustspielen von Molière ihre verschrobenen Verehrer im Stich, ohne mit der Wimper zu zucken.
Trotzdem wäre der Wissenschaftler eine Fehlbesetzung gewesen, denn er schwärmte allein für seine Ehefrau, die sieben Kinder – und für Gesteine. Im Jahr 1873 standen seine einflussreichsten Forschungen zwar noch bevor, doch sein Name kursierte schon europaweit in geologischen Fachkreisen. Kaum einer bezweifelte noch, dass dieser Suess ein ganz Besonderer war.
Plötzlich kam Unruhe auf, ein Mann in Sonntagsgarderobe wurde von Wachmännern durch das Gedränge zum Brunnen eskortiert. Eduard Suess blickte auf und erkannte Carl Mihatsch. Der Oberingenieur trat nun an den Rand eines schmalen Schachts. Dort unten befand sich das Wasserventil. Blass sah er aus und übermüdet. Am Vortag hatte er nochmals stundenlang die Leitung bis hinauf zum Rosenhügel im Südwesten der Stadt überprüft. Mehrfach waren Rohre bei den Testläufen geplatzt. Fehlte der Druck in der Leitung, würde es im Brunnen keine Fontäne geben.
Kurz vor elf Uhr brach plötzlich Jubel aus. Endlich rollte der Zweispänner des Kaisers über den Schwarzenbergplatz.
Carl Mihatsch stieg in den Schacht, während der Regent mit Hüteschwenken und Hochrufen begrüßt wurde. Der Oberingenieur griff nach dem Handrad des Ventils.
Die Einweihung war für den Kaiser nicht minder bedeutend, auch wenn sie neben seinen anderen Repräsentationsaufgaben auf den ersten Blick eher eine Nebenrolle zu spielen schien. Franz Joseph I. hatte in diesem Jahr schon den ersten Spatenstich für das neue Rathaus an der Ringstraße erledigt, die Weltausstellung im Prater eröffnet und aus diesem Anlass Dutzende Regenten, Prinzen, Fürsten und sogar den Schah von Persien empfangen. Trotz Börsenkrach und Cholera war er unbeirrt dem Protokoll gefolgt. Nun aber galt es, endlich auch den Untertanen Gutes zu tun.
Seine Majestät schritt zum Festzelt. Hoffnungen des Publikums, die Bayernfahnen an den Masten kündigten den Besuch von Kaiserin Elisabeth an, wurden leider enttäuscht. Sie war nicht gekommen. Der Kaiser hatte ersatzweise Kronprinz Rudolf und ein paar Erzherzöge mitgebracht. Die Untertanen auf dem Platz wussten, was sich gehörte und murrten nicht. Franz Joseph hob nun seinen Arm und winkte dezent in die Menge. So viel Publikum gab es normalerweise nur bei Begräbnissen von Mitgliedern der kaiserlichen Familie. Was dem Regenten in dem Moment durch den Kopf ging, ist nicht überliefert. Wahrscheinlich hoffte er, dass in diesem Jahr zur Abwechslung mal etwas klappte.
Nun trat er in den Schatten des Festzelts. Cajetan Felder folgte ihm. »Das Antlitz des Herrn Dr. Felder umspielte ein stolzes Lächeln« 4, notierte der Reporter des Illustrirten Wiener Extrablatts. Dann erfüllte der Bürgermeister seine Pflicht und huldigte dem Monarchen so salbungsvoll, dass nur Eingeweihte verstanden, was eigentlich los war.
Obwohl er selbst aus bescheidenen Verhältnissen stammte, beherrschte Felder selbstverständlich den hohen Konversationston der Aristokratie wie eine der sechs Sprachen, die er sich angeeignet hatte. Er wandte sich an »Euere kaiserliche und königliche apostolische Majestät«, um offiziell zu verkünden, dass das große Werk, dem »Euere Majestät vor drei ein halb Jahren durch den ersten Spatenstich in huldvollster Weise die Weihe verliehen«, nun vollendet war.
Phrasen, so pompös wie Barockfassaden. Die Menschen auf dem Platz kümmerte es nicht. In dem Getöse bekamen sie ohnehin kaum ein Wort mit. Für sie zählte bei solchen Ereignissen nur das Gesehene, nicht das Gesagte, das um drei Ecken trödelte. Jetzt sprach der Kaiser, lobte dieses respektable Ergebnis »eifriger Thätigkeit«, es sei das größte Werk, »welches die Kommune Wien’s jemals zu Stande gebracht« 5 habe.
Endlich schwenkte Eduard Suess ein weißes Tuch, das Signal für den Oberingenieur, die Fontäne in Gang zu setzen. Alle Blicke richteten sich auf den Brunnen. Doch nichts geschah.
»Eine peinliche Pause. Nach einigen Minuten wiederhole ich das Zeichen«, erinnerte sich der Geologe später. »Wieder nichts. Eine noch peinlichere Pause. Eine, zwei, drei Minuten. Ich beginne die Pulse an meinen Schläfen zu verspüren.« 6
Die Zuschauer, die nah am Bassin standen, hörten, wie Metall knirschte, als Carl Mihatsch immer energischer das Ventil bearbeitete. Der Kaiser überblickte die Szenerie und sah, dass es noch immer nichts zu sehen gab. Wien hielt den Atem an. Der Brunnen blieb trocken.
Das Wiener Hochwasser 1830, Leopoldstadt, Jägerzeile am 2. März
© akg-images
2: Das Trauma
2
DAS TRAUMA
Wien, 1830
Wenn es etwas gab, das in der Reichshauptstadt seit Menschengedenken im Überfluss vorhanden war, dann Wasser. Von allen Seiten strömte es nach Wien. Einige Quellen entsprangen im westlich gelegenen Wienerwald, wurden zu Bächen, die bis in die Vorstädte reichten. Der Alserbach führte im Norden an der Stadtmauer vorbei. Der Wienfluss näherte sich den Befestigungsanlagen frontal, nahm auf dem Weg dorthin den Mauerbach, den Rotwassergraben und den Hirschenbach auf, schwoll an und wich erst im letzten Moment nach Osten aus.
In Ufernähe stemmte die Karlskirche ihre imposante Kuppel empor. Die Eschen und Weiden, die den Fluss säumten, wirkten vor dem Gotteshaus wie ein Pilgerzug, der im stillen Gebet verharrte.
Das mächtigste Gewässer aber war die Donau. Von Linz kommend zwängte sie sich zwischen Leopoldsberg und Bisamberg ins Wiener Becken. Dort wurde sie launenhaft. Sie fächerte sich auf, verlegte den Hauptstrom mal nach links und mal nach rechts, während die vernachlässigten Arme zunehmend versandeten.
Wenn die Wiener an einer Stelle einen Hafen errichteten, konnte es sein, dass der Fluss seinen Schwerpunkt bald wieder verlagerte. Die Donau foppte die Bevölkerung. Entfernte sich das Wasser von der Stadt, wo es am einfachsten war, Schiffsladungen zu löschen, malten es Kartografen früherer Jahrhunderte weiter dorthin, wo sie es haben wollten, als ließe sich der Strom dadurch ins alte Bett zwingen. Die Strategie versagte. Immerhin führte der Donaukanal, einer der Arme, der Wiens Nordosten streifte, im Jahr 1830 wieder genug Wasser. Ansonsten ließ der Fluss die Menschen an seiner Unberechenbarkeit verzweifeln, hatte aber noch ganz andere Überraschungen auf Lager. Im Jahr 1830 wurde er zur Bestie.
Franz Sartori, der seit 1814 als Regierungssekretär dem Central-Bücher-Revisionsamt vorstand, dokumentierte die Katastrophe. Der verbeamtete Dichter stammte aus dem steirischen Dorf Unzmarkt und war 1802 nach Wien gezogen. Wie auch andere, die aus der Provinz in die Hauptstadt kamen, legte er sich dort ein paar Dünkel zu und blickte fortan argwöhnisch auf den weniger privilegierten Teil der Bevölkerung jenseits der Stadtmauern herab. Nicht einmal seine vormalige Heimat, die Steiermark, fand Gnade: »Eine eben so bedauerns- als die Menschheit herabwürdigende Erscheinung sind hier, so wie im Brucker Kreis, die sogenannten […] Trotteln, die sich in jedem Dorfe befinden«, urteilte Sartori. Generell missfielen ihm »Körper und Gesichtsbildungen« der Landbevölkerung.
Im Winter 1830 aber erkannte er, dass weder der Typus des Trottels noch unvorteilhafte Züge die Gesellschaft ernsthaft bedrohten – sondern die entfesselten Naturgewalten. Nicht über die Steiermark, über Wien war eine Katastrophe hereingebrochen. Bestürzt schrieb er:
»Diese Überschwemmung, welche in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März 1830 die Vorstädte […], ja selbst einen Theil der Inneren Stadt (Rothenthurmstraße, Adlergasse, Fischmarkt, Salzgries) überrascht, welche augenblicklich im Dunkel einer grauenvollen Mitternacht im Geleite eines fürchterlichen Sturmes heranrückte, hat keine ähnliche Erscheinung in den Jahrbüchern Wien’s aufzuweisen.« 7
Als das Jahr begann, hatten die Wiener schon drei bitterkalte Monate hinter sich. Im Januar sank die Temperatur noch tiefer, erreichte schließlich minus zwanzig Grad. Die Stadt erstarrte. Straßen wurden unpassierbar, weil der Schnee mancherorts bis zu den Türstürzen reichte. So lange der Holzvorrat reichte, flackerten drinnen Feuer in den Öfen. Der Rest war Kälte. Trotzdem ging das Leben weiter, zwar langsamer als sonst, aber die Laune ließ man sich nicht verderben. Schließlich war Fasching. Auch in den Theatern wurde noch gespielt und applaudiert. Das Publikum behielt einfach die Mäntel an.
Im Leopoldstädter Theater jenseits des Donaukanals fand zehn Tage vor der Flut die Premiere des Lustspiels Faschingskrapfen oder Bunt über Eck8 statt. Ein kleines Orchester untermalte die Gesangseinlagen. An der zweiten Geige saß Ferdinand Kauer, der sich mit dem Engagement etwas dazuverdiente. Obwohl er schon mehr als zweihundert Stücke komponiert hatte, wartete er noch auf den Durchbruch. Damit er über die Runden kam, rieb er sich zwischen der schöpferischen Arbeit daheim und am Theater auf. Kaum jemand interessierte sich für den Existenzkampf eines mittelmäßigen Künstlers.
Das Leopoldstädter Theater gehörte zu den beliebtesten der Vorstädte, die Kaiserfamilie kam regelmäßig, selbst Lord Nelson hatte sich in dem Haus schon amüsiert. Auch die Donau bot in diesen Tagen ein besonderes Schauspiel. Sie lag reglos in ihrem Bett, zumindest sah es so aus. Eine Eisschicht hatte das Wasser überzogen. Darauf fiel Schnee. Plötzlich wirkte der Strom ganz harmlos. Ein Bild der Unschuld, ein Trugbild. Weil die Temperaturen zu niedrig waren, die Donauarme zu zahlreich oder weil die Bevölkerung den schlafenden Strom nicht aufwecken wollte, unterließ sie es, systematisch zu prüfen, wie robust die Eisschicht war, um daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Der erste Fehler.
Fünf Tage vor der Katastrophe schlug das Wetter um. Die Temperatur stieg, und mit viel Fantasie konnte man sich einreden, die Luft dufte schon ein bisschen nach Frühling. Zumindest hatte der Winter seinen Griff gelockert. Die Menschen genossen zum ersten Mal seit September die Zeit im Freien.
Die Donau regte sich ebenfalls. Die Eisdecke knackte und knirschte, Schollen lösten sich und drängelten stromabwärts. Am 28. Februar schien der Fluss endlich eisfrei zu sein, der Wasserpegel sank sogar weiter als üblich. Niemand dachte daran, sich in Sicherheit zu bringen. Der zweite Fehler. Man ging früh zu Bett. Der dritte Fehler.
Denn im Nordwesten mobilisierte der Strom seine Kräfte. Dort hatte er gewaltige Eisschollen aufgestapelt, die ihn auf ganzer Breite blockierten. Deshalb war der Pegel stromabwärts gesunken. Das Eis saß fest, während der Druck stieg.
Zeitzeugen, die spätabends noch am Ufer unterwegs waren, vernahmen plötzlich ein Grollen und Kreischen in der Dunkelheit. Das war das Eis, das sich gegen die Wassermassen stemmte.
Kurz vor Mitternacht schickte der nahende Sturm einen Windstoß voraus, der die Gaslaternen in den Straßen auspustete. Dann brach die Flut durch die Eisbarriere, schnellte vorwärts und stürzte sich auf die Häuser. Sie lockerte Fundamente, Eisbrocken zertrümmerten Wände. Manche Bewohner wurden augenblicklich von herabfallenden Steinen oder Dachbalken erschlagen, andere riss die Strömung mit. Einige Familien, die sich überstürzt auf ein Boot retten konnten, hatten vergessen, daheim die Kerzen zu löschen. Zimmer gerieten in Brand, und so wurde später von Häusern berichtet, die im Eiswasser standen, während Flammen aus dem Dach schlugen. Nur elf Gebäude verschonte die Donau in der Leopoldstadt.
Das Unglück ging auch Franz Sartori nahe, der bisher wenig übrig hatte für die Ärmsten der Armen. Nun nahm er sich Zeit, über einzelne Schicksale zu berichten. Etwa über dieses:
»In einem der Häuser, wo ein paar Familien ziemlich enge zusammen in einem Zimmer wohnten, springt eine Frau, von dem Getöse geweckt, auf und will hinaus; als sie das Wasser gewahr wird, eilt sie zurück, ihre beiden Kinder zu retten und trägt sie im Finstern auf den Boden des Hauses. Als es Tag wurde, sieht sie, daß sie zwei fremde Kinder gerettet hatte, ihre eigenen waren umgekommen.« 9
Zu den Betroffenen zählte auch Ferdinand Kauer, die zweite Geige vom Leopoldstädter Theater. In seiner Wohnung vernichtete die Flut alle Kompositionen und zerstörte damit seine Existenz. 10 Im Jahr darauf starb er als Bettler. Die Flut forderte ihre Opfer in Raten. Als sie vorbei war, besichtigten die Wiener mit Grauen die städtischen Katastrophengebiete, etwa der österreichische Schriftsteller Franz Grillparzer. Die Eindrücke waren so erschütternd, dass er sie noch achtzehn Jahre später in seiner Erzählung Der arme Spielmann so authentisch schilderte, als wäre das Unglück erst am Vortag geschehen:
»Der Anblick der Leopoldstadt war grauenhaft. In den Straßen zerbrochene Schiffe und Gerätschaften, in den Erdgeschossen zum Teil noch stehendes Wasser und schwimmende Habe. Als ich, dem Gedränge ausweichend, an ein zugelehntes Hoftor hintrat, gab dieses nach und zeigte im Torwege eine Reihe von Leichen, offenbar behufs der amtlichen Inspektion zusammengebracht und hingelegt; ja, im Innern der Gemächer waren noch hie und da, aufrecht stehend und an die Gitterfenster angekrallt, verunglückte Bewohner zu sehen …« 11
Während Grillparzer die schweren Schäden begutachtete, verließen andere ihre zerstörten Wohnungen mit gepackten Koffern und zogen um. Eine dieser Familien hatte gerade ihren Aufstieg zu einer der berühmtesten Musikerdynastien der Welt begonnen. Johann Strauss wechselte mit Gattin und Kindern sein Domizil. Das Wasser war durch die Fenster im ersten Stock gebrochen. 12 Johann junior, der künftige Walzerkönig, war zu dem Zeitpunkt gerade viereinhalb Jahre alt. Dass er später seinen berühmtesten Walzer ausgerechnet der Schönen blauen Donau widmen würde, ist nach den traumatischen Erlebnissen erstaunlich. Möglicherweise hatte er die erschütternden Bilder verdrängt, oder der Titel war purer Sarkasmus. Wenn Zeitungen damals die Donau tatsächlich einmal als blau bezeichneten, dann in Anführungszeichen.
Es entstanden auch Gemälde, die das Ereignis von 1830 thematisierten. Eduard Gurk hielt die Not in Öl fest, allerdings malte er sie so gefällig, dass die Szenerie mehr dem vorherrschenden Kunstgeschmack entsprach als der Wirklichkeit. Zwischen herausgeputzten Häusern waren korrekt gekleidete Herrschaften in Holzbooten unterwegs.
Nachdem die Wasserschäden behoben worden waren, wollte auch das Leopoldstädter Theater tagesaktuell reagieren und setzte das neue Stück Die Überschwemmung. Dramatische Szenen an. Die Aufführung ist allerdings nicht verbürgt. Eventuell bekamen die Verantwortlichen Zweifel, ob es wirklich eine gute Idee war, dem Publikum unmittelbar nach der Tragödie einen solchen Schocker vorzusetzen.
Fortan nahm die Flut einen prominenten Platz im Gedächtnis der Bevölkerung ein, zumal Wiens Flüsse weiterhin alle paar Jahre über die Ufer traten. Sie richteten nicht annähernd so große Schäden an wie 1830, hielten aber die Erinnerung an das Unglück wach. Als Kaiser Ferdinand zehn Jahre später eine der ersten Wasserleitungen für die Bevölkerung bauen ließ, wurde natürlich die Donau angezapft.
Drei Jahrzehnte später schwappte die Flut erneut durch die Straßen und gab auch den später Geborenen ein Gefühl für das Volumen und die zerstörerische Kraft der Wassermassen. Das Trauma nach den beiden großen Überschwemmungen und die Erfahrung, dass Donauwasser mit relativ geringem Aufwand erschlossen werden konnte, erklärten später die massiven Vorbehalte gegenüber der extravaganten Idee, man müsse sich nach neuen Quellen umsehen, weil es Wien an Wasser fehle.
Vielen, die schon einmal erlebt hatten, wie die Donau nachts in ihre Häuser eindrang, erschienen solche Forderungen nicht nur absurd, sondern geradezu lebensgefährlich. Schließlich musste in Wien niemand verdursten. Man ertrank allenfalls.
Der Geologe Eduard Suess im Jahr 1869 – auf einer Lithografie von Josef Kriehuber
© Wikipedia gemeinfrei; Lithographie von Josef Kriehuber, 1869
3: Wien von unten
3
WIEN VON UNTEN
Wien, 1858
Er kam zu spät, nicht aus Nachlässigkeit, sondern um Spannung zu erzeugen. Eduard Suess schätzte den Moment, in dem die Atmosphäre im Saal zu knistern begann. Als seine Kutsche am 6. Dezember, einem Montag, vor dem prächtigen Barockgebäude der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften hielt, sollte er schon seit zehn Minuten am Rednerpult stehen und eine seiner ›populären Vorlesungen‹ halten. Doch die Wartezeit half dem Publikum, den Alltag hinter sich zu lassen und die Aufmerksamkeit neu auszurichten auf das, was bevorstand. Nach zwölf Minuten betrat Suess den Vortragssaal der Akademie im zweiten Stock. Es knisterte.
Der Geologe war zwar erst siebenundzwanzig Jahre alt, aber schon seit fast zwei Jahren Professor, wenn auch zunächst ohne Besoldung. Viele der älteren Naturwissenschaftler, die sich über Jahrzehnte in der universitären Hierarchie hochgedient hatten, verfolgten die Karriere des jungen Kollegen mit Argwohn. Schließlich stammte er nicht einmal aus einer Gelehrtenfamilie, was einen solchen Aufstieg eventuell noch gerechtfertigt hätte. Sein Vater war Wollhändler, wenn auch ein sehr gebildeter. Das Theologiestudium hatte er einst abgebrochen, weil sich sein künftiger Schwiegervater einen gestandenen Unternehmer an der Seite seiner Tochter gewünscht hatte. Also sattelte er um, heiratete und zog mit seiner Frau nach England, wo er ein Textilgeschäft eröffnete. Dort kam Eduard Suess zur Welt.
Als er drei Jahre alt war, übersiedelte die Familie nach Prag. Doch der Junge weigerte sich beharrlich, anders als auf Englisch zu kommunizieren, und war auch ansonsten kein leichter Fall. »Ich war ein sehr schlimmer Junge und mein Vater war sehr streng« 13, räumte er später ein. Mit vierzehn zog er mit seiner Familie nach Wien. Inzwischen hatte er wenigstens seinen Widerstand gegen andere Sprachen aufgegeben, beherrschte neben Englisch auch Deutsch und Französisch und spielte sogar mit dem Gedanken, ein großer Dichter zu werden. Lange kämpfte er lieber mit Versmaß und Metrik, anstatt sich für Steine zu interessieren.
Das änderte sich schlagartig, als er bei einem Museumsbesuch eine Sammlung antiker römischer Münzen bewunderte. Wenn der Erdboden solche Schätze barg, dann musste er sich mit der Materie genauer befassen. So erwachte seine Leidenschaft für die Erdwissenschaften, und sie wurde größer, je besser er den Untergrund verstand. Inzwischen hatte er die Karpaten durchwandert, die Gipfelzüge des Dachsteins vermessen und kannte die Eigenheiten des Bodens von der Nordsee bis zur Adria.
Außerdem sammelte er Fossilien. Den jungen Forscher faszinierte die Geschichte Europas, weniger die der Menschen, sondern die der Erde, die Hunderte Millionen Jahre zurückreichte.
Neben seiner Tätigkeit als Professor arbeitete Suess für die Hofmineraliensammlung. Er tauschte außergewöhnliche Exponate mit führenden Wissenschaftlern aus, verfeinerte und vervollständigte die Kollektion, korrespondierte aber auch mit fachfremden Forschern, wenn er deren Thesen für originell oder zumindest für bedenkenswert hielt. Einer, der seine Leidenschaft teilte, im großen Maßstab zu denken, um das tägliche Leben zu erklären, war ein gewisser Charles Darwin.
All das spielte bei den ›populären Vorlesungen‹ in der Kaiserlichen Akademie jedoch keine Rolle. Neben der Wissensvermittlung kam es vor allem auf den Unterhaltungswert an. Ein Referent musste schon sehr berühmt sein, damit ihm die Zuhörer einen gestammelten Vortrag verziehen. Suess rückte seine Notizen zurecht und blickte auf.
Nicht nur Studenten waren gekommen, sondern auch Beamte, Unternehmer, sogar Handwerker in entsprechender Tracht. Wissenschaft, so sah es Suess, erfüllte nur dann ihren Zweck, wenn die gesamte Bevölkerung davon profitierte. Zumindest musste sie Bescheid wissen. Und an diesem Abend, da war er sich sicher, würde er das Publikum aufrütteln.
Dabei klang sein Thema nicht sonderlich spektakulär: Der Boden der Stadt Wien. Den gelehrten Zuhörern mochte die Unterwelt aus antiken Mythen ein Begriff sein, die weniger Gebildeten waren einfach nur froh, wenn der Boden trocken blieb und nicht bebte. Aber was genau unterhalb Wiens vorging, damit hatte sich noch keiner im Publikum befasst. Suess beschrieb zunächst den sanft gebogenen Rücken, den die wasserundurchlässige Erdschicht in der Tiefe bildete. Sie erkläre, warum sich in den Senken Fluss- und Grundwasser mischten. Dass dort unten eine Art zweite Landschaft existierte, die sich hob und senkte wie das Wiener Umland, war den Zuhörern neu. Wasserläufe, Seen, Hügel, alles auch unterirdisch vorhanden. Das hätten sie dem Boden gar nicht zugetraut. Er war für die Menschen so selbstverständlich wie die Sonne, die Luft und der Kaiser. Straße für Straße schilderte Suess nun, wie die Erde beschaffen war und welche Folgen das für Menge und Qualität des Wassers hatte.
Der Geologe stellte Verbindungen her zwischen unten und oben, zwischen dem Boden und denen, die darauf lebten. So entwickelte er eine Art humanistische Erdwissenschaft. Und distanzierte sich damit vom akademischen Establishment seiner Zeit, das dem Ideal der ›reinen Wissenschaft‹ folgte, losgelöst von alltäglichen Bedürfnissen.
Was Suess an diesem Abend vortrug, war aber noch in anderer Hinsicht revolutionär.
Weil es noch keine technologischen Hilfsmittel gab, kratzten die meisten Geologen dort an der Erdkruste, wo sie zugänglich war, auf den Wiesen oder in den Bergen. Suess hingegen befasste sich mit dem Untergrund einer Großstadt, in der man nicht nach Belieben graben konnte, weil Häuser oder Pflastersteine im Weg waren. Wie also konnte er das unterirdische Wien so präzise kartieren?
Dem Geologen kam zugute, dass ganz Wien in diesen Tagen einer Baustelle glich. Die Bevölkerungszahl wuchs rasant, das erstarkende Bürgertum sehnte sich nach Palästen, am liebsten an der projektierten Ringstraße. Wo Gruben ausgehoben wurden, war Suess zur Stelle und entnahm Proben. Jeden Fundort markierte er auf seinem Stadtplan mit einem Punkt. Am Ende hatte die Karte Sommersprossen. Trotzdem gab es noch viel unerkundetes Terrain dazwischen. Nun bewährte sich eine Strategie, die Suess schon Jahre zuvor bei der Erforschung der Alpen verfolgt hatte.
Die Merkmale einer Gesteinsformation hier und einer anderen ein paar Kilometer weiter ließen ihn darauf schließen, dass beide durch ein und dieselbe unterirdische Kraft hervorgebracht worden waren. Er entwickelte Hypothesen, korrigierte und verfeinerte sie, je mehr Fundorte er einbezog. Und was er unterhalb Wiens entdeckt hatte, gab Anlass zur Sorge:
Ein Arzt habe am Donaukanal ein eigenartiges Phänomen beobachtet, berichtete er. Bei höherem Wasserspiegel litten die Bewohner ganzer Straßenzüge plötzlich an Durchfall. Kaum sinke er, seien die meisten wieder gesund. Erklärlich sei das nur mit den Vorgängen im Boden. »Zahlreiche Unrathskanäle münden mit einem geringen Gefälle in den Wiener Donauarm«, sagte er. »In demselben Augenblicke aber, in welchem der Fluss um 4 oder 5 Fuss gestiegen ist, ist er in dem Unrathskanale […] eben so hoch gestiegen« und reiche mitunter bis in die dritte Häuserreihe zurück. 14
Den Zuhörern dämmerte, worauf der Wissenschaftler hinauswollte. Manche kniffen die Augen zusammen, als könnten sie der Misere dadurch entgehen. Suess fuhr fort: »Der Silt, in welchem der Kanal liegt, ist noch trocken, aber es beginnt sofort eine Infiltration von Jauche in denselben, welche bei der anerkannt mangelhaften Beschaffenheit unserer Kanäle bedeutende Dimensionen annimmt.« Man dürfe daher nicht verwundert sein, wenn das Wasser im größten Teil der Brunnen ungenießbar werde. 15 Suess pausierte. Viele Zuhörer wirkten beunruhigt. Die Donau stand hoch in diesen Tagen.
Nun widmete sich der Forscher der Siebenbrünner Quelle. Unruhe im Saal, Wispern, Kichern, Stühlerücken, denn das war nun besonders brisant. Jeder wusste, wer von dort das vermeintlich beste Wasser der Stadt bezog. Es handelte sich um die offizielle Hofwasserleitung. Der Kaiser verteidigte sie energisch gegen alle Ambitionen der Anwohner, etwas davon abzuzweigen, damit ihre Brunnen nicht austrockneten.
»Ein Blick auf die beifolgende Bodenkarte von Wien zeigt sehr deutlich, dass auf dem Zusickerungsgebiete der Siebenbrünner Wasserleitung der neue protestantische Friedhof und wenigstens ein bedeutender Theil des Matzleinsdorfer Friedhofes liegen.« 16
Suess entfaltete die Karte, das Quellgebiet hatte er blau eingefärbt, die Friedhöfe waren schwarz schraffiert. Es war wenig Blau zu sehen, dafür sehr viel Friedhofsschwarz. Die Darstellung ließ keinen Spielraum für beschönigende Interpretationen: Ein Großteil des Regenwassers, das die kaiserliche Quelle speiste, begegnete auf dem Weg in die Tiefe der einen oder anderen Leiche. Suess formulierte es drastisch: Während man in Paris beim Brunnenbau Abstand zu den Toten halte, »sammelt man in Wien den unterirdischen Abfluss grosser Friedhöfe und bringt denselben als Trinkwasser in die Mitte der Stadt« 17.
Stille, bis das Publikum komplett erfasst hatte, was in Wien unterirdisch los war. Dann Applaus, energisch und minutenlang. Einige der anwesenden Unternehmer dachten vermutlich, dass Vorträge von Eduard Suess in jedem Fall lehrreicher waren als Abende in den Logen des Kärntnertortheaters. Manche Handwerker im Publikum mochten sich vorgenommen haben, gleich am nächsten Tag ihre Hauskanäle zu inspizieren. Brunnen und Senkgruben waren für sie bislang ganz verschiedene Löcher im Boden gewesen. Und die Donau floss in einem Graben. Dass sich unterirdisch alles vermischte, war beängstigend. Und noch etwas stand nach diesem Vortrag fest: Niemand würde den Kaiser jemals wieder um sein Trinkwasser beneiden.
Einiges deutet darauf hin, dass sich an diesem Abend auch ein Rechtsanwalt im Publikum befand, den die Rede des Geologen auf eine verwegene Idee brachte. Sie sollte Wien für immer verändern, aber noch war es nicht so weit. Fürs Erste beschloss Cajetan Felder, diesen Suess im Auge zu behalten.
Als er die Akademie verließ, schlug ihm eiskalter Wind entgegen. Die vermögenden Besucher des geologischen Vortrags eilten zu ihren wartenden Equipagen, die Bewohner der Vorstädte zogen die Schultern hoch und machten sich zu Fuß auf den Weg durch die Dämmerung. Cajetan Felder stieg auf sein gesatteltes Pferd. Das schnellste war es nicht mehr, aber robust und einigermaßen verlässlich. Der ausrangierte Kavalleriegaul hatte im Dienst des Advokaten die Vorzüge der Gemütlichkeit entdeckt. Möglicherweise hing das mit dem Kosenamen zusammen, den Felder ihm gegeben hatte: Muckerl! Wer so gerufen wurde, der preschte nicht mehr vorwärts, als ginge es um sein Leben. Den Anwalt störte das nicht, aber nun schlugen die Hufe seit zehn Minuten den Takt schwermütiger Begräbnismusik. Das war zu langsam. Felder schnalzte. Muckerl beschleunigte unmerklich.
Sie folgten der Rotenturmstraße, vorbei an den wuchtigen Häusern deutscher Handelsgesellschaften, die sich nahe dem Donaukanal angesiedelt hatten. Am Ufer war der Ring der Stadtbefestigung schon aufgebrochen worden, bald würde die ganze Mauer rund um Wien fallen. Eine neue Zeit hatte begonnen, die Residenzstadt wollte sich nach allen Seiten öffnen, zumindest städtebaulich. Felder bog in die provisorische Trasse ein, die einmal in die mondäne Ringstraße münden sollte. Der Untergrund war uneben wie ein umgepflügter Acker. Es gab noch viel zu tun für die Stadtplaner. Die Kälte kroch dem Anwalt in den Kragen, breitete sich über Schultern und Rücken aus. Er zog den Mantel enger. Viel half es nicht.
Felder bedauerte, dass er seine Wiener Wohnung vor sechs Monaten in einem Moment quälenden Großstadtüberdrusses aufgegeben hatte und aufs Land gezogen war. Damals war es Sommer gewesen, und die Aussicht auf ein Leben in Weidling, einem Dorf nördlich von Wien, so verlockend, dass er das vormalige Wochenendhaus zur dauerhaften Bleibe umgewandelt hatte. Die frische Luft bekam seiner Frau und seinem Sohn.
Die Wiener Fassaden waren hingegen auch im Sommer grau und trostlos. Für den Umzug gab es noch einen weiteren Grund: »Von großem Wert war für uns, die wir an das schlechte Röhrenbrunnenwasser der Josefstadt gewohnt waren, das vortreffliche Quellwasser, das der Hausbrunnen in steter Frische lieferte.« 18 Felder seufzte. Eine Wohnung gleich um die Ecke wäre in diesem Moment verlockender gewesen als der Ritt nach Weidling.
Er erinnerte sich an die Worte des Geologen. Das gemächliche Auf und Ab des Pferderückens brachte seine Gedanken in Schwung. Die Wasserversorgung war in Wien ein brisantes Thema. Seit Jahren berichteten die Zeitungen beinahe wöchentlich darüber. Wien wuchs, doch das Leitungsnetz hielt damit nicht Schritt, während der Pegel in den Hausbrunnen sank. Was also tun? Zunächst wurde die Saugleistung der alten Kaiser-Ferdinands-Leitung bis ans Limit erhöht. Die dampfbetriebenen Schöpfwerke pumpten nun mit mehr PS noch mehr Wasser durch unzureichende Schotterfilter zu den öffentlichen Brunnen und in die Häuser. Das Wasser sei trüb, klagten manche Bewohner, und es rieche sonderbar. Man könnte auch sagen: Es stank. Gelegentlich fanden sich darin sogar tote Käfer, welke Blätter oder Vogelfedern.
Die Zeitungen überboten einander mit immer absurderen Vorschlägen, wie die Versorgung zu sichern sei. Einmal war von noch unentdeckten Wasseradern in der Vorstadt die Rede, die angeblich mit solchem Druck im Boden zirkulierten, dass sie das Wasser ganz ohne Dampfpumpen bis in die Mitte der Stadt und hinauf zur Spitze des Stephansdoms transportieren könnten. Inzwischen wusste man als Leser nicht mehr, was ernst gemeint war und was sarkastisch.
Schuld an der Misere war die Unentschlossenheit des Wiener Gemeinderats, des ersten nach der Märzrevolution 1848. Während in den Jahrzehnten davor der Kaiser verfügte, wie die Reichshauptstadt auszusehen hatte, lag diese Entscheidung plötzlich in der Hand der Kommune. Ängstlichkeit und Ahnungslosigkeit führten dazu, dass das meiste blieb, wie es war.
Cajetan Felder wusste um die Befindlichkeiten in dem städtischen Gremium. Er selbst hatte ihm drei Jahre lang angehört, war dann aber ausgeschieden, um sich allein seiner Karriere als Rechtsanwalt zu widmen. Vor Gericht wurden Entscheidungen getroffen und Fortschritte erzielt. Im Gemeinderat geschah weder das eine noch das andere. Stattdessen prägte eine riskante Mischung aus Arglosigkeit und Träumerei die weitschweifigen Reden im Plenum. Es dauerte nicht lange, bis Geschäftemacher ihre Chance witterten und der Stadt verlockende Offerten unterbreiteten.
Felder erinnerte sich gut an das anonyme Konsortium aus London, das versprochen hatte, Wien durch eine privatisierte und straff organisierte Versorgung so reichlich zu bewässern wie ein Wolkenbruch von unten. Leitungen zu jedem Haus und bis hinauf in die Stockwerke wurden zugesagt. Was die Qualität betraf, blieb man allerdings vage: Das Wasser werde nicht schlechter sein als das gegenwärtige.
Ein Journalist verfasste danach eine Hymne auf britische Ingenieursleistungen, die einer Aufforderung an das Empire glich, das Kaiserreich Österreich bitte umgehend zu kolonisieren. Zunächst schilderte der Autor, dass die Londoner Wassergesellschaften den enormen Bedarf der britischen Hauptstadt spielend deckten, weil sie als Aktiengesellschaft auf maximale Produktivität getrimmt seien. »Um die erstaunliche Wasserquantität anschaulich zu machen, welche auf diese Art in 24 Stunden für den Verbrauch der Metropole […] gewonnen wird, hat man berechnet, daß man damit die ganze innere Höhlung der St. Paulskathedrale sammt Kuppel und Galerien täglich zweimal bequem anfüllen« 19 könne, hieß es in dem Artikel. Bei dem Wasser handelte es sich übrigens um Filtrat aus der Themse. Dass dort noch viel mehr Fäkalien stromabwärts wirbelten als in der Donau, verschwieg der Autor. Flusswasser? Grandios! Und für noch viel grandioser hielt er die Saugleistung der monströsen Dampfpumpen. »Dies sind nun freilich so colossale Verhältnisse, wie sie nur der britischen Hauptstadt ausschließlich angehören.« 20 Wer in Wien solche Zeilen las, musste den Eindruck gewinnen, die famosen Engländer pumpten täglich die Themse leer.
Kein Wunder, dass die Debatten im Gemeinderat, in den Salons und Wirtshäusern vorrangig um die Wassermenge kreisten. Sie war ein für jeden nachvollziehbares Maß. Selbst Laien wussten, wie viel ein Eimer fasste. Und wenn die Bevölkerung aus den Zeitungen von den großspurigen Plänen für die neuen Stadtpaläste an der Ringstraße erfuhr, die Springbrunnen und Kaskaden vorsahen, war das angesichts der vorhandenen Leitungs- und Brunnenkapazitäten vollkommen illusorisch.
So kam es, dass sich viele Wiener in ihrem Stolz verletzt fühlten, weil die Londoner rigoros die Themse plünderten, während doch die österreichische Reichshauptstadt einen mindestens ebenso stattlichen Fluss vor ihren Toren hatte. Offensichtlich war man unfähig, das vorhandene Quantum zu nutzen.
Trotzdem wurde das Angebot des britischen Konsortiums letztlich verworfen. Nicht weil das Wasser möglicherweise miserabel war. Im Gegenteil: Man fand das Projekt umwerfend – in der Fantasie. Und dort beließ man es dann auch, aus Angst, das Meisterwerk könnte in der Wirklichkeit weniger großartig geraten.
Und nun tauchte plötzlich dieser junge Geologe Eduard Suess auf, der ganz neue Perspektiven öffnete. Nicht die Wassermenge zähle, sondern die Qualität. Allerdings hatte der Professor die entscheidende Frage offengelassen: Wo gab es denn auf dem Stadtgebiet noch unbelastete Quellen, die nicht von Sickergruben und Friedhöfen bedrängt wurden? Wo verbarg sich das Wasser, das so frisch schmeckte wie das aus Felders Hausbrunnen in Weidling? Sollte sich irgendwo auf städtischem Terrain eine Wasserader verbergen, bezweifelte er, dass sie für mehr als ein paar wenige Haushalte reichte. Womöglich dehnte sich in großer Tiefe ein gigantischer kristallklarer See, zu weit entfernt, um ihn mit herkömmlichen Werkzeugen zu erschließen.
Eines hatte Eduard Suess den Kommunalpolitikern voraus: Er wusste, wovon er sprach, kannte die Bodenverhältnisse, die offenbar darüber entschieden, ob das Wasser schmeckte oder nur erduldet wurde. Der Geologe müsste sich in die Entwicklung der Wasserversorgung einbringen, fand der Anwalt. Dann könnte er beweisen, dass er tatsächlich die Fähigkeit besaß, mit seiner Forschung in die Gesellschaft hineinzuwirken, wie er es mit seinen populären Vorlesungen anstrebte.
Die Wege der Cholera – eine Karte aus dem Jahr 1820
© British Library
4: Cholera: Die Geburt der Pandemie
4
CHOLERA: DIE GEBURT DER PANDEMIE
Bengalen, 1818
Sonderbares geschah in der Ferne, und die Redakteure des Londoner Medico-Chirurgical Journal gehörten zu den Ersten, die Notiz davon nahmen. Wer wusste Genaues? War das zu glauben? Was war zu tun? Falls eine Entdeckung gemacht worden war, musste sie umgehend für die britische Krone reklamiert werden, bevor Frankreich Wind davon bekam. Hatten die Briten wieder mal Chaos gestiftet am anderen Ende der Welt, dann war das eher ein Fall für die kleinen Meldungen. Höchstens. Im Empire kam ein vertrautes Räderwerk in Gang. Es schluckte jede verfügbare Information, verarbeitete sie und produzierte noch mehr Neugier.
Auslöser für die Unruhe war ein Mann, der fast fünftausend Meilen weiter östlich in einer provisorischen Backsteinsiedlung wohnte. Durch das Fenster im Norden blickte Robert Tytler auf einen Arm des Ganges, der oft monatelang abgeschnitten war vom Rest des Flusses. Solange sich das Wasser bewegte, transportierte es allen Unrat zuverlässig ins Meer. Wenn es hingegen stehen blieb, versuchte Tytler flach zu atmen, damit ihm nicht übel wurde. Im Süden erstreckte sich eine Sumpflandschaft. Feuchte Hitze lastete auf der Gegend, und nach Regenfällen dampfte das Land wie die Vorhölle – und roch auch entsprechend.
Tytler war Assistenzarzt des Militärs, der im Auftrag der Britischen Ostindien-Kompanie nach Bengalen entsandt worden war. Die Handelsgesellschaft hatte dort im achtzehnten Jahrhundert zunächst einen Stützpunkt gegründet, sich inzwischen aber die ganze Region in Indiens Nordosten einverleibt. Sie exportierte Silber nach China, erwarb dort Tee, den sie ins Empire, aber auch nach Nordamerika verschiffte. Der Handel war lukrativ, die Ostindien-Kompanie wuchs. Ausgestattet mit immer umfassenderen Privilegien der englischen Krone beherrschte sie Bengalen: eine Kolonie der britischen Kaufmannschaft. Und Tytler leistete seinen Beitrag, damit sich daran nichts änderte.
Er achtete darauf, dass die Armee gesund blieb. Dafür musste er vor allem die Einheimischen im Auge behalten. Sie hausten im Dreck, anders konnte man es nicht ausdrücken. Kein Wunder, dass unter ihnen immer wieder rätselhafte Krankheiten aufflammten, Fieberattacken, Wunden, die ohne ersichtlichen Grund aufbrachen und sich nicht mehr schlossen. Der Anblick des offenen Fleisches, das schleimiges Sekret absonderte, brachte Tytler fast um den Verstand. Trotzdem kümmerte er sich gewissenhaft um das Problem, was vor allem hieß, dass er die Soldaten davon abhielt, die betroffenen Dörfer zu besuchen. Die sonderbaren Leiden durften keinesfalls auf die Armee übergreifen und deren Moral schwächen.