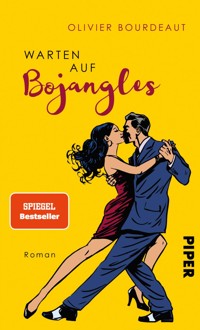
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie tanzen zu »Mr. Bojangles«, sie mixen sich Cocktails, gemeinsam mit ihrem Sohn fahren sie in ihr Schloss nach Spanien. Sie ist charmant und charismatisch, nimmt alle für sich ein mit ihrer extravaganten Art. Georges liebt sie hingebungsvoll, die beiden feiern das Leben, wann immer es geht, denn sie kennen auch seine dunklen Momente: Georges' schillernde Frau ist manisch-depressiv. Als diese bittere Wahrheit ihr Paradies zu zerstören droht, entführen Vater und Sohn die Frau, die sie lieben, kurzerhand aus der Psychiatrie. In einem amerikanischen Oldtimer nehmen sie Kurs auf Spanien, in der Hoffnung, dort so weiterleben zu können wie bisher. - »Warten auf Bojangles« ist eine hinreißende Liebesgeschichte aus Frankreich, wo sie Kritiker wie Leser begeisterte und die Bestsellerlisten stürmte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »En attendant Bojangles« bei Éditions Finitude, Bordeaux.Three lines of »Some People« from BURNING IN WATER, DROWNING IN FLAME: SELECTED POEMS 1955–1973 by CHARLES BUKOWSKI. Copyright © 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1974 by Charles Bukowski. Reprinted by permission of HarperCollins Publishers.
Übersetzung aus dem Französischen von Norma Cassau
ISBN 978-3-492-97685-5März 2017© éditions Finitude, 2015First published in the UK in 2017 by Fig Tree, an imprint ofPenguin Books LtdDeutschsprachige Ausgabe:© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2017Covergestaltung: Cornelia Niere, München nach einem Entwurf von studiostoksCovermotiv: shutterstockDatenkonvertierung: psb, BerlinSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
»Manche Leute werden niemals verrückt. Was für ein wirklich schreckliches Leben müssen die leben.«
Charles Bukowski
Suzon Victor für ihre kostbare Zuneigung und ihren unerschütterlichen Glauben an mich
Das ist meine wahre Geschichte, richtig herum und falsch herum gelogen, weil das Leben häufig so ist.
1
Vor meiner Geburt, hatte mir mein Vater erzählt, sei er mit einer Harpune auf Fliegenjagd gegangen. Er hatte mir die Harpune gezeigt und eine erlegte Fliege.
»Jetzt mache ich etwas anderes, es war zu anstrengend und sehr schlecht bezahlt«, hatte er hinzugesetzt und seine Arbeitsutensilien in einer Lackschatulle verstaut. »Jetzt eröffne ich Autowerkstätten, das ist viel Arbeit, aber sehr gut bezahlt.«
Am ersten Schultag nach den Ferien, wenn sich alle in den ersten Stunden vorstellen, erzählte ich nicht ohne Stolz von Vaters Berufen, aber ich wurde nur freundlich verspottet und reichlich getadelt.
»Die Wahrheit taugt nichts, dabei war sie diesmal sogar lustiger als jede Lüge«, jammerte ich.
In Wirklichkeit war mein Vater ein Mann des Gesetzes. »Das Gesetz ernährt uns!«, lachte er schallend und stopfte seine Pfeife.
Er war kein Richter, Abgeordneter, Notar oder Anwalt, nichts von alledem. Er verdankte seine Tätigkeit seinem Freund, dem Senator. Weil der ihn stets über die jüngsten Rechtsvorschriften informierte, hatte Vater sich in einen neuen Beruf gestürzt, den der Senator höchstselbst geschaffen hatte. Neue Vorschriften, neuer Beruf, und so wurde Vater »Autowerkstätteneröffner«. Denn um zu gewährleisten, dass alle Autos sicher und sauber rollten, hatte der Senator beschlossen, technische Untersuchungen einzuführen – für alle verpflichtend. Damit weniger Unfälle passierten, mussten die Besitzer sämtlicher Limousinen und Lieferwagen, Blechkaleschen und Benzinkutschen ihre Vehikel nun auf Herz und Nieren prüfen lassen; ob arm, ob reich, da mussten alle durch. Und weil das eben Pflicht war, ließ mein Vater sich die Arbeit teuer bezahlen, sehr teuer. Er ließ sich die Anfahrt bezahlen und die Abfahrt, die Inspektion und die Kontrollinspektion, und nach seinem Lachen zu urteilen, lief das Geschäft fabelhaft.
»Ich rette Leben, ich rette Leben!«, freute er sich, die Nase in den Bankauszügen vergraben.
Damals konnte man viel Geld damit verdienen, Leben zu retten. Nachdem mein Vater Unmengen an Werkstätten eröffnet hatte, verkaufte er sie an einen Konkurrenten. Maman war darüber sehr erleichtert, sie mochte es nicht, dass Vater Leben rettete, denn er musste dafür viel arbeiten, und wir bekamen ihn so gut wie gar nicht mehr zu Gesicht.
»Ich arbeite lange, damit ich nicht mehr lange arbeiten muss«, entgegnete er stets, aber ich verstand nicht, was er meinte.
Ich verstand häufig nicht, was Vater meinte. Im Laufe der Jahre wurde es ein bisschen besser, aber alles verstand ich nie. Und das war gut so.
Er hatte mir erzählt, er sei mit dieser aschgrauen Furche rechts an seiner Unterlippe zur Welt gekommen, ich fand aber bald heraus, dass diese stets leicht geschwollene Vertiefung, die sein schönes, ein wenig schiefes Lächeln ausmachte, vom fortwährenden Gebrauch seiner Pfeife kam. Sein Haarschnitt, der Mittelscheitel und die Wellen rechts und links davon, ähnelte der Frisur des preußischen Reiters auf dem Gemälde in der Diele. Außer an ihm und dem Preußen hatte ich diese Frisur nie an jemandem gesehen. Die tiefen Augenhöhlen mit den leicht hervorstehenden blauen, rollenden Augäpfeln verliehen seinem Blick etwas Eigentümliches, Tiefgründiges. Ich habe ihn damals immer glücklich erlebt, und er sagte es auch häufig: »Ich bin ein glücklicher Idiot!«
Worauf meine Mutter antwortete: »Wir glauben Ihnen aufs Wort, Georges, aufs Wort glauben wir Ihnen!«
Immerzu summte er vor sich hin, schief. Manchmal pfiff er, ebenso schief, aber wie alles, was von Herzen kam, war es erträglich. Er erzählte schöne Geschichten, und wenn ausnahmsweise keine Gäste da waren, faltete er seinen großen, festen Körper in meinem Bett zusammen, um mich in den Schlaf zu begleiten. Ein Augenrollen, ein Wald, ein Reh, ein Kobold, ein Sarg, und es war aus und vorbei mit meiner Müdigkeit. Am Ende sprang ich meistens munter auf dem Bett herum oder versteckte mich starr vor Schreck hinter den Vorhängen.
»Es sind Geschichten zum Schlafen im Stehen«, sagte er und verließ mein Zimmer. Und wieder glaubte ich ihm aufs Wort.
Sonntagnachmittags trimmte er seine Muskeln, als Ausgleich für die Exzesse der Woche. Mit nacktem Oberkörper und der Pfeife im Mundwinkel stand mein Vater vor dem großen Spiegel mit dem goldverzierten Rahmen und der majestätischen Schleife und stemmte winzige Hanteln zu Jazzmusik. Gym tonic nannte er das, weil er seine Übungen gerne für einige kräftige Schlucke Gin Tonic unterbrach und meiner Mutter zurief: »Sie sollten es einmal mit Sport versuchen, Alma, glauben Sie mir, es macht Spaß, und man fühlt sich viel besser danach!«
Worauf meine Mutter antwortete – die Zunge zwischen den Zähnen, ein Auge geschlossen bei dem Versuch, mit einem Cocktail-Schirmchen eine Olive aus ihrem Martini aufzuspießen –: »Sie sollten es einmal mit Orangensaft probieren, Georges, und glauben Sie mir, danach finden Sie die Sache mit dem Sport nicht mehr so spaßig! Und seien Sie so gut, nennen Sie mich nicht Alma, geben Sie mir einen anderen Vornamen, sonst fange ich gleich an zu muhen!«
Ich habe nie wirklich begriffen, warum das so war, aber mein Vater nannte meine Mutter niemals länger als zwei Tage beim selben Vornamen. Und Maman mochte diese Gewohnheit sehr, selbst wenn sie einige Vornamen schneller satthatte als andere; jeden Morgen in der Küche sah ich, wie sie meinen Vater schalkhaft beobachtete und den Urteilsspruch abwartete, die Nase tief in ihrer Tasse oder das Kinn auf die Hände gestützt.
»Oh nein, das können Sie mir nicht antun! Nicht Renée, nicht heute! Wir haben heute Abend Gäste!«, lachte sie. Dann drehte sie den Kopf zum Spiegel und grüßte grimassierend die neue Renée oder würdevoll die neue Joséphine oder plusterte sich auf wie Marylou. »Außerdem habe ich überhaupt nichts in meinem Kleiderschrank, was zu Renée passen würde.«
Es gab nur einen Tag im Jahr, an dem Mutter immer gleich hieß: Am 15. Februar war sie Georgette. Das war nicht ihr echter Vorname, aber der Tag der heiligen Georgette kam nach dem Valentinstag, und da meine Eltern es nicht besonders beschaulich fanden, sich wie auf Bestellung in ein Restaurant und zwischen lauter Zwangsromantiker zu setzen, feierten sie lieber das Fest der heiligen Georgette; dann war das Restaurant leer und die Bedienung allein für sie da. Außerdem fand Vater, ein romantisches Fest könne nur einen weiblichen Vornamen tragen.
»Würden Sie uns bitte den besten Tisch auf die Namen Georges und Georgette reservieren? Und Sie haben hoffentlich keinen dieser grauenvollen Kuchen in Herzform mehr übrig? Nein? Gott sei Dank!«, sagte er dann, wenn er einen Tisch in einem noblen Restaurant bestellte.
Am Tag der heiligen Georgette hatten die zwei mehr zu feiern als eine dumme Liebelei.
Nach der Geschichte mit den Werkstätten musste Vater nicht mehr aus dem Haus, um uns zu ernähren, also begann er, Bücher zu schreiben. Andauernd und reichlich. Er saß an seinem großen Schreibtisch vor seinem Blatt Papier und schrieb und lachte darüber, und schrieb über das, worüber er lachte; er stopfte die Pfeife und füllte den Becher mit Asche, mit Qualm den Raum und mit Tinte das Blatt. Das Einzige, was sich leerte, waren Cocktailgläser und Kaffeetassen. Die Antwort der Verleger lautete trotzdem immer gleich: »Gut geschrieben, lustig, aber ohne Hand und Fuß.« Um ihn über die Absagen hinwegzutrösten, sagte meine Mutter: »Ja, hat man denn schon mal ein Buch mit einer Hand und einem Fuß gesehen? Das wüsste ich!«
Darüber mussten wir sehr lachen.
Über Maman sagte mein Vater, dass sie mit den Sternen per Du sei, was merkwürdig war, denn sie siezte alle, sogar mich. Sie siezte selbst unseren Jungfernkranich, diesen eleganten und erstaunlichen Vogel mit den weißen Federbüscheln und den grellroten Augen, der mit seinem gewundenen, langen schwarzen Hals durch unsere Wohnung stelzte und dort lebte, seitdem meine Eltern ihn in ihrem früheren Leben von einer Reise nach Ich-weiß-nicht-wo mitgebracht hatten. Wir riefen ihn Taugenichts, denn er taugte zu gar nichts, außer grundlos und laut zu schreien, runde Pyramiden aufs Parkett zu setzen oder mich nachts zu wecken, indem er mit seinem orange-olivgrünen Schnabel an meiner Zimmertür pickte. Taugenichts war wie für die Geschichten meines Vaters gemacht, denn er schlief im Stehen, den Kopf unter dem Flügel versteckt. Als Kind hatte ich häufig versucht, ihn nachzuahmen, aber das war höllisch schwer.
Taugenichts mochte es, wenn Maman auf dem Sofa lag und las und ihm dabei stundenlang über den Kopf streichelte. Wie alle zahmen Vögel liebte er das Vorlesen.
Einmal hatte Mutter ihn in die Stadt zum Einkaufen mitnehmen wollen. Sie bastelte ihm eigens zu diesem Zweck eine hübsche Leine aus Perlen, aber Taugenichts bekam Angst vor den Leuten, und die Leute bekamen dann auch Angst vor ihm, denn er schrie wie nie zuvor in seinem Leben. Eine alte Dame mit Dackel warf Maman sogar vor, es sei unmenschlich und gefährlich, einen Vogel an der Leine auf dem Trottoir spazieren zu führen.
»Fell oder Federn, was macht das für einen Unterschied? Taugenichts hat noch nie irgendjemanden gebissen, außerdem finde ich ihn durchaus eleganter als Ihre Fellwurst! Kommen Sie, Taugenichts, gehen wir, diese Leute sind plump und ordinär!«
Maman war fürchterlich aufgebracht nach Hause gekommen und, wie immer, wenn sie in diesem Zustand war, gleich zu Vater gegangen, um ihm alles im Detail zu berichten. Und wie immer hellte ihre Stimmung sich erst gegen Ende ihrer Erzählung auf.
Sie regte sich häufig auf, aber niemals lange, denn die Stimme meines Vaters wirkte auf sie wie ein gutes Beruhigungsmittel. Die übrige Zeit geriet sie über alles in Verzückung, fand den Fortgang der Welt wahnsinnig unterhaltsam und begleitete ihn fröhlich tänzelnd. Mich behandelte sie weder wie einen Erwachsenen noch wie ein Kind, eher wie eine Figur aus einem Roman. Aus einem Roman, den sie übermäßig und zärtlich liebte und in den sie sich vertiefte, wann immer es ging. Von Traurigkeit und Sorgen wollte sie nichts hören: »Wenn die Wirklichkeit banal und trostlos ist, dann erfinden Sie eine schöne Geschichte für mich! Sie schwindeln so fein, es wäre schade, uns das vorzuenthalten.«
Also erzählte ich ihr meinen ausgedachten Tag, und sie klatschte begeistert und kicherte: »Was für ein Tag, mein liebes Kind, was für ein Tag, ich freue mich für Sie, so prächtig unterhält man sich sonst nie!«
Dann bedeckte sie mich mit Küssen. Sie sagte, sie herze mich, und ich ließ mich gerne von ihr herzen. Jeden Morgen, wenn sie ihren neuen Namen erhalten hatte, reichte sie mir einen ihrer frisch parfümierten Samthandschuhe, damit ihre Hand mich durch den ganzen Tag führen könne.





























