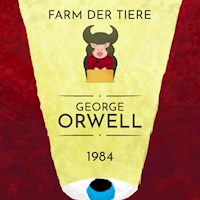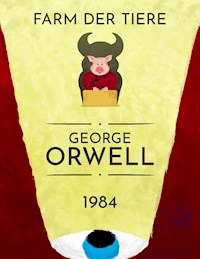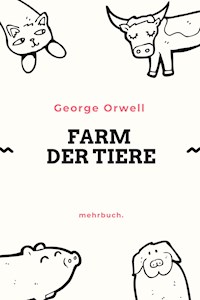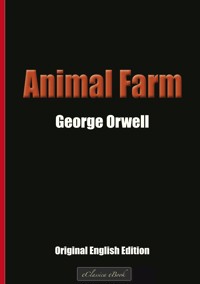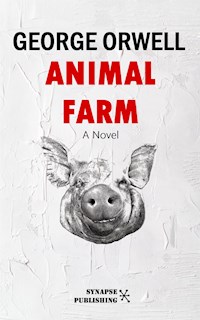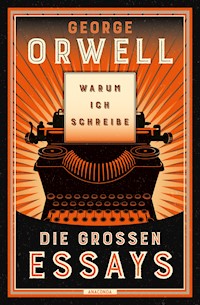
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Anaconda Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Mein größtes Ziel war es, aus dem politischen Schreiben eine Kunst zu machen.« Nicht nur mit seinen großen Parabeln 1984 und Farm der Tiere ist George Orwell dies gelungen. Auch seine klaren, klugen Essays sind herausragende Beispiele dafür, was passiert, wenn sich schriftstellerisches Talent mit politischem Scharfsinn mischt. Die erbarmungslose Ehrlichkeit, auch im politisch Heiklen, macht seine Essays zu einer zeitlos spannenden Lektüre. Warum George Orwell schrieb – nirgends wird es so deutlich wie in diesen Texten.
Enthält Essays aus zwei Jahrzehnten: Einen Elefanten schießen, Meine Zeit als Buchhändler, Faschismus und Demokratie, Erinnerungen an den Spanischen Bürgerkrieg, Anmerkungen zum Nationalismus, Warum ich schreibe, Wie die Armen sterben, Gedanken über Gandhi und viele mehr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 299
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
George Orwell
Warum ich schreibe
Die großen Essays
Neu übersetzt von Heike Holtsch
Anaconda
Die Übersetzung entstand mit freundlicher Unterstützung des Europäischen Übersetzerkollegiums Straelen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
© 2022 by Anaconda Verlag, einem Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlagmotiv: shutterstock / svekloid, Eroshka
Umschlaggestaltung: www.katjaholst.de
Lektorat und Textauswahl: Jochen Veit
Satz und Layout: Achim Münster, Overath
ISBN978-3-641-29759-6V001
www.anacondaverlag.de
Inhalt
Eine Hinrichtung
August 1931
Einen Elefanten erschießen
September 19366
Erinnerungen an einen Buchladen
November 1936
Rezension zu Adolf Hitlers Mein Kampf
März 1940
Mein Land von rechts und links
September 1940
Faschismus und Demokratie
Februar 1941
H. G. Wells, Hitler und der Weltstaat
August 1941
Rückblicke auf den Spanischen Bürgerkrieg
Juni 1943
Antisemitismus in Großbritannien
April 1945
Überlegungen zum Nationalismus
Oktober 1945
Die Verhinderung von Literatur
Januar 1946
Bücher vs. Zigaretten
Februar 1946
Warum ich schreibe
Juni 1946
Wie die Armen sterben
November 1946
Schriftsteller und der Leviathan
Juni 1948
Überlegungen zu Gandhi
Januar 1949
Editorische Notiz
Eine Hinrichtung
August 1931
Es war in Burma, an einem nassen Morgen während der Regenzeit. Blasses Licht überzog die hohen Mauern des Gefängnishofes wie Stanniolpapier. Wir warteten draußen vor den Zellen der Verurteilten, einer Reihe vergitterter Verschläge, wie kleine Tierkäfige. Jede Zelle war etwa drei Quadratmeter groß und bis auf eine Pritsche und einen Topf Wasser leer. In einigen Zellen hockten Männer mit brauner Haut schweigend an den Gitterstäben und hatten sich in ihre Decken eingewickelt. Das waren die Verurteilten, die erst in der nächsten oder übernächsten Woche gehängt werden sollten.
Einer der Gefangenen war aus seiner Zelle herausgeführt worden. Er war Hindu, ein schwächlicher Schatten von einem Mann, mit rasiertem Schädel und trüben, wässrigen Augen. Er hatte einen dicken, zottigen Schnurrabart, der für seinen schmächtigen Körper absurd groß erschien, eher wie der Schnurrbart eines Komikers im Film. Sechs hochgewachsene indische Aufseher begleiteten ihn und bereiteten ihn für die Hinrichtung vor. Zwei von ihnen standen mit Gewehren und aufgepflanzten Bajonetten bereit, während die anderen ihm Handschellen anlegten, durch die sie eine Kette zogen, um sie an ihren Gürteln zu befestigen, und ihm die Arme an beiden Seiten des Körpers fixierten. Sie scharten sich ziemlich dicht um ihn herum, behielten ihn die ganze Zeit lang achtsam, aber auch behutsam im Griff, als wollten sie sich vergewissern, dass er noch da war. Es schien wie die Handhabung eines Fisches, der noch lebt und jeden Moment zurück ins Wasser springen könnte. Er aber stand da und leistete keinen Widerstand, ließ sich die hängenden Arme an den Körper fesseln, als würde er gar nicht mitbekommen, was geschah.
Um Glockenschlag acht Uhr ertönte das Signal aus den ein Stück weit entfernten Kasernengebäuden, kaum hörbar in der feuchten Luft. Der Gefängnisvorsteher, der ein wenig abseits von uns stand und schlecht gelaunt mit seinem Stock im Schotter auf dem Boden herumscharrte, hob den Kopf. Er war Militärarzt, mit grauem bürstenartigen Schnurrbart und barscher Stimme. »Herrgott nochmal, mach doch schneller, Francis«, sagte er gereizt. »Der Mann sollte längst tot sein. Bist du immer noch nicht fertig?«
Francis, der oberste Gefängniswärter, ein fetter Dravide1 in weißer Exerzieruniform und mit goldgeränderter Brille, wedelte mit seiner schwarzen Hand. »Jawohl Sir, jawohl Sir«, sagte er hastig. »Alles zur Zufriedenheit vorbereitet. Der Henker wartet schon. Gleich geht es los.«
»Dann aber schnell. Bevor das nicht erledigt ist, können wir kein Frühstück an die Gefangenen austeilen.«
Wir machten uns auf den Weg zu den Galgen. Zwei Bewacher gingen auf jeder Seite neben dem Gefangenen her, die Gewehre über die Schultern gehängt, zwei weitere blieben dicht bei ihm und hielten ihn an Armen und Schultern gepackt, als wollten sie ihn gleichzeitig vorwärtsschieben und stützen. Wir anderen, richterliche Beamte und so weiter, gingen hinterher. Plötzlich, nach etwa zehn Metern, blieb der Tross ohne Vorwarnung stehen. Etwas Furchtbares war passiert – ein Hund, weiß der Himmel, wo der herkam, war auf den Gefängnishof gelaufen. Mit lautem Gebell sprang er auf uns zu, lief zwischen uns herum, sein ganzer Körper ein einziges Schwanzwedeln, vor lauter Freude, dass er so vielen Menschen auf einmal begegnet war. Es war ein großer Hund mit struppigem Fell, halb Airedale Terrier, halb Indischer Paria. Eine Weile tänzelte er um uns herum, und dann, ehe ihn jemand zurückhalten konnte, sprang er den Gefangenen an und wollte ihm das Gesicht ablecken. Alle standen entgeistert da, viel zu betroffen, als dass jemand den Hund gepackt hätte.
»Wer hat diesen dämlichen Köter hierher gelassen?«, fragte der Gefängnisvorsteher verärgert. »Fangt ihn ein, na los!«
Einer der Bewacher entfernte sich ein Stück von dem Tross und jagte unbeholfen dem Hund hinterher. Der aber entwischte ihm und tänzelte ein Stück außer Reichweite um ihn herum, als wäre das Ganze ein Spielchen. Ein junger eurasischer Gefängniswärter hob eine Handvoll Schotter auf und warf damit nach dem Hund, um ihn zu vertreiben, aber der Hund wich aus und lief weiter um uns herum. Sein Gebell hallte von den Gefängnismauern wider. Der Gefangene, im Griff der beiden Bewacher, wirkte gleichgültig, als wäre all das bloß eine weitere Formalität bei der Hinrichtung. Es dauerte mehrere Minuten, bis jemand es schaffte, den Hund einzufangen. Dann zogen wir mein Halstuch durch sein Halsband und gingen weiter, samt Hund, der winselnd an dem Halstuch zerrte.
Bis zu den Galgen waren es knapp vierzig Meter. Ich hatte den Blick auf den braungebrannten Rücken des Gefangenen gerichtet, der vor mir herging. Er lief unbeholfen, was an den seitlich fixierten Arme lag, aber mit recht festen Schritten, mit dem knicksenden Gang eines Inders, der die Knie nie gerade hält. Bei jedem Schritt bewegten sich seine Muskeln, der Haarschopf auf seinem Schädel wippte auf und ab, seine Füße hinterließen Spuren auf dem nassen Schotter. Und einmal, ungeachtet der Männer, die ihn an den Schultern gepackt hielten, machte er einen kleinen Schritt zur Seite, um nicht in eine Pfütze zu treten.
So seltsam es scheinen mag, aber bis zu dem Moment, hatte ich nie richtig begriffen, was es bedeutet, das Leben eines gesunden, in vollem Bewusstsein befindlichen Mannes auszulöschen. Als ich sah, wie der Gefangene einen Schritt seitwärts machte, um der Pfütze auszuweichen, erkannte ich den Widersinn, die unsägliche Verkehrtheit, ein Leben zu beenden, das noch in voller Blüte ist. Dieser Mann war kein Sterbender, er war genauso lebendig wie wir. Alle Organe in seinem Körper arbeiteten – der Darm verdaute das Essen, die Haut erneuerte sich stetig, die Nägel wuchsen, neues Gewebe bildete sich – all seine Organe mühten sich mit redlicher Sinnlosigkeit. Seine Nägel würden auch dann noch wachsen, wenn er unter dem Galgen stand, wenn er durch die Klappe fiel und nur noch eine Zehntelsekunde zu leben hatte. Seine Augen sahen den gelben Schotter und die grauen Mauern, sein Gehirn verfügte noch über Erinnerungen, schaute voraus, reagierte – reagierte sogar, um einer Pfütze auszuweichen. Er und wir waren Teil einer Gruppe von Männern, die sich zusammen fortbewegten, die sahen, hörten, fühlten, dieselbe Welt wahrnahmen; und in zwei Minuten wäre nach einem kurzen Knacken einer von uns nicht mehr da – ein Bewusstsein weniger, eine Welt weniger.
Die Galgen standen in einem kleinen Innenhof, abseits vom Hauptgelände des Gefängnisses und waren überwuchert von großem, stacheligem Unkraut. Die Konstruktion bestand aus Backsteinen, wie drei Wände eines Schuppens, mit Holzbohlen darauf und darüber zwei Balken und eine Querstrebe, an der ein Seil hing. Der Henker, ein grauhaariger Sträfling in der weißen Gefängnisuniform, stand neben der Vorrichtung und wartete. Als wir den Innenhof betraten, grüßte er uns mit einem unterwürfigen Kopfsenken. Auf eine Anweisung von Francis packten die beiden Bewacher den Gefangenen fester als die ganze Zeit zuvor, führten ihn halb und schoben ihn halb zu dem Galgen und halfen ihm, unbeholfen die steilen Stufen hochzusteigen. Dann stieg der Henker hinauf und legte dem Gefangenen fest den Strick um den Hals.
Wir standen da und warteten, in etwa fünf Metern Entfernung. Die Bewacher hatten sich in einem groben Kreis um den Galgen herum gestellt. Und dann, als die Schlinge zugezogen wurde, begann der Gefangene seinen Gott anzuflehen. Es war ein wiederholter hoher Schrei »Ram! Ram! Ram! Ram!«, nicht dringlich oder ängstlich wie ein Gebet oder ein Hilfeschrei, sondern gleichmäßig, rhythmisch, beinahe wie das Läuten einer Glocke. Der Hund reagierte mit einem Winseln darauf. Der Henker, der noch auf den Galgenbrettern stand, holte einen kleinen Baumwollbeutel hervor, ähnlich einem Mehlbeutel, und zog ihn dem Gefangenen über den Kopf. Doch der Klang seiner Stimme war noch immer zu hören, etwas gedämpft durch den Stoff, aber in stetiger Wiederholung: »Ram! Ram! Ram! Ram! Ram!«
Der Henker stieg herunter und stand bereit, mit der Hand am Hebel. Es schien, als vergingen Minuten. Die gleichmäßigen, gedämpften Schreie des Gefangenen ertönten weiter und weiter. »Ram! Ram! Ram!«, ohne eine einzige Pause. Der Gefängnisvorsteher hielt den Kopf gesenkt und stocherte mit seinem Stock langsam auf dem Boden herum; vielleicht zählte er die Schreie, weil er dem Gefangenen eine bestimmte Anzahl zugestanden hatte – fünfzig vielleicht, oder hundert. Alle hatten die Farbe gewechselt. Die Inder waren aschfahl geworden, wie abgestandener Kaffee, und eines oder zwei der Bajonette wankten. Wir sahen hinauf zu dem gefesselten Mann mit der Kapuze über dem Kopf und hörten seinen Schreien zu – jeder Schrei eine weitere lebendige Sekunde, und alle hatten wir den gleichen Gedanken: Oh, töte ihn schnell, damit es vorbei ist, mach diesem unerträglichen Geräusch ein Ende!
Auf einmal wirkte der Gefängnisvorsteher entschlossen. Er hob den Kopf und machte eine rasche Bewegung mit seinem Stock. »Chalo!«, schrie er dann fast schon erbittert.
Wir hörten ein rasselndes Geräusch, und dann herrschte absolute Stille. Der Gefangene war verschwunden, und das Seil drehte sich um sich selbst. Ich ließ den Hund los, und er rannte sofort zur Rückseite des Galgens, doch als er dort ankam, blieb er plötzlich stehen, bellte, dann zog er sich in eine Ecke des Innenhofes zurück, wo er zwischen dem Unkraut stand und uns furchtsam ansah. Wir gingen um den Galgen herum, um den Körper des Gefangenen zu inspizieren. Die Zehen in einer geraden Linie nach unten gerichtet, hing er an dem Seil und drehte sich langsam um sich selbst, mausetot.
Der Gefängnisvorsteher stieß mit seinem Stock gegen den leblosen Körper, der langsam hin und her pendelte. »Der ist erledigt«, sagte der Gefängnisvorsteher. Er kam unter dem Galgen hervor und stieß den Atem aus. Plötzlich machte er nicht mehr ein so übellauniges Gesicht. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr. »Acht Minuten nach acht. Das wäre dann für heute Morgen alles, Gott sein Dank.«
Die Bewacher schraubten die Bajonette ab und gingen davon. Der Hund, ernüchtert und sich bewusst, dass er sich schlecht benommen hatte, schlich hinter ihnen her. Wir verließen den Innenhof und gingen vorbei an den Zellen der wartenden Verurteilten zum Hauptplatz des Gefängnisses. Unter Aufsicht der mit Lathis2 bewaffneten Wärter bekamen die Gefangenen schon ihr Frühstück. In langen Reihen hockten sie da, ein jeder mit einer kleinen Blechpfanne, während zwei der Wärter mit Eimern herumgingen und Reis austeilten; nach der Hinrichtung schien das wie eine heimelige, fröhliche Szene. Enorme Erleichterung überkam uns, nun da dieser Auftrag erledigt war. Man hatte das Bedürfnis zu singen, in den Laufschritt zu verfallen, aufzulachen. Alle fingen auf einmal an, munter zu plaudern.
Der eurasische Bedienstete, der neben mir ging, zeigte mit dem Kopf in die Richtung, aus der wir gekommen waren, und sagte mit wissendem Lächeln: »Wussten Sie eigentlich, Sir, dass unser Freund (damit meinte er den toten Mann), als er erfuhr, dass sein Gnadengesuch abgelehnt worden war, auf den Boden seiner Zelle gepinkelt hat. Vor Angst. – Nehmen Sie ruhig eine Zigarette von meinen, Sir. Wollen Sie mein neues Silberetui denn nicht bewundern, Sir? Von einem Boxwallah3, für zwei Rupien und acht Annas. Schicker europäischer Stil.«
Einige der anderen lachten – worüber, wusste wohl keiner so genau.
Francis ging neben dem Gefängnisvorsteher her und redete munter drauflos. »Na also, Sir, hat doch alles zur vollsten Zufriedenheit geklappt. Ruck, zuck – und dann war es auch schon vorbei. Das geht nicht immer so – oh, nein! Ich habe schon erlebt, dass der Doktor unter den Galgen gehen und an den Beinen des Gefangenen ziehen musste, um sicherzustellen, dass er tot war. Wirklich unangenehm!«
»Hat er noch rumgezuckt, was? Das ist gar nicht schön«, sagte der Gefängnisvorsteher.
»Ach, Sir, wenn sie aufmüpfig werden, ist es noch schlimmer! Ich erinnere mich an einen Mann, der klammerte sich an den Gitterstäben seiner Zelle fest, als wir ihn holen wollten. Sie werden es kaum glauben, Sir, aber wir brauchten sechs Mann, um ihn da wegzukriegen. An jedem Bein mussten drei ziehen. Wir versuchten, ihm gut zuzureden. ›Lieber Freund‹, sagten wir, ›denk doch mal an all die Mühe und Scherereien, die wir wegen dir haben!‹ Aber nein, er wollte nicht hören! Ach, der war wirklich lästig.«
Ich merkte, dass ich ziemlich laut lachte. Alle lachten. Auch der Gefängnisvorsteher lächelte nachsichtig. »Am besten kommt ihr alle mit, und dann trinken wir erstmal was«, sagte er leutselig. »Ich habe noch eine Flasche Whisky im Auto. Die könnten wir jetzt gebrauchen.«
Durch das große Doppeltor des Gefängnisses gingen wir hinaus auf die Straße. »An seinen Beinen ziehen!«, stieß einer der burmesischen Beamten plötzlich hervor und brach in Gelächter aus. Wieder lachten wir alle mit. In dem Moment schien die Anekdote, die Francis erzählt hatte, ungeheuer komisch. Wir alle tranken etwas zusammen, Einheimische und Europäer, in freundschaftlichem Einvernehmen. Der Tote war hundert Meter weit weg.
1 vereinfacht: aus dem Süden Indiens stammende Bevölkerungsgruppe
2 Ein Schlagstock aus Bambus, der von indischen Ordnungskräften eingesetzt wurde und wird.
3 Straßenhändler
Einen Elefanten erschießen
September 1936
In Moulmein4, im Süden von Burma, war ich vielen Leuten verhasst – die einzige Zeit in meinem Leben, in der ich dafür überhaupt wichtig genug war. Ich war Unterabteilungsleiter bei der örtlichen Polizei, und gegen Europäer herrschten generell unterschwellig starke Ressentiments. Niemand hätte den Mut gehabt, einen Aufstand anzuzetteln, aber wenn eine europäische Frau allein über den Bazar ging, musste sie damit rechnen, dass ihr jemand Betelsaft aufs Kleid spuckte. Als Polizeibeamter war ich natürlich ein exponiertes Ziel und wurde behelligt, wann immer es gefahrlos möglich schien. Wenn ein flinker Burmese mir beim Fußball ein Bein stellte und der Schiedsrichter (ebenfalls Burmese) wegsah, wurde das vom Publikum mit Gejohle und gehässigem Gelächter quittiert. So etwas passierte mehr als einmal. Mit der Zeit machten mir die höhnisch grinsenden, gelben Gesichter junger Männer, die mir überall begegneten und die Beschimpfungen, die sie mir aus sicherer Entfernung hinterherriefen, schwer zu schaffen. Am schlimmsten waren die jungen buddhistischen Mönche. In der Stadt gab es mehrere Tausend und offenbar hatte keiner von ihnen etwas Besseres zu tun, als an einer Straßenecke zu stehen und Europäer anzupöbeln.
All das war erschütternd und verstörend. Denn auch ich war damals schon zu der Überzeugung gekommen, dass Imperialismus etwas Schreckliches ist, und je eher ich diesen Posten aufgab und da rauskam, desto besser. Theoretisch – und natürlich ganz im Geheimen – war ich absolut für die Burmesen und gegen ihre Unterdrücker, die Briten. Was die Position betraf, die ich dort bekleidete, so hasste ich sie mehr, als ich wohl in Worte fassen kann. Die jämmerlichen Gefangenen, die in stinkenden Gitterkäfigen hockten, die aschfahlen, verängstigten Gesichter der zu langen Haftstrafen Verurteilten, die vernarbten Hinterteile der Männer, die mit Bambusstöcken geschlagen worden waren – all das bedrückte mich aus einem nicht mehr zu ertragenden Schuldgefühl. Aber ich hatte noch keine andere Perspektive vor Augen. Ich war jung, ziemlich ungebildet, und so wie jeder Engländer in Fernost konnte ich mir nur im Stillen Gedanken über meine Probleme machen. Mir war nicht einmal klar, dass das Britische Empire in den letzten Zügen lag, geschweige denn, dass ich gewusst hätte, um wie vieles besser es war als die Imperien, die wohl darauf folgen werden. Ich wusste nur, dass ich hin- und hergerissen war zwischen meinem Abscheu gegenüber dem Empire, dem ich mich verpflichtet hatte, und meiner Wut auf die böswilligen kleinen Scheusale, die mir den Dienst zur Hölle machen wollten. Einerseits empfand ich das britische Kolonialreich als unüberwindbare Tyrannei, als etwas Unumstößliches bis in alle Ewigkeit, in saecula saeculorum, das den Unterdrückten aufgezwungen wurde. Andererseits dachte ich, die größte Freude auf Erden wäre, einem dieser buddhistischen Mönche ein Bajonett in die Eingeweide zu rammen. Solche Gedanken sind ein üblicher Nebeneffekt des Imperialismus; da kann man jeden anglo-indischen Beamten fragen, wenn er nicht gerade im Dienst ist.
Eines Tages geschah etwas, das in vielerlei Hinsicht erhellend war. An und für sich war es nur ein kleiner Zwischenfall, aber es vermittelte mir einen besseren Eindruck davon, was den Imperialismus wirklich ausmacht, als ich ihn zuvor hatte – einen Eindruck davon, aus welcher Motivation heraus man in despotischen Regierungssystemen handelt. Eines frühen Morgens rief mich der Unterinspektor eines Polizeireviers an und sagte, dass ein Elefant den Basar verwüste. Ob ich bitte kommen und etwas dagegen unternehmen könne? Ich wusste selbst nicht, was ich dagegen tun sollte, aber ich wollte wissen, was da los war. Also setzte ich mich auf ein Pony und machte mich auf den Weg. Mein Gewehr nahm ich mit, eine alte 44er Winchester, eigentlich viel zu klein, um einen Elefanten zu töten, aber ich dachte, ein knallender Schuss wäre vielleicht für eine Schrecksekunde ganz hilfreich, in terrorem sozusagen. Auf dem Weg hielten einige Burmesen mich an und erzählten mir, was der Elefant bereits angerichtet hatte. Natürlich war es kein wild lebender Elefant, sondern ein zahmes Tier, das gerade in der »Musth« war. Wie alle gezähmten Elefanten während der Musth war auch dieser angekettet gewesen, doch am Abend zuvor hatte er sich losgerissen und war ausgebrochen. Sein Mahut, der Elefantentreiber und damit der einzige, der ihn in diesem Zustand hätte besänftigen können, hatte sich auf den Weg gemacht, um den Elefanten einzufangen, war aber in die falsche Richtung aufgebrochen und nun zwölf Stunden weit entfernt. Am Morgen war der Elefant plötzlich wieder in der Stadt aufgetaucht. Die burmesische Bevölkerung hatte keine Waffen, stand also ziemlich hilflos da. Der Elefant hatte eine Bambushütte zerstört, eine Kuh getötet und ein paar Obststände verwüstet, wobei er sich die Auslagen einverleibt hatte; dann war er dem städtischen Mülllaster über den Weg gelaufen, und als der Fahrer aus dem Wagen sprang und davonlief, war der Elefant auf den Laster losgegangen und hatte ihn umgestoßen.
Der burmesische Unterinspektor und einige weitere Polizisten warteten in dem Stadtviertel auf mich, wo der Elefant gesehen worden war. Es war ein sehr armes Viertel, ein Labyrinth aus armseligen Bambushütten mit Dächern aus Palmblättern, das sich einen steilen Hang hinaufwand. Ich weiß noch, dass es ein bewölkter, schwüler Morgen war, zu Beginn der Regenzeit. Wir fragten ein paar Leute, wohin der Elefant gelaufen war, und wie üblich bekamen wir keine eindeutigen Informationen. Denn das ist in Fernost zwangsläufig immer so. Zunächst scheinen die Geschehnisse einigermaßen schlüssig, aber je näher man der Sache kommt, desto vager wird das Ganze. Einige sagten, der Elefant sei in diese Richtung gelaufen, andere sagten, er sei in jene Richtung gelaufen, manche gaben sogar an, von einem Elefanten hätten sie gar nichts mitbekommen. Mir kam schon der Verdacht, dass die Geschichte erfunden war, als wir plötzlich aus einiger Entfernung Geschrei hörten. Lautes, entsetztes Rufen: »Weg da, Kind. Geh sofort da weg!« Dann kam eine alte Frau mit einer Gerte in der Hand um die Ecke einer Hütte gerannt und scheuchte wie wild eine Schar Kinder vor sich her. Ein paar weitere Frauen folgten ihr, schnalzten mit den Zungen und riefen offenbar, dass dort etwas war, was die Kinder nicht hätten sehen sollen. Ich ging um die Hütte herum, und da lag ein Mann tot im Schlamm. Er war Inder, ein schwarzer dravidischer Kuli5, fast nackt. Er konnte noch nicht länger als ein paar Minuten tot sein. Die Leute erzählten, der Elefant sei plötzlich um die Ecke der Hütte gekommen und auf ihn zugelaufen, habe ihn mit dem Rüssel an den Füßen gepackt, über seinen Rücken auf den Boden geschleudert und ihn dann zertrampelt. Es war ja zu Beginn der Regenzeit, deshalb war der Boden aufgeweicht, und das Gesicht des Mannes hatte eine einige Meter lange Furche von etwa einem Fuß Tiefe hinterlassen. Er lag auf dem Bauch, mit ausgestreckten Armen und zu einer Seite verrenktem Kopf. Sein Gesicht war von Schlamm bedeckt, die Augen weit aufgerissen und die Zähne in einem von nicht auszuhaltender Qual entstellten Grinsen entblößt. (Mir soll bloß keiner mehr erzählen, Tote sähen friedlich aus. Die meisten der Leichen, die ich gesehen habe, wirkten nämlich teuflisch.) Die raue Haut des Elefantenfußes hatte dem Mann die Haut so vollständig vom Rücken geschabt, als hätte man ein Kaninchen gehäutet. Als ich den Toten sah, schickte ich sofort einen der Beamten zum nahegelegenen Haus eines Bekannten, um ein Elefantengewehr zu holen. Das Pony hatte ich schon zurückgeschickt, weil ich nicht wollte, dass es scheuen und mich abwerfen würde, wenn es den Elefanten roch.
Der Beamte kam einige Minuten später mit dem Gewehr und fünf Patronen zurück. Mittlerweile hatten sich ein paar Burmesen versammelt, die uns erzählten, der Elefant befinde sich in den weiter unterhalb gelegenen Reisfeldern, nur ein paar Hundert Meter weit von uns entfernt. Als ich mich auf den Weg dorthin machte, strömten fast alle Bewohner des Viertels aus ihren Hütten und liefen hinter mir her. Sie hatten das Gewehr gesehen und riefen aufgeregt durcheinander, dass ich den Elefanten erschießen würde. Als der Elefant beinahe ihre Hütten verwüstet hätte, hatten sie sich nicht sonderlich für ihn interessiert, aber jetzt, da er erschossen werden sollte, hatte sich das geändert. Sie schienen sogar ein bisschen Spaß daran zu haben, was bei einer englischen Menschenmasse im Übrigen ebenfalls der Fall gewesen wäre. Abgesehen davon spekulierten sie auf das Fleisch. Das bereitete mir ein wenig Unbehagen. Ich hatte nämlich überhaupt nicht vor, den Elefanten zu erschießen – eigentlich hatte ich das Gewehr nur holen lassen, um mich nötigenfalls verteidigen zu können –, und eine Menschenmenge im Rücken ist grundsätzlich beunruhigend. Als ich mit dem Gewehr über der Schulter den Abhang hinunterging und sich immer mehr Menschen an meine Fersen hefteten, kam ich mir vor wie ein Idiot. Unterhalb der Hütten verlief eine befestigte Straße und dahinter erstreckten sich über etwa tausend Quadratmeter sumpfige Reisfelder, die noch nicht gepflügt, aber von den ersten Regenfällen schon überschwemmt und hier und da von Grasbüscheln bewachsen waren. Der Elefant stand in ungefähr achtzig Metern Entfernung von der Straße und hatte uns die linke Seite zugewandt. Von der sich nähernden Menschenmenge nahm er keinerlei Notiz. Er riss Grasbüschel aus, schlug sie gegen seine Knie, um den Schlamm abzuschütteln, und stopfte sie sich dann ins Maul.
Ich war auf der Straße stehengeblieben. Beim ersten Blick auf den Elefanten, war mir absolut klar, dass es besser wäre, wenn ich ihn nicht erschießen würde. Einen Arbeitselefanten zu erschießen, ist eine ernste Angelegenheit – in etwa damit vergleichbar, als würde man eine große, teure Maschine zerstören – und das sollte man lieber lassen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Aus dieser Entfernung wirkte der friedlich grasende Elefant auch nicht gefährlicher als eine Kuh. Damals dachte ich und das denke ich noch heute, dass der Anflug von Musth bereits nachgelassen hatte und er friedlich herumlaufen würde, bis sein Mahut zurückkäme und ihn wieder einfangen würde. Abgesehen davon war mir absolut nicht danach, ihn zu erschießen. Ich beschloss, ihn noch eine Zeit lang im Auge zu behalten, um sicherzugehen, dass er nicht wieder wild würde, und dann nach Hause zu gehen.
Doch in dem Moment drehte ich mich um und sah die Menschenmenge, die mir gefolgt war. Diese Menge war riesig, mindestens zweitausend Leute, und mit jeder Minute wurden es mehr. Auf einer langen Strecke blockierten sie beide Seiten der Straße. Ich sah in die vielen gelben Gesichter oberhalb bunter Kleidung – freudig erregte Gesichter angesichts dieses kleinen Vergnügens, alle in der sicheren Annahme, dass der Elefant nun erschossen würde. Sie hatten ihre Augen auf mich gerichtet wie auf einen Zauberkünstler, der gleich einen seiner Tricks vollführen würde. Sie mochten mich nicht, aber mit dem magischen Gewehr in der Hand, lohnte es sich, den Blick auf mich zu richten. Da wurde mir plötzlich klar, dass ich den Elefanten doch erschießen musste. Die Leute erwarteten es von mir, also blieb mir gar nichts anderes übrig. Ich spürte geradezu, wie ich durch den zweitausendfachen Willen dazu getrieben wurde. Das war der Moment, als ich mit dem Gewehr in der Hand dort stand, in dem ich zum ersten Mal begriff, wie sinnlos, wie nutzlos die Herrschaft des weißen Mannes in Fernost doch war. Da stand ich nun, der weiße Mann mit seinem Gewehr, vor einer unbewaffneten Menge Einheimischer – als derjenige, der die vermeintliche Hauptrolle in diesem Stück spielte, in Wirklichkeit aber nichts weiter war als eine lächerliche Marionette, die vom Willen, der in diese gelben Gesichter hinter ihm geschrieben stand, an Fäden hin und her gezogen wurde. In dem Moment verstand ich, dass wenn der weiße Mann zum Tyrannen wird, er damit seine eigene Freiheit zerstört. Er wird zu einer hohlen Attrappe, die sich zur Schau stellt, die konventionelle Rolle des Sahibs6. Denn seine Herrschaft ist nun einmal darauf ausgerichtet, die »Einheimischen« Zeit seines Lebens zu beeindrucken. Deshalb muss er im entscheidenden Moment tun, was die »Einheimischen« von ihm erwarten. Er trägt eine Maske, an die sich sein Gesicht immer mehr anpasst. Ich konnte diesen Elefanten nur noch erschießen. Dazu hatte ich mich verpflichtet, als ich das Gewehr holen ließ. Ein Sahib muss sich verhalten wie ein Sahib. Er muss entschlossen auftreten, wissen, was er will, und die Dinge in die Hand nehmen. Den ganzen Weg hierher zu kommen, mit einem Gewehr in der Hand, mit zweitausend Leuten auf den Fersen, und dann eine lasche Haltung an den Tag legen und unverrichteter Dinge kehrtmachen – nein, das war unmöglich. Die Menschenmenge würde mich auslachen. Und mein ganzes Leben, das Leben jedes weißen Mannes in Fernost war ein einziger langer Kampf darum, nicht verlacht zu werden.
Aber ich wollte den Elefanten nicht erschießen. Ich sah ihm zu, wie er die Grasbüschel gegen seine Knie schlug, in dieser großmütterlich gewissenhaften Art, die Elefanten an sich haben. Es kam mir vor, als wäre es Mord, ihn zu erschießen. In dem Alter war ich nicht zimperlich, wenn es darum ging, Tiere zu töten, aber einen Elefanten hatte ich noch nie erschossen, und ich wollte es auch nie. (Irgendwie scheint es grundsätzlich schlimmer, ein großes Tier zu töten.) Abgesehen davon musste ich auch an den Besitzer des Elefanten denken. Lebend war der Elefant mindestens hundert Pfund wert, tot hätte er nur noch den Wert seiner Stoßzähne – fünf Pfund vielleicht. Aber ich musste schnell handeln. Ich drehte mich um zu ein paar Burmesen, die mir recht erfahren schienen und schon vor mir dort gewesen waren, und fragte sie, wie der Elefant sich verhalten hatte. Sie alle sagten das Gleiche: Solange man ihn in Ruhe ließ, beachtete er die Leute gar nicht, aber wenn man ihm zu nahe käme, könnte es sein, dass er angriffslustig würde.
Mir war absolut klar, was ich tun musste. Ich musste mich dem Elefanten auf etwa fünfundzwanzig Meter nähern und abwarten, wie er sich verhalten würde. Würde er auf mich losgehen, konnte ich ihn erschießen. Würde er mich ignorieren, wäre es ungefährlich, ihn in Ruhe zu lassen, bis sein Mahut zurückkam. Aber mir war auch klar, dass ich nichts dergleichen tun würde. Ich war ein schlechter Gewehrschütze und der Boden war so aufgeweicht, dass man bei jedem Schritt darin versinken würde. Wenn der Elefant mich angreifen würde und ich ihn dann verfehlte, stünden meine Chancen so gut wie die einer Kröte, die von einer Dampfwalze überrollt wird. Aber auch bei diesen Überlegungen dachte ich nicht in erster Linie daran, selbst mit heiler Haut davonzukommen, sondern nur an die gelben Gesichter hinter mir. Denn in dem Moment, unter den Augen der Menge, hatte ich keine Angst im eigentlichen Sinne, so wie ich sie gehabt hätte, wenn ich allein dort gewesen wäre. Ein weißer Mann darf in Gegenwart der »Einheimischen« keine Angst haben, also hat er auch keine. Mein einziger Gedanke war, dass wenn dabei irgendetwas schief ging, zweitausend Burmesen zusehen würden, wie ich gejagt, gestellt und zertrampelt werden würde, bis ich nur noch eine grinsende Leiche wäre wie der Inder ein Stück weiter den Hügel hinauf. Und wenn das geschehen würde, wäre es ziemlich wahrscheinlich, dass einige der Leute lachen würden. Das durfte auf keinen Fall passieren. Also gab es nur eine Möglichkeit. Ich lud das Gewehr mit den Patronen und legte mich auf die Straße, um besser zielen zu können.
Die Menschenmenge wurde sehr still, und ein tiefes, unterdrücktes, aber erwartungsfrohes Seufzen ertönte aus zahllosen Kehlen, so wie im Theater, wenn sich der Vorhang endlich hebt. Nun würden sie also doch noch ihren Spaß bekommen. Das Gewehr war eine perfekte Anfertigung aus Deutschland, mit Fadenkreuz-Visier. Damals wusste ich noch nicht, dass wenn man einen Elefanten erschießen will, man auf eine imaginäre Linie von einem Ohrloch zum anderen anlegen sollte. Da der Elefant seitlich zu mir stand, hätte ich also direkt auf das Ohrloch zielen müssen; aber ich zielte auf eine Stelle einige Zentimeter davor, weil ich dachte, das Gehirn läge weiter vorn.
Als ich den Abzugshahn zog, hörte ich den Schuss nicht und spürte auch keinen Rückstoß – das hört und spürt man nie, wenn der Schuss trifft –, aber ich hörte den unmenschlichen Jubel der Menge. In dem Moment, viel zu schnell, sollte man meinen, als dass die Kugel ihr Ziel schon hätte erreichen können, ging mit dem Elefanten eine furchtbare Veränderung vor. Er wankte nicht, und er fiel auch nicht, aber jede Furche seines Körpers hatte sich verändert. Er wirkte plötzlich angeschlagen, geschrumpft, unvorstellbar alt, als hätte die verheerende Erschütterung durch die Kugel ihn so bewegungsunfähig gemacht, dass er nicht zu Boden gehen konnte. Irgendwann, nach scheinbar endlosen Sekunden – es mögen vielleicht fünf gewesen sein– erschlaffte er und sank auf die Knie. Geifer lief ihm aus dem Maul. Eine unglaubliche Schwäche schien ihn überkommen zu haben. Man hätte glauben können, er wäre Tausende von Jahren alt. Ich schoss noch einmal auf dieselbe Stelle. Beim zweiten Schuss brach er immer noch nicht zusammen, sondern stellte sich mit verzweifelter Anstrengung auf die Füße und richtete sich mit hängendem Kopf schwankend auf, obwohl ihm die Beine immer wieder wegsackten. Ich schoss ein drittes Mal. Dieser Schuss gab ihm den Rest. Man konnte sehen, wie der Todeskampf seinen ganzen Körper erschütterte und ihm den letzten Rest Kraft aus den Beinen trieb. Doch selbst im Fall schien er sich noch einmal aufzurichten, denn als ihm die Hinterbeine wegsackten, neigte sich sein Oberkörper für einen Moment wie ein riesiger, stürzender Felsblock, und sein Rüssel ragte wie ein Baum zum Himmel hinauf. Er trompetete, zum ersten und letzten Mal. Und dann ging er zu Boden, mit dem Bauch in meine Richtung und einem solchen Krachen, dass dort, wo ich lag, der Boden bebte.
Ich stand auf. Die Burmesen rannten schon an mir vorbei durch den Schlamm. Der Elefant würde nicht mehr aufstehen, das war eindeutig klar, aber er war noch nicht tot. Er atmete rhythmisch, und mit jedem seiner langen, rasselnden Atemzüge hob und senkte sich die massige Erhebung seines auf der Seite liegenden Körpers. Sein Maul stand weit offen – ich konnte bis tief hinein in den hellrosa Rachen sehen. Ich wartete eine ganze Zeit lang, bis er sterben würde, aber er atmete unaufhörlich weiter. Irgendwann schoss ich mit den letzten beiden Kugeln auf die Stelle, wo ich sein Herz vermutete. Dickes Blut quoll heraus wie roter Samt, aber er war nicht tot. Sein Körper zuckte nicht einmal, als die Schüsse ihn trafen. Das qualvolle Atmen ging unaufhörlich weiter. Er starb, sehr langsam und sehr qualvoll, aber in einer Welt, die schon so weit von mir entfernt war, dass nicht einmal eine Gewehrkugel ihm noch etwas anhaben konnte. Ich musste dafür sorgen, dass die furchtbaren Geräusche aufhörten. Es war ein schreckliches Gefühl, diesen riesigen Koloss dort liegen zu sehen, unfähig sich zu bewegen, aber auch unfähig zu sterben, und nicht in der Lage zu sein, dem ein Ende zu bereiten. Ich ließ mein kleines Gewehr holen und schoss dem Elefanten ein paar Mal ins Herz und in den Rachen. Auch das schien keinerlei Wirkung zu haben. Die qualvollen Atemzüge kamen weiter so regelmäßig wie das Ticken einer Uhr.
Letzten Endes konnte ich es nicht länger ertragen und ging. Später hörte ich, dass er eine halbe Stunde brauchte, um zu sterben. Noch bevor ich ging, kamen die Burmesen schon mit Dhas7 und Körben, und später erzählte man mir, dass sie den Körper am Nachmittag schon fast bis auf die Knochen ausgeweidet hatten.
Anschließend gab es natürlich endlose Diskussionen darüber, dass ein Elefant erschossen wurde. Der Besitzer war außer sich, aber da er bloß Inder war, konnte er nichts machen. Abgesehen davon hatte ich aus rechtlicher Sicht richtig gehandelt, denn ein wild gewordener Elefant muss getötet werden, ebenso wie ein tollwütiger Hund, wenn der Besitzer nicht in der Lage ist, ihn einzufangen. Bei den Europäern waren die Ansichten gespalten. Die Älteren sagten, ich hätte richtig gehandelt, die Jüngeren sagten, es sei eine absolute Schande, einen Elefanten zu erschießen, weil er einen Kuli getötet hatte, denn ein Elefant sei schließlich mehr wert als so ein dämlicher dravidischer Kuli. Letzten Endes war ich heilfroh, dass der Kuli getötet worden war, denn dadurch war ich rechtlich auf der sicheren Seite und konnte einen guten Grund vorweisen, den Elefanten erschossen zu haben. Ich habe mich oftmals gefragt, ob von den anderen irgendjemand merkte, dass ich es einzig und allein deshalb getan hatte, um nicht dazustehen wie eine Witzfigur.
4 heute Mawlamyaing in Myanmar
5 Tagelöhner aus Südindien
6 Sahib, arabisch für Herr, Besitzender; auf dem indischen Subkontinent insb. während der britischen Kolonialherrschaft höfliche Form der Anrede; von verschiedenen britischen Autoren als ethnische Bezeichnung für Europäer verwendet (Kipling).
7 bis heute in Myanmar und benachbarten Ländern genutzte traditionelle Schwerter
Erinnerungen an einen Buchladen
November 1936
Als ich in einem antiquarischen Buchladen arbeitete – was man sich, wenn man nicht selbst in einem solchen Laden arbeitet, immer vorstellt wie eine Art Paradies, wo nette ältere Herren Ewigkeiten lang in ledergebundenen Bänden stöbern – erstaunte mich am meisten, dass belesene Menschen eine Seltenheit waren. Der Laden hatte außerordentlich interessante Bücher im Sortiment, aber ich habe so meine Zweifel daran, dass die Kunden, die ein gutes Buch von einem schlechten unterscheiden konnten, überhaupt zehn Prozent unserer Kundschaft ausmachten. Wichtigtuer, die nach Erstausgaben fragten, kamen wesentlich häufiger als Literaturliebhaber, und noch häufiger kamen Orientalistik-Studenten, die Lehrbücher herunterhandeln wollten, am häufigsten aber kamen unentschlossene Frauen, die nach Geburtstagsgeschenken für ihre Neffen suchten.