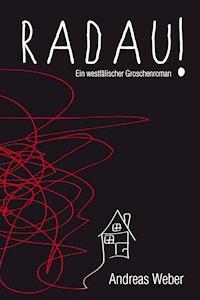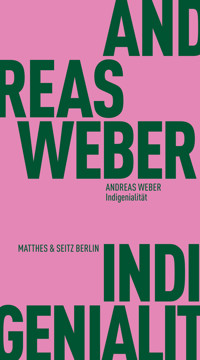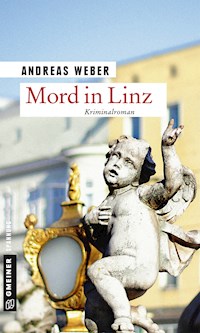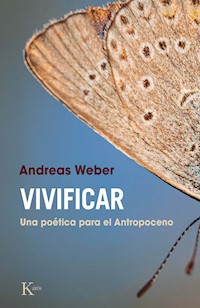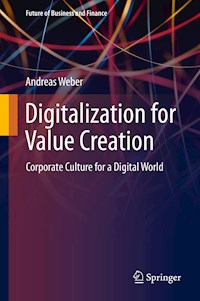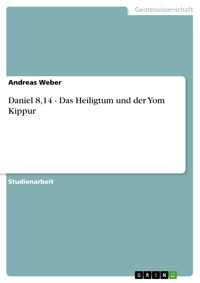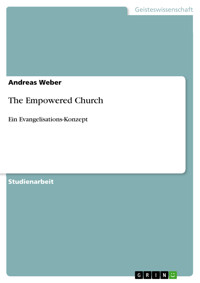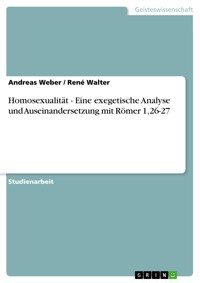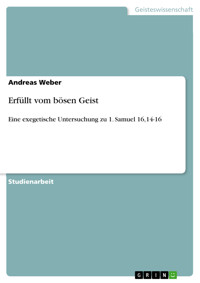Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliographisches Institut
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Warum?
- Sprache: Deutsch
Ob es um die eigenen Lebensziele geht, um wirtschaftlichen Wettbewerb oder um politisches Handeln: Kompromisslosigkeit gilt weithin als Zeichen der Stärke, als alleiniges Erfolgsrezept. Wer Kompromisse eingeht, gilt dagegen als schwach, als weltfremder Träumer. Auch Biologie und Wirtschaft suggerieren: Der Stärkere siegt. Aber stimmt das? Für den Philosophen und Biologen Andreas Weber sind Kompromisse keineswegs automatisch faul, sondern Grundvoraussetzung für ein gedeihliches Leben aller. Mehr noch: Als Lebewesen haben wir ein natürliches Bedürfnis nach Ausgleich. Kompromisse machen heißt eben nicht, zähneknirschend zweitbeste Lösungen zu akzeptieren, sondern das zu wählen, was mir etwas schenkt, weil ich selbst großzügig bin. So wird die Kunst des Kompromisses zur Lebenskunst, zur Lust daran, diese Welt zu bereichern und miteinander - auf Augenhöhe - ökologisch und politisch zu gestalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 111
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
1 Leben erlauben
2 Lieber keinen Kuchen als einen halben
3 Die Kakerlake in der Suppe
4 Beziehungsstatus geändert
5 Kapitalismus als Kriegszustand
6 I can’t breathe
7 Mit der Biosphäre per Du
8 Weil ihr uns die Zukunft klaut
9 Kompromiss als Lebenskunst
Danksagung
Anmerkungen
Autorenvita
Zum Buch
1 Leben erlauben
Vor ein paar Jahren arbeitete ich eine Zeit lang als Bibliothekar in der Gemeindebücherei einer italienischen Kleinstadt. Es war ein stiller, beruhigender Ort. Die hohen Gewölbe über den dicht gefüllten Stahlregalen atmeten auch an heißen Tagen Kühle. Als ich mein Amt antrat, wies mich Paola, die Bibliothekarin, eine Stunde lang in die Aufgaben ein. Ausleihen hatte ich in eine dicke Kladde einzutragen. Wenn eine Seite voll war, musste ich mit dem Lineal neue Spalten ziehen. Alles war einfach, ordentlich und klar geregelt.
Das Wichtigste schärfte mir Paola zum Schluss ein: Wenn jemand sein Buch nur wenige Tage zu spät abgebe, müsse er keine Strafgebühr zahlen. Jedenfalls nicht unbedingt. Ich solle bitte von Fall zu Fall entscheiden und dabei »Intelligenza« zeigen.
Ich musste lange über diesen Begriff nachdenken. Wörtlich übersetzt bedeutet das Wort das Gleiche wie das deutsche »Intelligenz«. Was Paola aber meinte, war eine Form von Lebensklugheit. Sie erwartete von mir die Bereitschaft zum Kompromiss. Ich sollte mich darauf einstellen, von Fall zu Fall einen Ausgleich zwischen den starren Regeln der Ausleihe (ab einem Tag Verspätung Strafe) und den persönlichen Umständen der verspäteten Abgabe zu finden. »Intelligenza« bedeutete, das Unvollkommene unseres Wesens und Lebens anzunehmen und auch einmal großzügig auf meine Autorität als Bibliothekar zu verzichten.
Ich weiß nicht, ob Paola glaubte, mich als Deutschen daran erinnern zu müssen. Unsere Nationalkultur ist nicht für ihre Stärke bekannt, sich je nach Situation mit den Umständen zu arrangieren. Um eine solche Flexibilität und Nonchalance zu erfahren, nehmen wir gern Reisen über die Alpen in Kauf. Dafür pflegen wir hierzulande im beruflichen und geschäftlichen Leben die Geradlinigkeit. Und leiden bisweilen darunter.
In der deutschen Gesellschaft haftet dem Kompromiss etwas besonders Negatives an. Unsere Kultur ist in der Tat oft eher durch Kompromisslosigkeit hervorgestochen. Unwörter wie »Endlösung« haben nichts von Zugeständnis. Den Deutschen wird »Hundertprozentigkeit« attestiert. Selbst Angela Merkel, die eigentlich als Meisterin des Arrangements gilt, sprach zur Rechtfertigung ihrer Politik des Öfteren von »Alternativlosigkeit«.
Längst stehen wir Deutschen mit unserem Hang zum Schwarz-Weiß-Denken nicht mehr allein. Die Spielräume für flexibles Handeln schrumpfen – weltweit. Die Bibliothek des italienischen Landstädtchens war schon damals auf der Apenninen-Halbinsel ein Anachronismus. Inzwischen ist sie geschlossen. Das Wort »Kompromiss« hat überall einen negativen Beigeschmack bekommen. Was, du lebst in einer Beziehung, für die du Kompromisse eingehen musst? Du bist nicht deinem Lebenstraum gefolgt, sondern hast beruflich genommen, was sich dir bot? Wer sich arrangiert, wer das akzeptiert, was gerade passt, und nicht alles ausschöpft, hat schnell den Ruf eines Losers.
Dagegen benutzen wir das Adjektiv »kompromisslos«, um erfolgreiches Handeln zu beschreiben. Das gilt für die Karriere, für die Partnerwahl, für das Agieren von Unternehmen auf dem Markt – und neuerdings wieder für Politikerinnen und Politiker, denen viele zutrauen, mit kompromissbehafteten Missständen aufzuräumen. »Kompromisslos« umschreibt die verbreitete Auffassung, dass belohnt wird, wer sein Ding macht, und dass ausstirbt, wer sich anpasst.
Mit dem Export des Optimierungsmodells in alle Ecken des Planeten (»Ich will das meiste aus meinem Leben machen!« statt »Ich will meine Rolle so produktiv wie möglich ausfüllen«) scheint der Kompromiss als natürlicher Feind des Gelingens identifiziert. Während es in der Antike und in Stammesgesellschaften geboten war, mit Maß und ohne Egozentrik zu agieren, erscheinen in unserer Zeit ein Mindestmaß an Narzissmus und damit einhergehender Kompromissfeindschaft unerlässlich für beruflichen und sozialen Erfolg.
Aber es zahlt sich nicht immer aus, Sieger zu sein. Vielfach lohnt sich der Mittelweg. Als Menschen fühlen wir uns mit einem Kompromiss oft stimmiger – so wie ich, wenn ich den Buchlesern der italienischen Kleinstadt mit südländischer Nonchalance ihre Gebühren erlassen konnte. Ein Kompromiss heißt etwas aufgeben (in dem Fall meine Autorität als Bibliothekar und die Einnahmequelle des Strafgeldes) und umgekehrt dafür etwas bekommen (eine freundliche Begegnung mit einem dankbaren Mitmenschen). Er folgt der alten mediterranen Idee von Zivilisation, die der Schriftsteller Albert Camus als »Pensée du Midi«, das »Denken des südlichen Mittags«, beschrieben hat: leben und leben lassen, leben dürfen und dafür anderen zu leben erlauben.1 Sich selbst etwas versagen und dafür von etwas anderem verschont bleiben. Der Kompromiss ist ein Mittelweg, den alle Beteiligten beschreiten können.
Das heißt freilich nicht, dass Kompromisse per se immer richtig sind. Auch dazu lernte ich etwas in Italien. Unlängst stritt ich mich mit der Bürgermeisterin einer Kleinstadt im süditalienischen Kalabrien. Ich wollte sie für einen Artikel über die Rolle der Mafia interviewen. Bei der Anfahrt zu unserem Gesprächstermin, dort, wo die Küstenstraße in den Ort einmündete, war ich an einer frischen Brandruine vorbeigefahren. Das war ihre Apotheke, erzählte mir die Bürgermeisterin. Ein paar Tage zuvor hatte die Mafia ihr Haus angezündet. Dass die Bürgermeisterin und ihre Familie, die im ersten Stock darüber wohnten, den Flammen lebend entkommen konnten, war reines Glück.
Drei in Zivil gekleidete Carabinieri, ihre persönliche Eskorte, waren mit uns die einzigen Gäste im Café an der Strandpromenade. Die drahtigen Männer mit den Sonnenbrillen saßen nicht sehr unauffällig in unserer Nähe. Die Politikerin wirkte gefasst, ja entschlossen. Sie sei keine Freundin des Kompromisses, meinte sie. Sie beharrte darauf, dass wir nur friedlich zusammenleben könnten, wenn wir uns an Prinzipien hielten. Ihr moralisches Idol war der Philosoph Immanuel Kant. Für diesen zählt allein der gute Wille – ganz gleich, was letztlich bei der Handlung herauskommt. Der Wille muss eisern sein. Kein italienisches Sich-Arrangieren, Ausnahmen-Machen, Wegblicken.
Ich widersprach der Bürgermeisterin. Ich erinnerte sie an die preußische Gehorsamsdiktatur und ihre Folgen. Zu viele Kompromisse erlauben, das werde schnell zu Anarchie, konterte die Lokalpolitikerin. Ich sähe ja selbst, was dabei herauskomme. Ich konnte sie verstehen. Zu wenig Freiheit für Arrangements jedoch, hielt ich ihr entgegen, ergebe ein starres System, in dem nur noch die alle einengende soziale Konvention regiert. Wie man sieht, hatte ich meine Lektion als menschenfreundlicher Hilfsbibliothekar gelernt.
Wir leben in einem Zeitalter, das sich viel darauf einbildet, eine professionelle Kompromissfähigkeit an den Tag zu legen. Unsere kapitalistische Demokratie mit ihren diversen Interessengruppen lebt von Deals und Zugeständnissen – oft, ohne dass sich an den bestehenden Verhältnissen wirklich etwas ändert. Darum ist es zum Schlachtruf der neuen Rechten und der vielen, dem »Establishment« feindlich gesinnten Populisten geworden, man wolle den »Sumpf trockenlegen« und die ewig lahmen Kompromisse »zerschlagen«.
Allerdings verbergen sich unter den müden Arrangements, die kein Vorwärtskommen bringen, in Wahrheit gar keine Kompromisse, sondern die Unfähigkeit dazu. Selten waren unsere Gesellschaften und ihre Akteure weniger kompromissfähig. Meiner starken Vermutung nach liegt das auch daran, dass wir weitgehend vergessen haben, was einen echten Kompromiss, einen Kompromiss, der von Herzen kommt und allen Konfliktpartnern dient, überhaupt ausmacht.
Der Kompromiss, von dem wir verächtlich sprechen, ist gar nicht der Kompromiss, den wir eigentlich brauchen, und auch nicht der, den wir tatsächlich suchen. Das Dilemma unserer in scheinbar unlösbare Konflikte verfahrenen Gegenwart besteht nicht darin, dass Kompromisse nicht funktionieren, sondern dass wir auch dann keine eingehen, wenn wir denken, dass wir es tun.
Statt den Kompromiss zu verachten, müssen wir ihn erst einmal entdecken. Und damit eine Seite von uns selbst, die wir im gängigen Verständnis des Menschen als »Homo oeconomicus«, als Gewinnmaximierer in einer erbarmungslosen Welt des Wettkampfes, oft nicht sehen. Eine Beschäftigung mit dem Kompromiss kann uns zu neuen Einsichten über die Natur unserer gemeinsamen Wirklichkeit verhelfen – und zu einer veränderten Erfahrung unserer selbst.
2 Lieber keinen Kuchen als einen halben
Ich habe mit meiner Frau eine Meinungsverschiedenheit. Es geht um die Frage, ob wir stolz darauf sein dürfen, wie weit es die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg geschafft haben, in einer Gesellschaft anzukommen, in der nicht nur Prinzipien geritten werden, sondern Menschen den Ausgleich suchen und Unterschiede tolerieren können. Inwieweit also wir Deutschen uns mit unserer Bereitschaft zu Kompromissen brüsten dürfen.
Meine Frau ist in Italien aufgewachsen. Sie kam während des Studiums nach Berlin. Sie beschloss zu bleiben, weil sie die Menschen hier als flexibler und weniger von vorgefassten Meinungen geprägt erlebt als ihre Landsleute jenseits der Alpen. Meine Frau findet, dass die Kompromissfähigkeit in Deutschland ausgeprägt ist. Und stößt damit bei mir auf Skepsis.
Schließlich – ich sagte es schon – liebe ich das südländische »leben und leben lassen«. Was ist mit den deutschen Hausnachbarn, die klingeln, damit ich die Fußmatte rechtwinklig zur Tür ausrichte? Was mit dem Satz: »Ordnung muss sein«? Mit dem mit Lineal gezogenen Doppelstrich, den die Mathelehrerin meiner Tochter aus Prinzip unter dem Rechenergebnis sehen wollte? Ich – und viele andere – ertragen so etwas mit leiser Scham. So richtig stolz auf die Erfolge dieser Kultur in der Kunst des Kompromisses vermag ich noch nicht zu sein.
Meine Frau kann das schwer fassen. Noch weniger, dass deutsche Freunde sofort dagegenhalten, wenn sie von ihrer neuen Heimat zu schwärmen beginnt. Warum so ein Schwarz-Weiß-Denken?, fragt sie. Warum von einem Extrem ins andere fallen und nicht das Gute und das Schlechte gleichermaßen sehen, in einem Mosaik, das beides enthält?
Nun, zwölf Jahre lang haben die Deutschen der Welt in die Ohren gebrüllt, was für eine überlegene Rasse sie seien. Seitdem machen sie sich klein, reden ihre Erfolge schlecht und finden, dass es keinen Grund zum Feiern gebe. Dafür fahren sie lieber außer Landes. Nach Italien etwa. In dieser Haltung bin auch ich ganz und gar kompromisslos. »Echt deutsch«, findet meine Frau.
In Deutschland ist der Kompromiss ein heikles Thema. Noch immer haben wir nicht unseren Frieden mit ihm geschlossen. Zugegeben, als Gesellschaft sind wir inzwischen erheblich kompromissbereiter als noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber die praktische Handhabung der »Intelligenza« fällt uns nach wie vor schwer, woran mich der Disput mit meiner Frau erinnert.
Gerade in Deutschland hatte Kompromissbereitschaft lange Zeit einen schlechten Ruf. Ein gesetztes Ziel nicht konsequent anzupeilen und umzusetzen, galt als Schwäche oder sogar Schande. Unsere Kultur war über weite Strecken ausgesprochen kompromissfeindlich, und möglicherweise lassen sich manche politischen Verhakungen von heute noch mit diesem Erbe erklären.
Aus der deutschen Kultur stammen jedenfalls einige der perfidesten Vertreter der Kompromisslosigkeit. Andererseits hat sie auch die vielleicht fantasievollste Werberin dafür hervorgebracht, dass ein aktives Suchen der Gemeinsamkeiten den Kern politischen Handelns ausmacht: die Philosophin Hannah Arendt. Das entgegengesetzte Extrem finden wir im Staatsrechtler Carl Schmitt, der in den 1930er-Jahren zum Stichwortgeber der Nationalsozialisten wurde, ehe sie ihn kaltstellten.
Für Schmitt bestand der Grundcharakter des Politischen in der Aufspaltung zwischen Freund und Feind. Politisches Handeln war für ihn alles, was das Aktionsfeld klar in »schwarz« und »weiß«, in »wir« und »die anderen« unterteilte. Je klarer die Frontstellung markiert wurde, desto eindeutiger würden die Konfliktpartner erkennen, was sie zu tun hatten, um ihr Anliegen durchzufechten. Schmitt fasste das Ziel politischen Handelns demgemäß so auf, dass es darum gehe, Polaritäten bewusst zu verschärfen und die jeweils andere Seite konsequent zu bekämpfen.
Diese Haltung hatte die kulturelle Praxis der Deutschen schon vor Schmitt geprägt. In den Augen des Politikwissenschaftlers und Militärhistorikers Andreas Herberg-Rothe konsolidierte sie sich im preußischen Soldatenstaat, wo sie von einem seiner maßgeblichen militärischen Strategen, dem General Carl von Clausewitz, zu einem Ethos der Kriegsführung systematisiert wurde. Für Clausewitz war der Krieg »die bloße Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln«.2 Das ist eine Sichtweise, der zufolge Unterschiede in den jeweiligen Interessen nicht anders als durch eine Konfrontation aufgelöst werden können. Rational handelt somit, wer alles dafür tut, den unvermeidlichen Kampf als Sieger zu beenden. Dass es noch eine andere Umgangsweise mit unterschiedlichen Bedürfnissen geben könnte, wird gar nicht erwogen.
»Es existieren grundsätzlich zwei Formen des politischen Handelns«, sagt Herberg-Rothe. »Eine der beiden ist das Gewalthandeln, dem es darum geht, sich durchzusetzen, immer auch mit Brutalität.«3 Das Gewalthandeln verachtet den Kompromiss als unpolitisch. Für diese Tradition stehen Clausewitz, Schmitt und natürlich auch der politische Dämon Adolf Hitler. Dessen Auffassung, wenn das deutsche Volk nicht die Weltherrschaft erringe, dann solle es ausgelöscht werden, bezeichnet die äußerste Konsequenz des Gewalthandelns. Ihre Kurzformel lautet: »Sieg oder Untergang«. Wie auch jene Behauptung, die uns im Populismus wieder begegnet: »Wer nicht für mich ist, ist gegen mich.«
Der zweite Pol politischen Tuns ist für Herberg-Rothe das »Zusammenhandeln«.4 Ursprünglich hat diesen Begriff die Philosophin Hannah Arendt geprägt. Im Zusammenhandeln liegt für Arendt der Horizont aller menschlichen Bemühungen.5 Demnach haben wir als Menschen ein grundsätzliches Bedürfnis, in Gemeinsamkeit zu agieren. Wir gewinnen diese Gemeinsamkeit, indem die Vielzahl der einzelnen Interessen bestehen bleibt – und nicht dadurch, dass wir diese gewaltsam homogenisieren oder aber deren Gegensätze verschärfen. Das Politische besteht für Arendt – und darin unterscheidet sie sich diametral von Schmitt – im aktiven Herausarbeiten dessen, was uns verbindet.
Sprachgeschichtlich entstammt das Wort »Kompromiss« einer solchen Haltung: Es bezeichnet ein Versprechen in Gegenseitigkeit, gebildet aus der lateinischen Vorsilbe cum, »miteinander«, und promissum, »Versprechen« (das wir auch im englischen Wort promise wiederfinden). Im alten Rom schlossen Streitparteien einen Kompromiss, indem sie einander versprachen, die je andere Position anzuerkennen.6 Dieses Versprechen war möglich, weil die Kontrahenten akzeptierten, dass zwar gegensätzliche Interessen zwischen ihnen standen, dass aber zugleich fundamentale Gemeinsamkeiten sie miteinander verbanden. Das Versprechen, das »cum-promissum«, beruhte letztlich auf der Anerkennung der gemeinsamen Menschlichkeit.
Vielleicht liegt die größte kulturelle Veränderung, die sich in Deutschland in den letzten siebzig Jahren vollzogen hat, im – zumindest angestrebten – Abschied vom Gewalthandeln und der damit verbundenen Kompromissfeindschaft. Wie sehr das gelungen ist, muss sich angesichts des Neuerstarkens von Anbietern radikaler Lösungen allerdings noch erweisen.