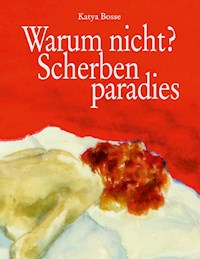
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Warum nicht - Scherbenparadies Ein Paradies voller Scherben oder trotz Scherben ein Paradies? Dieses Buch zeigt, dass man das Paradies auf Erden trotz Scherben sehen kann, jeder auf seine Weise. Für Katya war das Paradies ohne Hilfe nicht mehr sichtbar, denn Scherben gab es zu viele in ihrem Leben: missglückte Ehen, Gewalt, Depressionen, Krankheit. Aber die meisten Scherben versucht sie immer noch aus dem Weg zu räumen: den Kampf als Unfallopfer gegen den Versicherungsgiganten Allianz, gegen den ADAC-Verkehrsrechtsschutz, gegen untätige Anwälte und gegen (für?) das Recht - mittlerweile ein interessanter Job. Warum nicht?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Prolog
Sturm und Drang
Gewalt und Zärtlichkeit
Vernunft und Wahnsinn
Danksagung
Prolog
„Nix Kinder, Maschine...“ Mit diesen Worten hielt die tschechische Krankenschwester den Telefonhörer ungläubig in der Hand. Schnell nickte ich auffordernd, damit sie den Hörer nicht wieder auflegte.
Dann hielt sie ihn mir ans Ohr, und ich versuchte deutlich und nicht gequält zu klingen: „Hallo meine Süßen, hier ist Mami. Macht euch keine Sorgen, ich bin in Marienbad im Krankenhaus. Nichts Schlimmes, nur der Rücken ist kaputt. Hab euch lieb.“
Nichts Schlimmes - ich war bloß total im Eimer: Gehirnerschütterung, Arm, Hand und Schlüsselbein gebrochen, Blutungen im Bauch, Gesicht verbrannt und die Wirbelsäule zertrümmert. Oh Gott!
Ich war nur froh, dass ich meine Kinder endlich nach fünf Stunden informieren konnte. Sie machten sich doch Sorgen, wenn die Mami nicht nach Hause kommt. Um mit der „Maschine“ sprechen zu können, hatte ich sogar eine Zigarette in Kauf genommen, die ich gar nicht wollte, aber sonst wäre nie eine Kommunikation zustande gekommen. Die hatten mich doch links liegen gelassen, wahrscheinlich weil sie meiner und ich ihrer Sprache nicht mächtig waren.
Stundenlang lag ich nackt und vollgekotzt im stickigen, dunklen Zimmer. Selbst meiner Bettnachbarin, einer älteren Dame, war ich im Weg. Sie beschimpfte mich, weil ich eine Deutsche bin.
Was sollte ich nur machen? Ich war ausgeliefert und hilflos. Die Ärzte hatten mir zuerst gar nicht geglaubt, als ich ihnen sagte, dass mein Rücken gebrochen wäre. Ich musste zur Untersuchung gehen! Erst nach dem ich Röntgen hatten sie das Malheur festgestellt. Da hieß es plötzlich: strengste Bettruhe, nicht bewegen.
Zum Glück hatte ich meiner inneren Stimme vertraut: „Mach dich steif!“ Wer weiß...
Als die Schwestern mein Krankenbett nach dem ersehnten Telefonat mit der Maschine zurück ins Zimmer geschoben hatten, war ich beruhigter, im Halbschlaf harrte ich dessen, was noch kommen wird.
Sturm und Drang
Schon die erste Frage: „Ist unter euch jemand Raucher?“, forderte mich heraus, meine neu gewonnene Freiheit zu verteidigen.
Auf dem Internatshof schauten sich alle zukünftigen Studentinnen zögernd um.
„Ich hatte eine deutliche Frage gestellt“, erinnerte uns die pummelige, ältliche Rektorin und schaute uns eindringlich durch ihre Hornbrille an.
Aha, Aussortierung! Allein die Wortwahl: „jemand“! Also hoffentlich niemand oder wie?!
„Ich“, hob ich mich trotzig von den anderen hervor. Alle beäugten mich skeptisch. So ganz wohl fühlte ich mich in diesem Moment nicht. Kurz darauf ertönten noch weitere zaghafte „Ich's“. Mutig schaute ich der Rektorin provokativ in die Augen (Na, was willst du von mir?)
Frau Schraube, unsere Wohnheimleiterin erklärte uns Rauchern, dass auf den Zimmern und im übrigen Internat sowie in der Akademie striktes Rauchverbot herrsche. Doch gäbe es auf jeder Etage des Wohnheims Raucherzimmer, die wir doch bitte benutzen sollten - na, wenn es weiter nichts ist!
Um unser Outing zu demonstrieren, sammelten sich die Raucher für eine schnelle Zigarette, während die anderen zur Eröffnungsveranstaltung trudelten. Während dieser Raucherpause lernte ich gleich meine neuen Interessenvertreter kennen, die später auch meine dicken Freundinnen wurden: Karo, Daggi und Heini (vom Nachnamen Heinrich abgeleitet). Gemeinsame Neigungen schweißen zusammen.
Die Stimmung lockerte im „Raucherclub“ auf, und wir wurden vertrauter. Karo hatte wie ich ein „wohlerzogenes“ Leben genossen. Sie galt zu Hause als die Brave.
Durch unsere annähernden Gespräche stellte ich fest, dass Daggi und Heini, die sehr selbstsicher waren, schon viel mehr Erfahrungen hatten in Hinsicht auf Weggehen und Alkohol. Gut, so fand ich gleich meine Begleiter in die neue Freiheit. Von ihnen erhoffte ich mir Unterstützung bei meinen neuen Unternehmungen. Nun konnte ich endlich ausgehen, trinken, rauchen und „Männerbekanntschaften“ schließen, ohne die ständige Kontrolle und den einengenden Vorschriften meines Vaters! Zufrieden darüber, die erste eigene, große Entscheidung Vati gegenüber durchgesetzt zu haben, fieberte ich meinem neuen Lebensabschnitt entgegen.
Ohne Vatis Kontrollen und Vorschriften konnte ich nun eigenverantwortlich studieren, im Internat wohnen und LEBEN!
Ich fühlte mich ein bisschen erwachsener und freier, aber auch etwas unsicher.
Vati brauchte ich nicht – das wollte ich mit aller Macht beweisen.
In neugieriger Gespanntheit wollte ich die Eigenverantwortung wagen – warum nicht?
Kichernd setzten wir uns nach unserer „Gesprächsrunde“ in den Vorlesungsraum zu den anderen Kommilitoninnen.
Mann, waren das viele - das wurde mir erst jetzt richtig bewusst. Wir wurden in vier Seminargruppen eingeteilt mit jeweils fünfundzwanzig Mädchen. Ich kam in die SG eins, die Chorgruppe. Zum Glück teilten mit mir auch meine neuen Freundinnen das Vergnügen, in dieser Seminargruppe zu sein. Da konnte es ja nicht so schwer fallen.
Die Regeln der Fachakademie und des Internats, die verschiedenen Fachbereiche und die Dozenten wurden uns vorgestellt. Der Einfachheit wegen betitelten wir die Akademie als Schule und die Dozenten als Lehrer, sollte doch unser Studium in Schulform verlaufen: Anwesenheitspflicht und Unterrichtseinheiten.
Zum besseren Kennenlernen sollten wir drei Wochen im Internat bleiben, ohne an den ersten Wochenenden nach Hause zu fahren. So lange war ich noch nie von zu Hause weg. Nach der Eröffnungsveranstaltung wurden wir im Wohnheim in die verschiedenen, geschmackvoll möblierten Zimmer, jeweils eine ganze Seminargruppe auf einer Etage, und zimmerweise für den Wochenputzplan (Toiletten, Duschen, Waschraum, Fernsehraum und Küche) eingeteilt.
Ich musste mein neues Heim mit der Tochter vom Kreisschulrat, Katrin, teilen. Mit ihr sollte ich auch eine Praxisgruppe bilden.
Um alles zu verdauen, steckte ich mein altes Radio, das ich von Vati mitbekommen hatte, an, drehte es auf, suchte einen passenden Sender und legte mich in mein Bett. Auf UKW war der beste Empfang, aber auf Kurzwelle die beste Musik: Radio Luxemburg. Begierig sog ich schon als Kind die westlichen Klänge auf und hoffte zudem, Kontakte von Außerirdischen zu hören. Überall auf dem Kanal waren Morsezeichen zu hören, die leider auch den Empfang beeinträchtigten. Damals lernte ich auch das Morsealphabet, doch ich war zu langsam, um irgendetwas zu verstehen. Also nutzte dieser alte Kasten nur für die Musik – Bayern drei und Radio Luxemburg, dafür war er ja da.
Ich hatte mich für unten im Doppelstockbett entschieden. Ermattet kuschelte ich mich an meinen Stoffhund Schnuffi und streichelte Muttis Bettpüppchen mit dem riesigen, grünen Schaumstoffrock. Wie beim Abschied von meinen Eltern liefen mir erneut die Tränen herunter. Es war doch nicht so einfach, ohne Mutti zu sein. Sie fehlte mir schon jetzt . Werden sie und meine Schwester Kirsten mit Vati zurechtkommen? Schaffe ich die ersten drei Wochen? Erstaunlicher Weise vermisste ich auch die angenehme Baritonstimme meines Vaters, die verschiedene Lieder wie: „Wenn ich einmal reich wär'“ oder „Im tiefen Keller...“ zum Besten gegeben hatte.
Nachdem ich mich ausgeheult hatte, ordnete ich meine Kleidung in den Schrank und schaltete das alte Radio aus.
Nun schwieg es, und ich zog mit Katrin los, um die auf einer Liste stehenden Fachbücher und die Essensmarken für das Frühstück und das Mittagessen zu besorgen. Das Frühstück kostete fünfzig Pfennig und das Mittagessen fünfundsiebzig Pfennig, in dessen Genuss wir gleich anschließend kamen. Schmackhaft und ausreichend; wir durften sogar nachholen und Kompott als Dreingabe. Unterkunft und Essen waren also fast geschenkt. Abzüglich der Essensmarken und der monatlichen fünf Mark Internatsunterkunftskosten hatte ich einhundertdreißig Mark Stipendium im Monat übrig! So viel Geld hatte ich noch nie.
Davon mussten nur noch die ermäßigten Fahrtkosten, zirka zwanzig Mark, das Abendbrot und natürlich die Zigaretten bestritten werden. Letzteres war der teuerste Part von allem bei einem Preis von drei Mark und zwanzig Pfennig für eine Schachtel! Aber noch rauchte ich nicht viel. Das wäre doch zu schaffen!
Während unserer Einführungszeit wurden gleichzeitig die Lehrer aus dem ganzen Bezirk fortgebildet. Als Katrin und ich über das Schulgelände liefen, stand gerade ein Trüppchen Lehrer beieinander.
Ich musste zweimal hinschauen: Das war doch... mein Teenieschwarm! Mein Russischlehrer aus der fünften Klasse! Ich konnte es nicht fassen - in ihn hatte ich mich damals verliebt?! Ich war mittlerweile einen Kopf größer als er, und meine Körpergröße hatte nicht gerade Modellmaße! Außerdem verrieten seine ergrauten Haare ansatzweise sein Alter. Blitzartig errötete ich, als ich merkte, dass er mich entdeckte. Wir unterhielten uns kurz und wünschten uns gegenseitig alles Gute. Seine ausgestrahlte Wärme hielt mich etwas in den Erinnerungen fest, ja – bei ihm hatte ich mich aufgehoben gefühlt. Er war nett gewesen und hatte meine schulischen Leistungen anerkannt, an mich geglaubt. Allerdings war das „lange“ her, vor fünf Jahren. So vergeht eben die Zeit.
Die drei Kennenlernwochen gingen relativ rasch vorüber. Mit Katrin funktionierte es gut, Daggi, Heini und Karo sehnten mit mir den ersten Ausgang herbei - der Genuss der Unabhängigkeit von Vati.
Den ersten „Beweis“ der Freiheit lieferte ich mir, indem ich mir Ohrlöcher gestochen hatte, denn Vati hatte mir Ohrringe verboten. Ich seifte eine dünne Nähnadel ein, drückte einen Korken hinter das Ohrläppchen und stach zitternd durch. Allerdings passten die Kreolen nicht durch die hauchdünnen Löcher, sodass ich mit einer stärkeren Nadel nachstechen musste. Es tat ein bisschen weh, denn ich hatte viel zu langsam gestochen. Ich stellte mich ziemlich blöd an (war ja auch das erste Mal), jedenfalls bekam ich die Stopfnadel nicht mehr aus dem Ohr. Um Hilfe jammernd rannte ich durchs Internat. Die Mädchen kreischten bei meinem Anblick - mir zu helfen, traute sich keiner. Nur Karo fasste sich ein Herz. Ich hatte letztendlich die schönsten Ohrringe der Welt! Meine Ohrläppchen entzündeten sich nicht einmal. Ich war der geborene Ohrlochstecher!
Auch als Studentin stellte ich mich nicht schlecht an. Während der Vorlesungen stellte ich fest, dass mir die ganze „Geschichte“ Spaß machte, ich begriff schnell und die angebotenen Themen (Pädagogik, Psychologie, Marxismus/Leninismus, Praxisvorbereitung etc.) interessierten mich.
So lief es wieder einmal unbeschwert für mich, ich lernte im Schlaf und erzielte die besten Noten. Der Unterricht ging täglich von acht bis zirka sechzehn Uhr, einschließlich Gitarrenunterricht, Chor und natürlich die einstündige Mittagspause, die uns genügend Zeit gab, um anständig und gut zu essen und bei ein bis zwei Zigaretten zu entspannen. Samstags war schon gegen elf Uhr Schluss, dann konnte es nach Hause gehen! Mit dem Studentenausweis bekamen wir Ermäßigung für die Bus- und Zugfahrscheine. Außerdem erhielten wir in Museen, Ausstellungen und verschiedenen Veranstaltungen ermäßigten Eintritt. Nur war bei mir das Geld immer irgendwie knapp, sodass ich mich den Trampern anschloss. Erstens sparte ich somit Geld und zweitens war ich schneller zu Hause. Denn auf den Bus zum Bahnhof musste man schon eine Weile warten.
Das Trampen war überhaupt kein Problem, wir mussten nie lange an der Straße stehen, und ich lernte viele nette Menschen kennen. Vati durfte davon jedoch nichts wissen, denn er war der Meinung, es wäre viel zu gefährlich. Dass er Recht behalten sollte, erfuhr ich erst auf späteren Tramptouren.
Die öffentlichen Verkehrsmittel benutzte ich auf der Rückfahrt von zu Hause bis ins Internat. Manchmal fuhr mich auch Mutti mit unserem Trabbi zurück in die Fachakademie. Bei dieser Gelegenheit konnte ich weitere persönliche Dinge wie meinen in Ehren gehaltenen, von meinen Eltern zum Geburtstag geschenkten Plastik- Plattenspieler, meine Langspielplattensammlung und Bücher mitnehmen. Meine Kleidung hatte ich schon größtenteils im Internat. Diese durfte ich sowieso nicht zum Waschen nach Hause bringen. Ich wäre erwachsen genug, meinte Vati.
Im Internat war ein Waschraum mit Waschmaschinen, die wir gratis benutzen durften.
So viel Wäsche ließ ich jedoch nicht zusammenkommen, ich wusch meine Sachen mit der Hand im Waschbecken, so wie es Vati mir gelernt hatte. Demnach war mein Reisegepäck nach Hause ziemlich gering.
Nachmittags half ich meinen Mitstudentinnen beim Verarbeiten des Erlernten, darin war ich ja schon geübt, und wir spielten gemeinsam Gitarre, besonders gerne „House of rising sun“, „Sag mir wo die Blumen sind“, „Lola“, „Lady in black“ und viele selbstgeschriebene Liebeslieder, sogar zweistimmig. Karo und ich harmonierten stimmlich super miteinander, sodass wir oft zweistimmig sangen und die anderen uns lauschten. An den freien Nachmittagen besorgten wir auch Nahrungsmittel, etwas zum Naschen, natürlich Zigaretten, erweiterten unsere Plattensammlungen und kauften verschiedene Bücher sowie Fachliteratur.
Im Ort gab es den besten Joghurt, der jemals meinen Gaumen berührte. Er wurde in der ansässigen Molkerei produziert. Um ihn zu besorgen, stiefelten Karo und ich los. Da ich ohne Brille, die ich nur im Unterricht oder im Dunkeln aufsetzte, nicht viel sehen konnte, war ich froh, Karo dabei zu haben, denn so grüßte ich wenigsten nicht die falschen Leute. An der Kinoecke sah ich ihn: groß, muskulös, lockige schwarze Haare, süße Augen und ein bezauberndes Lächeln. Mein Herz schlug Kapriolen.
Nun ging ich jeden Tag am Kino vorbei und jeden Mittwoch in die Diskothek, nur um ihn zu treffen. Einmal stand er wieder am Kino, er wartete auf den Bus. Zitternd fragte ich ihn, wie er heiße und ob ich ihn zum Tanz wieder treffen könnte. Maxi willigte ein. Ich war glücklich!
Während der Disko quatschten und tanzten Maxi und ich oft miteinander. Mir sackten vor Aufregung fast die Beine zusammen. Ich erfuhr in unseren Gesprächen, dass er acht Jahre älter als ich war. Ich hatte ihn viel jünger eingeschätzt!
Meine Enttäuschung war groß, als er mir eröffnete, dass er verlobt war, noch dazu mit einer Studentin aus dem 3. Studienjahr! Trotzdem buhlte ich, was das Zeug hielt. Das lockte leider auch andere Männer an, von denen ich überhaupt nichts wissen wollte, zumindest nicht sexuell. Ich war der Meinung, sie akzeptierten dies und empfand sie als Kumpels.
Karo verliebte sich in Zicke. Um ihn zu treffen, wurde sie meine ständige Begleiterin. Auch wenn wir gar zu ausgelaugt vom Tag waren, zur Disko ging es immer noch. Zicke versuchte sein Glück bei mir, erfolglos. Erstens war er gar nicht mein Typ und zweitens überhaupt – mit meiner Freundin zusammen. Wütend pöbelte er mich an. Ich würde doch sonst auch mit jedem ins Bett steigen. Oops, wie kommt er auf so etwas? Ich beschwerte mich bei meinen Freundinnen, war ratlos, enttäuscht, gekränkt. Sie brachten mich zur Überzeugung, dass die Männer so etwas nur behaupteten, um anzugeben und um ihr Ego zu stärken. Solche unreifen Naivlinge konnten einem durch ihr unüberlegtes Prahlen ganz schön den Ruf vermiesen!
Nur konnte oder vielmehr wollte ich den Mädels nicht gestehen, dass ich noch nie Geschlechtsverkehr hatte. Ich gab mehr oder weniger mit meiner „Sex-Erfahrung“ an, bloß um eine von ihnen zu sein. Dies zeugte von keiner größeren Reife als von den Herren, die mit dem angeblichen Sex mit mir prahlten.
Ein Zurück meinerseits gab es nicht, ich hätte mich geschämt, zumal mein ausgestopfter Busen ja auch nur Vortäuschung falscher Tatsachen war! Mit diesen Lügen musste ich wohl leben.
Ein- bis zweimal abends in der Woche testeten Daggi, Heini, Karo und ich die ansässigen Kneipen. Netter Weise wurden wir von den Wirtshausbesuchern sehr oft eingeladen, sodass uns die Kneipengänge fast nichts kosteten.
Jedoch für mich war es peinlich: ich vertrug nicht viel Alkohol. Nach dem zweiten Bier „lag ich schon unter dem Tisch“. Da hieß es für mich: üben, üben, üben! Allerdings brachte mir dieses Üben auch bald, hinter vorgehaltener Hand, einen Spitznamen ein.
Nach dem zweiten Bier einer „Übung“ musste ich auf die Toilette. Auf dem Rückweg zum Biertisch fühlte ich in der Tasche meiner geliebten, selbst gekauften, roten Jacke einen Faden. Ich wickelte ihn um den Zeigefinger, um ihn abzureißen. In meinem Rausch merkte ich gar nicht, wie locker dieser Faden war. Am vollbesetzten Tisch angelangt zog ich mit einem Ruck den Faden heraus. Bis ich mit meinem verlangsamten Reaktionsvermögen registrierte, dass an dem Faden etwas baumelte (zum Glück nicht benutzt), hatte ich schon die Aufmerksamkeit der ganzen Kneipe auf mich gezogen. So kam ich zu dem Spitznamen „Tampon“ (sonst nannte man mich einfach nur Kathy). Meine Freundinnen kicherten, hakten mich unter und beförderten mich schnellstens ins Internat. Selbst im Rausch merkte ich an meinem heißen Gesicht, wie peinlich die Situation für mich war, leider zu spät. Mit dem neuen Spitznamen musste ich fortan leben.
Die Zeit, die ich zum Buhlen um Maxi und zur Alkoholgewöhnung hatte, musste clever durchdacht sein.. Im ersten und zweiten Semester bekamen wir laut Wohnheimordnung nur bis einundzwanzig Uhr Ausgang, einmal in der Woche konnte verlängerter Ausgang bis einundzwanzig Uhr fünfundvierzig (komische Festlegung) genehmigt werden. Die Einhaltung der Regeln wurde von drei Pförtnern abwechselnd kontrolliert. Das Wohnheim war ab einundzwanzig Uhr verschlossen. Ab dem 18. Lebensjahr wurde der verlängerte Ausgang bis zweiundzwanzig Uhr fünfundvierzig für zweimal in der Woche erweitert und zweimal wöchentlich konnte vom Gruppenrat und der Seminargruppenleiterin Nachturlaub genehmigt werden. So viel zur neuen Freiheit!
Wir waren aber nicht auf den Kopf gefallen. Wie in jeder Etage befanden sich auch im Erdgeschoss des Internats Gemeinschaftstoiletten. Die hinterste schlossen wir ab und stiegen aus dem Fenster ins Freie. Das erwies sich als sehr einfach, denn vor dem Fenster befand sich nur weicher Rasen, in dem wir keine verdächtigen Spuren hinterlassen konnten. Nachdem wir das Fenster von außen wieder fest angelehnt hatten, blieb uns der Rückweg offen. Eine Zeit lang ging dies gut, aber man ist uns auf die Schliche gekommen, nur wusste die Wohnheimleiterin, Frau Schraube, nicht, wer die Flüchtenden waren, denn sie lauerte uns nicht auf, sondern öffnete die dauernd verschlossene Toilettentür und verriegelte das Fenster, für immer!
Wir schauten nicht schlecht, als der Rückweg ins Wohnheim versperrt war. Wenn wir erwischt worden wären, dann hätte es für einen Monat Ausgangssperre gegeben! In unserer Verzweiflung klopften wir an ein Fenster, aus welchem Licht schimmerte. Kerstin aus dem zweiten Studienjahr ließ uns ein, ihre Zimmerkollegin schlief. Flüsternd bot Kerstin uns sogar an, ihr Fenster weiterhin zu benutzen. Darüber waren wir natürlich sehr erfreut, wir bedankten uns und schlichen auf unsere Zimmer. Meine Mitbewohnerin Katrin murrte und schimpfte über meine Lebenseinstellung. Es war mir jedoch relativ egal, Hauptsache, sie verpetzte mich nicht! Ich beschwichtigte sie - dafür würde ich morgens zum Bäcker gehen. Ich ging zum Bäcker, Katrin hielt dicht.
Wenn wir Kerstin Bescheid gaben, lehnte sie das Fenster abends nur an. Leider benutzten wir dieses Fenster so oft, dass sich ihre Mitbewohnerin beschwerte und uns den Einstieg untersagte, sonst würde sie sich an die Wohnheimleitung wenden.
Karo, gerissen wie sie durch uns schon war, hatte eine neue Idee: Sie machte sich an einen Pförtner heran, umschmeichelte ihn, bis sie den Wohnheimschlüssel erhielt.
Im Schlüsselbesitz durften wir nicht vor Mitternacht ins Internat zurück, denn so lange war die Nachtwache besetzt. Das war für uns natürlich kein Problem. Aber dieses Vergnügen wurde uns von dem Pförtner nur einmal in der Woche zugestanden. Naja, übertreiben müssen wir ja nicht. Und Katrins Schweigen wurde auch nicht überstrapaziert.
Damit konnten wir leben.
In Katrins und meinem Zimmer wurde es immer wohnlicher, wir räumten die Möbel um und richteten uns eine Essecke ein. Wir kamen ganz gut miteinander aus. So wagte sie es auch, mich auf meinen Busen anzusprechen. (Es war ja auch zu auffällig. Ich zeigte mich niemals „oben ohne“, duschte nicht mit den anderen und wusch mich ständig, ohne mein wattiertes Bustier abzulegen.) Katrin erzählte mir eine Geschichte von einem Mädchen, das sich den Busen ausstopfte.
„Man kann ja nichts dafür, wenn die Natur es so entwickelt hat. Nur Unreife machen sich darüber lustig“, teilte sie mir ihre Meinung mit. Alle anderen Freundinnen von diesem Mädchen würden genauso denken.
Jedenfalls hätte sich das Mädchen die Pille besorgt, davon würde nämlich der Busen wachsen.
Selbstverständlich meinte sie mit dem Mädchen mich! Aber was war das mit der Pille? Einen größeren Busen?! Das ließ ich mir nicht zweimal erzählen! Immerhin war das besser, als Lorbeerblätter zu essen und sich den Busen mit Eiweiß einzureiben, wie man es mir in der Schulzeit weismachte.
Sofort besorgte ich mir einen Termin beim Frauenarzt. Ihm erzählte ich, ich würde zu meinem Freund fahren, denn die Pille gab es zwar kostenlos aber nicht einfach nur so. Ich würde ihn lieben und glaubte, es wäre soweit... Nach dieser, ihn überzeugenden Geschichte verschrieb er mir meine heißersehnte, hormonelle Unterstützung. Zusätzlich bekam ich noch eine Salbe, die das Wachstum der Brust beschleunigen würde.
Ich glaubte fest daran und war zufrieden. Außerdem begann ich, mich langsam Katrin gegenüber „oben ohne“ zu zeigen und mit Karo ging ich auf eine kleine Insel im Flüsschen, FKK-Sonnenbaden.
Dazu mussten wir einen Steilhang nach unten klettern und durch das Flüsschen über Steine balancieren. Wir fanden eine gut geschützte Stelle und waren ab dem Frühjahr Dauergast. Sogar die Chorprobe und den Instrumentalunterricht schwänzten wir mit der Ausrede, einen Zahnarzttermin zu haben, nur um Sonne zu tanken. Im Instrumentalunterricht verpasste ich sowieso nichts. Mit meinen Gitarrenvorkenntnissen aus der Musikschule war ich eh' unterfordert und die Lehrerin überlegte schon, ob ich nicht den Fortgeschrittenen-Kurs belegen sollte. Und Chorleiter Herr Helbig war bestimmt froh, ab und zu von mir Pause zu haben. Mit meiner Schwatzsucht und witzigen Bemerkungen störte ich doch die anstrengende Einübung verschiedener Gesangparts. So studierte er mit uns mehrstimmige Volks- und FDJ-Lieder (sogenannte Kampflieder) ein und sogar einen Kanon: „Dona nobis pacem“. Diesen Kanon hatte ich gefressen, wahrscheinlich auch durch meine Abneigung gegenüber der Kirche. Ständig sang ich absichtlich laut und quer, bis Herr Helbig mich freiwillig von einigen Chorproben befreite.
Nach eben solch einem „ausgiebigen“ Arzttermin lästerten Daggi und Heini: „Dass man beim Zahnarzt so braun wird...!“
Die ersten zwei Semester vergingen wie im Flug, manches Wochenende waren wir mit dem Chor unterwegs, nahmen an Wettbewerben teil, unterhielten uns, lachten und gingen gemeinsam aus. Es fand niemand mehr schlimm, dass wir nicht nach Hause fahren konnten.
Ein erstes Praktikum in einem Kindergarten zeigte mir noch meine Unsicherheit im Umgang mit kleinen Kindern. Unbeholfen suchte ich Kontakt mit den Kindern und bewunderte die Erzieherin, die den ganzen Ablauf ohne sichtbare Mühe meisterte.
Wir erhielten eine Ausbildung in Sprecherziehung (Hochdeutsch-Sprechen) und in der Technik mit audiovisuellen Unterrichtsmitteln. Das heißt: Wir lernten, Kassettenrekorder, Diaprojektoren, Tonbänder usw. bedienen und reparieren. Im Fach Deutsch behandelten wir verschiedene Kinderliteratur, spielten auch mal ein Märchen nach und lernten Sprach- und Sprechprobleme sowie Lösungsmöglichkeiten kennen.
Während verschiedener Unterrichtseinheiten vertieften wir die Methoden und Bildungsziele für Kindergartenkinder im Umgang mit der Natur, mit Mengen, im gesellschaftlichen Leben (soziale Umwelt), für das künstlerische und musische Gestalten und für die sportliche Betätigung - um nur Einiges zu nennen, ich fand das alles wahnsinnig spannend. Des Weiteren lernte ich Interessantes über die Anatomie und Physiologie der Kinder in diesem Alter, einschließlich der Kinderkrankheiten. Die Dozentin von diesem Fachbereich bewunderte oft meine „makellose Haut“ – deshalb mochte ich sie wohl auch.
Muttis Briefe verkürzten mir die Zeit des Studiums, ab und zu telefonierten wir – Mutti von ihrer Arbeit aus, ich aus der Pförtnerloge. Ein Hauch Liebe und Geborgenheit. Leider benutzte Vati nun meine Schwester Kirsten als Blitzableiter. Vielleicht merkten Mutti und Kirsten jetzt, was ich alles erdulden musste. Kirsten und Mutti taten mir schrecklich leid! Abwechslung verschafften mir auch die regelmäßigen Briefe vom Polen Reinhold, der sowjetischen Nadja, Mustafa aus dem Jemen, meiner Kinderliebe Karsten, meiner Reisebekanntschaft Churel aus der Mongolei und diverser Soldaten, die ich über ein Jugendmagazin kennenlernte, wo sie Briefkontakte - und vielleicht mehr – suchten.
Der Goldschmiedemeister Walter aus Frankfurt am Main, den ich damals bei Mutti in der Gaststätte kennenlernte, brauchte nunmehr seine Pakete nicht mehr zu meiner ehemaligen Klassenkameradin Angelika schicken. Was ich im Internat erhielt, entzog sich ja Vatis Kontrolle. Die Pakete überraschten mich jedes Mal aufs Neue. Sie versorgten mich mit vielen liebevoll eingepackten Geschenken: Dunhill-Zigaretten, Goldschmuck, den ich aus Geldmangel leider versetzen musste, Konserven wie Dorschleberstückchen und Krabben - ich wusste nicht einmal, was das ist, geschweige denn, wie es zubereitet wurde, Hauptsache aus dem Westen - Kaffee, Kakao, Süßigkeiten, Seifen, Deodorants und Parfüm. Dabei traf er eine sehr gute Wahl, denn wenn ich das Parfüm „Tramp“ benutzte, zog ich alles an, Jungen wie Mädchen. Alle schwärmten vom betörenden Duft.
Auch die anderen Sachen konnte ich gut gebrauchen, wurde doch so mein Geldbeutel geschont. Nur mit dem Kochen haperte es noch, außer Spiegel- und Rührei hatte ich in der Internatsküche noch nichts ausprobiert. Die anderen Mädchen stellten sich nicht viel besser an. Das kommt davon, wenn man als Kind immer alles fertig vor die Nase gesetzt bekommt!
Lange Zeit hatte ich gebraucht, um den zweiten Teil meiner Geschichte zu schreiben. Zu viel Erniedrigung, zu viel Enttäuschung, zu viel Selbsttäuschung hatte ich in meiner geistigen Abstellkammer verschlossen. Ich hatte sogar vergessen oder verdrängt, dass es diese Kammer gibt, hatte den Schlüssel verlegt. Eine zweite Depression zeigte mir, dass ich die neuen Probleme nur verarbeiten kann, wenn ich diese Kammer öffne, hineinschaue und sie herauslasse. Es ist schwierig, aber machbar. Machbar mit vielen Anläufen und Rückschritten. Jede zusätzliche Ernüchterung kratzt an der Hoffnung, doch ich bin ein Kämpfertyp – manchmal, aber konsequent. Habe ich eine Sache begonnen, möchte ich sie auch durchziehen. Ich habe also die Tür aufgeschlossen, und ich glaube, der Anfang war nicht einmal schlecht.
Es nahte der dreißigste Jahrestag der DDR. Deshalb fand im Juni 1979 das Nationale Jugendfestival in Berlin statt. Da Karo, Daggi, Heini und ich zu den Besten des Jahrgangs gehörten, wurden wir mit einigen anderen Mädchen aus den höheren Seminargruppen zu dieser Veranstaltung delegiert. Sämtliche Kosten wurden von der Freien Deutschen Jugend übernommen, es wurden sogar Sonderzüge eingesetzt.
In diesem Monat war es sehr heiß, gepaart mit unserem Reisefieber fast unerträglich. Die bevorstehenden Zwischenprüfungen waren vergessen. Für das erste Studienjahr wurden wir ja nur mündlich in Pädagogik und Marxismus/Leninismus, das heißt im dialektischem und historischem Materialismus, geprüft. Heute weiß ich nicht 'mal mehr etwas mit diesen Worten anzufangen! Kursabschlüsse für Sprecherziehung und Technik der Arbeit mit audiovisuellen Unterrichtsmitteln hatten wir ja schon im Laufe des zweiten Semesters bekommen. Dem Jugendtreffen konnte nichts im Wege stehen.
Leicht bekleidet (Pulli und zerrissene, ausgewaschene Jeans) standen wir auf dem Bahnhof mitten unter Massen von Jugendlichen und erhielten unsere einheitlichen Schultertücher für das Festival von den FDJ-Beauftragten. Sie sollten uns als Freifahrkarte für sämtliche Verkehrsmittel in Berlin dienen. Toll, so privilegiert war ich noch nie! Die sommerliche Hitze, die unzähligen Teilnehmer und die ansteckende gute Laune brachten die Luft am Bahnsteig zum Kochen, als ein Sonderzug der Deutschen Reichsbahn einfuhr. In jeder Kreisstadt wurde ein solcher eingesetzt. Alles war gut durchorganisiert, jeder bekam einen Sitzplatz. Sorgfältig verstaute ich mein Gepäck, richtete mein Amulett (ein Dschingiskhan aus Kupfer von meinem mongolischen Brieffreund) und fiel zufrieden auf meinen Sitzplatz.
Nach einer kurzweiligen Fahrt, auf der wir viel Gitarre gespielt, gesungen und gelacht haben, kamen wir am Berliner Ostbahnhof an. Dort wurde uns das Programm der Veranstaltungen ausgeteilt. Alles war freiwillig, nur an Demonstrationen und Kundgebungen mussten wir mit unserer FDJ-Gruppe teilnehmen. Der Treffpunkt war die Turnhalle, welche uns als Unterkunft diente. Karo und ich waren unter den Wenigen, die privat untergebracht wurden. Wir wohnten in einem Einfamilienhaus in einem Randbezirk und bekamen von unseren freundlichen Gasteltern gleich den Haustürschlüssel und Verpflegung für die erste Kundgebung.
In Massen zogen wir in FDJ-Kleidung durch das prächtig geschmückte Berlin, am Staatsratsgebäude und am roten Rathaus vorbei, sangen begeistert sozialistische Jugend- und Kampflieder und schwangen unsere großen Halstücher. Überall winkten uns die Menschen zu, die Stimmung war phantastisch! Wir schwitzten unter dem strahlend blauen Himmel und liefen uns fast die Füße wund. Erleichterung und Abkühlung verschafften uns die netten Berliner. Sie schütteten eimerweise Wasser über uns Demonstranten, sogar Feuerwehren erfrischten uns mit ihren Wasserspritzen. All dies brachte unsere Stimmung immer wieder auf Hochtouren. Geduldig und enthusiastisch hörten wir uns die Reden der DDR-Staatsoberhäupter an und jubelten ihnen zu.
Nach dieser riesigen Eröffnungsfeier hatten wir Freizeit, in welcher wir von Zelt zu Zelt tingelten, uns die verschiedenen Bands anhörten und wie die Verrückten tanzten. Dabei warf ich meine Keilabsatzschlappen in den Staub und tanzte barfuß. Alle lachten und viele taten es mir gleich. Es war nicht einfach, die Schuhe wiederzufinden! Am nächsten Tag hatte ich vor, meine Römersandaletten anzuziehen, die waren bequemer. Zwischendurch konnten wir uns mit Gutscheinen Essen und Getränke in verschiedenen Gaststätten und Cafés sowie an Kiosken besorgen und uns stärken. Nur Alkohol musste selbst bezahlt werden.
Ich wartete vor einem Café auf Karo, während sie uns ungarische Langos besorgte. Zwei Jungen nutzten die Gelegenheit, um sich von mir ein Autogramm auf ihrem Festivaltuch geben zu lassen. Plötzlich kamen noch vier Mädchen dazu und die Schlange, die nun vor mir stand, wurde immer länger. Ich fühlte mich wie eine Prominente, vielleicht glaubten die anderen es auch. Jedenfalls genoss ich diesen Augenblick und grinste Karo an, als sie mit zwei vollen Händen ungläubig vor dem Café stand. Nachdem ich die Autogrammjäger befriedigt hatte (es dauerte fast eine halbe Stunde) stopften wir uns mit den Langos zu und gingen selbst auf Autogrammjagd.
In Berlin waren auch viele fremdländische Jugendliche, mit denen wir uns in englisch, russisch, deutsch und mit Händen und Füßen verständigten. So verabredeten wir uns mit zwei Algeriern am Abend auf der Wiese vor dem Palast der Republik.
Karo und ich stärkten uns für unser Date mit einem Bier - ich vertrug immer noch nicht viel mehr - und warteten auf dem Rasen sitzend auf unsere Errungenschaften.
Gemeinsam mit den zwei exotischen Männern lauschten wir der Musik, knabberten Salzstangen und tranken noch ein Bier. Bei Anbruch der Dunkelheit war ich schon enthemmter und ließ mich auf die Zärtlichkeiten meines geheimnisvollen Partners ein. Ich hatte noch nie Zärtlichkeiten mit einem Ausländer ausgetauscht, schon gar nicht mit einem aus der „westlichen“ Welt. Neugierig machten sich meine Hände auf die Entdeckungsreise. Doch unter der Gürtellinie angelangt, hielten mich seine Hände einfach fest. Enttäuscht versuchte ich es wieder, ganz behutsam, ohne Erfolg, aber er hatte bei mir damit kein Problem. Das war mir einfach zu blöd, ich wollte gehen. Karo erging es ebenso. Wir verstanden nicht, warum unsere Hände unangenehm für sie sein sollten. Etwas beleidigt verabschiedeten wir uns, Achmed gab mir noch seine Adresse. Er war Schneider und lebte in Westberlin. Später schickte er mir noch eine Levis, die wie eine zweite Haut und viel besser als die Wrangler vom Goldschmied aus Frankfurt am Main passte. Ich liebte sie heiß und innig, bis sie total zerrissen war, hauptsächlich am Hintern. Damals gab es für uns zwei Sorten Jeans: Westjeans und Ostjeans. Die Ostjeans waren aus sehr groben, steifen Material. Sie sahen aus wie Arbeitshosen und trugen den Markennamen PIONIER. An Westjeans kannte ich nur zwei Marken: LEVIS und WRANGLER. Der Unterschied war enorm!
Mit der S-Bahn fuhren Karo und ich zurück zur Unterkunft. Auf dem Weg zu unseren Gasteltern bemerkten wir noch eine Party, die im vollen Gange war. Angeheitert luden uns unbekannte Berliner Jugendliche dazu ein, wir sagten natürlich nicht nein.
Völlig erledigt krochen wir am beginnenden Morgen, so leise es uns möglich war, ins Bett, um für die nächste Kundgebung am folgenden Tag wieder fit zu sein.
Es war eine sehr kurze „Nacht“.
Aufgepäppelt mit einem kräftigen, späten Frühstück ging es zur nächsten Kundgebung. Die Müdigkeit steckte noch in den Gliedern und die Begeisterung hielt sich in Grenzen. Gelangweilt, muskelschwach und unter den strengen Blicken unserer Gruppenleiter setzten wir uns einfach zwischen den ganzen FDJlern auf unser voll signiertes Tuch und rauchten eine Zigarette, hoffend, bald wieder in die Festzelte gehen zu können.
Nach dieser anstrengenden Hürde stürzten wir uns in das Vergnügen, genossen die Live-Musik und feierten, was es das Zeug hielt.
Ungern ging Karo mit mir zu meiner Verabredung mit meinem Brieffreund Mustafa aus Jemen. Er wohnte in Marzahn und studierte auch in Berlin. Es war einfach, nach Marzahn zu kommen, denn wir hatten ja einen Freifahrtschein, den wir für die U-Bahn benutzten. Marzahn war schrecklich öde, nur Hochhäuserblöcke und kaum Grün. Alles sah irgendwie schmuddelig aus. Mit unsicherem Umherirren fanden wir seine Wohnung. Nach einer freundlichen Begrüßung im kleinen, geschmacklos eingerichteten und nicht ganz sauberen Zimmer ging es dann zur Sache. Zum Glück hatte ich Karo im Schlepptau, denn Mustafa wollte einfach nur Sex. Er hatte sogar seinen Kumpel dabei. Total unwohl und ängstlich log ich ihm einen Termin vor und trat mit Karo überstürzt den Rückzug an. „Scheiß Ausländer“, dachte ich. Wir beschlossen, für diesen Tag aufzugeben und das Bett aufzusuchen.
Auf dem Nachhauseweg stießen wir erneut auf eine Party und es ging durch bis zum nächsten Morgen, an dem Karo und ich nur noch unsere Sachen von unseren Gasteltern holten, uns bei ihnen mit einem kleinen Geschenk (Handtücher, denn schöne waren Mangelware) bedankten und zum Treffpunkt am Bahnhof Straußberg ermattet krochen.
Der eingesetzte Sonderzug für die Heimreise ließ auf sich warten. Anfangs tauschten wir unsere Erlebnisse mit unseren Freundinnen aus und sie neckten mich mit meinem ersten Knutschfleck, den ich stolz zur Schau stellte.
Doch Karo und ich wurden immer müder. Wir suchten irgendeinen Ort zum Langlegen. Nicht einfach bei so vielen schnatternden Jugendlichen, der ganze Bahnhofsvorplatz war eng gestopft mit fröhlichen Jungen und Mädchen.
Vor einem Gartenzaun schauten Karo und ich uns in die Augen: „Die hohe Wiese! Ideal!
Nur einen Moment, bis der Zug kommt!“
Sogar die leicht zu öffnende Gartentür lud uns ein. Wir fielen erschöpft bäuchlings ins hohe Gras, unsere Taschen hatten wir am Vorplatz stehen gelassen. Das Gras war so hoch, dass wir total darin versteckt waren, keiner konnte uns sehen und eventuell Schwierigkeiten machen – wegen unbefugtem Betreten und so. Es war so weich, so angenehm, so still... So still?! Wo waren die anderen?!
Erschrocken sprang ich hoch: „Träume ich? Karo, wir sind eingeschlafen, wach auf! Die sind alle weg!“
Verdattert und unbeholfen stürzten wir zum Bahnhof. Da standen einsam unsere Taschen. Wir schnappten sie und rannten so schnell wir konnten. Der Zug war gerade im Begriff loszufahren.
„Halt! Halt!“ schrien wir und stolperten hinterher. Der Zug wurde schneller, wir auch.
Karo verlor ihre Schuhe, da öffnete sich während der Abfahrt noch eine Tür.
„Schneller, schneller“, feuerten uns Daggi und Heini an und hielten uns die Hände entgegen. Im letzten Moment erwischten wir sie und ließen uns in den Zug ziehen.
Geschafft! Ist zum Glück nochmal gut gegangen. Gar nicht auszudenken, wenn der Zug ohne uns gefahren wäre! Wir hätten gar nicht gewusst, wie wir nach Hause gekommen wären, ohne Geld! Erst jetzt bemerkte ich, dass ich meinen Glücksbringer Dschingiskhan verloren hatte. Gewiss im hohen Gras, oder beim Rennen? „Es wird sich bestimmt jemand darüber freuen“, sinnierte ich traurig. Da war eben nichts mehr zu machen. Ohne Schuhe und ohne Talisman schliefen Karo und ich im Abteil ein, kein Lärm störte uns. Dieses Festival war trotz der verlorenen Dinge ein riesentolles Erlebnis! Freude, Freiheit, Leichtigkeit, Geselligkeit – alles hatten wir in der kurzen Zeit erlebt.
Mit überwältigenden Eindrücken kehrten wir in den Ausbildungsalltag zurück. Nun mussten wir für die Prüfungen in Pädagogik und Marxismus/Leninismus lernen. Dies bereitete mir wenige Probleme, sodass ich mit dem Mittagessen auf dem Schoß vor dem Prüfungszimmer saß, während die anderen eifrig in ihre Hefter schauten.
„Was ich heute noch nicht weiß, lerne ich vor der halbstündigen, mündlichen Prüfung sowieso nicht mehr“, war meine Devise. Also ließ ich es mir in aller Ruhe schmecken. Dass alle Aufregungen umsonst gewesen wären, bewiesen meine Prüfungsergebnisse. Am Ende des ersten Studienjahres wurde ich als beste Studentin des ersten Kurses ausgezeichnet. Die Urkunde und ein Buch über psychologische Fallbeispiele überreichte mir der zweite stellvertretende Direktor und Deutschlehrer Dr. Makowsky, der erstaunlicher Weise bei meinem Anblick leicht errötete.
Mein provozierendes Wesen griff es natürlich auf, schaute ihm direkt in die Augen und hielt seine zur Gratulation gereichte Hand etwas länger. Die Mädchen in der Appellrunde kicherten hörbar und Dr. Makowsky leitete nervös zum nächsten Thema über.
Ich wurde aufgrund meiner Leistungen zur Studentenbeauftragten gewählt. Das hieß: Ich arbeitete mit der stellvertretenden Direktorin Frau Maler zusammen und war für die Studienleistungen der anderen verantwortlich. Ich musste die Benotungen kontrollieren, leistungsschwache Studentinnen erkennen, deren Gründe für den Leistungsabfall erfahren und ihnen Hilfe (Extraseminare) anbieten. Diese neue Aufgabe steigerte enorm mein Selbstbewusstsein und machte mich mächtig stolz.
Außerdem bekam ich für das dritte und vierte Semester das höchste Leistungsstipendium in Höhe von achtzig DDR-Mark zugesprochen. Das war mehr als toll, somit hatte ich zweihundertsechzig Mark im Monat zur Verfügung!
Während des gesamten Studiums mussten wir einmal am Studentensommer teilnehmen, das war Vorschrift. Diese vier Wochen sollten uns einen Einblick ins Arbeitsleben gewähren. Karo, Daggi, Heini und ich entschieden uns für die diesjährigen Ferien.
Der Studentensommer fand in Berlin statt - wie praktisch, wir kannten Berlin ja schon vom Jugendfestival. Berlin war einfach anders!
Das Zeltlager für die Studenten war in Wuhlheide. Zirka zehn Jugendliche (Jungen und Mädchen natürlich getrennt) teilten sich jeweils ein Zelt mit Doppelstockbetten und Spinden. Es gab auch zwei „geschlechtergetrennte“ Waschzelte mit ewig langen Steinwaschtrögen und offenen Duschen, Toiletten, ein Rot-Kreuz-Zelt und eine Kantine, die aus Stein gebaut und mit einer Terrasse versehen war. Dort konnte man sich auch Kleinigkeiten wie Zeitschriften, Süßigkeiten, Getränke, Snacks und Zigaretten kaufen. Für alles Lebensnotwendige war also gesorgt.
Unser Trupp wurde in dem gleichen Zelt untergebracht, Unterhaltung war somit auch gesichert.
Karo und ich sollten von Wuhlheide zwei Stunden mit der Straßen- sowie S-Bahn nach Berlin-Adlershof fahren, um in einer – man staune - Schiffswerft zu arbeiten, wo Bullaugen hergestellt wurden. Das Werk befand sich direkt an der Mauer zu Westberlin, und mir war es bei diesem Anblick schon etwas mulmig zumute. Kann man hier drüber klettern? Wird man hier erschossen oder von Wachhunden angefallen? Was ist mit dem Apfelbaum, der an dieser Mauer stand? Durfte man die Äpfel essen? All diese Fragen waren für mich wichtiger als zu wissen, worin meine Arbeit bestand.
Ich erfuhr aber, dass es nur eine Sichtschutzmauer vor der eigentlichen Mauer war. Ahnte jedoch nichts von den angeblich dahinter befindlichen Minenfeldern und Selbstschussanlagen.
Notwendigerweise erklärte mir der Schichtführer meine Arbeit: Ich musste Schrauben sortieren! Ein sehr anspruchsvoller Job! Das konnte ich in Kauf nehmen bei der guten Bezahlung. Außerdem waren ja noch andere Arbeiter in der Halle und ich konnte denen zusehen, zum Beispiel wie Metallrahmen für die Schiffsfenster in verschiedene Becken mit irgendwelchen Flüssigkeiten getaucht wurden. Ahnung hatte ich davon jedenfalls keine. Arbeitskleidung bekamen wir keine, dafür diente eine abgenutzte Cordhose und ein paar ausgetretene Halbschuhe, da wir auf Anweisung der Schulleitung zum Studentensommer alte Kleidung mitnehmen sollten. Ein Kollege schenkte mir ein schönes, langes, blau-weiß-gestreiftes, kragenloses Herrenhemd, zu damaligen Zeit auch „Fleischerhemd“ genannt.
Ich war keine langsame Arbeiterin, deshalb war ich mit dem Sortieren schneller fertig bevor der Nachschub kam. Die aufgetretenen Pausen nutzte ich mit Essen, Rauchen und Sonnen! Karo war ein bisschen benachteiligter, weil sie andere Kleinteile geliefert bekam, von denen genug auf Lager war. Irgendwann jedoch war überhaupt keine Arbeit mehr da, weder für Karo noch für den Rest der Belegschaft.
Schnell wurden die Tauchbecken gesäubert, mit Wasser aufgefüllt und los ging es! Während der bezahlten Arbeitszeit konnten wir baden und uns genüsslich sonnen oder Wechselbäder unter der Dusche nehmen und in der Kantine essen. Das war gut verdientes Geld! Bloß die Anwesenheit war Pflicht. Man konnte nicht so einfach zu Hause bleiben, denn dies wurde durch die Stechuhr kontrolliert. Kam man mal zu spät, was durchaus passieren konnte, stempelte jedoch ein Kollege für dich ab, aber fernbleiben ging gar nicht. Das wäre Verrat an den Kollegen, mit denen wir uns sehr gut verstanden.
In den Genuss, dass andere für mich meine Anwesenheitskarte abstempelten, kam natürlich auch ich.
Ich hatte mich mit Karsten verabredet und besuchte ihn zu Hause. Er wollte mich unbedingt mit auf eine Party nehmen, um mich seinen Freunden vorzustellen.
Eigentlich hatte ich keine Lust, doch er bettelte solange, bis ich einwilligte. Bei seinem Kumpel Lars war es ganz lustig, es wimmelte von jungen Berliner. Wir redeten, sangen, tanzten und tranken bis alle Hemmungen von den meisten verschwunden waren. Auch bei Karsten. In einem Nebenzimmer küssten wir uns und gingen vorsichtig auf Körperkontakt. Karsten legte sich auf ein Bett und wollte mich zu ihm ziehen, da er glaubte, dass mir dies nicht fremd wäre. Ich spürte, dass er mächtig erregt war und hatte plötzlich ziemliche Angst zu versagen. So trunken war ich noch nicht, dass mich meine Unerfahrenheit nicht störte. Schließlich wäre es für mich das erste Mal gewesen. Ich wollte mich nicht blamieren, wies ihn ab und gesellte mich schlechten Gewissens zu den anderen. Gerade in diesem Moment fiel Lars, der über den Teppich stolperte, gegen eine Glastür und zerschnitt sich dabei ziemlich arg den Arm. Geschäftig kümmerte ich mich um ihn, nur damit ich mich nicht Karsten erklären musste, und wandte meine Kenntnisse aus „Gesundheitserziehung“ an: Fachmännisch versorgte ich den klaffenden, in Strömen blutenden Unterarm, säuberte die Wunde und legte einen schützenden, blutungsstillenden Verband an. Karsten sah leicht eifersüchtig – wie ich meinte – zu und drängte mich, mit ihm nach Hause zu gehen. Ich wusste, was mich da erwartete und benutzte als Ausrede, bei Lars wegen der Verletzung bleiben zu müssen. Beleidigt, ohne Abschiedsküsschen, verließ Karsten die Party und so nach und nach leerte sich das Haus, sodass Lars und ich nur noch alleine waren. Es war schon drei Uhr am Morgen, in vier Stunden musste ich auf Arbeit sein. Abzüglich der zirka zwei Stunden Fahrzeit nach Adlershof, blieben mir also noch zwei Stunden. Es lohnte sich also nicht mehr nach Wuhlheide. Wir schliefen erschöpft in Löffelstellung auf der Couch ein, ohne Sex.
Erschrocken sprang ich nach dem Nickerchen auf. Fünf Uhr dreißig! Und wie komme ich zum S-Bahnhof?!
Nach einer kalten Gesichtsdusche, mit einer Semmel in der Hand setzte ich mich auf Lars' Moped, mit dem er mich bereitwillig - um abzukürzen, quer durch einen Wald - zum Bahnhof fuhr. Unterwegs rutschten wir durch meinem Mangel an Gleichgewichtssinn und Vertrauen auf dem lockeren Sandboden aus und fielen mitsamt dem Moped zu Boden, zum Glück nur leicht, denn durch den Sand wurde der Aufprall abgedämpft. Bloß weil ich Lars nicht zutraute, das Moped durch die Bäume zu schlängeln! Ist ja noch ein mal gut gegangen.
Endlich in der S-Bahn sitzend hatte ich mich dann auch noch verfahren. Weil ich durch meine Müdigkeit vergessen hatte umzusteigen, landete ich da wo ich eben nicht hin wollte – in Wuhlheide. Also musste ich noch einmal zwei Stunden fahren, um zur Arbeit zu gelangen.
Dort angekommen begrüßten mich meine Kollegen lächelnd mit: „Mahlzeit!“, es war wirklich schon Mittag. Nur Karo war sauer. Kein Wunder, ich hatte den Spindschlüssel bei mir und sie musste in geliehenen Arbeitssachen von einem Kollegen, die viel zu groß waren, herumrennen! Verlegen versuchte ich meine Lage zu erklären, doch so wirklich interessierte sich niemand dafür, stattdessen schickten sie mich in die Garderobe: „Schlaf dich erst mal richtig aus, Mädel!“
Das ließ ich mir natürlich nicht zweimal sagen und legte mich auf die hartgepolsterte Rot-Kreuz-Liege zur Ruhe, bis mich Karo wieder versöhnlich weckte: „Steh auf und komm was essen!“
Aus Schlafmangel bekam ich Wadenkrämpfe. „Wechselduschen helfen“, meinte Karo und wir verschanzten uns zu zweit in Fleischerhemd und Unterhosen hinter dem Duschvorhang, setzten uns auf das kleine Becken und ließen uns gegenseitig unter Stöhnen abwechselnd kaltes und heißes Wasser über die Beine laufen. Tat das gut!
Erst später merkten wir, dass sich einige Frauen in der Garderobe tuschelnd Gedanken machten, was wir wohl stöhnend hinter dem Vorhang trieben.
Kichernd beendeten wir unsere Wellness und aller Unmut war vergessen.
Das Arbeiten lastete uns überhaupt nicht aus. Wir genossen das Lagerleben bis tief in die Nacht hinein, sangen, spielten Gitarre, unterhielten uns und rauchten und rauchten. Das Geld reichte bald nicht mehr aus und ich besorgte mir die billigen und starken „Karo“. Bald hatte ich einen Raucherhusten, der so schmerzhaft war, dass ich mich krümmte. Aber statt mir einen Krankenschein und Medikamente zu geben, empfahl mir nur der Lagerarzt, ich solle mit dem Rauchen aufhören! Klasse. Selbst Vergnügungen hatten Nebenwirkungen. Die Nächste ließ auch nicht lange auf sich warten.
Karo und ich verabredeten uns auf der Arbeit mit einigen jungen Herren für eine Party. Wir besorgten eine Flasche Wodka und gingen am Nachmittag zur Bushaltestelle, wo wir abgeholt werden sollten. Wir warteten und warteten, niemand kam. Entweder der falsche Ort, die falsche Zeit oder einfach nur die falschen Leute, die uns vergessen hatten. Frustriert zogen wir in einer Affenhitze mit der Flasche Wodka in den Wald in der Nähe des Zeltlagers. Die Blöße wollten wir uns nicht geben, dass wir versetzt worden waren. Uns blieb nichts anderes übrig, als zu zweit die Flasche zu leeren.
Anfangs hatten wir viel Spaß, dann schlich sich die Melancholie ein und wir erzählten uns gegenseitig unsere Sorgen und heulten solidarisch. Zum Schluss war es uns nur noch schlecht, aber verschenken wollten wir nichts! Mit Ekel und großer Überwindung leerten wir auch noch den letzten Schluck der Flasche. Karo musste sich übergeben und wurde etwas nüchterner. Ich jedoch war total blau! Mit stierendem Blick auf den Boden, damit ich wusste, wohin ich meine Füße setzte, torkelte ich an Karos Arm lallend zum Lager. Der Lagerwache sind wir natürlich trotz gleich aufgefallen. Karo erklärte ihnen, dass ich meine Brille suchte, weil ich so komisch auf den Boden starrte. Leider hatte auch sie einige Artikulationsprobleme, die Wachhabenden hatten nämlich „Pille“ statt „Brille“ verstanden und wollten uns bei der Suche helfen. Aus Panik, dass sie unseren Rausch entdeckten rannten wir kurzerhand nach dem unschuldigen Zücken des Studentenausweises in die Richtung unseres Zeltes, vorbei an der Kantinenterrasse, auf der ein paar Studenten saßen.
Da passierte es: Platsch! Ich lag im Dreck zu Füßen der anderen! Sch...!
Peinlich übermannt raffte ich meine Jacke und den Ausweis zusammen und flitzte außer Sichtweite ins Waschzelt, um mir eine ernüchternde Dusche zu nehmen. Ich ließ meine Sachen fallen und räkelte mich im kalten, erfrischenden Wasserstrahl. Wieder Sch...! Ich war in der Männerdusche und einige Jungen schauten mir belustigt zu.
Ich griff nach meinen Sachen, nicht mal ein Handtuch hatte ich, hielt sie mir vor den Körper und flüchtete in unser Zelt, das ich für den Rest des Tages nicht mehr verlassen hatte.
So konnte es nicht weitergehen! Ich muss meine Perspektive ändern. Es wurde Zeit, dass ich eine Beziehung einging, um gesitteter zu werden. Außerdem war ich ja noch immer Jungfrau – und das mit siebzehn Jahren!
Ohne es zu ahnen, bewegte ich mich Schritt für Schritt in die Richtung eines neuen Lebensabschnittes. Vielleicht würde ich es heute anders machen, vielleicht aber auch nicht, denn ich hätte sonst eine andere Lebensqualität und einen anderen Lebensinhalt, den ich eigentlich doch nicht missen möchte. Also musste es so sein.
An den Wochenenden brauchten wir nicht arbeiten und konnten in Ruhe das Lagerleben genießen. Als Karo und ich so durch das Lager schlenderten, sah ich IHN. Inmitten der anderen Jugendlichen saß ein blonder, nicht sehr groß wirkender, vollkommen in Jeans bekleideter Mann mit schulterlangen, dünnen, gewellten Haaren und Schnurrbart, rauchte und trank ein Bier aus der Flasche. Seine Gitarre lehnte am Tisch, die Mundharmonika lag daneben und eine Brünette umgarnte ihn liebevoll. Trotzdem trafen sich unsere Blicke. Da war etwas! Es kribbelte, ich spürte seine Begierde und mein Atem wurde schwer. Er verkörperte die komplette Freiheit, die ich ersehnte. Hemmungslos flirtete er mit mir und schickte kurzerhand seine Freundin weg. Karo überließ mich grinsend meinem Schicksal. Jetzt oder nie!
Wir verschwanden in seinem Zelt. Das erste Mal – ich war wahnsinnig aufgeregt!
Wenn ich zurück denke, war das die schönste Zeit in meinem Leben, die Jugend halt.
Der Genuss der Unabhängigkeit, der Duft der Freiheit, die Sehnsucht nach Neuem, nach Selbstständigkeit – Erinnerungen, die sich erhalten, die gehütet werden, die geformt haben, die erwachsen machen. Diese schöne Jugendzeit bekam leider einen grauen Schleier, der sich erbarmungslos über die Leichtigkeit legte, der aber zum Leben gehört. Diesen Schleier anzuheben, darunter zu schauen und das Darunter zu akzeptieren, bereitet mir starkes Herzklopfen. Schaffe ich es, nüchtern zu erkennen, anzunehmen? Der Versuch ist es wert, ich brauche die Herausforderung, um das Heute zu verstehen, zu akzeptieren und genießen zu lernen. Nutze den Tag, er hält immer etwas Schönes bereit – du musst es nur zulassen!
Gewalt und Zärtlichkeit
Es dämmerte schon, Wolf, so nannten ihn alle, schob mich im Zelt zu einem Bett in der rechten Ecke, gleich neben dem Eingang. Auf der unteren Liegefläche, auf welcher nur ein Kissen und eine Decke lagen, ließ ich mir von Wolf die Hose abstreifen. Er ging ziemlich routiniert vor. Dann drang er, gierig knutschend, in mich ein. Komisches Gefühl. Was sollte ich jetzt tun? Er bewegte sich stöhnend hin und her, vor und zurück und mit ihm das Bett. Ich hielt mich mit den Händen kopfüber an den Metallstangen vom Bett fest und dachte immer und immer wieder: „Wie lange dauert das noch?“, „Das soll schön sein?“, „Ist das langweilig.“
Jedenfalls war ich wohl ein totales Brett und zufrieden, als Wolf sich erleichtert hatte.
Nach einer Weile stand ich auf - das war`s, das erste Mal.
Stolz, nun auch „dazu zu gehören“, ging ich in unser Zelt, um Karo genauestens Bericht zu erstatten.
Am nächsten Vormittag saß Wolf wieder vorm Zelt bei einer Flasche Bier, blies Mundharmonika und ließ sich von der Brünetten streicheln. Ein bisschen zwickte es mir ins Herz. So schnell vergessen? Aber der Klang seiner Mundi zog an, und ich setzte mich errötend ihm gegenüber. Er grinste mich verschmitzt an.
Über Gott und die Welt gequatscht, verschwanden wir wieder im Zelt, diesmal auf die obere Etage eines Bettes inmitten vieler anderer. Einige waren mit anderen Jungs belegt, die lümmelten oder lasen. Um mich nicht zu blamieren und als prüde dazustehen, ließ ich alles geschehen, allerdings sehr darauf bedacht, die Decke nicht verrutschen zu lassen, denn so unbekümmert freizügig war ich nun auch wieder nicht!
Als Wolf seine Lust befriedigt hatte, unterhielten wir uns das erste Mal über persönliche Dinge. Er hieß Wolfgang Dragon, war dreiundzwanzig Jahre alt, hatte zwei jüngere Brüder, lebte in der Nähe von Berlin und studierte zur Zeit in Sachsen Ingenieur für Maschinenbau. Er liebte den Blues und musizierte gern. Zum Beweis holte er seine Gitarre, nackt wie er war, diskutierte lautstark mit der Brünetten und spielte mir einige Songs im Bett vor. Herrlich! Dazu tranken wir einen Schluck Bier und da stand sie – die Lagerwache!
„Ich...ich...ich bin schon achtzehn!“, stammelte ich. Machtüberlegen schauten sie mich an: „Lagerausweis!“
„Wo soll ich bitteschön hier einen Ausweis haben?“, wehrte ich mich frech, richtete mich auf und bedeckte nur meinen kleinen Busen, um ihnen meine Nacktheit zu demonstrieren.
„Na gut, aber beim nächsten Mal!“, drohten sie und verließen das Zelt. Nochmal gut gegangen.
Von nun an hing ich jeden Abend bei Wolf im Bett, wurde als Stammgast sogar geduldet und genoss die „andere“ Zeit. Mittlerweile machte mir der Sex schon Spaß und ich stellte mich auch nicht mehr so blöd an. Ich war verliebt, aber total!
Der Sommer neigte sich seinem Ende entgegen.
Mit den Taschen voller Geld und vor Tränen und Liebe glänzenden Augen fuhren wir Studentinnen wieder nach Hause. Werde ich ihn wiedersehen? Wir hatten nicht einmal unsere Adressen getauscht!
Am Bahnhof meiner Heimatstadt angekommen, traute ich meinen Augen nicht. Er stand am Bahnsteig! Wie hatte er das gemacht? Woher wusste er, wo ich wohne, wann ich am Bahnhof ankomme, wieso war er vor mir da? War es nur Zufall? Mein Herz klopfte, mir wurde schwindelig, ich war glücklich! Den kleinen Rosenstrauß und einen heißen Kuss nahm ich dankbar entgegen, und Wolf trug meinen Koffer nach Hause. Ich sollte ihn meinen Eltern vorstellen! Es deutete darauf hin, eine feste Beziehung zu werden.
Überglücklich und strahlend klingelte ich an der Wohnungstür.
Vati öffnete die Tür und polterte: „Wer ist das denn?! Einer aus dem Urwald?! So ein Hergelaufener kommt hier nicht rein!“
Er schob mich grob in die Wohnung, ich konnte mich nicht einmal von Wolf, der wie ein begossener Pudel dastand, verabschieden oder ein Treffen ausmachen oder, oder, oder.
Zu Hause war gleich dicke Luft. Vati hielt mir einen Vortrag, was die Leute denken würden, dass Wolf nach nichts Gutem aussah und verbot mir den Umgang mit ihm.
„Na, warte“, dachte ich. „Jetzt erst recht! Wenn du denkst, du kannst mir mein Leben kaputt machen, hast du dich geschnitten.“
Mein armes Schwesterlein radelte für mich zum zirka fünfzehn Kilometer entfernten Studentenwohnheim zu Wolf, um ihm zu sagen, dass ich am Samstag von zu Hause wegfahren werde, und dass ich ihn liebe. Sie hatte es geschafft. Von der langen Strecke war sie total k.o, die treue Seele.
Lange hielt ich die erdrückende Stimmung mit Vati nicht aus. Abends packte ich meine Sachen und fuhr am nächsten Morgen mit dem Zug Richtung Wohnheim.
Am Umsteigebahnhof sah ich Wolf wieder. Hatte er die ganze Zeit auf mich gewartet? Es kommen doch mehrere Züge, und weder er noch ich hatten gewusst, mit welchem ich fahren werde. Das war doch Vorherbestimmung! Allerdings nahm mir Wolf sofort ein bisschen Luft aus den Segeln: „Wenn du dich mit mir triffst, ziehe gefälligst keine Absatzschuhe an!“
Der Nächste, der mir was vorschreiben wollte! Wolf war nur einen halben Kopf größer als ich. Bei einem Mann musste man sich an die Schulter anlehnen können, zu einem Mann musste die Partnerin aufschauen – dachte ich. Also sah ich seine Forderung ein.
Da es Samstag war, schlug Wolf mir vor, bei ihm im Internat zu schlafen. Natürlich! Das musste er mir nicht zweimal sagen!
Es war ein riesiges Studentenwohnheim bestehend aus zwei miteinander verbundenen Gebäuden im Plattenbau-Stil. Auch hier war eine Pförtnerloge, wo die Studenten sich ausweisen mussten. Auf allen Vieren kroch ich unter dem Fenster hindurch, während Wolf die Aufpasser mit einem kurzen Gespräch ablenkte.
Sein Zimmer, das er mit Pitty, einem rothaarigen, zotteligen Vollbärtigen, teilte, war etwas spartanischer eingerichtet als die Zimmer in unserem Wohnheim. Aber im Prinzip war es dasselbe, sodass ich mich gleich wie zu Hause fühlte. Wolf schlief oben im Bett und wir nahmen es sofort ein, während Pitty höflicher Weise das Zimmer verließ.
Wolf verwöhnte mich von Kopf bis Fuß, mit seinem Mund, seiner Zunge, bis ich zu meinem ersten Höhepunkt kam. Es war mir ein völlig unbekanntes Gefühl, ich wusste nicht, was mit mir geschah. Mein Körper kochte, bebte und zitterte. Ich hörte mich nur noch: „Hilfe – Mama!“, schreien, was mir dann doch relativ peinlich war. Aber schön!!!
Nun konnte das zweite Studienjahr beginnen. Ich nahm mein Amt als Studentenvertreterin anfangs sehr ernst. Stolz genoss ich die Macht und kontrollierte die Leistungen sämtlicher Studentinnen, hatte ich doch Einsicht in alle ihre Leistungen und zog sie zur Rechenschaft, wenn der Leistungsstand sich verschlechterte. Endlich war ich wer. Nur merkte ich nicht, dass es mit mir selbst stetig abwärts ging.
Begonnen hatte es mit meiner Zimmernachbarin Katrin, mit der ich in einer gemeinsamen Praxisgruppe in einem Kindergarten war.
Höflich, wie ich erzogen wurde, hielt ich mich immer im Hintergrund, versuchte unauffällig zu sein und teilte meine Ideen Katrin mit. Sie als Tochter vom Kreisschulrat wollte natürlich positiv auffallen und verkündete meine Vorschläge lautstark unserer Mentorin, was dazu führte, dass ich schlechtere Benotungen bekam und Katrin ihr Liebling wurde. Schließlich beurteilte unsere Mentorin mich als bequem, ich würde alles meiner Mitstudentin überlassen und müsste endlich selbst Aufgaben übernehmen. Ich konnte mich anstrengen wie ich wollte, sie sah es einfach nicht. Ich fühlte mich unverstanden und massiv unwohl, wie so oft in meiner Kindheit, keine Aussprache hatte geholfen. Ich heulte nur noch, wollte nicht mehr zum Praktikum in den Kindergarten. Katrin begann ich zu hassen. Das anständige Mädel war für mich hinterlistig und rücksichtslos. Ich wurde öfter krank, begann beim Arzt Krankenscheine zu stehlen und fälschte sie, ich kannte ja die Schlüsselnummer für Magen-und Darm-Verstimmung, da diese Symptome am schnellsten eine Krankschreibung einbrachte. Ich wollte nur nicht mehr in die Praxiseinrichtung.
Bei einer „Symptomdemonstration“ wurde ich sogar mit Blaulicht ins Krankenhaus gefahren, weil meine vorgetäuschten Bauchschmerzen und die tatsächlich erhöhten Leukozyten auf eine Blinddarmentzündung deuteten. Mann, hatte ich Bammel, operiert zu werden! Ich flehte regelrecht unter Tränen den Chirurg an, es nicht zu tun, bis er mich mit schlechtem Gewissen doch nach Hause gehen ließ, nicht ohne mir das Versprechen abgenommen zu haben, bei einer Verschlechterung unverzüglich ins Krankenhaus zu kommen. Erleichtert versprach ich alles, was er wollte. Nie wieder wollte ich Bauchschmerzen vortäuschen, da war das Fälschen von Krankschreibungen doch sicherer.
Den nun echten Krankenschein nutzte ich aus und verbrachte die Zeit bei Wolf im Internat. Wie es hinein ging, war ja schon erprobt, nur das Verlassen war immer wieder eine Schwierigkeit. Mal musste ich durch den Heizungskeller fliehen und dabei nicht vom Hausmeister entdeckt werden, mal sprang ich aus der ersten Etage aus dem Fenster, mal kletterte ich bei einem Kumpel aus dem Fenster, mal musste ich an der Wache vorbei kriechen. Ich wurde nie erwischt! Clever.
Wolf lernte mir während des „Kassenurlaubes“, wie man Spaghetti mit Tomatensoße kocht, wir duschten gemeinsam und er zeigte mir, was ein Mann beim Sex so mag. Ich glaube, ich war einen gute Schülerin, er war jedenfalls zufrieden.
An Blockpraktika hingegen nahm ich regelmäßig und mit guten Ergebnissen teil, dennoch wurden die Lehrkräfte stutzig über mein ständiges Fehlen an den üblichen Praxistagen. Ich wurde zur Rede gestellt. Unter Tränen teilte ich ihnen mein Unbehagen mit. Sie hatten Verständnis, zwar könne es mit meiner Einstellung so nicht weitergehen, aber sie schlugen mir vor, die Einrichtung sowie die Zimmernachbarin zu wechseln. Ich gelobte Besserung.
So kam ich mit Karo in ein Zimmer, da waren ja die Richtigen zusammen, beide Raucher, beide Nachtschwärmer! Die versprochene Besserung an den Praxistagen trat ein, aber das Leben außerhalb der Schule nahm an Intensität zu.
Karo und ich begannen, auf dem Zimmer zu rauchen, stopften mit Parfüm getränkte Wattebausche ins Schlüsselloch. Wurden wir dennoch von der Wohnheimleiterin erwischt, heulten wir und spielten Liebeskummer vor - darauf war Frau Schraube ganz heiß, sie geilte sich an unserem angeblichen Kummer auf und erlaubte uns dabei sogar das Rauchen.
Dann gründeten Karo und ich einen gemischten Jugendklub, das hieß Mädchen der Mädchenschule und Jungen aus dem Ort. Im Vorstand des örtlichen Jugendklubs waren wir ja eh schon und durften mittwochs sogar länger ohne Beantragung ausbleiben, um die Räumlichkeiten wieder auf Vordermann zu bringen.
Unser neuer Klub- und Gesellschaftsraum wurde nach langem Verhandeln mit den „Vorgesetzten“ versuchsweise in den Keller unseres Internats gelegt, der von allen Mitgliedern begeistert renoviert, gestrichen, eingeräumt wurde. Im Keller ist ein angenehmer Aufenthaltsraum mit Tischtennisplatte, Bar und Musikanlage für alle entstanden.
Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, an dem Illusionen verwischen, wie die Blütenpollen vom Regen.
Erst hieß es, die Forderungen gegen die Versicherung müssen wir über den Haushaltsschaden berechnen; wir haben in kürzester Zeit alle notwendigen Unterschriften besorgt. Nach einer mehrstündigen Skype-Konferenz unseres Anwalts aus Perth mit der „Pflichtanwältin“ des Rechtsschutzes in Tschechien waren sich alle einig.
Doch gestern schwenkte die tschechische Anwältin plötzlich um. Die Forderungen wären zu hoch, außerdem sollten wir die Schäden bei den vorherigen tschechischen Anwälten einklagen, die hätten es doch versäumt, Forderungen dem Gericht vorzulegen, was wiederum zirka zehn Jahre dauern würde. Aber vielleicht auch nicht - im Falle des Ablebens der Beiden oder eines unbekannten Aufenthaltsortes. An ihrer Stelle würde ich mich auch verdünnisieren, genügend Schmiergeld abgesahnt und vor den Konsequenzen flüchtend.
Was haben die schon für eine Ahnung von angemessener Schadenshöhe, nach neun Jahren Kampf für Gerechtigkeit. Das Leben ist versaut, die Gesundheit nicht mehr reparabel, die finanzielle Situation mehr als unsicher, die alten Freuden verabschiedend vegetiert man im neuen Leben dahin und sucht vergeblich den Sinn. Was wäre, wenn der Unfall nicht passiert wäre? Was wäre, wenn ich die Augen nach dem Zusammenstoß nicht mehr geöffnet hätte? Was wäre, wenn...
Nach den sexuellen Erlebnissen mit Wolf war ich neugierig, wie das so mit anderen Männern ist.
Der Alkohol machte die Sache leichter. Gefiel mir jemand, ließ ich so lange meine vorhandenen weiblichen Reize spielen, bis ich ihn hatte. Es war nicht immer erfüllend. Ein Freund einer Kommilitonin inspirierte mich mit seinen langen, schwarzen Haaren. Mit ihm war es äußerst langweilig, er war eher auf Akrobatik aus als auf Genuss.
Einen frisch aus dem Gefängnis Entlassenen wollte ich wegen seiner Enthaltsamkeit testen, wir trieben es gleich im Park, ungeachtet dessen, dass andere auch durch den sogenannten Lustgarten gingen. Bei ihm ging es mir zu schnell.
Einen Freund von Maxi bezirzte ich, bis er mich mit nach Hause nahm. Auf dem Schaffell war es zwar romantisch, aber sonst auch nichts weiter. In Erinnerung blieb mir nur die im Hintergrund vom Plattenspieler singende Kate Bush, deren Stimme mir die Langeweile vertrieb.





























