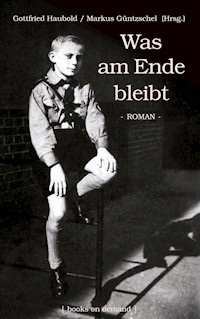
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jürgen Klausner und seine Freunde verbringen am Beginn des Zweiten Weltkriegs eine sorglose Kindheit, doch bald reißen Hitlerjugend, Wehrmacht und totaler Krieg die Jungen und ihre Familien in einen Sog aus Machtgelüsten und Gewalt, Hilflosigkeit und Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 672
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gottfried Haubold wurde am 28. Juni 1928 in Chemnitz (Sachsen) geboren und verbrachte dort seine Kindheit und Jugend. In dieser Zeit erlebte er den Zweiten Weltkrieg.
Sein Einsatz als Soldat in den letzten Monaten des Krieges und die damit verbundenen Erlebnisse, insbesondere der Bombenangriff auf Dresden im Februar 1945, beschäftigten ihn bis weit in das Erwachsenenalter hinein.
Nach dem Krieg erlernte er den Beruf des kaufmännischen Angestellten und bildete sich später zum Möbeltechniker fort.
In den Jahren um 1970 verfasste er das Manuskript des vorliegenden Romans und beschrieb anhand der Figur Jürgen Klausner seine Kindheit und Jugend. Der Arbeitstitel lautete „Die braune Pest“.
Sein Wunsch nach einer Verlegung des Romans in der DDR ließ sich nicht verwirklichen.
Am 26. Juli 1985 verstarb Gottfried Haubold nach einer langjährigen Nieren- und Zuckerkrankheit in Chemnitz, das von 1953 bis 1990 Karl-Marx-Stadt hieß. Der Roman blieb unvollendet.
Ab dem Frühjahr 2008 wurde das Manuskript von seinem Enkel Markus Güntzschel weiterbearbeitet. Nach mehrjähriger Arbeit wurde der Roman im Jahr 2012 fertiggestellt und veröffentlicht.
In den Jahren 2020 und 2021 erfolgte eine letzte Überarbeitung in die hier vorliegenden Fassung.
Wenn die Liebe einen Weg zum Himmel fände und Erinnerungen zu Stufen würden, so stiegen wir hinauf und holten euch zurück.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
1
Bündelartig fächerten die grellen Strahlen der heißen Nachmittagssonne durch die Zweige schlanker Fichten und hochstämmiger Birken, hinein ins Tal des kleinen Sees.
Nur einzelne Wölkchen unterbrachen das Spiel der Sonne, deren Schatten kantig auf die Porphyrfelsen schlugen und sich auf den Waldboden streuten. Stufenartig ragten die rot-braunen Felsen in schwindelnde Höhe. In Gesteinsrissen wurzelten mutig kleine Birken. Aus dem Talkessel schlängelte sich in südwestlicher Richtung ein schmaler Weg hinaus zur Landstraße.
Versteckt inmitten eines großen Waldgebietes vor der mittelsächsischen Industriestadt lag dieser Steinbruch.
Im hinteren Teil des Talkessels spiegelten sich im grünlichklaren Quellwasser eines Teiches tief herunterhängende Weidenzweige. Diesen Teich speiste ein Bächlein, das entlang des Zufahrtsweges dahinplätscherte.
Neben dem Teich, hinter Haselnussgesträuch, verbarg sich eine tief ins Gestein getriebene Höhle, die einst den Steinbrucharbeitern bei Sprengungen als Unterschlupf gedient hatte. Vor dem Höhleneingang war ein kreisförmiger Vorplatz, auf dem drei Jungen um ein kleines Biwakfeuer hockten.
Ernst und würdevoll sprach einer der Jungen: »Keine Macht der Welt soll die Freundschaft zwischen mir, dem Häuptling der Apachen, genannt Winnetou, und euch beiden Anführern der weißen Rasse, Old Shatterhand und Old Firehand, zerschmettern, es sei denn, unsere Leiber werden bei vollem Bewusstsein von Aasgeiern gefressen!«
Er reichte eine mit bunten Bändern und gebrannten Lehmkügelchen geschmückte, rot und weiß bemalte kleine Tonpfeife an Old Shatterhand weiter, nachdem er selbst den Tabakrauch in alle vier Himmelsrichtungen geblasen und seine Worte mit: »Howgh, ich habe gesprochen!« bekräftigt hatte.
»Die Friedenspfeife mit dem großen Häuptling des edlen und ständig siegenden Stammes der Apachen zu rauchen ist ein Zeichen dafür, dass der große Manitu unsere gemeinsamen Wege beschützt und uns Kraft zum Kampf gegen die weißen Eindringlinge verleiht. Howgh, ich habe gesprochen.«
Old Shatterhand blies den Rauch ebenfalls in die vier Himmelsrichtungen und sagte dann: »Old Firehand, sprich du weiter!«
Der als Old Firehand angesprochene Junge trug, wie Old Shatterhand, ein buntkariertes Hemd. Seinen Hals umschlang ein buntes Tuch, das vorn mit einer Streichholzschachtelhülse zusammengehalten wurde.
Um ihre Hüften schlang sich ein bunt bestickter und mit blanken Nieten verzierter, breiter Gürtel aus grobem Leinengewebe, in dem jeder zwei Holzpistolen und einen Dolch griffbereit stecken hatte. Ihre breitkrempigen grauen Hüte hatten sie ins Genick geschoben. Der aus farbigen Lederstreifen geflochtene Halteriemen hing locker unter dem Kinn.
Als auch Old Firehand seinen weisen Satz gesprochen und den Rauch von sich geblasen hatte, legte er einige trockene Äste ins kleine, fast rauchlose Feuer.
Der schwarzhaarige Hans Angermann hatte - als Winnetou gekleidet - ein Band um den Kopf geschlungen, an dessen Hinterseite drei buntgefärbte Federn steckten. Vor den Ohren hingen von diesem Kopfband mehrere Bänder herab. Den Kragen seines Hemdes hatte er nach innen geschlagen. Um den Hals trug er eine selbst gefertigte Kette aus Draht, an der er eben die Friedenspfeife wieder befestigte.
Seine dunklen Augen über der schlanken Nase betonten bei seiner mittelgroßen Gestalt tatsächlich indianisches Aussehen. In seinem Gürtel steckte ein aus Holz gebauter, buntbemalter Tomahawk. Auf seinen Knien lag ein Luftgewehr.
»Mein roter Bruder«, sagte Jürgen Klausner, der in der Rolle des Old Shatterhand steckte, zu Winnetou gewandt, »noch dringen weiße Männer, die gierig nach Golde suchen, in die Jagdgründe der Rothäute ein, morden Frauen und Kinder und brennen deren Zelte nieder. Es sind Männer meiner und Old Firehands Rasse. Wir beide aber sind treue Freunde der mutigen Stämme aller Indianer. Wir werden den Rothäuten helfen, wo es auch sein mag! Howgh, ich habe gesprochen!«
Dunkelblondes, verwildertes Haar über den grünlich-grauen Augen und buschigen Brauen ließ bei ihm, von Gestalt groß und breitschultrig, den unüberwindlichen Old Shatterhand erkennen.
Drahtig und schlank wirkte dagegen Eberhard Möbius, der Old Firehand darstellte. Strohblondes, kurzgeschnittenes Haar wurde vom etwas zu großen Trapperhut verdeckt. Seine blauen Augen durchforschten gerade die nächsten Büsche, als wäre von dort her eine Gefahr zu erwarten.
»Old Firehand, brauchst nicht so krampfhaft zu spähen! Winnetou hört alles im Umkreis von vielen Metern!«, sprach Hans Angermann mit ernster Miene. Er hatte schon zahlreiche Indianerbücher gelesen, weshalb er sich auch jetzt wieder in einen Indianerhäuptling verwandeln konnte.
Er hatte seinen Satz kaum beendet, als Jürgen mit erhobener Hand andeutete, still zu sein. »Psst, ich höre Schritte!«
Gespannt lauschten die drei Jungen.
Eberhard riss mit einem Ast die Glut in ein für diese Fälle vorbereitetes Loch und schob etwas Erde darüber.
Katzenartig huschten Eberhard und Hans in die Höhle. Eberhard schob - von innen herauslangend - zwei niedrige, doch dichte Fichten, die mit ihren Wurzeln noch im Erdreich steckten, als Tarnung vor den Eingang. Von hier aus beobachteten sie die nähere Umgebung.
Schlangengleich glitt indessen Jürgen am Felsen entlang zum Dreifichteneck, um von dort das Gelände übersehen zu können.
Entlang des Baches kamen vier Jungen gelaufen. Sie trugen gleichfalls Trapperhüte auf ihren Köpfen. Wie Jürgen erkannte, schienen sie nicht zu ahnen, dass sich in ihrer Nähe eine andere Gruppe Jungen befand und sie sogar beobachtete.
Sie sprachen so laut miteinander, dass Jürgen ihre Worte verstand. Er hörte den ersten der Jungen zu den hinter ihm laufenden sagen: »Irgendwo muss sich doch diese Höhle befinden. Es kann nicht mehr weit sein!«
Jetzt wusste Jürgen, mit welcher Absicht die anderen in ihr Jagdgebiet eindrangen. Um sie aufzuhalten, schleuderte er eine Handvoll kleiner Steine gegen die Felswand hinter den Angreifern. Sofort warf sich die Vierergruppe in das farnartige Waldgras und forschte nach der Ursache der Geräusche.
Jürgen schlich zur Höhle zurück und verständigte in hastigem Flüsterton seine Freunde. Gleich kamen sie hervorgekrochen und schoben hinter sich die kleinen Fichten wieder vor den Eingang. Die örtlichen Verhältnisse waren ihnen gut bekannt, und so fanden sie schnell zu anderen Verstecken, von denen aus ein weiteres Beobachten möglich war.
Hans Angermann als Häuptling der Apachen gab den beiden weißen Männern den Befehl, wie sie sich zu verhalten hätten, falls die Trapper ihre Höhle finden würden.
Durch Jürgens Steinwurf irregeführt, verharrten diese einige Minuten unbeweglich in ihrer Deckung. Da sich jedoch nichts mehr regte, glaubten sie, das Rascheln hätte irgendein Tier verursacht. Somit setzten sie ihre Erkundung fort.
»Verdammt noch mal, irgendwo muss die Höhle ja sein«, schimpfte ihr Anführer, während auf einem kleinen Felsvorsprung, nur wenige Schritte hinter ihm, seine drei Freunde durch das Gebüsch krochen.
Die sich versteckt haltenden Jungen erkannten jetzt, aus ihrem Gestrüpp herausspähend, wen sie vor sich hatten. Old Shatterhand raunte dem neben ihm liegenden Winnetou ins Ohr: »Das sind Goldsucher.« Der Indianer nickte bestätigend.
Die Ankömmlinge waren gut zu verstehen: »Hier irgendwo muss die Höhle sein! Seht, hier brannte noch vor kurzer Zeit ein Feuer - und hier sind Fußspuren!«
Derjenige, der das sprach, konnte einen Freudenschrei nicht unterdrücken und quirlte nun hervor: »Was sehen dort meine scharfen Augen?« Die von Eberhard vor die Höhle geworfenen kleinen Fichten drückte er eifrig auseinander: »Hier ist sie ja!«
Neugierig geworden traten seine Freunde neben ihn. Ihr Anführer befahl: »Los, die Bäume weg und rein - mal sehen, was da drinnen zu finden ist! Ich bleibe als Wache draußen.«
Eben wollte der dritte Junge noch in der Höhle verschwinden, doch da hielt ihn sein Anführer am Arm fest. »Bleibe du zur Verstärkung hier draußen für den Fall, dass man uns doch gesehen hat. Ich traue der Ruhe nämlich nicht! Verdammt, ich habe so ein komisches Gefühl im Bauch!«
Abwartend blickte der nun mit ihm vor dem Höhleneingang stehende Junge dorthin, wo sie hergekommen waren, während sein Anführer ins Dunkel rief: »Habt ihr was entdeckt?«
Noch hatten die zwei in der Höhle keine Antwort gegeben, als er durch knackende Zweige und gellendes Geschrei erschrocken zusammenfuhr. Blitzschnell packten ihn robuste Hände und warfen ihn zu Boden. Der andere Wächter wurde ebenso überrumpelt. Unter Aufbietung aller Kräfte versuchte er sich loszureißen, doch Jürgen war stärker. Mit gespreizter Hand hatte er ihn am Kinn gepackt und presste seinen Kopf auf den kantigen Stein.
Eberhard rang den anderen Jungen nieder. Auf der Mitte des kleinen Vorplatzes stand - mit ernstem Gesicht und sein Luftgewehr zum Höhleneingang gerichtet - Winnetou Hans Angermann und sprach mit erzwungen tiefer Stimme: »Ihr Bleichgesichter, was veranlasst euch, in die Jagdgebiete des großen und klugen Stammes der Apachen einzudringen?«
Sam Pedro, der Trapper-Anführer, keuchte noch unter dem festen Griff Old Shatterhands. Der aber rief: »Winnetou, los, binde ihm die Hände!« Einige Handgriffe genügten, um Sam Pedro endgültig bewegungsunfähig zu machen.
Der unter Old Firehand liegende Junge hatte den Kampf schon bald aufgegeben, als er erkannte, dass Eberhard der Stärkere war.
An Händen und Füßen gefesselt lagen die beiden Jungen neben dem Höhleneingang. Die zu seiner Tarnung gebrauchten Fichten waren im Kampfgetümmel umgerissen worden. Vom dunklen Höhlenhintergrund hoben sich gespenstisch die beiden Gesichter der zur Erkundung geschickten Jungen ab.
Barsch forderte Winnetou sie auf: »Kommt heraus, aber lasst eure Waffen in der Höhle zurück!«
Mit ungewissem Gesicht kroch der erste hervor und hielt bereits seine Hände übereinander, um sich Fesseln anlegen zu lassen. Als Jürgen ihm diese um das Handgelenk binden wollte, bekam er dessen Fäuste plötzlich unter das Kinn und taumelte getroffen gegen die Felswand. Mit weiten Sprüngen versuchte nun Jürgens Gegner zu entfliehen, doch Eberhard konnte ihm einen Knüppel zwischen die Beine werfen.
»Apachen-Strolch!«, krächzte der Gestürzte mit stoßendem Atem, denn Eberhard kniete sogleich auf ihm und drohte keuchend: »Wenn ihr denkt, ihr könntet in unsere Wigwams eindringen, so habt ihr euch getäuscht! Der große Winnetou wird entscheiden, ob ihr freigelassen oder am Marterpfahl sterben werdet! Howgh, ich habe gesprochen.«
Auch der vierte Junge lag, von Hans überwältigt und an den Händen und Füßen gefesselt, am Boden. Die Hände auf der Mündung seiner Silberbüchse übereinandergelegt, sprach Hans Angermann: »Hier steht Winnetou, der Häuptling der Apachen! Er fragt euch: Was führt euch in unsere Jagdgründe?«
Unschlüssig schauten die auf dem Felsen liegenden Trapper zu ihrem Anführer Sam Pedro, einem schlanken, mittelgroßen Burschen. Weder er noch die anderen Jungen antworteten ihm. Winnetou trat an sie heran: »He, Bleichgesichter, Winnetou fragt, was euch zu uns geführt hat! Ich gebiete zu antworten!«
Old Shatterhand beobachtete indessen, wie Sam Pedro mühevoll versuchte, sich von seinen Handfesseln zu befreien. Immer wieder drehte er die Handgelenke oder spreizte sie voneinander ab. Doch die bei Angermanns Mutter stibitzte Wäscheleine war straff verknotet und hielt zuverlässig.
Scheinbar wähnte Sam Pedro die Situation als verloren, denn er antwortete unterwürfig: »Winnetou, großer Häuptling der Apachen! Wir liegen vor dir im Staube. Ich, Sam Pedro, Anführer dieser drei Goldgräber, will mit dir, aber nicht mit diesen Verrätern der weißen Rasse sprechen!«
Seine Blicke streiften Jürgen und Hans. Doch beide, diese Ächtung nur zu gut aus Indianerbüchern kennend, blieben ruhig, als wäre nicht über ihre Person gesprochen worden.
Sam Pedro versuchte, sich in Sitzstellung aufzurichten, doch seine Beinfesseln geboten ihm, liegen zu bleiben. »Schicke die beiden Männer weg!«, forderte er.
Winnetou antwortete ihm kurzum: »Diese beiden Männer neben mir sind meine Freunde und bleiben deshalb hier!«
Er beugte sich nieder und knebelte die Fesseln zuerst bei Sam Pedro ab. Dem Beispiel folgend, lösten Old Shatterhand und Old Firehand auch bei den übrigen Jungen die Knoten.
»Jetzt habt ihr den Beweis unserer Stärke, aber auch unseres Vertrauens zu euch, obwohl ihr dreist in unsere Jagdgründe eingefallen seid!«
Von der plötzlichen Wende überrascht, richteten sich die bisher Gefesselten auf und rieben ihre Handgelenke, an denen sich rote Striemen der Fesselschnüre abzeichneten.
»Nur Sam Pedro erhält seine Waffen zurück, ihr anderen bleibt vorläufig noch ohne sie«, entschied Winnetou. »Bedenkt: ihr seid vier und wir nur drei!«
Sam Pedro nickte zustimmend, während ihm Old Firehand sein Holzgewehr reichte.
Winnetou setzte sich mit seinen beiden Gefährten in Blickrichtung zur Felswand und deutete den anderen Jungen an, sich ihnen gegenüber niederzulassen.
»Ihr seid frei, doch die Waffen deiner Gefährten, Sam Pedro, bleiben so lange in unserem Besitz, bis wir wissen, was euch zu uns geführt hat. Also sprecht!«, forderte Winnetou.
Mit untergeschlagenen Beinen hockten die sieben Jungen im Kreis. Wäre ein Erwachsener hinzugekommen, hätte er meinen können, die Jungen seien echte Indianer und Trapper, die hier über Leben und Tod verhandeln.
Sam Pedro ließ sich nieder und versetzte sich in würdevolle Haltung. Er sprach langsam und betont: »Der allen Rothäuten und auch uns als mächtiger Häuptling der Apachen bekannte Winnetou möge meinen Worten Glauben schenken: Wir sind gekommen, um in diesem Tal nach Gold zu graben.«
Old Shatterhand beschnitt ihm das Wort: »Lüge nicht, Sam Pedro! Du suchtest etwas anderes!«
»Was willst du damit sagen, Old Shatterhand?« Er wollte sich verteidigend erheben, doch Winnetou drückte ihn mit dem Gewehrkolben auf seinen Platz zurück.
»Sprich weiter, Sam Pedro. Ich werde prüfen, ob die Wahrheit über deine Lippen kommt!«
»Ich hatte ja noch nicht ausgesprochen. Also, wir suchten zudem nach dieser Höhle.«
»Und weiter?«, fragte Old Shatterhand.
»Dann habt ihr uns hinterhältig überfallen!«
»Noch hast du nicht die volle Wahrheit gesprochen, Sam Pedro.«
Old Firehand drang ebenfalls in ihn, die Wahrheit zu sagen: »Wir wissen genau, was ihr vorhattet!«
Sam Pedro wollte sprechen, doch mit einer Handbewegung verbot Winnetou es ihm: »Wir setzten in euch Vertrauen, aber ihr missbrauchtet es schäbig!« Finster blickten seine Augen ihm entgegen.
Sam Pedro blieb stumm. Old Shatterhand erkannte dessen Vorhaben, nach neuen Ausflüchten zu suchen, weshalb er sich ruckartig erhob und sagte: »Sam Pedro, ich weiß, weshalb ihr zu uns gekommen seid. Deswegen fordere ich euch zum letzten Male auf, die Wahrheit zu sagen! Spricht sie Sam Pedro nicht, werde ich ihn dazu zwingen! Howgh, ich habe gesprochen!«
»Gut, ich sage die volle Wahrheit! Wir hatten von eurer Höhle gehört, wollten sie suchen und nachsehen, ob ihr darin etwas verborgen habt, das wir auch gebrauchen können. Schätze suchten wir!«
»Genauso ist es und nicht anders! Ich habe euch vorhin belauscht. Nur deshalb konnten wir uns verstecken und schließlich euer Vorhaben vereiteln.«
Jürgen hatte sich nach diesen Worten wieder hingehockt, doch sprach er weiter: »Hätten wir euch nicht bemerkt, lägen wir nun hier - von euch überfallen, gefesselt und geknebelt. Und ich bezweifle, ob ihr so großzügig gehandelt hättet wie wir.«
Eberhard hatte sich bisher wenig am Gespräch beteiligt. Er dachte an den Jungvolkdienst, der ihm interessanter schien als das Indianerspiel, zumal er nicht eine Hauptperson wie Winnetou oder Old Shatterhand darstellen durfte.
Unwillig fragte er: »Also, wie geht die Sache hier weiter? Die ewige Verhandelei habe ich satt. Ich will Taten sehen!«
Hans und Jürgen kannten Eberhards aufzüngelnde Art nur zu gut. Dass er ausgerechnet jetzt, wo ein Sieg fast perfekt war, querzutreiben versuchte, war beiden unverständlich.
Gereizt sagte Jürgen darum: »Sam Pedro, du siehst, auch Old Firehand wünscht unseren Streit zu beenden. Wir wollen friedlich nebeneinander leben. Gemeinsam mit dem Stamm der Apachen wollen wir gegen die Unterdrücker der Rothäute kämpfen.«
Sam Pedros Haltung straffte sich wieder. Wohl erkannte er, dass die ihm gebotene Friedenshand zu fassen sei, weshalb er bekräftigte: »Ich bin einverstanden und gebe euch auch das Versprechen, mit meinen Leuten nicht wieder in eure Jagdgründe einzudringen.«
Winnetou nestelte von seiner Halskette die Friedenspfeife ab. »Rauchen wir gemeinsam diese Friedenspfeife und schwören dabei, uns nicht wieder zu bekämpfen, und dass ihr zukünftig unsere Jagdgründe meidet, wie du, Sam Pedro, eben erklärtest!«
Aus einem kleinen, bunten Lederbeutel fasste Winnetou mit den Fingerspitzen fein geschnittenen Tabak und stopfte damit die Tonpfeife. »Seid ihr dazu bereit, so werdet ihr eure Waffen zurückerhalten und wir scheiden als Freunde!«
Sam Pedro sprach mit feierlicher Betonung: »Wir sind bereit, Winnetou!«
Winnetou steckte die Friedenspfeife an und blies den Rauch wieder in die vier Himmelsrichtungen. Dann sprach er feierliche Worte über freundschaftliches Zusammenleben der Bleichgesichter und der Apachen. Die anderen Jungen folgten seinem Beispiel.
Nachdem dieses Zeremoniell beendet war, verließen die Trapper das kleine Plateau.
Old Shatterhand beobachtete sie, bis ihm gewiss war, dass sie das Tal des kleinen Sees verlassen hatten.
Als er wieder zurückgekommen war, motzte er zu Eberhard: »Nicht viel hätte gefehlt und unser Sieg wäre durch dich Dussel vereitelt worden. Jawohl!«
Eberhard entgegnete: »Wieso denn?«
»Da fragst du noch?« Jürgen riss seinen Trapperhut vom Kopf und wandte sich von ihm.
Eberhard antwortete hastig: »Es ist doch so: Wir spielen hier wie die kleinen Kinder Indianer. Stattdessen könnten wir exerzieren üben!«
»Du spinnst ja ganz schön! Hast wohl noch nicht genug vom Jungvolk?«, meinte Jürgen ärgerlich.
Hans hatte seinen Kopfputz abgenommen und verfolgte interessiert die Auseinandersetzung.
Laute Fragen, deren Worte im Wald mehrfach widerhallten, prallten auf Eberhard Möbius.
»Langt es nicht aus, wenn wir mittwochs und sonnabends strammen Dienst ableisten? Ist es hier im Wald nicht prima? Mir gefällt’s!«
Das Hämmern eines Spechtes lenkte die Jungen kurz ab.
Hans Angermann hatte seine Winnetou-Rolle noch im Sinn und zeigte auch jetzt kein sonderlich ausgeprägtes Interesse für den Jungvolkdienst. Lässig und blinzelnd meinte er zu Eberhard: »Wenn dir’s nicht passt, dann …!«
»Aha, ihr wollt mich wohl loswerden, he?«, stoppte Eberhard Hans’ Rede.
»Ach, quatsch doch keinen Blödsinn! Ich meinte nur, du solltest nicht zum Spielverderber werden. Nichts weiter!«
Aus Winnetou war wieder Hans Angermann geworden, denn mit geordnetem Hemdkragen und ohne Indianerfedern sprach er nicht mehr mit Indianer-Pathos.
»Wollen wir nicht auch noch die dritte Friedenspfeife rauchen, ihr Streitochsen?«
»Wir streiten uns doch gar nicht! Stimmt’s, alte Pfeife?« Ein Boxhieb Jürgens traf Eberhard. Doch der, zu Händeleien stets bereit, schlug gekonnt zurück.
Lachend rauften sie miteinander und hörten erst auf, als Hans sie zum Aufbruch ermahnte, denn lange Schatten legten sich bereits über das Tal. Mückenschwärme spielten im ständigen Auf und Ab.
Wortlos liefen die Jungen auf einem schmalen Pfad durch den Mischwald.
Eberhard Möbius brach das Schweigen und kündigte an: »Ihr könnt mir glauben, dass wir das nächste Jungvolkgeländespiel hier in dieser Gegend starten werden.«
»Eberhard, da bin ich dagegen! Unser klasse Gelände den anderen preisgeben?«, widersprach ihm Jürgen.
»Was willst du machen, wenn ich den Befehl dazu gebe? Oder sagen wir, wenn ich es dem Jungzugführer vorschlage?«
»Recht hast du, da kann ich nichts machen, Befehl ist Befehl!«
»Sag mal, Jürgen, willst du mich verhöhnen?«
»Ach was, ich dich verhöhnen, wo du doch so ein zackiger Jungschaftsführer bist?«
Jürgen starrte nach seinen Frotzeleien auf Eberhards Kopf, ob er sich zu ihm umwenden würde. Eberhard blieb sogar stehen und blickte Jürgen wortlos an, der nun seinerseits nicht weiterlaufen konnte.
»Bist wohl beleidigt, weil ich über dein Vorhaben anders denke? Mann, nun tu doch nicht so!« Er packte Eberhard an der Schulter, schob ihn unsanft in die alte Marschrichtung und sprach: »Wir sind nicht im Jungvolkdienst! Dort kannst du mir Befehle geben: Arsch zusammenkneifen und die Hände an die Hosennaht pressen, dass einem die Fingernägel weiß werden!«
»Hans, was sagst du denn zu Jürgens dusseligem Gequassel?«, drängte Eberhard, auf Zustimmung hoffend.
Hans lief vorneweg und antwortete, den Kopf seitwärts wendend: »Indianerspiel ist doch klasse – sag bloß, das ist für dich nichts?«
Verärgert darüber, dass seine Freunde nicht kritiklos dem Jungvolkdienst zustimmten, wollte Eberhard ihnen nochmals seine Meinung darlegen: »Leute, nun hört doch mal her. Im Jungvolkdienst lernen wir, wie sich ein richtiger deutscher Junge zu verhalten hat. Ihr kennt ja die Worte unseres Führers: Hart wie Krupp-Stahl und zäh wie Leder muss ein deutscher Junge sein!«
»Schöner Quatsch mit dem Krupp-Stahl und dem zähen Leder! Ist der Spruch aus der Bibel?«
»He, he, was unser Führer sagt, ist nicht aus der Bibel, mein lieber Jürgen!«, parierte Eberhard.
Mittlerweile waren sie an der Hauptstraße angekommen.
Hans meinte: »Eigentlich lässt sich unser Indianerspiel bestens mit dem Jungvolkdienst verbinden. Mensch, Eberhard, verstehst du das denn nicht?«
»Klar verstehe ich das! Aber so eine richtige Männersache ist die Indianerspielerei auch nicht!«
Jürgen stichelte erneut: »Willst wohl schon ein richtig großer Mann sein - mit deinen dreizehn Lenzen?«
»Wie ich darüber denke werdet ihr sehen, wenn ich die grüne Dienstschnur bekomme und Jungzugführer bin! Da rasselt’s im Karton!«
»Aha, daher weht der Wind! Da müssen wir uns ja höllisch vor dir in Acht nehmen!«, spöttelte Jürgen.
Hans aber versuchte nun zu vermitteln: »Klar, in unserer Jungvolkuniform mit Dienstschnur und Rangabzeichen können wir uns in der Öffentlichkeit schon eher sehen lassen, als mit Indianergeheul und Maskerade. Was hat’s für einen Sinn, die Friedenspfeife zu rauchen? Es ist Krieg und Deutschland braucht harte Männer.«
»Schau an, schau an, welch kämpferische Gedanken durchzucken dein Hirn?« War es sonst nicht Jürgens Art, seine Freunde zu foppen, so sah er sich heute mehrfach geradezu herausgefordert. Hans gab ihm aber keine Antwort.
Nachdem sie über die Hauptstraße gerannt waren, meinte Eberhard: »Recht hat der Hans, Deutschland braucht wirklich harte Männer! Noch längst ist es nicht an der Zeit für die Friedenspfeife. Zuerst kommt der Dienst und dann das Spiel!«
Jürgen erwiderte schnippisch: »Ich habe so eine Ahnung: Eberhard will heute noch seinen alten Trapperhut verbrennen. Schade drum.«
An der Straßengabelung trennten sich die drei Freunde voneinander. Jürgens Überlegungen kreisten umher: Wie schön und abenteuerlich doch die Stunden im Wald stets sind. Der Möbius aber wird jeden Tag komischer. Geht ihm der Jungvolkdienst tatsächlich über alles?
Jürgens Gedanken wurden durch eine am Straßenrand liegende, alte Konservenbüchse abgelenkt, die er nun, wie einen Fußball, lärmend vor sich her stieß.
2
Bei Familie Klausner war es Tradition, ihre Geburtstage stets festlich zu begehen. Jeder - ob Mutter, Vater, Reinhard oder Jürgen - freute sich schon Tage vorher auf seinen Ehrentag.
Wurden auch die Geburtstagsgeschenke wegen des nun schon zwei Jahre währenden Krieges von Jahr zu Jahr bescheidener, so bemühte sich trotz allem jeder, den anderen irgendwie zu erfreuen.
Das passte so recht zu dem Wandspruch, den Klausners seit ihrem Hochzeitstag über der Flurtüre hängen hatten:
Mag draußen die Welt ihr Wesen treiben - mein Heim soll meine Ruhstatt bleiben!
Morgens pünktlich aus den Federn zu kommen, kostete Jürgen meistens mächtig Überwindung. Mehrmals musste seine Mutter ins Schlafzimmer kommen, um ihn zu mahnen, doch endlich aufzustehen.
Heute schien dies aber anders zu sein, denn er hatte seinen dreizehnten Geburtstag. Die Arme unter dem Kopf zusammengeschlagenen, lag er schon hellwach und überlegte: Ob es Vater gelungen ist, einen Bezugsschein für die Fahrradreifen zu bekommen, die ich seit langem benötige? Sicher - so wünschte er sich - wird Mutter beim Kunze-Bäcker eine Dreizehn backen lassen haben. Vielleicht kleiner als üblich, weil die Brotmarken nicht reichten. Der Rosenstrauß wird gewiss auf dem Geburtstagstisch in der bauchigen Vase stehen, denn für Blumen braucht man ja weder einen Bezugsschein noch Marken.
Er musste lächeln, überhaupt solchen Quatsch zu ersinnen, dass vielleicht noch für Blumen eine Bezugsgenehmigung benötigt würde. So ein wenig zu spinnen konnte ihm ja keiner verbieten. Er brauchte niemand zu erzählen, was er sich dachte, nicht einmal seiner Mutter.
Schmunzelnd lag Jürgen im Bett. Er war einfach aufgekratzt, weil er heute seinen Festtag hatte. Seine Decke ein wenig fort schiebend, grübelte er darüber nach, was so ein Geburtstag doch für Auswirkungen mit sich brachte.
Von selbst war er heute munter geworden! Mutter hatte ihn weder zu wecken brauchen, noch wiederholt mahnen müssen: Na, was wird denn nun, steh endlich auf! Du musst zur Schule!
Fast hätte er sie nicht bemerkt, so sehr war er mit sich beschäftigt. Das dunkelgrüne Rollo sauste am Fenster nach oben. Dieses Geräusch kannte Jürgen nur zu gut, hatte es ihn doch schon manchen Tag aus dem Schlafe gerissen! Oft hing es ihm noch während des Vormittags in den Ohren, wenn seine Gedanken in den Schulstunden spazieren gingen.
Heute jedoch war es für ihn eine Morgenmusik. Der jetzt ins Schlafzimmer spielende neue Tag mit seinem blank geputzten Morgenhimmel versprach ein echter Feiertag zu werden.
Mutter Klausner beugte sich über ihren Jungen und sagte: »Du bist schon munter! Heute brauche ich meinen Langschläfer wohl gar nicht erst zu wecken? Wie kann es zum Geburtstag auch anders sein.« Mütterliche Liebe umwob ihre Augen, als sie das Fenster öffnete.
Währenddessen fragte er: »Hat Vati Reifen für meine Spule bekommen?«
»Wer wird denn da so neugierig sein? Wirst es schon sehen! Komm rüber in die Stube!«
Jürgen sprang mit einem solchen Ruck auf, dass das Federbett fast auf den Boden gefallen wäre. Barfüßig rannte er aus dem Schlafzimmer zur Wohnstube. Um ein Haar hätte er dabei den mit seinen Kleidungsstücken belegten Stuhl umgerissen.
Die Mutter schüttelte lachend den Kopf. »Du müsstest jeden Tag Geburtstag haben, dann wäre das Aufstehen für dich kein Problem mehr!«
Mit Indianergeheul umtanzte Jürgen den Tisch, war es Vater doch gelungen, die ersehnten Fahrradreifen tatsächlich zu beschaffen. Die gebackene Dreizehn war wunschgemäß auch vorhanden, dieses Jahr aber wirklich sehr viel kleiner und ohne Zuckerguss, den Jürgen doch besonders gerne schleckte. Der Krieg ließ auch diesen winzigen Luxus eben nicht mehr zu.
Gerade wollte er nach einem Päckchen greifen, das mit einem bunten Band zusammengeschnürt war, als Mutter seine Hände ergriff: »Also, mein lieber Kleiner, jetzt will ich dir erst einmal zu deinem Geburtstag gratulieren!«
Sie drückte ihren Jüngsten fest an sich und wünschte ihm alles Gute. Dabei dachte sie auch an ihren großen Sohn, der als Soldat irgendwo an der Front in Westeuropa stand.
Ihre Liebe galt in diesem Augenblick nicht nur Jürgen, sondern gleichzeitig auch ihrem Reinhard, weshalb sie Jürgen umso fester an sich presste und ihm dabei zärtlich über das Haar strich.
»Aber Mutti, warum kommen dir die Tränen?« Verwundert blickte er sie an. »Was ist denn los?«
»Ach nichts, mein Junge!«
»Wisch dir die Tränen aus dem Gesicht! - Na siehst du, so gefällst du mir viel besser.«
Beide lachten und die Mutter steckte ihr Taschentuch in die Schürzentasche zurück.
Die neuen Fahrradreifen waren an ein Tischbein gelehnt. Den runden Geburtstagstisch zierte ein weißes Tischtuch mit Blumenmuster. Zart duftend präsentierten sich die Rosen.
Nun wickelte Jürgen endlich das Päckchen aus. Er legte Bogen um Bogen verschiedenen Papiers auseinander, bis er eine kleine Schachtel in den Händen hielt. Er öffnete sie vorsichtig, dann hüpfte er wieder vor Freude von einem Bein auf das andere.
»Eine Taschenlampe! Also, meine liebe Mutti, schönsten Dank - danke für alles, und über die Taschenlampe freue ich mich ganz besonders!« Übermütig blinkte er seiner Mutter mit der schwarz lackierten Lampe ins Gesicht.
Sie erklärte: »Taschenlampen gibt es zu kaufen, weil sie bei der Verdunklung unbedingt gebraucht werden. Nimm sie während der Verdunklung nicht unnütz, sonst können wir wegen Nichteinhaltung der Luftschutzdisziplin angezeigt werden.«
In strammer Haltung, die linke Hand an der Hosennaht des Schlafanzugs liegend, streckte Jürgen ihr die Rechte entgegen: »Hiermit danke ich meiner Mutter für die Belehrung über das luftschutzgemäße Verhalten mit der Taschenlampe während der Verdunklung!«
Er griente seine Mutter an, worauf sie entgegnete: »Mach bitte keine albernen Witze! Es war ganz ernst gemeint.«
»Ich werde mit der Lampe keinen Unfug anstellen, Mutti!«
»Hier ist auch ein Brief von Reinhard an dich.« Mutter Klausner reichte ihm das mit vielen Stempeln versehene Kuvert.
»Herrn Jürgen Klausner«, las er. »Donnerwetter, Herrn steht auf dem Umschlag. - Du, Mutti, ab wann ist man eigentlich ein richtiger Herr oder Mann, so mit allen Rechten und Pflichten meine ich?«
»Nun, frühestens mit achtzehn Jahren«, antwortete sie ihm und ergänzte: »zuvor ist man noch ein Kind.«
»Aha, wenn die Sache so ist, müsste es richtig heißen: An das Kind Jürgen Klausner.« Lachend fügte er hinzu: »Den süßen kleinen Matz!«
Er wickelte jetzt noch ein weiteres kleines Päckchen aus, das die Mutter eben erst auf den Tisch gelegt hatte.
»Du, Mutti, die passen prima zu meiner Jungvolkuniform«, stellte er fest, nachdem ein Paar graue Kniestrümpfe zum Vorschein gekommen waren.
»Ja, die gehören dazu. Kniestrümpfe gibt es meistens in grau, weil sie unbedingt zur Uniform passen müssen. Du kannst sie natürlich auch zu deiner normalen Kleidung anziehen.« Nach kurzem Überlegen ergänzte sie: »Die Strümpfe sind von den letzten Punkten der Kleiderkarte.«
Am Tonfall ihrer Worte bemerkte Jürgen wieder einmal, dass die Jungvolkuniform seiner Mutter ein Dorn im Auge war. Er wollte noch etwas erwidern, unterließ es jedoch. Ihm schien es besser so.
»Aber nun dalli, dalli, anziehen und frühstücken, sonst kommst du heute wirklich noch zu spät in die Schule!«, mahnte seine Mutter.
Wenig später läutete es an der Wohnungstüre Sturm. Ilse Klausner öffnete. Unter lautem Getöse wurde sie von Jürgens Schulkameraden Hans und Eberhard überrumpelt. Die beiden Jungen stürmten gleich in die Wohnstube, um ihm zu gratulieren.
Jürgen war bemüht, die letzten Bissen seines mit Kunsthonig bestrichenen Brötchens hinunterzuschlingen und muffelte: »Danke schön!«
Hans ergriff die Reifen und ereiferte sich: »Junge, Junge, hast du Massel! Zwei Pneus! Tolle Sache! Jetzt können wir endlich wieder gemeinsame Radtouren drehen, ohne Angst zu haben, dass es pffft macht und dein Hinterrad auf der Felge watschelt.«
Eberhard stand am Tisch, die Hände in den Hosentaschen, und sagte: »Schließlich ist es auch keine Sache, wenn man nur noch auf Flicken umherfährt. Mann, dein Rad wird ja wie neu!«
»Mensch, spinn nicht so in die Gegend, Eberhard!«, meinte Hans kopfschüttelnd, dabei mit dem Kuchen liebäugelnd. »Frau Klausner, bleibt’s dabei? Dürfen wir heut Nachmittag kommen? Ist doch Tradition, alte Freunde verlassen einander nicht.«
»Ja, natürlich, Hans. Wir werden so gut wie möglich Geburtstag feiern.«
»Nicht wahr, Frau Klausner, Kaffeetanten sind wir deshalb aber nicht? Ich meine wegen Kaffee und Kuchen und so!«
»Ach Unsinn, Hans, bei uns wird Geburtstag gefeiert, solange dies überhaupt nur möglich ist.«
»Also Leute, kommt, sonst müssen wir noch rennen«, erinnerte Jürgen und schaute dabei auf Hans, der sich mit seinen Blicken offensichtlich vom Kuchen nicht trennen konnte.
»Du, der Kuchen sieht echt lecker aus - wenn der auch so schmeckt …«, bemerkte Hans beim Weggehen erwartungsvoll.
»Acht Stunden musst du dich noch gedulden, verfressenes Luder!«
»Wer ist denn hier verfressen?«, brummelte Hans.
Mit Heil Hitler! verabschiedeten sich die beiden Freunde von Frau Klausner.
»Na, macht’s mal gut, ihr Lausejungen.«
Die Burschen stürmten die Treppe hinunter. Ilse Klausner hörte die Haustür an die Hauswand schlagen, so schwungvoll war sie aufgerissen worden.
Auf dem Weg zur Schule sagte Hans mahnend: »Hoffentlich habt ihr nicht vergessen, dass heute beim alten Mayer eine Biologiearbeit steigt!«
»Ei! Daran habe ich überhaupt nicht mehr gedacht«, gestand Jürgen erschrocken ein und ihm schien, als würde sein Schulranzen in diesem Moment einige Kilogramm schwerer werden. »Das werden wir schon meistern«, versuchte er sich und seine Freunde zu beruhigen.
»Ja, du bist so’n richtjer Meester«, spöttelte Eberhard.
Hans meinte: »Alles halb so wild, heute gilt unsere ganze Konzentration der Geburtstagsfeier bei Klausners und nichts anderem. Biologie ist interessant, doch heute werden wir uns mit dem Schrumpfvermögen von Backwaren beschäftigen, oder hat das nichts mit Naturwissenschaft zu tun? Schließlich ist Kuchen Materie, die man sogar essen kann.«
»Wenn es bei Herrn Hans um die Fresserei geht, stinkt er vor Intelligenz«, entgegnete Jürgen lachend.
»Denkt ihr vielleicht, ihr könntet mich verspotten, ihr A...«, schlug Hans zurück.
»Nun, Affen wolltest du bestimmt nicht zu uns sagen, sondern: ihr alten, guten Kameraden.« Eberhard räusperte sich erhaben, was bedeuten sollte: Na, wie habe ich’s dir gegeben, mein lieber Hans?
Bevor sie ins Klassenzimmer traten, erinnerte Jürgen an seinen Geburtstag: »Also denkt daran: Halb vier große Feier mit Feuerwerk bei Klausners.«
Eberhard drängte: »Los, nun kommt doch, es hat bereits zum zweiten Mal geklingelt. Der Mayer wird gleich antanzen.«
In der Sonnenleite Nummer 6, wo Klausners mit fünf anderen Parteien wohnten, war in der Mittelwohnung der ersten Etage Mutter Klausner derweil beschäftigt, die Zimmer aufzuräumen. Sie wusch das Frühstücksgeschirr ab und hantierte da und dort.
Schließlich nahm sie die abgegriffene Markenmappe aus dem Schrank und überprüfte ihre Lebensmittelkarten. Sparsam gewirtschaftet hatte sie wohl, aber trotzdem waren die aufgesparten Marken dürftig, sodass sie nur das Allerwichtigste für die Feier würde einkaufen können.
Ihr schmerzte schon der Kopf, wenn sie die monatlichen Marken vom Blockwart erhielt. Es geht aber den meisten Hausfrauen so, versuchte sie sich immer wieder zu trösten.
Ilse Klausner ergriff beklommen ihre kunstlederne Tasche, um ihre Besorgungen zu tätigen. Gern wollte sie Jürgens Wunsch erfüllen, mittags Krautrouladen für ihn zu kochen - sein Leibgericht.
Stets, wenn die Lebensmittelkarten wie ein fragwürdiger Scherenschnitt aussahen, zogen sich Sorgenfalten ins Antlitz der Kriegsfrauen, wie auch sie eine war.
Mathematisch genau galt es dann, die noch verfügbaren Rationen einzuteilen, damit der Anschluss an die nächsten Karten garantiert war. Ilse grübelte darüber nach, ob sie heute, dem Anlass geschuldet, nicht gar unbedacht handeln würde.
Dann verließ sie das Haus. Nach einer Stunde war sie mit ihren Einkäufen zurück.
Ihren Sohn hörte Ilse schon von weitem. Er pfiff sich gern ein Liedchen, manchmal freilich in recht schrillen Tönen. Sie stutzte: »Was denn, kommt Jürgen schon wieder heim?« Erstaunt schaute sie zur Wanduhr. Tatsächlich, es war schon eins.
Doch sie freute sich, wenn ihr jüngster Sohn guter Dinge war. Es klang, als würden Jürgens Schuhe auf der Treppe noch den Takt zu seinem Pfeifkonzert schlagen. Er brauchte nicht zu klingeln, denn seine Mutter stand schon an der Tür und scherzte: »Dich hört man ja kilometerweit!«
Er strich sich die schmutzigen Schuhe ab und stieß dabei gegen die Wohnungstür. Das war ihm sehr peinlich, weil er wusste, dass Mutter sich stets sehr viel Mühe machte, die Wohnung sauber und ordentlich zu halten.
Vorsichtshalber sagte er: »Entschuldige, Mutti, es war nicht mit Absicht.«
Spitzbübisches Lächeln blitzte unverhohlen aus seinen zusammengekniffenen Augen: was sollte Mutter hierauf sagen? Sie meinte nur: »Besser aufpassen wäre mir lieber!«
»Ui, das duftet, das duftet! Gibt’s Rouladen? Meine Mutti ist doch die Beste, die Allerbeste! Ich hab’s ja schon immer gesagt!« Er fasste sie an den Händen, tanzte mit ihr und sang: »Wiener Blut, das ist gut, das ist gut, trala lala …«
»Junge, bist du heute aber wild! Wenn das neue Lebensjahr so weitergeht, wie es beginnt, na dann gute Luft!«
»Ja, gute Luft und feiner Duft, trala lala«, alberte er weiter und verschwand in der Küche.
Versucht, mit der linken Hand den Topfdeckel zu lüften, dabei mit der anderen nach einem Löffel greifend, hielt ihn die Mutter am Jackenkragen zurück: »Naschpeter gibt’s mit dreizehn Jahren aber nicht mehr!«
Er schaute sie enttäuscht an, zog ein langes Gesicht und ließ unwillig den Deckel klappernd auf den Topf zurückfallen. Auch der Löffel klimperte unbenutzt auf einen Teller.
Wie schon der Morgen angekündigt hatte, lastete zur Mittagszeit sommerliche Hitze über der Stadt. Träge hopsten einige Spatzen auf den Latten des Gartenzauns und in den Kirschbäumen naschten dicke Amseln die frisch-roten Früchte an - trotz der darin aufgehängten, glitzernden Staniolstreifen.
In dieses ländlich anmutende Idyll drängte sich der Großstadtlärm mit seiner Hast und Unruhe.
Jürgen sah zum Wohnzimmerfenster hinaus. Sein Blick huschte auf zwei Jungen, die einen hoch mit Schrott beladenen Handwagen zogen - Rohstoff für den Krieg. Laut schwatzten die beiden, um das Gerassel des Wagens zu übertönen.
Kaum waren die jungen Schrottsammler vorbeigerumpelt, galt Jürgens ganze Aufmerksamkeit den im Vorgarten stehenden Kirschbäumen. Er dachte darüber nach, wie oft er hier schon gepflückt haben mochte. Am liebsten wäre er gleich hinuntergegangen, um sich einige Hände voll mit reifen Kirschen abzunehmen.
Mutter Klausner hatte eine Überraschung für Jürgen und seine Freunde vorbereitet. Sie überlegte, ob sie es Jürgen schon sagen sollte oder nicht. Sie entschloss sich aber, damit noch zu warten.
Den Kaffeetisch deckte sie heute besonders liebevoll, wusste sie doch nicht, ob sie im nächsten Jahr dazu überhaupt noch in der Lage wären, ob ihr Mann noch daheim oder wie Reinhard zur Wehrmacht eingerückt sein würde. Kurt hatte im Ersten Weltkrieg in Frankreichs Schützengräben gekämpft, aber heute war es ihr großer Sohn, der diesen Boden erneut zerstampfte.
War Frankreich denn Deutschlands Erbfeind und musste bald jede Generation für diese aufgeputschte Feindschaft Tribut zollen, mussten Millionen Menschen getötet oder zum Krüppel geschossen werden?
In diese Gedanken versunken stellte Ilse Klausner ein Gedeck zusätzlich auf den Tisch und Jürgen, der sich eben vom Fenster abwandte und seiner Mutter zusah, fragte: »Erwartest du noch jemanden, außer meinen Freunden? Hast ja ein Gedeck zuviel auf dem Tisch!«
»Wieso?«, fragte sie irritiert.
»Nun, sieh doch«, erklärte Jürgen, »einmal für dich, einmal für mich, dann für Hans und Eberhard. Das sind vier. Und Vati kommt ja erst später.«
»Stimmt, mein Junge! Na so was! Weißt du, ich dachte an Reinhard und dabei ist mir der Fehler unterlaufen. Wenn er nur erst wieder daheim wäre. Mein Großer!«
»Wo wird der jetzt wohl sein?«, überlegte Jürgen.
»Du hast doch den Brief gelesen. In Frankreich, irgendwo an der Kanalküste. Er darf doch nichts Genaueres mitteilen.«
»Weißt du noch, Mutti, wie schön es zu Festtagen immer war? Was für tollen Spaß wir hatten?«
Mutter stellte den Rosenstrauß wieder mitten auf den Tisch.
»Stimmt, Jürgen, wenn du sagst hatten. Was haben wir noch für Freude in dieser ungewissen Zeit? Keiner weiß, ob nicht schon morgen sein letztes Stündchen schlagen wird.«
»Von wegen letztes Stündchen, so ein Quatsch!«
»Rede ich vielleicht Quatsch?«
»So habe ich das überhaupt nicht gemeint, Mutti.« Leicht verlegen erklärte er: »Durchhalten müssen wir. In der Zeitung steht es täglich: Jeder muss sein Letztes hergeben für Führer, Volk und Vaterland.«
»Jürgen, sprich nicht davon. Diese Redereien kann ich nicht ertragen.«
»Aber Mutti, das ist doch …«
Ilse wandte sich eindringlich an Jürgen: »Nichts ist doch! Jetzt höre mir mal zu: Gleich zu Anfang des Krieges musste Reinhard einrücken. Der Führer befahl es und fertig. Denkst du vielleicht, dein Bruder wurde mit Begeisterung Soldat? Etwa, wie du eben meintest, um sein Letztes zu geben? Als Reinhard so alt war wie du heute bist, gab es noch keine Hitlerjugend, die schon Kinder in Uniformen steckt oder ihnen gar Gewehre in die Hände drückt.«
Jürgen schien den tiefen Sinn der Worte seiner Mutter nicht voll verstanden zu haben, denn er sprach: »Und nun ist Reinhard schon ein alter Krieger, wie er immer schreibt.«
»Was sollte er auch anderes tun, als einzurücken. Wehe dem, der dem Gestellungsbefehl nicht nachkam! - Na, reden wir nicht weiter darüber.«
Still verflossen einige Sekunden, bevor Ilse beklagte: »Vielleicht ist’s auch gar nicht richtig, wenn wir in dieser Kriegszeit hier großartig den Geburtstagstisch decken und so tun, als hätten wir’s. Was wir heute vernaschen, das fehlt uns dann zu den Hauptmahlzeiten. Ach, wir spielen uns täglich immer wieder selbst Theater vor.«
»Du gibt’s wohl nicht gern, Mutti?«
»Zu gerne gebe ich’s, aber … - ja, wenn das aber nicht wäre, Jürgen!«
Während dieser Unterhaltung nahm Ilse nochmals Reinhards Geburtstagsgruß zur Hand. Der Feldpostbrief lag schon mehrere Tage da, weil Reinhard bedacht hatte, ihn rechtzeitig abzuschicken.
In seiner Geburtstagsfreude gestand Jürgen: »Mutti, es ist schön, dass du für uns Jungen dein Sonntagsgeschirr auf den Tisch gestellt hast!«
»Aber wie kommst du ausgerechnet heute zu dieser Feststellung? Wir haben es doch nie anders gehandhabt?«
»Mir fiel es eben auf.«
Seine Mutter sagte dazu: »Ja, wenn man älter wird, stellt man so manches als außergewöhnlich fest, das einem vorher als selbstverständlich galt. Warum soll ich uns eigentlich diese Freude nicht machen - an deinem Ehrentag? Die Kinder sind das höchste Gut der Eltern, und wenn wir Familienfeste feiern, zumal ein Fest eines unserer Kinder, dann wird das Beste auf den Tisch gestellt!«
Ilse spürte heute ein ungewohntes Mitteilungsbedürfnis und wollte ihr Empfinden loswerden. Trotz der Geburtstagsfreude fühlte sie sich bedrückt, ja, fast schon schwermütig. Wiederholt verwünschte sie dieses versteckte Würgen, doch wollte es ihr einfach nicht gelingen.
Auf dem Fensterbrett prangte noch ein Strauß weißer Nelken, der seinen Dufthauch mit dem der frischen Rosen vermischte.
Die auf dem Wohnzimmerschrank stehende Uhr mit ihrem nachschwingenden Gong schlug soeben drei Mal. Bald würden Hans und Eberhard eintreffen.
Jürgen hatte zwischenzeitlich seine Schularbeiten - einen Aufsatz mit dem Thema: Siegreich wollen wir Frankreich schlagen! - fertig geschrieben. Heute jedoch, an seinem Geburtstag, hatte er sich weniger Mühe als sonst gegeben, eigene Gedanken niederzuschreiben, sondern einige Passagen den Neuesten Nachrichten entnommen. Damit würde er sicherlich nichts Falsches verfasst haben.
»Jürgen, jetzt kommt deine Rasselbande«, rief Mutter aus der Küche ins Wohnzimmer hinüber. Stürmisch wie immer klingelten seine Freunde. Jürgen rannte zur Wohnungstür.
Hans Angermann trug seine Sonntagshosen und ein fein gebügeltes Hemd. Eberhard Möbius dagegen stand in der Pimpfenuniform vor Jürgen.
Ilse Klausner kam auch zur Tür: »Nun, Jungs, seid ihr da zum Kuchenessen?«
Hans reichte Frau Klausner die Hand und grüßte wieder: »Heil Hitler!«
Eberhard knallte die Hacken zusammen und grüßte, dazu stramm stehend, gleichfalls mit: »Heil Hitler!«
Jürgens Mutter erwiderte diesen Gruß nicht, sondern sagte: »So zackig brauchst du mich nicht zu begrüßen, Eberhard. Ich bin doch nicht dein Fähnleinführer.«
»Frau Klausner, gelernt ist gelernt«, entgegnete er.
Wie könnte er auch nur anders sein, wenn sein Vater doch Offizier ist, dachte sie bei sich.
Der blonde Eberhard verbarg hinter seinem Rücken ein Päckchen. Majestätisch trat er zu Jürgen und übergab es ihm. Der überlegte, was es wohl dieses Jahr sein könnte. Es war unter ihnen üblich, dass zwei zusammenlegten, um dem Dritten ein Geschenk zu kaufen.
»Also, mein lieber Jürgen«, begann Eberhard feierlich, »heute, zu deinem Geburtstag, überreichen wir dir etwas ganz besonders Schönes und Wertvolles.«
Er machte eine Betonungspause und holte durch die Zähne zischend Luft, bevor er weiter sprach: »Sei dir als deutscher Junge jederzeit bewusst, welche Ehre es ist, dieses Fahrtenmesser, besser gesagt, diesen Ehrendolch des Deutschen Jungvolks, mit dir zu tragen!«
Beide schüttelten sich kraftvoll die Hand. Dann trat Hans zu Jürgen: »Und ich wünsche dir, dass du in nächster Zeit auch Jungschaftsführer, also Träger einer rot-weißen Dienstschnur, wirst.« Freundschaftlich packte er Jürgen am Oberarm und schüttelte ihn herzlich.
Seit einigen Jahren schon hatte sich Jürgen von seinen Eltern solch ein Messer gewünscht. Sein Vater wollte ihm diesen Wunsch aber nie erfüllen. Deshalb freute sich Jürgen heute ganz besonders über dieses Geschenk. Sein Besten Dank, Kameraden kam deshalb aus ehrlichem Herzen.
Die scharfe Klinge betrachtend las er: »Blut und Ehre.«
Er sann ein wenig nach, um den Inhalt dieser ins Metall eingravierten Worte zu erfassen, aber es gelang ihm im Augenblick nicht. In die andere Klingenseite war eine Blutrinne eingeschliffen.
Mutter Klausner äußerte sich zu diesem Geschenk nicht, wusste sie doch, dass es bei ihrem Mann nur Widerwillen und Ärger erregen würde. Ja, sie glaubte fast, er würde Jürgen das Tragen des Messers verbieten.
Sie erkundigte sich bei Eberhard: »Sag mal, du trägst wohl zu Feierlichkeiten neuerdings Uniform?«
Hierauf wusste Eberhard im Moment keine passende Antwort zu geben. Sagte er ja, war es nicht verkehrt, denn die Uniform galt für ihn als Ehrenkleidung, sagte er aber nein, so würde er verleugnen, wie gern er sie anzog.
»Ich habe heute noch Dienst – Unterführerdienst, Frau Klausner«, antwortete er schließlich.
Eberhard war Jungschaftsführer und erwartete, schon bald zum Jungzugführer befördert zu werden. Dann könnte er die heißersehnte grüne Dienstschnur tragen.
»Wann beginnt dein Dienst?«
»Pünktlich um achtzehn Uhr, Frau Klausner.«
Ihr kam es so vor, als würde sich Eberhard bei ihrer Frage automatisch wieder in militärische Positur bringen und sein Rückgrat straffen.
»Ja, Dienst ist Dienst.« Sie schüttelte nachdenklich den Kopf, als wollte sie noch sagen: Eigentlich begreife ich das alles nicht.
»Holst du jetzt die Kaffeekanne, Mutti?«
»Wie das Geburtstagskind wünscht.«
Nach wenigen Augenblicken stand der dampfende Kaffee auf dem Tisch. Aber auch die Kirschtorte trug sie als Überraschung auf.
»Oho, oho, was bringst du denn da noch? Eine Kirschtorte! Ich werde verrückt«, jubelte er und konnte es nicht unterlassen, hinzuzufügen: »Mutti, wie hast du das bloß noch geschafft?«
»Lasst es euch nur gut schmecken und fragt nicht nach dem Wie und Woher. - Ist mir die Überraschung gelungen?«
»Und ob, Frau Klausner!«, bestätigten die Gäste wie aus einem Munde.
»Hast du deinen Aufsatz fertig geschrieben?«, wollte Jürgen von Eberhard wissen.
Siegesgewiss lächelnd sagte dieser: »Selbstverständlich. Ich habe geschrieben, dass Frankreich mit wuchtigen Angriffswellen überrannt wurde und dass wir’s den Franzosen ordentlich gegeben haben.« Derart altklug betonte er hierbei seine Worte, als wäre er selber mit dabei gewesen.
»Übrigens schrieb mein Vater unlängst«, berichtete Eberhard weiter, »dass er bald zu einem besonderen Kommando versetzt werde, um in Frankreich mit den kriminellen Franktireurs radikal aufzuräumen.«
»Was sind denn Franktireurs?«, fragte Hans.
»Nun, Freunde, das sind Banditengruppen, die im Hinterland der Front gegen unsere Truppen kämpfen, obwohl sie keine rechtmäßigen Soldaten sind. Mein Vater wird künftig als Offizier eine Kampfeinheit befehligen, die diese Banden vernichten soll. Ihr könnt euch darauf verlassen: Mein alter Herr wird den Franzmännern gehörig das Laufen beibringen.«
Hans war sogleich wieder Feuer und Flamme und wollte Näheres darüber wissen, aber Eberhard winkte ab: »Mehr weiß ich auch nicht!«
Während dieser Erörterungen langten die Jungen hastig zu.
Stöhnend lehnte sich Eberhard bald vom Tisch zurück: »Jetzt kann ich nichts mehr essen.« Ilse Klausner quittierte Eberhards Seufzer mit einem Dankeschön.
Eberhard sprach weiter: »Wenn wir heute Abend gejagt werden, kann ich bestimmt nicht auf und nieder. Mein Fähnleinführer wird mich anspitzen: Die bleierne Ente hat wieder mal zu viel gefressen und kann sich nun nicht mehr bewegen. Dann habe ich das Vergnügen - zur Auflockerung, müsst ihr wissen -, dreimal um den Sportplatz zu sausen. Na ja, andermal lass ich dafür einen meiner Pimpfe traben.«
Jürgen wollte Eberhards Redefluss abbremsen, weil er bemerkte, dass er Ausdrücke gebrauchte, die bei seiner Mutter nur Verärgerung erregten. Daher merkte er an: »So ist’s richtig: Wenn du eine drübergebraten kriegst, dann willst du den gleichen Stock in die eigenen Hände nehmen und damit zurückschlagen. Mein Fall wäre das nicht, bestimmt nicht!«
»Nur keine Zimperlichkeiten! Mensch, wer nicht spurt, dem wird Dampf unter dem Hintern gemacht, der geht auf die Rennbahn!« Überlegen blickte er in die Runde.
Ilse Klausner staunte, was für Ausdrücke Kinder heutzutage doch hatten und überzeugt davon waren, sich mit allen Mitteln gegenseitig die herrschende Ideologie aufdrängen zu müssen. Sie musste endlich eingreifen.
»Also, Jungs, jetzt fehlt bloß noch, ihr streitet euch darum, wie ihr eure Freunde …«
»Das heißt Kameraden und nicht Freunde, Frau Klausner«, platzte Eberhard dazwischen.
»… am besten ärgern könnt.«, brachte Ilse Klausner ihren Satz zu Ende.
Hans wollte Eberhard nicht nachstehen und ergänzte dessen Belehrungen gegenüber Frau Klausner: »Ja, auch schon im Jungvolk herrscht das Führerprinzip. Das heißt, was ein Führer befiehlt, muss ausgeführt werden, selbst wenn es verkehrt ist. Keiner darf sich dem widersetzen. Wer das versucht, ist ein Staatsfeind - das sagte neulich erst unser Fähnleinführer in einer Befehlsausgabe. Jawohl, das hat er gesagt!«
»Nun schnappt mal nicht über! - Sagt mal, habt ihr denn überhaupt nichts anderes im Kopf, als anderen Jungs Befehle zu erteilen und von ihnen Gehorsam zu verlangen?« Das Herz schlug ihr bis zum Halse. »Denkt doch mal: ihr seid Kinder! Wo soll das nur alles noch hinführen?«
»Ach Mutti, das verstehst du nicht! In der Zeitung steht es doch jeden Tag: Die Front braucht harte Männer, deshalb müssen schon wir Jungen zu Gehorsam und Pflichterfüllung erzogen werden.«
»Sehen Sie, Frau Klausner, der Jürgen weiß schon, warum dies notwendig ist«, stellte Eberhard fest.
Doch sie wandte sich ihrem Sohn zu und fragte: »Glaubst du etwa gar, dass du diesen Krieg noch mitmachen musst?«
»Ich weiß nicht, aber …«
»Was aber?« Um eine Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Sohn vor den Augen seiner Freunde zu vermeiden, wurde sie energisch: »Jetzt reden wir nicht mehr von Befehlen und Krieg und wie ihr andere Menschen peinigen könnt! Schluss mit dieser Rederei. Schluss!«
Unausgesprochen schwor sie sich, auf ihren Jürgen zukünftig mehr Einfluss zu nehmen, damit er nicht ins Fahrwasser eines Möbius oder Angermann geriete.
Erleichtert atmete sie auf, als es läutete und ihr Mann von der Arbeit nach Hause kam. Vom Flur aus rief er ihnen zu: »Das Geburtstagskind soll zu mir kommen!«
Er ging mit Jürgen, der ihm entgegen gerannt war, gleich in die Küche, denn es war seine Eigenart, persönliche Dinge unter vier Augen abzumachen.
Er gratulierte seinem Jungen: »Also, mein Kleiner - bald darf ich das schon nicht mehr sagen -, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles, alles Gute. Bleibe so, wie du bist und bessere dich noch!« Mit den letzten Worten glitt ein Lächeln über sein abgespanntes, blasses Gesicht. Fest drückte auch er den Kopf seines Sohnes an sich.
Jürgen freute sich über diese kameradschaftlichen Worte und meinte: »Ich habe aber noch einen Geburtstagswunsch.«
»Und der wäre? Was in meinen Kräften steht, will ich tun! Na, was ist’s?«
»Ich wünsche mir den Sieg! Dann kommt auch mein Bruder heim, dann gibt’s genug zu essen, dann brauchen wir nicht mehr zu verdunkeln, dann brauchen wir keine Angst mehr zu haben, dass uns eine Bombe aufs Haus kracht, dann …«
»Schön wär’s!«, fiel der Vater Jürgen ins Wort.
Der aber redete weiter: »Vati, mein Geschichtslehrer Zinser hat heute erst wieder gesagt, wenn eine Kriegsmaschine so rollt, wie die unseres Führers, dann gibt’s kein Aufhalten. Alles wird niedergewalzt, was in den Weg kommt - bis zum Endsieg!«
»Ja, der Hitler rammelt alles über den Haufen. Aber deinem Wunsch, deinem Herzenswunsch, Reinhard möge gesund nach Hause kommen: dem schließe ich mich an. Wie könnte es auch anders sein. Ich fürchte, Reinhard wird nicht der einzige aus unserer Familie bleiben, der an die Kriegsfront muss.«
»Wie meinst du das, Vati?«
»Darüber sprechen wir später noch, wenn wir allein sind. Jetzt will ich erst einmal deinen Freunden guten Tag sagen.«
Vater Klausner lief nun über den kleinen Flur. Vor der Wohnzimmertür blieb er einen Moment stehen und schob mit einigen Handgriffen sein von der Mütze niedergedrücktes, leicht ergrautes Haar locker. Dann trat er ein.
»Tag, Jungs! Schön, dass ihr wieder mal bei uns seid.« Er schaute auf den Tisch. »Hat euch der Kuchen geschmeckt?«
Hans Angermann lobte strahlend: »Danke, große Klasse, Herr Klausner!«
»Ja, unsere Mutti zaubert immer wieder etwas Besonderes«, meinte Vater Klausner. Dann entschuldigte er sich für ein paar Minuten: »Jungs, gleich bin ich wieder bei euch.«
Nachdem er sich gewaschen und umgezogen hatte, setzte er sich mit in die Wohnstube zu Jürgens Gästen. Seine Frau hatte ihm eine Tasse Blümchenkaffee eingeschenkt und er ließ sich nun ebenfalls ein Stück Kirschtorte schmecken.
Er nickte zu Eberhard und fragte: »Du scheinst heute noch etwas vorzuhaben, weil du in großer Uniform zu Besuch gekommen bist?«
»Ich bin Jungschaftsführer und hab heute noch Führerdienst.«
»So, so, Führerdienst hast du. Musst wohl bald gehen?«
»Kurz vor achtzehn Uhr.«
»Hans, du bleibst aber noch etwas länger?«
»Ja, ich kann noch bleiben!«
Kurt Klausner sagte zu seiner Frau: »Ursel hat mich heute im Betrieb angerufen. Sie kommt mit Herbert gegen Abend bei uns vorbei.«
»Nanu, sie wollten doch erst am Sonntag kommen?« Zögernd befürchtete sie: »Ist etwas passiert?«
»Ja, es ist etwas passiert: Herbert hat den Gestellungsbefehl bekommen. In vier Tagen muss er eintreffen.«
Das hatte Ilse nicht erwartet. Ihr Mann wandte sich an Jürgen: »Nun weißt du, was ich dir vorhin schon andeutete: Reinhard bleibt nicht der einzige in unserer Familie.«
Ilse fragte besorgt: »Wo muss er denn hin?«
»Zu den Fliegern - irgendwo in Norddeutschland.«
Nachdenklich trank Kurt Klausner den letzten Schluck Kaffee, dann brannte er sich eine Zigarette an.
»Und sie sind gerade erst ein paar Wochen verheiratet. Wer weiß, ob und wann Herbert wieder nach Hause kommt.«
»Herr Klausner«, mischte sich Eberhard frech ins Gespräch, »ist es denn nicht Ehrensache, für den Sieg Großdeutschlands zu kämpfen?«
»Ehrensache? Eine hohe Ehre ist’s, für Deutschland zu sterben.«
Nur den Gegenstand Ehre hatte Eberhard erfasst, die unausgesprochenen Gedanken aber blieben ihm verborgen, genau wie es Vater Klausner beabsichtigt hatte. Der dachte bei sich: Es ist wirklich schlimm, wie die Kinder für den Krieg getrimmt werden. Jeder wird mit ins große Kriegspaket eingeschnürt, keiner kann sich heraushalten.
Solcherart Massenpsychose gegenüber kam er sich wieder einmal machtlos vor. Möbius’ Vater war Militäroffizier und der von Angermann langjähriger Polizeioffizier gewesen. Wie konnte er, der einfache Arbeiter Kurt Klausner, diese Söhnchen belehren wollen? Ein unbedachtes Wort und die zwei konnten ihn bei den Staats- oder Parteiorganen anschwärzen.
Er ballte seine Fäuste, dass die Knöchel blutlos weiß wurden. Gelassen ruhig sagte er dann: »Der Krieg ist hart und er fordert Opfer.«
Eberhard Möbius ergänzte mit soldatisch straffer Miene: »Und wenn es sein muss: das Leben!«
»Du redest, wie’s dir gelehrt wird.« Mehr wagte er aber nicht hinzuzufügen. Doch nach einer Weile, als er Eberhard in dessen brauner Pimpfenuniform fixierte, wandelte er diese gedanklich in eine Wehrmachtsuniform um, an der etliche Kriegsauszeichnungen prangten.
Überschäumend quoll es aus ihm hervor: »Deine Uniform, Eberhard, steht dir recht gut! Du wirst in ihr noch ein großer Mann!«
»Was meinen Sie damit?«
»Das wirst du hoffentlich rechtzeitig verstehen lernen, mein Lieber!«
Eberhard stand plötzlich auf und verabschiedete sich: »Ich muss zum Dienst.«
Vater Klausner konnte sein Lächeln nicht verkneifen, als er den eifrigen Eberhard aufspringen sah. »Ja, wenn du Dienst hast, musst du gehen«, unterstützte er dessen Vorhaben, obwohl Eberhard seiner Ansicht nach noch Zeit gehabt hätte. Wollte er so etwa eine weitere Unterhaltung mit ihm vermeiden?
»Herr Klausner, wir haben Führerdienst. Ich muss pünktlich auf dem Stellplatz sein. Disziplin ist oberstes Gebot!«
Ilse Klausner folgte, im Sessel zurückgelehnt, den Gesprächen. Mütterlich sagte sie zu Eberhard: »Bevor du gehst, gebe ich dir erst ein bisschen vom Kartoffelsalat.« Sie stand auf und verließ die Wohnstube.
Trotz ihrer achtundvierzig Jahre wirkte sie jung: die weich betonten Backenknochen im faltenlosen, blassen Gesicht, ihr kastanienbraunes Haar straff nach hinten gekämmt und dort, als Rolle geformt, zusammengesteckt. Einzelne Silbersträhnen hatten sich schon dazwischengeschmuggelt.
Während Eberhard zunächst einmal seinen Dienst zu vergessen schien, als Frau Klausner vom Abendessen sprach, rief Hans ihr in die Küche nach: »Der braucht nichts mehr zu futtern, der hat doch vorhin den ganzen Kuchen fast allein verspachtelt.«
Eberhard bekam einen roten Kopf. Angekränkelt meinte er: »Nun mach’s bloß halb lang. So schlimm war es nun auch wieder nicht! - Wie denken Sie darüber, Frau Klausner?«
Nachdem Eberhard hastig den von ihr gereichten Salat verschlungen hatte, empfahl er sich und verließ die Wohnung. Bei Herrn Klausner knallte er gewohnheitsgemäß die Hacken zusammen. Der aber dachte bei sich: Dieser Miniaturgeneral kann es einfach nicht lassen!
Erinnerungen an schikanöses Strafexerzieren und manche Sonderdienste im Kriegsjahr 1916 wurden in ihm wach. Er sah sich durch morastige Tümpel robben und hörte sich ein dreifaches Hurra! auf den Kaiser rufen. Ganz nach dem Befehl des Feldwebels. Wie oft auch hatte er während seiner Militärzeit erfahren müssen, dass mancher Vorgesetzte, nachdem seine Schulterklappen mit Lametta dekoriert worden waren, seine eigenen Kameraden nicht mehr kennen wollte.
Und im eigenen Betrieb war es ähnlich. Getragen von gieriger Postenhascherei waren für manch Emporgekommenen die ehemaligen Kollegen und jetzigen Untergebenen zu Dreck geworden. Pfui Teufel. Am liebsten hätte Kurt Klausner ausgespien, so bitter schmeckte ihm sein Speichel.
Auf dem Flur wurde Eberhard von Hans und Jürgen verabschiedet. Er stand vor dem Spiegel und besah sich mädchenhaft genau vom scharf gezogenen Scheitel bis zu den gleichmäßig gebundenen Schnürsenkeln. Vor allem die rotweiße Jungschaftsführer-Dienstschnur musste vorschriftsmäßig sitzen. Dann riss er die Schultern nach hinten und prüfte den Sitz des Käppis.
»So, Kameraden, jetzt geht’s los. Wenn ihr erst Führer seid, dürft ihr auch mit zum Führerdienst gehen!«
Die Tür klappte hinter Eberhard zu.
Jürgen öffnete sie wieder und rief ihm nach: »Hoffentlich wirst du richtig getriezt! Wir feiern weiter meinen Geburtstag.« Eberhards Erwiderungen hierauf verloren sich – unverständlich für die Zurückgebliebenen – im Flur des Hauses.
Kurt Klausner hatte inzwischen das Mensch-ärgere-dichnicht-Spiel hervorgeholt und aufgebaut. Als die Jungen wieder hereinkamen, freuten sie sich auf ein Spiel zu dritt.
Sie hatten ihre erste Partie noch nicht beendet, als es klingelte. Jürgen rannte zur Tür und öffnete sie.
»Fein, dass ihr zu meinem Geburtstag kommt! Jetzt wird’s erst richtig lustig«, hörten die anderen ihn rufen.
Onkel Herbert hatte stets einige Späße zur Begrüßung parat, doch heute sagte er nur schlicht: »Herzlichen Glückwunsch, mein lieber Jürgen.«
Er blickte sorgenvoll einher. Sicherlich belastete ihn die heute erhaltene Einberufung. Auch seine Frau Ursula wirkte bedrückt.
Nachdem Kurt seine Schwägerin und seinen Bruder herzlich begrüßt hatte, nahm er Jürgen noch im Flur beiseite und sagte leise zu ihm: »Geh mit Hans in die Küche, damit wir uns mit Onkel Herbert in Ruhe unterhalten können.«
»Mich interessiert doch auch, was er uns sagen will.«
»Ja, aber der Hans braucht nicht alles mitzuhören. Onkel Herbert wird über seine Einberufung nicht begeistert sein.«
»Na, und was hat das mit Hans zu tun?«
Leise, jedoch eindringlich genug, erklärte Kurt seinem Jüngsten: »Sehr viel. Sein Vater ist ein alter Offizier – und diese Leute sind vom Militär und dem Krieg begeistert. Sie könnten deshalb nie verstehen, was ein Krieg für Menschen wie wir, für die kleinen Leute also, bedeutet.«
Etwas verwirrt fragte Jürgen: »Wieso sind wir kleine Leute?«
»Herrgott noch mal, denen gegenüber sind wir klein. Der alte Angermann gehört zu denen, die über uns bestimmen. Du verstehst mich nicht, oder?«
»Nein, Vati, das verstehe ich nicht.«
»Wir sprechen später darüber. Geh jetzt bitte in die Küche.«
Kurt bemerkte Jürgens Unwillen, sodass er ihm noch freundschaftlich auf die Schulter klopfte.
Auf dem Fensterbrett stand die Schüssel mit Kartoffelsalat. Obwohl sie mit einem Teller zugedeckt war, durchzog ein würziger Essig-Zwiebel-Duft die Küche.
Jürgen bückte sich, um einen unter dem Schrank stehenden Karton hervorzuholen, in dem die von ihm gebastelten Kriegsschiffe ihren Platz gefunden hatten. Genau nach Bauplan waren sie gefertigt, die blau-grau lackierten Modelle von Kreuzern und Zerstörern der Kriegsmarine.
Hans drehte an den Geschütztürmen und richtete sie auf Jürgen, dabei Geschützdonner nachahmend. Jürgen hätte jetzt auch gern eine Seeschlacht gespielt, aber er besann sich eines Besseren: »Pst, mach nicht so laut, meinem Vater passt es nicht, wenn ich Krieg spiele.«
Hans verzog verächtlich sein Gesicht. »Na, dann eben nicht«, murrte er. »Erst fliegen wir aus dem Zimmer und dann dürfen wir nicht mal ein bisschen schießen. Mensch Meier, diese Spielerei ist doch prima, Jürgen. Da ist doch weiter nichts dabei, da kann doch nichts passieren!«
»Aber wenn’s mein Vater nicht mag, dann lassen wir es zumindest jetzt.«
»Du hast ja unheimlich Schiss vor deinem Alten.«
Geringschätzig schob Hans den Panzerkreuzer Bismarck zur Seite, der vor ihm auf dem mit Wachstuch belegten Küchentisch stand.
»Wenn der Vater befiehlt, muss der Junge springen - ha, ha. Erst darfst du Panzerkreuzer basteln, aber dann nicht damit schießen – verstehe ich nicht!«
»Na, manchmal darf ich schon, aber meistens wird mein Vater wütend. Einmal hätte er bald so ein Schiff in die Ecke gefeuert.«
Jürgen schob den Bismarck verlegen hin und her.
Den Begriff konsequent und den Wortinhalt von Wem nützen Waffen? kannte er nicht. Für Jürgen und seine Generation galt als Feind, wer nicht arischer Abstammung war oder gar zu den Bolschewiken zählte. Warum eigentlich? Wusste es denn Kurt Klausner?
»Du bist eben ein gescheites und folgsames Kind«, foppte Hans und zog abschätzig seine Augenbrauen hoch. »Ja, was machen wir dann?« Dabei richtete sich sein Blick auf eine Flasche, die halb verborgen auf einem Schrank stand. Er packte Jürgens Kopf an beiden Ohren und drehte ihn dorthin. »Winnetou mit seinem scharfen Blick hat eine große Entdeckung gemacht! Siehst du sie, mein weißer Bruder?«
Jürgen wollte sich befreien, wobei er mehrmals versuchte, seinen Kopf zu drehen, aber den hielt Hans so fest, dass er dessen Entdeckung zwangläufig erspähen musste. Überrascht sagte er: »Eine Flasche!«
Nachdem Hans ihn wieder losgelassen hatte, kletterte Jürgen auf einen herangeschobenen Stuhl und angelte sie mit seinem rechten Arm hervor. Still las er ab: »Echter Kümmel, Vol. 40% - Junge, Junge, wie kommt denn die Flasche hierher? Du, der Korken sitzt schon locker!«





























