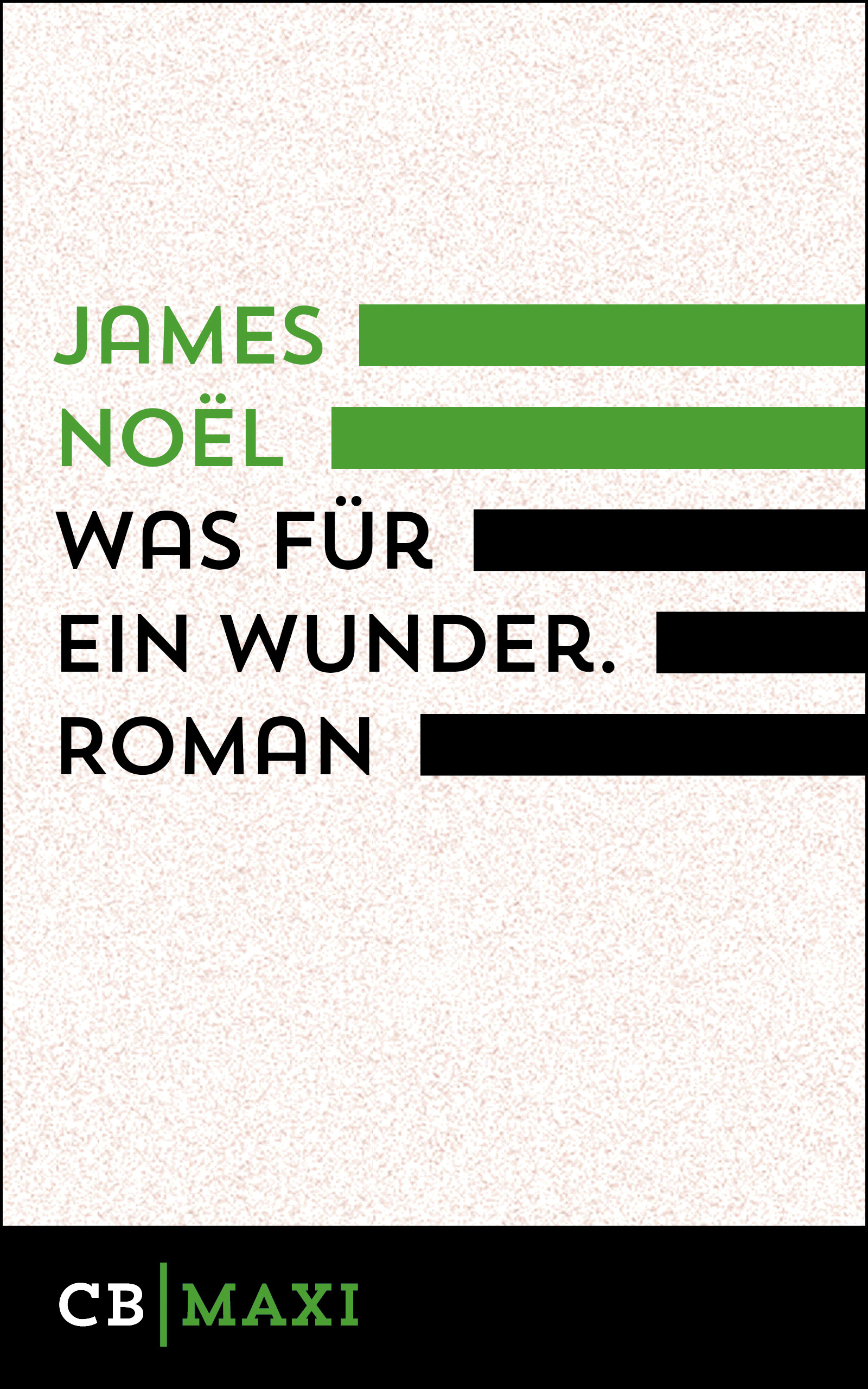
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Was für ein Wunder, selten hat ein Roman seinen Titel so zu Recht getragen.« Kerenn Elkaim, Livres Hebdo Port-au-Prince, 12. Januar 2010, Tag des verheerenden Erdbebens in Haiti. Ein Überlebender, der sich Bernard nennt, begegnet Amore, einer Neapolitanerin, die für eine NGO arbeitet. Liebe auf den ersten Blick. Um dem Chaos der zerstörten Stadt zu entkommen und um Bernard zu helfen, schlägt Amore ihm eine Reise nach Rom vor. Ein poetischer Roman voll bissigem Humor über Liebe, Sex, Verwirrung und die absurden Seiten der internationalen Hilfe in einer rhythmischen, magisch-kreativen Sprache.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 166
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2020
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Alle Rechte vorbehalten
Das französische Original erschien 2017 unter dem Titel »Belle merveille«, © Editions Zulma, Paris 2017
Lektorat: Peter Trier
Printausgabe: © Litradukt, Literatureditionen Manuela Zeilinger-Trier 2020
E-Book-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Mai 2020
ISBN 978-3-95988-169-2
Über das Buch
Port-au-Prince, 12. Januar 2010, Tag des verheerenden Erdbebens in Haiti. Ein Überlebender, der sich Bernard nennt, begegnet Amore, einer Neapolitanerin, die für eine NGO arbeitet. Liebe auf den ersten Blick. Um dem Chaos der zerstörten Stadt zu entkommen und um Bernard zu helfen, schlägt Amore ihm eine Reise nach Rom vor. Ein poetischer Roman voll bissigem Humor über Liebe, Sex, Verwirrung und die absurden Seiten der internationalen Hilfe in einer rhythmischen, magisch-kreativen Sprache.
»James Noël legt einen Erstlingsroman vor, in dem die Erde und die Körper beben. Beißend und verstörend.« Sophie Pujas, Le Point
»Was für ein Wunder, selten hat ein Roman seinen Titel so zu Recht getragen.« Kerenn Elkaim, Livres Hebdo
Über den Autor
James Noël, geboren 1978 in Hinche, Haiti, wurde durch das kreolische Gedicht Bon nouvèl, ins Französische übertragen von Georges Castera und vertont von Wooly Saint-Louis Jean, praktisch über Nacht berühmt. Dank Gedichtbänden wie Poèmes à couble tranchant (2005), Le sang visible du vitrier (2009) oder Le Pyroname adolescent (2013) gehört er heute zu den wichtigsten haitianischen Gegenwartslyrikern. Im Januar 2018 schrieb er einen vielbeachteten offenen Brief an Donald Trump, nachdem dieser mehrere Länder, darunter Haiti, als “shithole countries” bezeichnet hatte. Im selben Jahr erschien bei Litradukt unter dem Titel Die größte der Raubkatzen/Le plus grand des félins eine Auswahl seiner Gedichte in einer zweisprachigen Ausgabe. Was für ein Wunder
James Noël
Was für ein Wunder
Aus dem Französischen und mit einem Vorwort von Rike Bolte
Vorwort: Von bebenden Wunderdingen oder: Was ist eine Katastrophe?
Was ist eine Katastrophe?
Wird diese Frage literarisch gestellt, gelangt man schnell in den Bereich des Dramas, einer Gattung, aus der sich maßgeblich der literarische Katastrophenbegriff ableitet. Andererseits gibt es die moderne Katastrophenforschung. Diese unterscheidet zwischen sozialen und Naturkatastrophen und liefert auch den Schlüssel für das Verständnis dessen, was als »humanitäre Katastrophe« bezeichnet wird.
Das Erdbeben, das Haiti im Januar 2010 getroffen hat, war eine solche humanitäre Katastrophe. Die verheerenden Folgen der Naturkatastrophe sind in dem karibischen Inselstaat bis heute spürbar. Nicht nur machte das Beben die ohnehin prekäre Situation des Landes evident; hinzu kam politische Unzulänglichkeit, die Haiti den Titel »Republic of NGO’s« einbrachte. Zur Flut von Bildern der Katastrophe kam ein Chor von Kommentaren, die sich zur Lage des geschundenen Landes äußerten; in ihn fielen auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen ein. So stufte zum Beispiel der aus der Dominikanischen Republik stammende Autor Junot Díaz Haitis Situation als apokalyptisch ein.
Wie kommt es dann, dass der vorliegende Text, den der 1978 in Haiti geborene James Noël über die Katastrophe verfasst hat, den Titel Was für ein Wunder – auf Französisch Belle merveille – trägt? Wieso lässt es der vielfach international ausgezeichnete Lyriker und Erzähler nicht dabei bewenden, seinen Erdbebenroman erst im Jahr 2017 vorzulegen? Während Dany Laferrière mit Tout bougeautour de moi stante pede, das heißt noch 2010, reagierte?
Wie immer geht James Noël trickreich vor. Einerseits lässt er die ›Verspätung‹ im Roman selbst vom Protagonisten kommentieren: »Böse Zungen behaupteten, ich hätte meinen Kalender verschludert, die Jungs meinten, ich hätte die Orientierung verloren. Sieben Jahre schon! […] Verdammte sieben Jahre!« Andererseits stilisiert er die Zeitspanne, die er verstreichen ließ, um seine Version des Erdbebens und seiner Folgen zu publizieren: sieben Jahre.
In der Zahlenmystik besitzt die Sieben eine kulturübergreifend herausragende Stellung; Himmelskunde und Kalenderchronologie (die in der oben zitierten Passage nicht von ungefähr als verbaselt bezeichnet wird) gründen auf dem System der Sieben; im muslimischen, buddhistischen und jüdisch-christlichen Glauben kodiert die Zahl fundamentale Vorstellungs- und Anleitungsmodelle; Fülle und Vollkommenheit, doch auch Fluch und Strafe werden mit der Zahl belegt; topographische Ansichten – der siebte Himmel, die sieben Stufen, die sieben Hügel – sind entsprechend beziffert; sieben sind die fetten und mageren Jahre. Und auch in anderen Glaubenssystemen besitzt die Zahl große Bedeutung. James Noël bezieht sich nicht nur auf viele dieser Codierungen, er lässt eben auch sieben Jahre verstreichen, um einen Erdbebenroman mit dem Schlüsselwort belle merveille überschreiben zu können. Es ist vielleicht die Zeit, die es verflixt nochmal braucht, um Schlüssel für das Verständnis eines hochkomplexen Szenarios zu finden, eines Szenarios, in dem lokales Unvermögen und internationale Interessen (und Inkompetenzen) aufeinandertrafen und auch die Last historischer Erfahrungen deutlich wurde. Der Umgang mit dem durch das Naturunglück ausgelösten Desaster in Haiti war (und ist) abhängig von kulturellen Deutungsmustern, Glaubenswissen und pragmatischen Handlungsweisen. Um in einem Unglück etwas Wunderbares zu lesen und diese Deutung zudem zu literarisieren, also öffentlich zu machen, braucht es indes eine besondere Form von Waghalsigkeit. Eine wunderbare Waghalsigkeit.
Genau hierum geht es in Was für ein Wunder. Und dazu gehört eine grundlegende Begriffsklärung. So umkreist der Roman selbst den Terminus belle merveille: Es handelt sich um einen Wunderbegriff, der in Haiti im Moment unerwarteter Ereignisse benutzt wird, seien diese erschreckender oder erfreulicher Art. Diese Auffassung überschneidet sich durchaus mit der allgemeineren Definition vom Wunder als einem Raum- und Zeit-Ereignis, das Naturgesetzen zu widersprechen scheint und womöglich sogar Regellosigkeit oder Chaos mit sich bringt.
Und hier setzt Was für ein Wunder an, unterscheidet sich indes von Pressemeldungen aus dem Jahre 2010, die während des »Aufmerksamkeitstsunamis« im Januar 2010 mit sensationellem Bildmaterial unterlegt formulierten, es grenze an ein Wunder, dass noch mehrere Tage nach dem Erdbeben Opfer lebendig geborgen worden seien. Die gleichen Meldungen stellten die Hilfseinsätze der Vereinten Nationen heraus – auch diese werden in Was für ein Wunder in ganz anderem Licht erscheinen.
Die poetische Lizenz dafür, das Erdbeben von 2010 als ein wie oben definiertes Wunder zu begreifen, liefert das ›populär-sprachliche Katastrophenmanagement‹, das Noël in Was für ein Wunder gewissermaßen zitiert. Dass der Roman die Register der oralittérature nutzt, bedeutet, dass darin starke Anklänge poetischer Sprechsprache, doch ebenso alltagsprachliche Redeweisen und volkstümliche Denkweisen zu finden sind. Diskurse über Wunderdinge verquicken sich mit Aspekten aus den sensationalistischen Reden der medialen Gesellschaft: »Eine Brücke stürzt auf die Route Neuf. Was für ein Wunder nochmal! Ein Feuer in einem Hotel in Pétion-Ville. Ein in Flammen aufgegangenes Paar, nackt, bei lebendigem Leibe verbrannt. Was für ein Wunder!«
Entlang dieses auf den ersten Blick irritierenden Wunderberichts erzählt James Noël allerdings auch die Geschichte einer flippigen Liebe zwischen Haiti und Italien, genauer gesagt Port-au-Prince und Rom. Damit ist der Roman eine ›die Liebe-ist-ein-Wunder-und-erst-recht-angesichts-des-Todes‹-Reportage. In diesem – durchaus topischen – Rahmen vollzieht der Text jedoch eine literaturgeschichtliche Rückführung, weil er an das Nachsinnen über Wunderhaftes anknüpft, das die Debatte um das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755 und die Kontingenz-Debatte geprägt sowie beeindruckend »viel Tinte« hat »fließen lassen«, wie in Was für ein Wunder selbst angemerkt wird. Tatsächlich hat das Beben von Lissabon, das unter der europäischen Literaturelite unter anderem Voltaire beschäftigte, grundlegende Visionen und Registrierungsmodelle der Moderne auf den Weg und diese haben wiederum alte (Bedeutungs-)Vorstellungen buchstäblich ins Wanken gebracht.
Was für ein Wunder ist nun aber einer Poetik der Kontingenz des 21. Jahrhundert verschrieben. Ganz explizit wird auf Modelle der Chaosforschung eingegangen, etwa den Schmetterlingseffekt. Das Phänomen manifestiert sich dort, wo nicht vorhersehbar ist, wie minimale Schwankungen in den Anfangsbedingungen eines Systems sich langfristig auf die Entwicklung desselben auswirken werden. Der butterfly effect hat Literatur und Kino beeinflusst, exemplarisch für einen der großen Globalisierungsfilme der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts, der das Phänomen adaptiert, ist Babel von Alejandro G. Iñárritu aus dem Jahr 2006. Hier wird ein recht beliebiger Unfall zum Epizentrum einer über Landesgrenzen führenden Verkettung von Ereignissen. Im Zusammenhang der Terrorismushysterie nach nine eleven erhält der Unfall eine unangemessen große mediale Resonanz, in der letztlich biblische Themen wie die Frage nach Hochmut, daraus folgender Strafe und Zerstreuung aufscheinen.
James Noël belegt in seinem Bericht das Erdbeben in Haiti und den respektiven Gedanken zu Verkettungsdynamiken (»ein bloßer Schmetterlingsflügelschlag ist in der Lage, ein Erdbeben in Chile auszulösen. Das Problem der Welt betrifft alle Welt«) ebenso wie das Attentat auf die Zwillingtürme in New York mit dem Begriff des Wunders und beteiligt sich damit synoptisch an jenen Ansichten, die den Terrorangriff spektakularisiert haben. Die Bemerkung (»Zwei Flugzeuge machen sich wie zwei Mücken davon. Sie knallen in einen New Yorker Wolkenkratzer. Sechstausend Tote. Was für ein Wunder!«) haitianisiert aber das hegemoniale Terrorunglück, und zwar im Zuge der bereits anzitierten Auflistung lokaler belles merveilles. Der komplette Wunderbericht, der dabei herauskommt, enthält Passagen, die an Paradoxographien erinnern. Allerdings erhalten alle Ereignisse, dieWas für ein Wunder auflistet, das Prädikat belle merveille.
Der vorliegende Roman ist somit unter anderem ein Essay über die Medialisierung von Unglücksfällen. Sogar auf einer Metaebene wird darüber reflektiert, wie Katastrophe erschrieben werden könne; die Auskunft über die medialen Ungeheuerlichkeiten, die das Beben von 2010 begleitet und sich als Ausdruck einer Reihe nationaler und internationaler Ungeheuerlichkeiten politischer Natur erwiesen haben, lässt die literarische Schreibnotwendigkeit umso dringlicher erscheinen.
Doch der Clou an Was für ein Wunder ist, dass Noëls Protagonist, selbst Opfer des Unglücks, während desselben zum Liebenden wird und letztlich nach Formen sucht, beide Ereignisse, den Einbruch der Liebe und das ›Einreißen‹ seines Landes*, in gleichermaßen treffende Worte zu fassen. Die Hauptfigur, Bernard, ist also ein Dichter, der die poetische Lizenz, in der Katastrophe nach Wundern zu suchen, automatisch mitbringt (und darüber hinaus noch andere Lizenzen, etwa die, auto(r)fiktional zu argumentieren, an erste frustrierende Schreiberfahrungen zu erinnern etc.). Bernard ist aber auch Bernard l’Hermite, ein eremitisch-erratischer Schelm des 21. Jahrhunderts, ein ›Einsiedlerkrebs‹, der sich gerne in Google Earth aufhält und im Street Viewing fischen geht – bis er schließlich vom Erdbeben (und der Liebe) und dem Schreibdrang heimgesucht wird.
Noël belässt es aber nicht bei der Verquickung von Liebes- und erschreckenden Wunderdingen sowie der Bestandsaufnahme von pikanten bis horrenden Vorkommnissen im Haiti des Jahres 2010, sondern flicht auch Anekdoten aus der Geschichte des Inselstaates ein. Bis zum Beginn der Globalisierung schaut der Text zurück, dergestalt, dass Christoph Kolumbus »nach einer ganzen Reihe schöner Bescherungen« als »erste[r] Besucher der Insel« auftritt und vor seinen Männern angesichts der Schönheit der Insel ganz entfesselt »Was für ein Wunder« schreit. Die Fakten und Fiktionen rund um die moderne Geschichte Haitis – Revolution und Duvalier-Diktatur, nachfolgende Putsche usf. – werden außerdem aufgenommen. Vieles von dieser Information ist verschlüsselt, so dass die Arbeit mit Fußnoten, die die Lektüre ein wenig unterstützen mögen, angebracht schien.
Liest man Was für ein Wunder, drängt sich die Frage auf, ob es sich überhaupt um einen Roman handelt. Denn über den bereits genannten essayistischen Aspekten rangiert noch ein poetischer Ton, der die Überlegung zulässt, ob Noël nicht eigentlich ein langes Gedicht verfasst hat.
Zum Beispiel beginnt Was für ein Wunder keineswegs in medias res, sondern allegorisiert die Katastrophe in einer Ouvertüre in ein schwindelerregendes Ereignis, das sowohl im Bild eines Schmetterlings als auch über den Sound des Schmetterlingsflügelschlags den butterfly effect vor- und Überlegungen zu faktischen und fiktiven Ursprüngen von Katastrophen anführt. Der Text eröffnet flatternd, ja schwebend, gleichsam aber bebend; dieses Formprinzip wird bis zum Ende durchgehalten. Wie Dichtung – oder wie ein Erdbeben – geht Noëls Schreiben synkopisch und elliptisch vor; der Text löst Sprünge aus, schlägt zu, lässt aus. Auf die Sorge, mit welcher Sprache auf eine Katastrophe zu antworten sei, wird demnach geschickt mit Strategien des lyrischen, kontra-narrativen Schreibens gekontert. Kann denn nach einem Erdbeben überhaupt stringent erzählt werden?
Eben nicht. Es finden sich aber Worte, die quasi erneuernd wirken. Nicht von ungefähr bezieht sich Was für ein Wunder neben vielen anderen, oftmals karibischen literarischen Vorbildern** auf den Modernisierer der europäischen Lyrik Arthur Rimbaud. Dessen postromantisches Konzept der Entregelung der Sinne und der Sprache stand im Dienst einer wegweisenden Wirklichkeitssicht, die nicht nur auf das Poetische gemünzt war. Noël wählt neben dem poetischen Weg für die Darlegung der Ereignisse, die seinem Protagonisten widerfahren, eine außerdem politisch vorfühlende Optik. Die hypermoderne Humoreske, die daraus resultiert, wirkt beinahe seismographisch, weil sie, wenngleich sardonisch, sensibel die gesellschaftlichen Aspekte einer Naturkatastrophe im 21. Jahrhundert aufzeichnet. An Rimbauds Lyrik gemahnt etwa die Szene, in der der in Pont-Rouge ermordete Kaiser Haitis »rote Löcher« an beiden Körperseiten aufweist; das letzte Terzett des berühmten Sonetts Le dormeur du val (dt. Der Schläfer im Tal) von Rimbaud aus dem Jahr 1870 zeigt einen im Grün liegenden Soldaten, der erst in der letzten Zeile, nach mehreren Strophen fast filmischen Streifzugs durch eine scheinbar idyllische Naturszenerie, als tot (und eben nicht als schlafend) erkennbar wird, weil der Text plötzlich auf »rote Löcher« an einer Körperseite desselben hinweist.
Ist Was für ein Wunder wie andere Erdbebenromane aus Haiti, etwa Kettly Mars’ Roman Aux frontières de la soif (dt. Vor dem Verdursten) von 2013, ein riskanter – und im selben Zug allzu undramatischer – Text, wo er Katastrophe nicht nur im Verweis auf den Topos der Nächstenliebe und der Empathie verhandelt, sondern auch mit Lust und Verlangen zusammenbringt? Und muss die Frau, die den Protagonisten errettet, wirklich Amore heißen und aus Rom kommen, so schön diese quasi-Anagrammierung auch klingt? Ist das nicht ein wenig viel Dekor in einem Roman, der beben soll?
Studien zur Erdebenliteratur ebenso wie die Katastrophenforschung haben gezeigt, dass Parallelwelten und Mikrokosmen in postkatastrophalen Situationen häufig sind. In diesem Zusammenhang nimmt das Begehren, wie auch Mars’ Roman zeigt, eine ganz besondere Gestalt an. Während bei Mars das auch in Was für ein Wunder erwähnte Sammellager Canaan eine Schlüsselrolle (und zwar zuerst sogar als Ort perversen Verlangens) spielt, irrt Noëls Bernard weiter in dem Versuch umher, Tücken und Laster des in Haiti eingefallenen internationalen Hilfskomplotts zu benennen, ohne die Liebesdinge links liegen lassen zu müssen. Für seine im »Hügelland« gemachten Katastrophennotizen bietet ihm die sexuelle Begegnung die nötige kathartische Kraft. Gleichzeitig ist Bernards ebenso labyrinthische wie spitzfindige Rede eingewoben in ein Gewirr aus Stimmen anderer Figuren, die jeweils von ihrer persönlichen Katastrophe erzählen. Im Rahmen einer psychologischen Sitzung kommen Figuren namens Sacha und Paloma sowie »der Blinde«, »der Atheist«, »der Evangelist« und »der Guerillero« zu Wort. Lakonische, zynische, pragmatische und metaphorische Worte für die traumatischen Erlebnisse fallen. Was für ein Wunder kapriziert sich also nicht auf einen Monolog; es ist ein chorales Werk.
Entlang dieser drastischen Gegenüberstellungen von Sicht- und Redeweisen nimmt die Liebesgeschichte zwischen Bernard und Amore ihren Fortgang bis nach Europa. Bernard bleibt aber der notorischen Desorientierung treu, allein deswegen, um die raumzeitlichen Inkohärenzen des Textes zu legitimieren, die wiederum stellvertretend für den »Schiffbruch« eines Landes und die vereinte Lage der globalisierten Welt und ihr korruptes Hilfsnetz sind (das nur Pest und – im wahrsten Sinne des Wortes – Cholera bringt). Dieser Blick auf welt- wie nationalökonomische Fakten verdichtet sich zu einer Rhapsodie aus Metaphern, in dem das große Konzert der Nationen plötzlich als »Spaghettigericht« der Nationen serviert wird.
Was für ein Wunder hat Groove, manche der kurzen Passagen sind mit musikalischen Noten überschrieben. Sie betiteln die Skalen der Stimmung Bernards, seine Bewegtheit und seine Bewegung zwischen Italien und Haiti, auf Flughäfen, in der Luft – hier zitiert der Text aus Antoine de Saint-Exupérys Nachtflug (Vol de nuit) –, im Siebten Himmel. Bis der Travelogue (dessen musikalischer Subtext ein Echo auf die Noten-Punktierung in Jacques Stephen Alexis’ hymnischen Schiffbruchroman L’EtoileAbsinthe zu sein scheint) die Liebe auf die Probe stellt, parallel dazu aber eruiert wird, ob nach dem Beben der Erde nicht auch noch andere Elemente erschüttert werden könnten. Ein prophetischer Freund Amores weiß dazu Auskunft.
Die Übersetzung von Belle merveille ins Deutsche war eine Herausforderung. Es galt nicht nur den versteckten Hinweisen auf kulturelle, insbesondere voodooistische und intertextuelle Referenzen nachzugehen, sondern auch Wortspiele aufzuspüren, die nicht immer ins Deutsche übertragen werden konnten. Angeführt sei das Bild von »zerquetschten Hunden« (chiensécrasés), das auch auf die Bedeutung des chien écrasé, der Zeitungsmeldung über einen unbedeutenden Vorfall verweist. Oder politisch gefärbte Bilder, in denen gewaltsame Racheaktionen gegen Mitglieder und Nutznießer der Duvalier-Diktatur und anderer Regime angesprochen sind. In der Übersetzung ging Nebensinn mehrfach unvermeidlich verloren. Die musikalischen Überschriften bzw. Inschriften von Was für ein Wunder sind im Französischen in manchen Fällen gleich mehrfach verschlüsselt, etwa bei dem Sol la do ré…, das in den ersten Zeilen des Kapitels mit dem ebenso zweideutigen Originaltitel Suspends ton vol (vol als Flug und Raub; im Deutschen wurde hieraus Raubvogel) auftaucht und im Französischen, anders als im Deutschen, in dem die entsprechenden Noten G, A, C und D genannt werden, zudem in der Huldigungsformel sol adoré (angebetete Erde) aufgehen kann. Hier musste kompensatorisch paraphrasiert werden.
Auch das onomatopoetische Incipit des Originals, pap pap pap, das den papillon antizipiert, ist polyvalent; es bildet die Sigle PAP für den internationalen Flughafen Port-au-Prince ab und führt weiterhin zu Papa Loko, Geistwesen des Voodoo, das sich in Wind zu verwandeln versteht, in Was für ein Wunder wiederum im verirrten Schmetterling Gestalt annimmt und von Bernard als inkompetent dargestellt wird, weil es seiner Aufgabe, hellsichtig zu sein und als Schutzgeist (gegen die Katastrophe) zu agieren, nicht nachgekommen ist. Im Deutschen wird das pap pap pap zu einem »Schmetter… Schmetter… Schmetter…«, kann aber keine Brücke zur Flughafen-Sigle herstellen. Auch Bernards Namensverwandtschaft mit jener Krebsart, die sich in fremden Behausungen einnistet, Bernard l’hermite, war nicht ins Deutsche hinüberzuretten. Die Liste der schwierigen Übersetzungsmomente ließe sich fortführen; genannt sei noch ein doigt donneur, »Spenderfinger«, in dem der doigt d’honneur, der »Stinkefinger«, anklingt.
Dass an mehreren Stellen des Textes die deutsche Version nicht mit dem Original kongruent sein kann, erscheint jedoch deswegen nicht tragisch, weil James Noëls Text insgesamt so reichhaltig und trickreich – und insgesamt dicht – ist, dass es hinnehmbar ist, wenn die Lektüre im Deutschen hier und da etwas luftiger ausfällt. Sprengkraft hat der Text so oder so; allein durch den Auftritt der Elemente, die als unheilbringende Kräfte wie erotische Ressourcen wirken. Das führt soweit, dass Amore noch zur »Flammenfrau« wird.
Noëls Alchimie ist darin womöglich postfeministisch; vor allem aber ist sie postheroisch. Denn die Katastrophe in Was für ein Wunder bringt anstelle von Held und Heldin Beobachtungspleen, Sprachlist und Lust hervor. Und zu guter Letzt lehnt sie sich an Rimbauds »Alchimie des Wortes« und den Versuch, Schwindel zu erfassen, an; in der bodenlosen Stadt Port-au-Prince bewegen sich der »König« und »die Königin des Schwindels« wie in einem übergeschnappten Kreisel.
Wird da nicht, wie die Kritik an diesem Buch formuliert hat, zu viel durcheinandergewürfelt? Oder fragen wir lieber: Was nun ist die Katastrophe in Was für ein Wunder? Die Antwort wird finden, wer das Buch liest und gleichzeitig selbst noch einmal den Zeugnissen des Unglücks nachgeht. Denn Noëls Text enthält in seiner fast (posttraumatisch?) manischen Metaphernwut auch präziseste Bilder, die zum Beispiel an die erschütternden und gleichzeitig stilistisch beeindruckenden Aufnahmen erinnern, die der spanische Fotograf Luis Alcalá del Olmo von Menschen nach dem Erdbeben gemacht hat. Wer das erkennt und zudem erkennt, was ›Bildnotwendigkeit‹ auch sprachlich bedeuten kann, ist froh, dass Noël unterschiedliche Register für die Erinnerung an eine Katastrophe gewählt hat, welche dem heiklen Versuch, »das Leid anderer zu betrachten«, wie Susan Sontag es formuliert hat, mit der nötigen Tiefenschärfe und gleichzeitig Lebendigkeit beispringen.
Rike Bolte, Barranquilla, 6.1.2020
Die Übersetzung ist Odile Kennel gewidmet.
* »Wie aus Liebe sterben / zu einem Land / das aus bissigen Rissen erdichtet ist«, heißt es in James Noëls Gedicht Tote Zeit ( Temps mort), erschienen u.a. in dem zweisprachigen Auswahlband Die größte der Raubkatzen/ Le plus grand des félins (2018).
** Siehe hierzu etwa den Verweis auf Aimé Césaires Cahierd’un retour au pays natal (1939), zu dem im Deutschen zwei Übersetzungen vorliegen (Zurückins Land der Geburt von Janheinz Jahn und Notizen von einer Rückkehr in die Heimat von Klaus Laabs). Die Übersetzung der Paraphrasierung, die Noël vornimmt, fusioniert Anteile aus beiden Titelfassungen. Ein weiteres Werk ist Jacques Stephen Alexis’ Roman Compère Général Soleil (dt. General Sonne) von 1955.
Marie, Pascal und weiteren Wundern gewidmet.
Papa Loko o se van, ou se papiyon, wa pouse n’ale, wa pote nouvèl bay Agwe.





























