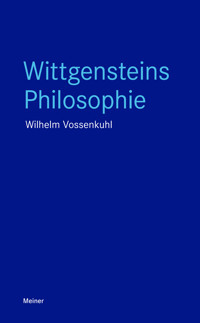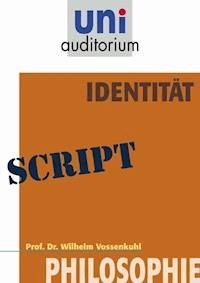Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Felix Meiner Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Blaue Reihe
- Sprache: Deutsch
Wilhelm Vossenkuhl stellt in seinem neuen Buch die für die Philosophie zentrale Frage nach der Geltung. Seine These lautet: Das, was gilt, stellt einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Das, was gilt, hebt also die Trennung von Sein und Sollen auf. Anknüpfend an sein letztes Buch »Die Möglichkeit des Guten«, in dem Vossenkuhl den Zusammenhang zwischen Geltung, Rechtfertigung und Anerkennung analysierte, rückt er nun die Frage nach der Geltung in den Mittelpunkt. Damalige Leitidee war das Gute als Maßstab für die Integration der Güter in einer Gesellschaft. Allerdings ist der Zusammenhang zwischen dem Guten und der Geltung sehr viel enger, als damals angenommen: Wir können beide nicht voneinander trennen, weil das, was gut ist, und das, was gilt, zusammen ein menschliches Grundbedürfnis bilden. Wir wollen uns auf das, was gilt, verlassen können, und dies sollte immer etwas Gutes sein. In drei großen Kapiteln begründet Vossenkuhl seine Grundthese über Geltung als Zusammenhang zwischen Sein und Sollen (1) und fragt nach den ontologischen Voraussetzungen dieser Annahme, vor allem in Auseinandersetzung mit Kant und Frege (2). Anschließend erprobt er diesen Ansatz anhand einer praktisch-philosophischen Frage, nämlich ob der Rechtspositivismus, wie er etwa von Hans Kelsen vertreten wird, geltungstheoretisch erfolgreich ist (3).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 682
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Vossenkuhl
Was gilt
Über den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll
Meiner
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet über ‹http://dnb.d-nb.de› abrufbar.
eISBN (PDF) 978-3-7873-3938-9
eISBN (ePub) 978-3-7873-3939-6
www.meiner.de
© Felix Meiner Verlag Hamburg 2021. Alle Rechte vorbehalten. Dies gilt auch für Vervielfältigungen, Übertragungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, soweit es nicht §§ 53, 54 UrhG ausdrücklich gestatten. wikipedia.de. Konvertierung: Bookwire GmbHFür Links mit Verweisen auf Webseiten Dritter übernimmt der Verlag keine inhaltliche Haftung. Zudem behält er sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings (§ 44 b UrhG) vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Inhalt
cogito
Einleitung
1. Was gilt?
1.1 Ob es ein ontologisches Bedürfnis gibt
1.2 Ob wir glauben, was wir wissen
1.3 Ob es nicht-reflexive und reflexive Gewissheiten gibt
1.4 Ob es das Gute gibt
1.5 Ob es ideale Maßstäbe der Geltung gibt
1.6 Ob Geltung teilbar ist
1.7 Ob das, was gilt, existiert
1.8 Ob wir das Mögliche vom Wirklichen her verstehen
1.9 Ob die Existenz von etwas mehrere Bedeutungen haben kann
1.10 Ob es Kriterien der Identität von Bedeutungen gibt
1.11 Ob Prinzipien offene Bedeutungen haben
2. Ob die Geltung von etwas ontologische Voraussetzungen hat
2.1 Ob Kants Geltungstheorie erfolgreich ist
2.2 Ob Freges Geltungstheorie erfolgreich ist
2.3 Ob es eine objektive Geltung gibt
2.4 Ob das Nicht-Reflexive reflexiv erfasst werden kann
2.5 Ob das, was sich zeigt, etwas Vor-Sprachliches ist
2.6 Ob es die Asymmetrie des Nicht-Reflexiven gibt
2.7 Ob das Nicht-Reflexive ontologisch relativ ist
2.8 Ob Normen wie Prinzipien gelten
2.8.1Ob die Geltung aus der Genese ableitbar ist
2.8.2 Ob Kant die Geltung von Moral und Recht ohne Genese begründen kann
2.8.3 Ob Kants rein moralisch begründete Geltung erfolgreich ist
2.9 Ob eine diskursiv begründete Geltung möglich ist
2.10 Ob eine naturrechtlich begründete Geltung möglich ist
3. Ob eine rein rechtliche Geltung möglich ist
3.1 Ob der Rechtspositivismus geltungstheoretisch erfolgreich ist
3.1.1 Ob es Legalität ohne Legitimität gibt
3.1.2 Ob Recht und Staat eine Einheit bilden
3.1.3 Ob eine rein positive Rechtsgeltung möglich ist
3.1.4 Ob die Interpretation des Rechts seine Geltung begründet
3.1.5 Ob Recht nur geltendes Recht ist
3.2 Ob sich in der Praxis zeigt, was gilt
3.2.1 Ob die Geltung von Begriffen und Prinzipien reflexiv uneinholbar ist
3.2.2 Ob die Menschenwürde reflexiv uneinholbar ist
3.2.3 Ob Kants Würde-Konzept reflexiv einholbar ist
3.3 Ob das, was gilt, vom Willen abhängig sein kann
3.3.1 Ob Wille und Sprache vergleichbar sind
3.3.2 Ob der Wille irrational ist
3.3.3 Ob der Wille darüber entscheiden kann, was gilt
3.3.4 Ob die Willensbildung einem Gemeinsinn folgt
3.3.5 Ob das, was gilt, exemplarisch gilt
3.3.6 Ob das, was exemplarisch gilt, gut ist
Ein Blick zurück
Dank
Anmerkungen
Literaturverzeichnis
Personenregister
Sachregister
Für Dodo
13. 09. 1949 – 13. 12. 2015
COGITO
omnia mutantur, nihil interit(Ovid, Metamorphosen)
Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie«, schreibt Hegel in der Vorrede seiner Rechtsphilosophie.1 So ist es, denke ich. Genau dies ist die Aufgabe der Philosophie. Und Hegel ergänzt, »denn das was ist, ist die Vernunft«. Das kann aber wohl kaum sein, es sei denn, dass das, was ist, etwas ganz anderes ist als das, was uns als Wirklichkeit erscheint. Der unbeherrschte Wandel aller natürlichen und sozialen Lebensbedingungen scheint doch das zu sein, was wirklich ist. Ein äußeres Kennzeichen dieses Wandels ist die Flut von Informationen, die es uns erschwert, Wahres von Falschem und Wissen von Irrtum zu unterscheiden. Es wäre widersinnig anzunehmen, dass diese Wirklichkeit mit allen ihren Erscheinungen »ihren Bildungsprozeß vollendet« hat, wie Hegel sagt.2
Das, was ist, kann nicht nur Wandel und Veränderung sein. Sonst könnten wir nicht zwischen ›ist‹ und ›ist nicht‹ unterscheiden, und das, was ist, nicht von dem, was nicht ist, trennen. Was ist, muss Bestand haben, damit wir es denken und wissen können. Damit es Bestand hat, muss etwas gelten, was die Unterscheidung zwischen dem, was ist, und dem, was nicht ist, möglich macht. Das geltende Maß für diese Unterscheidung ist die Widerspruchsfreiheit. Sie ist nur eine Form für das, was als tatsächlich existierend gelten kann, weil sie nicht sagt, was es alles gibt. Würde sie nicht gelten, könnten wir nicht zwischen ›ist‹ und ›ist nicht‹ unterscheiden. Ohne diese Unterscheidung könnten wir auch nichts über die Wirklichkeit wissen. Also muss dieses Maß gelten, damit wir wissen können, was es gibt. Es ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung dieses Wissens. Mindestens die Widerspruchsfreiheit muss gelten, damit wir wissen können, was es gibt.
Nun gibt es aber viel Widersprüchliches, was jenes Mindestmaß nicht erfüllt, wie Irrtümer, Unwahres und Lügen. All das sollte nicht sein. Wenn wir begreifen wollen, was wirklich ist, aber nicht sein sollte, muss mehr als die Widerspruchsfreiheit gelten. Es muss möglich sein, Wahres von Unwahrem und Falschem zu unterscheiden. Was wahr ist, ist selbst ein Maß für die Unterscheidung des Wahren von Falschem. Es ist aber kein Maß für die Unterscheidung dessen, was ist, von dem, was nicht sein sollte. Für diese Unterscheidung benötigen wir ein weiteres Maß, das Gute. Nur was gut ist, sollte sein. Das Schlechte und Widersprüchliche existiert aber dennoch. Dagegen können wir uns mit dem, was gilt, wehren.
Es gibt Unterschiede zwischen der Geltung der eben erwähnten Maße. Sie zeigen sich, wenn wir überlegen, woran wir zweifeln können. Es hat keinen Sinn, am Maß der Widerspruchsfreiheit und an dem der Wahrheit zu zweifeln, weil wir beide Maße benötigen, um zweifeln zu können. Wir benötigen beide Maße auch, damit wir einen Zweifel aufheben können. Anders verhält es sich mit dem Maß des Guten. An diesem Maß können wir leicht zweifeln. Wir können daran zweifeln, dass es dieses Maß gibt, und wir können uns fragen, ob wir es benötigen, um zu begreifen, was wirklich ist. Wer glaubt, dass Wissen wertfrei sein sollte, wird diese Frage verneinen. Unklar bleibt dann aber, wie wir beurteilen können, was ist, aber nicht sein sollte. Wir müssten uns dieses Urteils enthalten.
Wenn wir die Wirklichkeit begreifen wollen, müssen wir verstehen, was gut und was schlecht ist, und dies hängt von dem ab, was gilt. Nur so können wir unterscheiden, und für diese Unterscheidung muss das, was gut ist, im Wandel Bestand haben. Dieser Gedanke scheint aus der Zeit zu fallen, weil er selbst beständig sein soll und sich nicht wandeln darf. Andererseits muss er sich in der Zeit behaupten und kann nicht davor gefeit sein, sich zu wandeln. Dieser Gegensatz zwischen dem, was Bestand hat, und dem, was sich wandelt, wäre ein unhaltbarer Widerspruch, wenn nichts gelten würde, was den Gegensatz aufhebt.
Das, was gilt, zu untersuchen, bedeutet nicht, darüber zu belehren, was alles gelten sollte. Zu wissen, was nicht gelten sollte, bedeutet nicht zu wissen, was gelten sollte. Eine philosophische Belehrung, »wie die Welt sein soll«, käme immer zu spät, wie Hegel in der erwähnten Vorrede schreibt. Er hat Recht. Es kann schon deswegen nicht um eine Belehrung darüber gehen, wie die Welt sein sollte, weil das, was gilt, ja schon in irgendeiner Form existiert, wenn überhaupt etwas gilt. Außerdem ist das, was gilt, kein Resultat der Philosophie. Es ist etwas, was in der mannigfachen menschlichen Praxis zustande kommt, in der sozialen, politischen und ökonomischen Praxis, in der Praxis der Rechtsprechung, in der religiösen und kulturellen Praxis und nicht zuletzt in der Praxis der Wissenschaften. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, was ›Praxis‹ bedeutet. Was gilt, ist Resultat einer Praxis und nicht einer Theorie. Dies ist freilich selbst eine theoretische Aussage. Unser theoretisches Verhältnis zur Praxis ist selbst ein Problem, das zu klären ist. Die Praxis des Sprachgebrauchs zeigt, wie das Problem geklärt werden kann.
Was in einer Praxis gilt, enthält viele begründete und nicht begründete Ansprüche. Ein Anspruch, der begründet sein kann, ist, dass das, was gilt, auch tatsächlich gelten soll. Wenn aber das, was gilt, existiert und gleichzeitig gelten soll, fallen Sein und Sollen zusammen. Sie fallen nicht zusammen, wenn das, was ist, nicht gelten soll, wie das Unrecht, das Unglück und die Unmenschlichkeit. Dann sind Sein und Sollen getrennt. Die beiden Begriffe ›Sein‹ und ›Sollen‹ haben eine philosophische Geschichte. Sie spricht seit langem dagegen, dass diese Begriffe überhaupt zusammenfallen können. Wenn sich unsere Lebenswelt tatsächlich fortwährend wandelt, bedeutet dies ja nicht, dass sie sich wandeln soll. Wenn aber etwas gilt, existiert dies nicht nur, sondern es soll auch befolgt werden. Auch die Naturgesetze, die es ermöglichen, das, was ist, zu beschreiben, gelten und verbinden Sein und Sollen. Wenn wir sie nicht als verbindlich ansehen, können wir die Natur nicht zuverlässig beschreiben und nicht wissen, was ist. Mit der bloßen Behauptung, es gebe einen Dualismus von Sein und Sollen, dürfen wir uns im Hinblick auf das, was gilt, nicht abfinden.
Das umstrittene Maß für das, was gelten soll, ist – wie eben erwähnt – das Gute. Was gilt, sollte gut, zumindest aber nicht schlecht sein. Wir Menschen wollen dem, was gilt, vertrauen können. Auch das Gute hat eine philosophische Geschichte. Viele tun sich schwer mit der Frage, was das Gute ist und was ›ist gut‹ bedeutet, weil diese Prädikate nicht definierbar sind. Das Gute erscheint uns heute wie ein Konto aus der Vergangenheit, von dem wir nichts mehr abheben können, weil wir den Zugangscode verloren haben. Dieses Konto ist aber nicht leer. Wir können es genauso aktivieren wie Platon, der noch im Staat für das Gute nur Gleichnisse anbietet, in seinem späten Werk Nomoi aber sagt, dass das Gute die »Kraft des gemeinsamen Werdens«3 ist. Er deutet diese Kraft wie eine menschliche Naturanlage. Es geht darum, die Bedeutung dieser Kraft für das, was ist, zu verstehen. Es geht auch darum zu zeigen, dass es das Gute gibt und dass wir ein Bedürfnis danach haben. Das Gute gibt es nicht als etwas Vollendetes, sondern als Werdendes. Nach dem Werden des Guten in der Praxis unserer Lebenswelt haben wir ein Bedürfnis.
Wenn von ›Geltung‹ die Rede ist, denken wir meist an Gesetze oder Regeln. Wir erwarten, dass das, was gilt, begründet ist. Der Anspruch auf Begründung ist zumindest seit der Epoche der Aufklärung eng mit dem Anspruch auf Rationalität verbunden, weil er sich gegen autoritäres Denken und Handeln richtet. Wir wollen einer Überzeugung nur dann folgen, wenn sie gut begründet ist. Wir halten eine Überzeugung für irrational, für die es keine Begründung gibt. Die rationale Begründung ist ein Anspruch an uns selbst als mündige Bürger in einer offenen Gesellschaft zur Abwehr autoritären Denkens und Handelns.
Begründungen sind nur dann erfolgreich, wenn sie sich auf Prinzipien berufen können. Ein Beispiel für ein einleuchtendes Prinzip ist die erwähnte Widerspruchsfreiheit. Würden wir diesem Prinzip nicht folgen, wären weder wahre Aussagen noch rationale Begründungen möglich. Wir könnten uns dann auf nichts verlassen und könnten irrationalen und autoritären Verhältnissen nichts entgegensetzen. Ein anderes Prinzip, auf das wir uns in einer liberalen Gesellschaft berufen, ist die Menschenwürde. Ohne dieses Prinzip wüssten wir nicht, wie die Unmenschlichkeit und das Unrecht geächtet werden könnten, die unsere jüngere Geschichte zwölf lange Jahre beherrschten.
Für die beiden eben genannten Prinzipien gibt es keine rationalen Begründungen. Die Hinweise darauf, was mit ihrer Geltung vermieden werden kann, sind keine Begründungen, sondern Motive, die Prinzipien anzuerkennen. Die Prinzipien gelten ohne Begründung und das bedeutet, sie gelten unabgeleitet. Wir halten dennoch am Anspruch auf rationale Begründung mit Hilfe dieser und anderer Prinzipien fest. Offenbar müssen wir unterscheiden zwischen den Ansprüchen, die begründbar, und denen, die nicht begründbar sind. Es geht darum zu zeigen, wie wir beiden Ansprüchen gerecht werden können. Die Beispiele in dieser Untersuchung sind die eben genannten, die Widerspruchsfreiheit und die Menschenwürde.
Die Philosophie ist keine Naturwissenschaft4, kann aber dennoch das, was ist, begreifen, weil das Denken ihre Praxis ist. Der Satz des Parmenides, Denken und Sein sei dasselbe5, wurde in der jüngeren Philosophiegeschichte angezweifelt, weil Denken auf Sprache angewiesen ist. Die Sprache erlaubt uns sowohl zu sagen, was ist, als auch, was nicht ist, unabhängig davon, ob dies tatsächlich so ist oder nicht. Die Sprache ersetzt aber nicht das Denken, mit dem wir diesen Unterschied beurteilen und erkennen. Wir erfassen erst etwas mit unserem Denken, drücken es in einer Sprache aus und beurteilen dann, ob es ist und was es ist. Unser Denken ist auf das angewiesen, was wir erfassen können. Die Philosophie kann nur dann die Aufgabe haben, zu begreifen, was ist, wenn der Satz des Parmenides in einer bestimmten Weise zutrifft.
Der Satz des Parmenides präsentiert noch keinen Gegenstand. Wenn er zutrifft, können wir annehmen, dass das Denken die Fähigkeit ist, zu begreifen, was wirklich ist, was ist und was nicht ist. Die Einsicht, im Denken den Ansprüchen von Wissenschaften beim Begreifen dessen, was ist, gerecht zu werden, müssen wir selbst denkend gewinnen. Sonst können wir das, was wir denken, nicht verantworten. Wir benötigen zweifellos die Naturwissenschaften, wenn es darum geht, die Wirklichkeit zuverlässig zu beschreiben. Die Naturwissenschaften können das, was ist, aber nur beschreiben, wenn die Naturgesetze gelten. Das, was ist, ist aber dann nicht naturwissenschaftlich beschreibbar, wenn es um Prinzipien wie die Widerspruchsfreiheit oder die Menschenwürde und deren Bedeutung für unser Leben und Denken geht. Die Philosophie ist eine Prinzipienwissenschaft und damit auch eine Geltungswissenschaft.
In den Rechtswissenschaften geht es um das geltende Recht. Diese Wissenschaften können erklären, was ›Geltung des Rechts‹ in allen Arten von Gesetzen bedeutet. Ob es in diesen Wissenschaften auch um den Zusammenhang zwischen dem, was ist und dem, was sein soll, geht, hängt davon ab, wie sie den Zusammenhang zwischen Sein und Sollen verstehen. Geltungsfragen begegnen uns nicht nur im Recht, sondern in allen Bereichen des Denkens und Handelns. Es geht in diesen Fragen um das, was in allem Wandel Bestand hat. Wenn wir wissen, was Bestand hat, wissen wir, was ist und was nicht ist. Deswegen müssen wir verstehen, was gilt. Was gilt, hilft uns zu verstehen, was ist und was nicht ist, und zwischen beidem zu unterscheiden. Wenn nichts gelten würde, könnten wir zwischen beidem nicht unterscheiden. Wer behauptet, dass nichts gilt, widerspricht sich selbst, weil dies auch für seine eigene Behauptung gelten würde. Die Philosophie muss begreifen, was gilt, um begreifen zu können, was ist.
EINLEITUNG
Die Frage, was gilt, stelle ich unvermittelt, und mit der Antwort falle ich in gewisser Weise mit der Tür ins Haus. Meine Antwort ist, dass das, was gilt, einen Zusammenhang herstellt zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Das, was gilt, hebt die Trennung von Sein und Sollen auf. Die Antwort auf die Frage, was gilt, begründe ich im ersten und im zweiten Kapitel dieses Buches. Mein Anspruch dabei ist allgemein, weil es mir um alle Arten theoretischer und praktischer Geltung geht. Diesen Anspruch zu stellen, ist nur möglich, wenn der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, tatsächlich allen Arten der Geltung zugrunde liegt.
Die Frage, was gilt, beschäftigte mich schon in meinem Buch Die Möglichkeit des Guten (2006). Dort beschränkte ich mich darauf, das Verhältnis zwischen Geltung, Rechtfertigung und Anerkennung zu analysieren. Das Gute verstand ich dabei unabhängig vom Konzept der Geltung als Leitidee und als Maßstab für die Integration der Güter in einer Gesellschaft. Danach erst wurde mir klar, dass der Zusammenhang zwischen der Geltung und dem Guten sehr viel enger ist, als ich in dem Buch annahm. Wir können das eine vom anderen nicht trennen, weil das, was gut ist, und das, was gilt, zusammen ein menschliches Grundbedürfnis bilden. Wir wollen uns auf das, was gilt, verlassen können, und dies sollte immer etwas Gutes sein. Es sollte nicht irgendetwas sein und vor allem nichts, was schlecht ist und uns schadet. Nur das, was gut ist, sollte gelten, und zwar möglichst dauerhaft und zuverlässig. Dann können wir uns darauf verlassen. Dem Guten können wir vertrauen.
Dieses Bedürfnis ist so sehr mit unserem Dasein und unserer Natur verbunden, dass ich es ein ›ontologisches Bedürfnis‹ nenne (Kap. 1.1). Außerdem nenne ich es so, weil es nicht ausgedacht und erfunden ist, sondern weil wir es in unserem Leben erfahren und finden. Es ist ein Gegenstand und kein Konstrukt unseres Denkens, deswegen nenne ich es ›nicht-reflexiv‹. Weil es kein Konstrukt unserer Reflexion ist, ist es auch nicht wegzudenken, was immer wir für ›gut‹ halten. Die Wörter ›gut‹ und ›das Gute‹ bezeichnen nun aber nichts, was wir definieren und mit Gewissheit wissen können. Außerdem versteht jeder etwas anderes darunter. Aus diesen Gründen habe ich mich in dem eben erwähnten Buch noch auf die Möglichkeit des Guten und auf das Gute als Leitidee beschränkt, ohne dafür zu argumentieren, dass es das Gute gibt.
Nunmehr behaupte ich aber, dass es das Gute gibt. Dafür argumentiere ich, was angesichts des eben erwähnten Risikos, dass wir nicht genau wissen, was es ist, waghalsig erscheinen mag. Der Hinweis darauf, dass Platon Ähnliches versucht, ersetzt keine Argumente. Ich will zeigen, dass es das Gute gibt, obwohl wir nicht genau wissen, was es ist. Für das Wissen, dass es etwas gibt, wovon wir nicht wissen, was es ist, ist das Gute ein besonderes Beispiel, aber nicht das einzige. Freiheit und Leben sind andere Beispiele, auch die Gravitation ist eins. Wir wissen von alledem und von vielem anderem nicht, was es ist, zweifeln aber nicht daran, dass es existiert.6 Für manches in der Natur, wie die Gravitation, gibt es einen messbaren Nachweis und damit ein Kriterium der Identität. Für anderes, wie das Gute, gibt es nur den Begriff, aber keinen messbaren Nachweis und auch kein Kriterium der Identität seiner Bedeutung. Ähnliches trifft für die Freiheit zu.
Für das Leben in seinen vielfältigen Formen gibt es wie für die Gravitation zuverlässige Nachweise. Wir können verstehen, wie und seit wann Leben auf der Erde möglich ist. Wir wissen auch, dass z. B. die Homöostase ein klares biologisches Kriterium des Lebens ist. Dieses Kriterium erklärt, dass alles, was lebt, Energie aufwenden muss, um sich gegen die Umwelt abzugrenzen. Homöostase ist ein Kriterium für den Erhalt des Lebens.7 Es erklärt, warum das, was lebt, lebt. Damit können wir das, was lebt, identifizieren. Es erklärt aber nicht, was ›Leben‹ bedeutet.
Der Umgang mit Begriffen ist nicht von Kriterien ihrer Identität abhängig. Ich argumentiere sprachphilosophisch dafür, dass es für die Identität mancher – nicht aller – Bedeutungen keine Kriterien ihrer Identität gibt. Dies trifft vor allem auf die Bedeutung von Prinzipien zu. Wir können dennoch sicher sein, dass es sie gibt und dass sie eine Bedeutung haben. Wir gebrauchen viele Bedeutungen, ohne dass uns ein Kriterium ihrer Identität zur Verfügung steht. Dies fällt uns gewöhnlich nicht auf. Wenn es uns dann, wie beim Prinzip der ›Menschenwürde‹, auffällt, sind wir ratlos, wenn wir nach einem Kriterium der Identität dieses Prinzips suchen, aber keines finden. Die Suche nach einem Kriterium der Identität von Prinzipien ist aussichtslos und deshalb verfehlt. Die Bedeutung von Prinzipien ist offen (Kap. 1.10). Ich bezweifle mit dem eben erwähnten Argument die allgemeine Brauchbarkeit des Kriteriums der Analytizität von Bedeutungen, das in der analytischen Philosophie von Rudolf Carnap und anderen für die Identität von Begriffen beansprucht wird (Kap. 1.9).
Wenn es keine Identitätskriterien für bestimmte Begriffe gibt, kann das Risiko des Irrtums beim Nachdenken über ihre Bedeutungen nicht ausgeschlossen werden. Umso wichtiger ist es, sich darüber im Klaren zu werden, dass es das, was die Begriffe bezeichnen, tatsächlich gibt. Wenn es dies gibt, können wir die Frage nach dem, was ›Geltung‹ bedeutet, in den ontologischen Rahmen unseres Daseins stellen. Es wird möglich zu sagen, dass es das, was gilt, tatsächlich für uns gibt. Das ist der Anspruch, mit dem das ontologische Bedürfnis nach dauerhaft und vertrauenswürdig Gutem befriedigt werden kann. Unsere These ist: Was gilt, existiert. Es ist nicht einfach erfunden oder aus funktionalen Gründen konstruiert oder fiktiv oder ein Irrtum oder eine nützliche Illusion. Weil es nicht konstruiert ist, sollte das, was gilt, auch nicht relativistisch verstanden werden. Meine Ablehnung des Relativismus hat nicht zuletzt rechtsphilosophische Folgen, die in meiner Diskussion von Hans Kelsens Geltungstheorie im dritten Kapitel des Buches (Kap. 3.1) deutlich werden.
Unterstützt wird der eben erhobene Anspruch, dass das, was gilt, existiert, von Argumenten, die Saul Kripke in seinen John Locke Lectures (1972) entwickelt (Kap. 1.6). Er entwirft mit logischen Argumenten eine Ontologie, die auch auf abstrakte Gegenstände und auf den Bereich des Fiktionalen anwendbar ist. Es wird damit möglich zu sagen, dass Hamlet, Sherlock Holmes und Moses existieren, so abwegig dies auf den ersten Blick erscheinen mag. Wir können über diese literarischen Personen Wahres und Unwahres sagen. Ganz und gar nicht abwegig ist seine Argumentation, dass auch abstrakte Gegenstände wie ›Nation‹ existieren, wenn sie bestimmte Wirkungen haben. Natürlich will ich das Gute mit Kripkes Argumenten nicht fiktionalisieren. Vielmehr sind auch das Gute, die Freiheit und Prinzipien wie die Menschenwürde oder die Widerspruchsfreiheit abstrakte Gegenstände, die über das menschliche Denken real wirksam werden können. Kant hält ›Existenz‹ für kein ›reales Prädikat‹. Wir werden seine Argumente prüfen. Wenn sie zutreffen, können wir nicht behaupten, dass das, was gilt, existiert.
Die Behauptungen, dass es das Gute gibt und dass das, was gilt, existiert, ließen sich oberflächlich gesehen damit begründen, dass das Gute ein idealer Maßstab der Geltung ist. Diese Begründung ist aus mehreren Gründen aber nicht möglich (Kap. 1.5). Außerdem kann das Gute kein Maßstab für das, was gilt, sein, wenn wir nicht wissen, was es ist. Da wir kein Wissen davon haben, haben wir auch kein wahres Wissen davon. Nicht nur das Gute, auch die Wahrheit scheiden bei näherer Prüfung als Maßstäbe der Geltung aus. Damit wird allerdings auch fraglich, was Wissen ist und was als Wissen gelten kann.8 Das Risiko, von etwas zu behaupten, dass es gilt und existiert, ohne zu wissen, was es ist, stellt den kognitiven Anspruch dieser Untersuchung in Frage. Es sieht so aus, als würde ich über etwas nachdenken, wovon ich nichts weiß. Das ist Grund genug, es gerade deswegen zu tun.9
Das eben erwähnte Risiko führt notgedrungen zu der Frage, was überhaupt gewiss ist. Es gibt, wie ich denke, zwei Arten der Gewissheit, die nicht-reflexive und die reflexive (Kap. 1.3). Eine nicht-reflexive ist z. B. die Gewissheit des Todes. Sie ist kein Konstrukt unseres selbstbewussten Nachdenkens, sondern selbst im Zeitalter scheinbar beliebiger Lebensverlängerung unabweisbar. Wir erfahren den Tod anderer Menschen. Diese Erfahrung gehört zu unserem Dasein und zu unserer endlichen Natur. Die reflexive Gewissheit ist diejenige Descartes’, dass ich denkend existiere. Beide Gewissheiten verbinden wir reflexiv und subjektiv. So kann das, was als ›Wissen‹ gelten kann, im subjektiven Denken entstehen, aber dennoch objektiv gelten kann (Kap. 2.3). Das reflexive und subjektive Wissen ist der einzige Zugang zum Nicht-Reflexiven. Jenseits dessen, was wir reflexiv mit Hilfe von Begriffen denken können, gibt es nichts, was wir wirklich denken und wissen können.
Diese Grenze hat Auswirkungen auf das, was gilt. Wenn das, was gilt, existiert, und wir wissen, dass es existiert, aber nicht wissen, was es ist, können wir dessen Geltung nur reflexiv erfassen. Was dies bedeutet, ist ein Thema des zweiten Kapitels (Kap. 2.4-2.7). Die Grenze des Wissens wird mit den Geltungstheorien von Immanuel Kant (Kap. 2.1) und Gottlob Frege (Kap. 2.2) erkennbar. Kant entwirft als Erster mit seiner »transzendentalen Deduktion« in der Kritik der reinen Vernunft eine anspruchsvolle Geltungstheorie. Er erkennt den subjektiven Charakter des reflexiven Erfassens der erfahrbaren Wirklichkeit und glaubt nachweisen zu können, dass die Begriffe, mit denen wir dies tun, a priori gelten. Dieser Nachweis könnte aber nur gelingen, wenn die nicht-reflexiven Grundlagen seines Nachweises reflexiv und a priori vollständig erfassbar wären. Nicht-reflexive Grundlagen der Deduktion sind die Urteilstafel, die Einbildungskraft, die Apperzeption, das ›Ich denke‹, die Spontaneität und die Synthesis des Verstandes, alles, was er ›synthetischapriori‹ nennt. Kant versteht diese von ihm reflexiv aufgefundenen Grundlagen so, als ob sie Ergebnisse seiner Deduktion wären. Sie sind aber deren unabgeleitet geltende Voraussetzungen. Da die Grundlagen der Deduktion aber nicht gleichzeitig nicht-reflexiv und reflexiv sein können, steht Kants Nachweis in Frage. In Frage steht damit auch sein Versuch, eine transzendentale Geltungstheorie ohne Ontologie und die Geltung von Begriffen frei von Erfahrung, aber für die Bildung objektiven Wissens zu entwerfen.10 Auch die Geltung von Begriffen stellt einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was erkannt werden soll, her. Das Ergebnis ist wahres Wissen von dem, was ist.
Frege erkennt und akzeptiert anders als Kant die nicht-reflexiven Voraussetzungen seiner logischen Analyse. Es geht ihm um die Geltung wahrer Sätze, genauer gesagt um die Grundlagen der Berechtigung des Fürwahrhaltens wissenschaftlicher Erkenntnisse. Die Wahrheit dieser Erkenntnis ist das normative Ziel seiner Logik. Sie stellt den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her. Frege erkennt, dass es nicht möglich ist zu definieren, was ›ist wahr‹ bedeutet. Dessen ungeachtet geht es ihm um die Gesetze des Wahrseins. Er spricht ausdrücklich davon, dass es ihm dabei um »ein Sein« gehe. Dieses Sein könne nur gefasst und erfasst, aber nicht deduziert oder begründet werden. Freges Beispiele für dieses Erfassen sind das, was er »Gedanken« nennt, also z. B. Naturgesetze. Sie sind nicht-reflexiv, nicht-subjektiv, gelten als wahr und sind »unzeitlich«. Frege ist überzeugt, dass alles das, was als wahr gilt, also Gedanken, auch existiert und deswegen nur erfasst, aber nicht konstruiert werden kann. Gedanken existieren und gelten als wahr, ohne dass sie eine psychische oder eine quantifizierbare raumzeitliche Präsenz hätten. Sie gelten unzeitlich und physisch nicht quantifiziert.
Frege schärft damit den Unterschied zwischen der zeitlichen Genese des Erfassens von Gedanken, etwa von Naturgesetzen und ihrer unzeitlichen Geltung. Er entwirft die Grundlagen einer Theorie objektiver Geltung. Das Manko seiner Geltungstheorie ist, dass er nicht erklärt, wie die nicht-reflexiven Gedanken reflexiv und subjektiv und individuell erfasst werden können. Er erklärt nicht, wie wir mit Hilfe der Logik den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellen. Da es eine begrifflich nicht überbrückbare Asymmetrie zwischen dem Nicht-Reflexiven und Reflexiven gibt (Kap. 2.4–2.6), kann dieses Manko theoretisch nicht vollständig behoben werden. Wir müssen einsehen, dass keine Theorie der Geltung dieses Manko beheben kann, weil das Nicht-Reflexive reflexiv nicht vollständig erfasst werden kann.
Man könnte nun vorschnell vermuten, dass nichts objektiv gelten kann. Dies ist nicht der Fall, wie die Theorien von Tyler Burge und Wolfgang Spohn zeigen (Kap. 2.3). Burge rekonstruiert die nicht-reflexiven Grundlagen der Objektivität wahrnehmungspsychologisch und baut darauf die Wahrheitsansprüche objektiver Erkenntnis auf. Spohn geht angelehnt an Hume von den nicht-reflexiven, zunächst nur scheinbar geltenden Wahrnehmungen aus und entwickelt dann eine probabilistische Theorie der Bildung von Überzeugungen, die unterschiedlich hohe Ansprüche auf Wahrheit erheben können. Beide Autoren zeigen, dass der theoretische Anspruch auf Geltung sehr weit reicht, obwohl der Anspruch selbst nicht vollständig begründet werden kann. Das, was der theoretischen Geltung zugrunde liegt, zeigt sich in beiden Theorien und ist selbst nicht konstruiert oder deduziert. Erst in der Forschungspraxis zeigt sich das, was theoretisch gilt.
Der Gedanke, dass erst die Praxis zeigt, was gilt, ist für diese Untersuchung grundlegend. Der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, ist ein praktischer. Ludwig Wittgenstein hat den Gedanken, dass die Praxis zeigt, was gilt, geprägt und zunächst mit der Unterscheidung zwischen Sagen und Zeigen im Tractatus erläutert. Dieser Gedanke bleibt über den Tractatus hinaus ein integraler Bestandteil seines Denkens. In seinen Philosophischen Untersuchungen verbindet er den Unterschied zwischen Sagen und Zeigen mit der Praxis des Sprachgebrauchs. In dieser Praxis zeigt sich das, was als richtig und falsch gilt, und dies gilt nicht nur für die sprachliche Praxis. Die Praxis des Sprachgebrauchs kann als Modell jeder Praxis, einschließlich der Forschungs- und der politischen Praxis, verstanden werden. Dies ist ein sehr weit reichender Anspruch, der in meiner Untersuchung allerdings nicht im Einzelnen geprüft und begründet wird.
Die sprachliche Praxis hat selbst einen nicht-reflexiven Charakter. Deswegen zeigt sich das, was als richtiger und falscher Sprachgebrauch gelten kann, in der Praxis, ohne dass es für die Richtigkeit Argumente oder Kriterien gibt. Wittgenstein ist überzeugt, dass es keine Theorie des richtigen und falschen Sprachgebrauchs geben kann.11 Wittgensteins Überlegungen zur Praxis des Sprachgebrauchs haben eine gewisse Ähnlichkeit mit der These des frühen Carl Schmitt, dass sich die Richtigkeit eines Urteils in der Praxis richterlicher Entscheidungen zeigt (Kap. 3.1.3).
Hinter die Praxis des Sprach- und Begriffsgebrauchs können wir nicht zurückgehen. Dies haben aber ernst zu nehmende Denker versucht. Sie haben das Vor-Sprachliche und das Vor-Begriffliche zum Thema gemacht. Martin Heidegger ist einer dieser Denker (Kap. 2.5). Er deutet den Satz von Leibniz ›Nichts ist ohne Grund‹ so, als wäre das Grundlose, das in diesem Satz, wie er meint, zum Ausdruck kommt, nicht das letzte Wort. Er glaubt, dass der Satz darauf hinweist, wie das ›Sagen vom Sein‹ möglich ist. Heidegger unterscheidet nicht zwischen Sagen und Zeigen. Er spricht zwar auch davon, dass sich das Sein zeigt, glaubt aber, dass er ›das Sein‹ auch sagen kann. Er glaubt sogar, dass dies die Aufgabe seines Denkens ist. Wenn das, was existiert, aber nicht-reflexiver Natur ist, kann es reflexiv nicht gesagt werden. Das Vor-Sprachliche kann nicht sprachlich repräsentiert und deswegen auch nicht gedacht und begrifflich repräsentiert werden. Aus dem gleichen Grund scheitert auch der Solipsismus, den Wittgenstein noch im Tractatus vertritt.
Damit ist der theoretische Teil dieser Untersuchung abgeschlossen. Ich konzentriere mich dann auf moral- und rechtsphilosophi sche Ansätze. Mit Ausnahme des Naturrechts stellt keiner dieser Ansätze die Frage, was ›Geltung‹ bedeutet, in einen Zusammenhang mit dem, was ist. Sie setzen den Dualismus von Sein und Sollen voraus, als ob er selbstverständlich wäre. Einige Vertreter dieses Dualismus berufen sich auf Kant, ohne dies begründen zu können. Die Geltung des Moralgesetzes will Kant nicht mit einer transzendentalen Deduktion nachweisen, sondern mit Argumenten, die auf dem Zusammenhang zwischen diesem Gesetz und der Freiheit beruhen. Wenn dieser Zusammenhang so unauflöslich ist, wie Kant glaubt, gelingt der Geltungsnachweis ohne Ontologie. Die entscheidende Voraussetzung dieses Zusammenhangs ist Kants Überzeugung, dass das Moralgesetz ein ›Faktum der Vernunft‹ ist, etwas Unabweisbares und Nicht-Reflexives. Wir prüfen diese Überzeugung und versuchen, die Bedeutung der Freiheit in diesem Zusammenhang zu klären. Kant will auch nachweisen, dass Moral und Recht im Prinzip der Freiheit eine gemeinsame Grundlage haben, dass beide als Gesetze der Freiheit gelten. Die Diskurstheorie von Jürgen Habermas enthält geltungstheoretische Ansprüche, die auf Kant zurückgehen. Habermas meidet aber Kants Apriorismus und dessen transzendentalphilosophische Voraussetzungen (Kap. 2.12).
Trotz der geltungstheoretischen Defizite der erwähnten Ansätze ist die Auseinandersetzung mit ihnen lohnend. Sie vermitteln im Ergebnis die Einsicht, dass der Anspruch auf Geltung reflexiv und rein begrifflich ebenso wenig gesichert werden kann wie kommunikativ und argumentativ. Das Naturrecht geht anders als die Moraltheorien davon aus, dass das, was gilt, einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellt. Diesem Zusammenhang liegen im Naturrecht aber theologische Prämissen zugrunde, die Gott eine Garantenstellung für den Zusammenhang einräumen. Damit kann der Zusammenhang nur in theologischer Hinsicht gelten. Die theologischen Prämissen werden in der Ontologie von Thomas von Aquin erkennbar. Sie zeigt, welche direkte und indirekte Bedeutung die theologischen Grundlagen seiner Ontologie für einige neuere naturrechtliche Ansätze hat (Kap. 2.12).
Die Diskussion der unterschiedlichen geltungstheoretischen Ansätze zeigt, dass die Ansprüche auf Geltung jeweils unabgeleitete Voraussetzungen haben. Ich spreche deswegen von ›unabgeleiteter Geltung‹ im Unterschied zu allem, was daraus argumentativ und in Verfahren abgeleitet und begründet werden kann. ›Unabgeleitet‹ bedeutet, dass es keine weiteren, allgemeineren Grundlagen für den Anspruch gibt, dass etwas gilt. Alle theoretischen und praktischen Prinzipien gelten unabgeleitet. Als Beispiele dafür dienen mir an vielen Stellen der Untersuchung, stellvertretend für theoretische und praktische Kontexte, das Widerspruchsprinzip und die Menschenwürde. Normen gelten dagegen nicht unabgeleitet. Sie können aus Prinzipien abgeleitet und mit ihrer Hilfe argumentativ begründet werden. Sie gelten deswegen nicht so wie Prinzipien (Kap. 2.8). Der Anspruch der Normativität ist nicht identisch mit dem Anspruch auf Geltung, sondern diesem untergeordnet.
Mit den Beispielen des Widerspruchsprinzips und der Menschenwürde will ich die geltungstheoretischen Gemeinsamkeiten von Theorie und Praxis betonen. Es gibt aber auch Unterschiede. Ich argumentiere, wie erwähnt, dafür, dass es für Prinzipien keine Identitätskriterien gibt und sie deswegen offene Bedeutungen haben. Wir haben zu dieser Offenheit aber ein unterschiedliches reflexives Verhältnis. Aristoteles macht in der Nikomachischen Ethik12 mit einem Bild diesen Unterschied verständlich. Es kommt, wie er bemerkt, darauf an, ob wir von Prinzipien ausgehen oder zu ihnen aufsteigen. Im Fall des Widerspruchsprinzips gehen wir von einer der Bedeutungen des Prinzips aus. Im Fall der Menschenwürde steigen wir zu den unterschiedlichen Bedeutungen des Prinzips auf. Dies ändert allerdings nichts daran, dass beide Prinzipien offene Bedeutungen haben. Wir erkennen sie nur aus verschiedenen Perspektiven.
Für den weiteren Gang der Untersuchung kommt es darauf an, die begrenzte Tragfähigkeit des Gedankens, dass die Praxis zeigt, was gilt, zu erkennen. Wenn sich das, was gilt, in einer Praxis zeigt, wissen wir lediglich, dass das, was sich zeigt, nicht Ergebnis einer Theorie oder begrifflichen Erklärung ist. Damit erkennen wir die Qualität dessen, was sich zeigt, noch nicht. Es kann etwas sein, was nicht gut oder gar schädlich ist. Das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem befriedigt keine Praxis schon allein deswegen, weil sich in ihr zeigt, was gilt. Es gab und gibt auch die verwerfliche Praxis des Unrechts und auch in ihr zeigt sich, was ihren schlechten oder gar unmenschlichen Maßstäben nach gilt. Wenn das, was gilt, tatsächlich einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellt, sollte in dem Rahmen, den die menschliche Praxis dafür bietet, nicht gelten, was beliebig und schlecht ist.
In liberalen, rechtsstaatlich verfassten Demokratien ist es die Aufgabe des Rechts, eine Praxis des Unrechts zu verhindern. Die Geltung des Rechts soll dafür sorgen.
Im dritten Kapitel geht es um die Frage, was ›Geltung des Rechts‹ bedeutet. Hans Kelsen beantwortet diese Frage mit seiner Reinen Rechtslehre. Er vertritt einen Dualismus von Sein und Sollen und argumentiert dafür, dass die Geltung des Rechts nicht nur unabhängig ist von allem, was es gibt, sondern eine eigene, in sich geschlossene und kohärente Begründung hat. Kelsen glaubt nicht, dass das Recht selbst unabhängig von der Moral ist.13 Er glaubt aber, dass die Rechtsgeltung unabhängig von Sein und moralischem Sollen ist.14 Das Recht generiert seine eigene Positivität. Kelsens Rechtspositivismus diskutiere ich im Vergleich mit zwei anderen, aber anders argumentierenden Vertretern dieser rechtsphilosophischen Tradition, nämlich Herbert Hart und Joseph Raz (Kap. 3.1). Das Ergebnis meiner Überlegungen, die da und dort von Ronald Dworkins Argumenten (Kap. 3.1.4) unterstützt werden, ist, dass es keine rein rechtliche Geltung geben und dass der Rechtspositivismus keine argumentativ geschlossene Geltungstheorie sein kann.
Das Scheitern der Argumente für eine reine Rechtsgeltung macht aber nicht alle Einsichten Kelsens obsolet. Rechtstheoretisch überzeugend sind seine klare Unterscheidung zwischen der Genese und der Geltung des Rechts und seine Einsicht in die sich selbst generierenden Kräfte der Rechtsordnung. Den Unterschied zwischen Genese und Geltung diskutiere ich ausführlich am Beispiel zweier Kommentare zum ersten Satz des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Der Satz sagt, dass die Menschenwürde unantastbar ist. Die Kommentare stammen von Horst Dreier und Matthias Herdegen (Kap. 3.2.2). An deren Beispiel versuche ich zu zeigen, welche Folgen die These hat, dass es keine Identitätskriterien für Prinzipien gibt. Das Ergebnis meiner Überlegungen ist, dass das Prinzip der Menschenwürde reflexiv uneinholbar ist und deswegen in einer Art ständigem Aufstieg zur Bedeutung dieses Prinzips immer wieder neu bestimmt werden muss, wenn seine Geltung in Gefahr gerät. Der Vergleich der beiden Kommentare zeigt dies. Es wird auch deutlich, dass das, was gilt, in eine fortdauernde Genese eingebettet ist und dass die Geltung nicht das Ende einer Genese sein kann.
Die beiden eben erwähnten Kommentare zum ersten Satz des Grundgesetzes lassen offen, wie sich Kants Würde-Konzept zum Prinzip der Menschenwürde verhält. Es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen, weil Kant die Würde weder als Prinzip noch als absoluten Wert versteht. Vor allem erlaubt es sein Würde-Konzept nicht, die Würde einem Träger physisch zuzuschreiben. Es ist möglich, auf der Grundlage seiner Überlegungen in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten der Würde sowohl einen inneren als auch einen äußeren Wert zu geben und sie argumentativ bei ethisch schwierigen Entscheidungen etwa in der Transplantationsmedizin oder in der Forschung mit embryonalen Stammzellen anzuwenden. Kants Würde-Konzept kann dazu beitragen, umstrittene verfassungsrechtliche Wertzuschreibungen zu korrigieren.
Die Ergebnisse der Untersuchung ergeben bis dahin noch kein Gesamtbild. Wir haben dafür argumentiert, dass die Praxis zeigt, was gilt, und dies auch für die Praxis der Rechtsprechung angenommen. Wenn die Praxis aber nicht garantieren kann, dass das, was gilt, gut und menschenwürdig ist, müssen wir fragen, wovon dieser Anspruch abhängig ist. Es geht um den Zusammenhang zwischen dem, was in der Praxis der Fall ist, und dem, was der Fall sein soll, zumindest aber nicht der Fall sein sollte. Es liegt nahe anzunehmen, dass es Argumente sind, die den Zusammenhang herstellen. Selbst wenn die Kompetenz derer, die entscheiden, und deren Integrität vorausgesetzt sind, bedarf es ihres Willens, den Zusammenhang in einer bestimmten Weise herzustellen. Argumente allein sind keine Akteure und richten von allein nichts aus, wenn sie niemand vertreten will.
Es liegt zwar auf der Hand, dass der Wille derer, die entscheiden, eine Bedeutung hat, es ist aber unklar, welche. Zum einen geht es darum zu verstehen, was mit ›Wille‹ gemeint ist, zum anderen, wie sich der Wille bildet (Kap. 3.3). Schopenhauer und Nietzsche argumentieren, dass der Wille grundlos und keine Ursache ist. Wäre er selbst eine Ursache, wäre er seinerseits verursacht; dann wäre er auch determiniert, wie viele meinen. Wenn der Wille grundlos ist, ist er wirklich frei und unbestimmt. Dann stellt sich die Frage, wie die Willensbildung zu verstehen ist. Einerseits soll der Wille orientieren, andererseits bedarf er der Orientierung, vorzugsweise durch die Vernunft.
Damit stehen wir vor einem Dilemma. Dieses Dilemma lässt sich mit Hilfe von Kants Konzept der Urteilskraft auflösen (Kap. 3.3.3–3.3.5). Sein Konzept ermöglicht ein Verständnis der Willensbildung, das weder voluntaristisch noch rationalistisch ist. Die Willensbildung ist eine Urteilsbildung, die einen Gemeinsinn voraussetzt, den wir – unabhängig von Kant – als Sympathie für die Anderen verstehen, aktives und nicht nur passives Mitfühlen mit der Freude und dem Leid der Anderen. Über die so verstandene Willensbildung kann das ontologische Bedürfnis, dass das, was gut ist, dauerhaft und vertrauenswürdig gelten soll, die menschliche Praxis bestimmen. Das, was gilt, kann, wenn wir Kants Konzept der Urteilskraft folgen, nur exemplarisch, aber nicht universal gelten. Obwohl sich das Dilemma der Willensbildung auflösen lässt, gibt es keine Garantie dafür, dass sich das, was gut ist, in der kollektiven Willensbildung durchsetzt und gilt. Ohne eine Willensbildung, die sich von den Idealen der Vorurteilsfreiheit, der Intersubjektivität und der Kohärenz leiten lässt, kann das, was gut ist, nicht dauerhaft gelten. Dann ist die Geltung der Menschenwürde und anderer Prinzipien der Moral und der Politik gefährdet.
Die Untersuchung folgt unterschiedlichen argumentativen Methoden. Einige Argumente sind sprachphilosophischer und analytischer, andere sind hermeneutischer und phänomenologischer Natur. Analyse, Erklärung und Interpretation sollen sich ergänzen. Die Methoden entsprechen der Sache, um die es geht, und nicht umgekehrt.
1. WAS GILT?
In der Philosophie liegt die Schwierigkeit darin, nicht mehr zu sagen, als wir wissen.(Ludwig Wittgenstein)
Es geht in dieser Untersuchung um das, was gilt. Der Grundgedanke ist, dass das, was gilt, einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellt. Dieser Zusammenhang ist aber nicht offensichtlich. Behauptungen scheinen doch einfach deswegen zu gelten, weil das, was behauptet wird, der Fall ist. Es scheint aber nur so, als würde das, was ist, allein für die Geltung von Behauptungen ausreichen. Tatsächlich gelten sie aber nur, wenn sie wahr sind. Aussagen sollten wahr sein, damit sie als Behauptungen gelten können. Behauptungen stellen also doch einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Anders scheint es sich zu verhalten, wenn es nur um das geht, was ist, ohne dass darüber etwas behauptet wird. Könnten wir nicht wenigstens dann sagen, dass das, was ist, gilt, ohne in einem Zusammenhang mit dem, was sein soll, zu stehen? Denken wir an die vielen Entdeckungen über die Natur und ihre Gesetze. Was entdeckt wurde, zeigt doch, dass es schon vorher so war. Naturgesetze gelten ja nicht erst, nachdem sie gefunden wurden. Ohne Zweifel. Sie können aber erst dann als Naturgesetze gelten, wenn sie überprüfbar, bestätigt und wahr sind. Sie stellen deswegen so wie andere Behauptungen einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll.
Wiederum anders scheint es sich zu verhalten, wenn nur etwas behauptet wird, was sein soll, ohne dass es einen Bezug zu dem gibt, was tatsächlich der Fall ist. Dann gibt es keine wahren und überprüfbaren Gründe für das, was ›Gesetz‹ genannt und durchgesetzt wird, außer der willkürlichen Macht und Gewalt. Deren reale, alles überwältigende Existenz verhindert die Überprüfung des Zusammenhangs zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Unmenschliche, rassistische und diskriminierende Gesetze sind dafür Beispiele. Sie sollten nicht als gültig anerkannt werden, auch wenn sie dem Wortsinn nach ›gesetzt‹ sind.
Es fällt uns nicht leicht, den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, für das, was gilt, zu erkennen. Ein Grund dafür ist, dass wir das, was ist, gewöhnlich auf wahrnehmbare materielle Dinge in Raum und Zeit beziehen. Was auf wahrnehmbare Weise raumzeitlich existiert, hat keinen unmittelbar erkennbaren Bezug zu dem, was sein soll. Sobald wir aber über das, was ist, nachdenken und etwas jenseits der Grenzen unserer Sinne erkennen wollen, können wir den Zusammenhang herstellen. Wir bemühen uns dann, dass unser Erkennen mit wissenschaftlichen Mitteln dem, was ist, angemessen ist. Es soll dem, was ist, angemessen sein, damit es als Wissen gelten kann. Ob dies so ist, hängt von den Hilfsmitteln und Begriffen ab, die wir dabei gebrauchen. Sie existieren zwar nicht so wie die Dinge in Raum und Zeit. Sie existieren aber im Denken und Erkennen und damit ebenfalls in Raum und Zeit.
Es scheint dann so, als ob wir über zweierlei Arten von ›Existenz‹ sprechen, über die Existenz der Dinge und über die Existenz des Denkens. Das wäre unglücklich, weil dann das eine mehr, das andere weniger existent wäre. Tatsächlich könnten wir die beiden Arten der Existenz, wenn es sie gäbe, nicht klar unterscheiden, weil wir nur mit Begriffen beschreiben können, was im raumzeitlichen Sinn der Fall ist. Die Begriffe und Gesetzmäßigkeiten, mit denen wir das, was ist, beschreiben, existieren sowohl in unseren Beschreibungen als auch in dem, was wir ›äußere Wirklichkeit‹ nennen. Sie normieren das, was wir über die Wirklichkeit denken, und sie gelten dabei. Sie gehören dann nicht nur zu dem, was wir beim Denken und Beschreiben tun, sondern auch zu dem, was ist. Naturgesetze gelten, weil sie wissenschaftlich erklärt werden können. Wir sollten sie beachten, wenn wir die Natur verstehen und beschreiben. Mit Naturgesetzen können wir das Wissen von der Natur begründen. Dieses Wissen stellt, wenn es wahr und begründet ist, einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, her.
Leichter zu verstehen ist der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, bei jedem Versprechen. Wenn jemand etwas verspricht, existiert dieses Versprechen. Damit gilt die Verpflichtung, es einzuhalten. Ohne die Einsicht in die Verbindlichkeit des Versprechens, ohne den Willen, es zu erfüllen, und ohne das Wissen, wie dies am besten getan wird, kann es aber nicht erfüllt werden. Das Versprechen begründet mit diesem Wissen und Wollen seine eigene Geltung.
Offensichtlich ist der Zusammenhang auch bei Verkehrsregeln oder bei Gesetzen für den Umweltschutz. Der Straßenverkehr gefährdet Menschen, sie sollen aber sicher daran teilnehmen können. Deswegen gelten Verkehrsregeln. Die Zerstörung des Lebensraums der Arten, die Vergiftung der Böden und der Erdatmosphäre gefährden das Leben insgesamt. Dies sollte verhindert werden. Deswegen gelten Gesetze, die genau dies verhindern sollen. Auch das Widerspruchsprinzip stellt einen Zusammenhang her zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Etwas ist oder ist nicht, es soll aber nicht beides gleichzeitig vom selben in der gleichen Hinsicht behauptet werden. Die Aussagen über das, was ist, sollen sich nicht widersprechen. Wahres Wissen ist nur möglich, wenn dieses Gesetz beachtet wird.
Der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, ist im Denken der Antike und des Mittelalters durch das Gute gesichert. Die Moderne bezweifelt diesen Zusammenhang und bringt ihn mit dem, was gilt, nicht mehr in Verbindung. Was zusammengehören könnte, ›Sein‹, ›Sollen‹ und ›Geltung‹, oder was mit diesen Worten gemeint ist, zerfällt in der Moderne. Auf einen Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, scheint es für das, was gilt, nicht mehr anzukommen. Es scheint sogar so, als ob eine rationale Begründung dessen, was gilt, überhaupt erst möglich wird, wenn jene Bereiche streng voneinander unterschieden werden. Eine Folge davon ist der Glaube an den Dualismus von Sein und Sollen, eine weitere Folge ist die Trennung zwischen theoretischer und praktischer Geltung und die noch weiter gehende Trennung der Geltungen von Recht und Moral.
Ein Grund für die strenge Unterscheidung der Bereiche ist das häufig unglückliche, immer wieder enttäuschte Wissen von dem, was den Zusammenhang ursprünglich sichern sollte, vom Guten. Wir kommen aber nicht umhin über das, was gut ist, und das, was wir darüber wissen können, nachzudenken. Wir tun dies wohl wissend, dass wir selbst nicht genau sagen können, was es ist. Es gäbe aber keinen Grund darüber nachzudenken, wenn wir nicht wissen könnten, dass es das Gute wirklich gibt. Dafür benötigen wir aber Argumente. Bei Versprechen, Verkehrsregeln, dem Umweltschutz und dem Widerspruchsprinzip unterstellen wir, dass es gut ist, dass sie gelten, ohne dass wir an die Existenz des Guten denken oder an ihr zweifeln.
Die Identifikation dessen, ›was sein soll‹, mit dem Guten, liegt auf der Hand, darf aber nicht auf das moralisch Gute eingeschränkt werden. Wir denken mit Hilfe von Begriffen und Gesetzmäßigkeiten und halten uns bei dem, was wir tun, an Normen oder auch nicht. Sie gelten und normieren das, was wir erkennen und tun. Es ist gut, dass sie gelten und wir uns an ihnen orientieren. Es ist gut, weil sie den Zusammenhang unseres Denkens und Handelns mit dem herstellen, was ist. Deswegen existieren sie, obwohl sie keine materiellen, sondern abstrakte Gegenstände sind. Sie existieren durch das, was wir denken und tun, in dem Raum, in dem etwas überhaupt gut sein kann. Das moralisch Gute ist darin enthalten, bestimmt diesen Raum aber nicht insgesamt.
Ein weiterer Grund für die erwähnten scharfen Unterscheidungen ist, dass das, was in Raum und Zeit existiert, seit langem ein Gegenstandsbereich der Naturwissenschaften ist. Ohne an deren Wissen immer teilhaben zu können oder an deren Kompetenzen zu zweifeln, müssen wir aber die Frage, was es gibt, in unserem Leben ständig selbst beantworten. Wir kommen nicht umhin, dies zu tun, auch wenn wir uns häufig irren. Von manchem glauben wir, dass es existiert, obwohl dies nicht der Fall ist. Irrtümer dieser Art können leicht aufgeklärt werden. Weniger leicht aufgeklärt werden kann der Irrtum, dass das, wovon wir nichts wissen, auch nicht existiert. Es kommt also darauf an, wovon wir mit guten Gründen sagen können, dass es existiert.
Noch ein Grund für die Unterscheidungen ist, dass die Frage, was gilt, seit einiger Zeit den Rechtswissenschaften überlassen wird. Dort stellt sich die Frage in gewisser Weise von selbst, aber gewöhnlich unter dem dualistischen Vorbehalt, dass das gesetzliche ›Sollen‹ vom ›Sein‹ getrennt und unabhängig ist. Dabei ist der Zusammenhang dessen, was gilt, mit dem, was ist, und was sein soll, im Recht und in der Praxis der Rechtsprechung offensichtlich. Die Rechtsordnung stellt genau diesen Zusammenhang her. Dunkel und begrifflich undurchsichtig scheint für diesen Zusammenhang die Bedeutung des Willens zu sein. Diese Bedeutung müssen wir aber für das, was gilt, verstehen, wenn informierte Argumente und rationale Begründungen allein die Geltung nicht begründen können. Es spricht einiges gegen den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, obwohl er in allem, was gilt, erkennbar ist. Der Zusammenhang zeigt sich besonders klar und unabweisbar in der menschlichen Praxis. Die Praxis unseres Sprechens und Handeln zeigt, wie wir urteilen und was wir denken, wie wir miteinander umgehen und woran wir uns dabei orientieren. Sie zeigt, was wir für gut und für schlecht halten, wonach wir streben und was wir für verbindlich und gültig halten.
Die Frage, was ›Geltung‹ bedeutet, wird in der Ethik Kants durchaus mit dem menschlichen Willen in Verbindung gebracht, nicht dagegen in seiner Erkenntnistheorie. Kants erkenntnistheoretische Auffassung von ›Geltung‹ hat aber viele Vertreter der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie geprägt. Erkennbar ist dieser Einfluss an zwei Unterscheidungen, derjenigen zwischen ›Geltung‹ und ›Genese‹ und derjenigen zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll. Beide Unterscheidungen werden im Denken, das Kant verpflichtet ist, nicht in Frage gestellt.15
Wir wollen den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, verstehen, weil er bei allem, was gilt, eine ähnliche Bedeutung hat wie bei einem Versprechen. Außerdem haben wir ein Bedürfnis nach Gutem, und dieses Bedürfnis ist mit der Frage nach dem, was ist, verbunden. Es ist, wenn man so will, ein ontologisches Bedürfnis, das Bedürfnis, dass das, was gut ist, nicht nur existiert, sondern dauerhaft existiert. Was gut ist, soll beständig sein, sei es in Form von Gesetzen oder in Form von Erkenntnissen. Je unbeständiger es ist, desto größer ist das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem. Wir wünschen uns das Gute als etwas Dauerhaftes, obwohl wir nicht genau wissen, was es ist. Das mangelnde Wissen kann uns verleiten, daran zu zweifeln, dass es das Gute gibt. Wir wissen aber häufig, was nicht schlecht ist, und davon wüssten wir nichts, wenn wir wirklich am Guten zweifeln müssten.
In Literatur und Kunst, Geschichtsschreibung, Museen und im eigenen Leben gibt es viele Beispiele für das, was gut, nicht schlecht – und schlecht – ist. Wir wissen, dass Anerkennung, Liebe, Glück, eine verlässliche Partnerschaft, Gesundheit, Arbeit, Eigentum, Sicherheit, eine faire Rechtsordnung, gerechte soziale Verhältnisse, Friede und der Schutz der natürlichen Umwelt zu einem guten Leben gehören. Was und wie viel von alledem das Gute ausmacht, wissen wir aber nicht. Das Gute kann uns als teilbar, aber auch als unteilbar, als etwas Absolutes und als etwas Relatives erscheinen. Für alle diese Merkmale gibt es Beispiele, obwohl sie sich eigentlich wechselseitig ausschließen müssten. Gerade weil wir so viele Beispiele kennen, wissen wir, dass das Gute möglich ist. Jeder hat selbst schon Gutes erfahren und hofft auf mehr. Fragen nach dem, was ist, was sein soll und was gut ist, sind seit jeher Wissensfragen. Mit den Antworten auf diese Fragen können wir begründen, was gilt und gelten sollte. Daran orientieren wir uns. Wir wollen als Erstes wissen, wie wir das, was wir ›ontologisches Bedürfnis‹ nennen, verstehen können.
1.1 Ob es ein ontologisches Bedürfnis gibt
Die Gründe, die wir Menschen für das, was gilt, erkennen, sind nicht immer so zuverlässig wie bei Naturgesetzen, Versprechen und Verkehrsregeln. Wir verbinden das, wovon wir glauben, dass es ist, mit dem, was wir für gut halten und deswegen sein soll. Wir können über beides irren. Das, was wir für gut halten, ist nicht immer gut, wie wir häufig erfahren. Nicht einmal der Friede oder die Liebe sind immer gut, geschweige denn dauerhaft. Den Unterschied zwischen dem, was gut ist, und dem, wovon wir glauben, dass es gut ist, sollten wir kennen, bevor etwas gelten soll. Wir kennen den Unterschied aber nicht genau, auch wenn wir uns sicher sind, dass wir uns nicht täuschen. Deswegen können wir mit dem Unterschied auch nicht argumentieren und das Wissen nicht gegen den Glauben ausspielen. Mehr als glauben, dass etwas existiert und gut ist, können wir nicht, wohl wissend, dass wir uns täuschen können.
Menschen haben ein Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, selbst wenn sie nicht wirklich wissen, was es ist.16 Beides wird ihnen bewusst, wenn es ihnen nicht gut und anderen besser geht. Was für die einen gut ist, kann anderen fehlen. Deswegen muss das, was für die einen gut ist, nicht für alle gut sein. Was gut und gerecht für die einen ist, kann für andere ungerecht und ein Grund für Neid, Missgunst und Hader sein. Das eigene Bedürfnis nach dauerhaft und verlässlich Gutem ist daher zwiespältig und kein Maßstab für das, was für alle gut ist. Manche haben dieses zwiespältige Bedürfnis gerade dann, wenn sie sich das, was für sie selbst gut ist, auch selbst erworben haben. Dann glauben sie, dass ihr Bedürfnis, dass das, was für sie gut ist, dauerhaft so bleibt, auch gerecht ist, obwohl es anderen schlecht geht.
Es läge nahe, das Bedürfnis, dass das, was gut ist, so bleibt, ›egoistisch‹ zu nennen, weil es zwiespältig ist. Das wäre vorschnell und unbedacht. Denn dieses Bedürfnis ist keine Einstellung, die gegen bessere Einsicht zu Lasten der anderen gewählt wird. Das Bedürfnis ist natürlich und hat einen nicht-reflexiven Charakter.17 ›Nicht-reflexiv‹ bedeutet, dass es zwar gedacht wird, aber nicht durch das eigene Denken entsteht und auch nicht Ergebnis des Nachdenkens über sich selbst, über andere und die Welt ist. Es ist einfach da, es ist vielfältig, und jede Person hat es. Wir können dieses Bedürfnis auch korrigieren. Dies ist bei einem anderen natürlichen Bedürfnis, demjenigen, Schmerz zu vermeiden und Lust zu empfinden, nicht so. Dieses Bedürfnis kann von vornherein nicht dauerhaft befriedigt werden; es ist auch nicht zwiespältig, weil die Lust des einen nicht der Schmerz des anderen sein muss. Das Bedürfnis nach Lust darf mit dem Bedürfnis nach bleibend Gutem nicht verwechselt werden.
Der Zwiespalt des Bedürfnisses nach bleibend Gutem ist im Verhalten von Individuen und Gruppen zueinander und in den Konflikten und Spannungen zwischen ihnen erkennbar. Menschen können aber auf einen Teil dessen, was sie für gut halten, zugunsten anderer verzichten, wenn sie erkennen, dass es anderen fehlt. Als natürliche Einstellung ist das ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem weder egoistisch noch ein Bedürfnis nach Lust. Auch kranke und behinderte Menschen haben das Bedürfnis, dass das, was für sie gut ist, dauerhaft so bleibt, auch wenn es ihnen schlechter als anderen geht.
Es geht um den Zusammenhang zwischen dem, was ist, mit dem, was sein soll, durch das, was gilt. Das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, das ontologische Bedürfnis, stellt zwar bei jedem einzelnen Menschen jenen Zusammenhang her, ist aber zwiespältig und kann nicht für alle gelten. Deswegen kann das individuelle ontologische Bedürfnis nach dauerhaft Gutem das, was für alle gelten kann, weder begründen noch dauerhaft sichern. Dafür müssen äußere Bedingungen für alle gelten, und diese Bedingungen müssen so dauerhaft und verlässlich wie eine Verfassung sein, die einer Gesellschaft ihre Ordnung gibt. Ohne solche äußeren Bedingungen, die dem Leben einer ganzen Gesellschaft Stabilität geben, können Menschen nicht gut leben, unabhängig davon, was sie für gut halten. Das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem wäre ohne solche Bedingungen für alle enttäuschend und von vornherein eine Illusion.
Die Stabilität äußerer Lebensbedingungen ist aber kein Garant für die Qualität dieser Bedingungen. Was gerecht und gut für die einen und ungerecht und schlecht für die anderen ist, kann durch eine äußere Ordnung dauerhaft so sein. Wenn es dabei bleibt, ist die Ordnung schlecht und die Menschen leben nicht mehr in einer, sondern in mehreren, unverbundenen Wirklichkeiten. Eine schlechte Ordnung ist für viele Menschen, die in ihr leben müssen, keine Ordnung, sondern Unordnung und Unrecht und Ursache ihrer Leiden. Kann eine schlechte Ordnung dennoch gelten? Sie kann offenbar in Kraft sein, wie die Geschichte zeigt, sollte aber nicht gelten. Der Zwiespalt des Bedürfnisses nach dauerhaft Gutem kann sich einerseits in dem, was gilt, fortsetzen. Andererseits kann nur das, was gilt, die ungute Wirksamkeit des zwiespältigen Bedürfnisses nach dauerhaft Gutem kontrollieren und einschränken. Wenn die geltende Ordnung selbst gut ist, kann das Bedürfnis aller nach bleibend Gutem befriedigt werden, so hoffen wir.
Wäre das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem nicht zwiespältig, würden wir alle nach demselben Guten streben. Daraus könnte unmittelbar eine gute Ordnung für alle erwachsen, eine natürliche gute Ordnung sozusagen. Da es aber einen Unterschied zwischen dem Bedürfnis nach dauerhaft Gutem und dem, was für alle gelten kann, gibt, kommt es auf das an, was tatsächlich gilt. Denn nur das, was gilt, kann jenen Unterschied korrigieren und den Zwiespalt der Bedürfnisse entschärfen. Es kommt auf das an, was gilt, damit die existierenden zwiespältigen Bedürfnisse nach Gutem in eine Ordnung integriert werden können, die für alle gut ist. So kann der Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, durch das, was gilt, hergestellt werden.
Um dies zu verstehen, könnten wir die geltenden Ordnungen betrachten, die unser gegenwärtiges Leben bestimmen. Es sind Ordnungen der Politik, des Rechts und der Moral, die wir als liberale Ordnungen schätzen und für unverzichtbar halten. Wir schätzen sie, weil es Ordnungen sind, welche die Freiheit des Einzelnen und das Leben aller sichern können. Die Liberalität dieser Ordnungen ist ein Gut, das dauerhaft sein soll. Es ist ein ontologisches Bedürfnis aller Menschen in einer Gesellschaft wie der unseren. Ohne die Dauerhaftigkeit dieses Guts kann das Bedürfnis nach dauerhaft Gutem, das wir als Einzelne und als Mitglieder einer Gesellschaft haben, nicht befriedigt werden. Deswegen wollen wir wissen, wie die Geltung einer liberalen Ordnung dauerhaft gesichert werden kann.
Die liberalen Ordnungen sagen uns aber ähnlich wenig über das, was ›Geltung‹ bedeutet, wie uns der Geschmack eines guten Gerichts sagt, warum es uns schmeckt. Wir müssen in beiden Fällen Maßstäbe kennen, um urteilen zu können. Das Rezept, nach dem gekocht wurde, enthält Maßstäbe des Geschmacks, die allerdings nicht für jeden gelten. Die geltenden Ordnungen enthalten die Maßstäbe ihrer Liberalität, die unabhängig vom individuellen Geschmack für alle gelten sollten. Es sind vor allem Freiheits- und Menschenrechte, der Rechtsstaat, soziale Gerechtigkeit und die demokratische Ordnung, Arbeit und Einkommen, die eine liberale Ordnung ausmachen und ein gutes Leben ermöglichen.
Um die Geltung dieser Bedingungen zu verstehen, genügt es nicht, sie aufzuzählen und zu beschreiben. Wir müssen prüfen, ob der Zusammenhang zwischen dem, was ist – dass diese Maßstäbe gelten –, und dem, was sein soll – was sie bedeuten –, durch die geltende Ordnung auf ähnliche Weise hergestellt wird wie bei einem Versprechen. Eine Ordnung enthält tatsächlich, wenn wir uns die genannten Maßstäbe anschauen, nicht nur ein, sondern viele Versprechen, auf deren Erfüllung die Menschen einen Anspruch haben. Das große Versprechen jeder guten Ordnung ist, dass das ontologische Bedürfnis aller Menschen einer Gesellschaft erfüllt wird. Nur eine Ordnung, die dieses Bedürfnis erfüllen kann, sollte gelten. Wir nehmen an, dass eine liberale Ordnung diesem Bedürfnis gerecht werden kann, weil sie das, was ist, mit dem, was sein soll, auf bestmögliche Weise verbindet. Die Prinzipien dieser Ordnung existieren. Sie sagen auch, was sein soll, wenigstens dem Namen nach. Daran, dass sie gelten, zweifeln wir nicht. Was genau sie bedeuten, können wir nicht sagen. Dies kann uns zu der irrigen Annahme verleiten, dass sie gar nicht existieren. Das Muster dieses Irrtums ist, dass das, was wir nicht sagen können, auch nicht existiert.
Was wissen wir wirklich? Anders als bei einem Versprechen gibt es bei einer liberalen staatlichen Ordnung keinen Sprecher, der sie in Geltung setzt, indem er sagt, was er genau versprochen hat. Deswegen können wir die Geltung ihrer Prinzipien auch nicht – wie in nicht-liberalen, autoritären Ordnungen – auf den Willen einer oder mehrerer Personen zurückführen. Wir verstehen deswegen noch nicht, was ›Geltung‹ für eine liberale Ordnung bedeutet, weil wir nicht wissen, worauf wir sie zurückführen können. Wir verstehen auch noch nicht, was es bedeutet, dass die Prinzipien einer solchen staatlichen Ordnung existieren, und wir wissen nicht, was sie genau sagen. Dies alles versuchen wir aufzuklären. Nur wenn uns dies gelingt, können wir verstehen, wie das, was gilt, den Zusammenhang zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll, herstellen kann.
Wir gehen davon aus, dass das, was gut für das Leben aller ist, zuverlässig gelten sollte. Die Zuverlässigkeit setzt die genannten Maßstäbe und deren Versprechen voraus. Einen dieser Maßstäbe, die Menschenwürde, werden wir später genauer betrachten. Gemessen an dem ontologischen Bedürfnis jedes Einzelnen nach dauerhaft Gutem sind die Maßstäbe einer liberalen Ordnung und deren Geltung aber noch weit weg. Wir sollten erst verstehen, was uns näher als alles andere ist. Es ist das, was wir als zwiespältiges Bedürfnis nach dauerhaft Gutem bezeichneten. Es ist etwas Nicht-Reflexives, etwas, was wir nicht wählen und uns nicht ausdenken, sondern auffinden. Deswegen fragen wir, welche Bedeutung dieses Bedürfnis trotz seiner Zwiespältigkeit im Leben jedes Einzelnen hat. Wir werden sehen, dass sich ein bereits erwähnter Zwiespalt erneut auftut. Es ist der Zwiespalt zwischen Nichtwissen und Wissen, der uns schon beim Guten begegnet.
Ludwig Wittgenstein versucht, uns mit dem grundlosen Glauben vertraut zu machen. Er schreibt in einem der letzten Texte, an denen er gearbeitet hat: »Die Schwierigkeit ist, die Grundlosigkeit unseres Glaubens einzusehen.«18