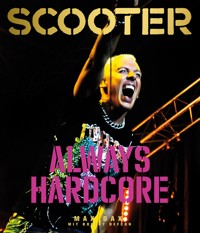Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kanon Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Anstiftung zur Inspiration.Was ist Kreativität? Wie entsteht sie? Wie wollen wir leben? Max Dax verführt 24 weltberühmte und prägende Künstler:innen unserer Zeit zu den überraschendsten Antworten.»Weint die Erde, wenn ein Vulkan ausbricht?«, fragt Max Dax die Sängerin Björk. Diese antwortet: »Das ist eine lustige Frage. Wir sind einfach unglaublich stolz darauf, dass sich die Erde ausgerechnet bei uns auf Island meldet.« In seinen Interviews sucht Max Dax die Routine aufzubrechen und das Gespräch als Spiel zu eröffnen. So entstehen witzige, kluge und zum Teil aufsehenerregende Wortwechsel. Ob mit Quincy Jones, Isabella Rosselini oder Nina Hagen, ob mit Yoko Ono, Hans Ulrich Obrist oder Tony Bennett – jedes Gegenüber belohnt seine Aufschläge. »Was ich sah, war die freie Welt« ist ein Spiegelbild der jüngeren Gegenwart, indem es ihre Spannungspole offenlegt: zwischen Tradition und Avantgarde, Identität und Projektion, Introspektion und Glamour.»Seine Interviews sind wie Kurzgeschichten, im Sinne Hemingways, dessen Kurzgeschichten fast alle dialogisch sind. Ihre Dialoge zeichnen sich durch Präzision aus, durch Weglassungen ebenso wie durch präzise Wörter.« Klaus Theweleit»Max Dax ist ein Magier des Interviews: Wenn er fragt, beginnen seine Gesprächspartner nach den verschütteten Geschichten zu suchen, die sie noch keinem erzählt haben.«Sarah Connor
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Helena Estelle Perpetua
MAX DAX
»Was ich sah, war die freie Welt.«
24 Gespräche über die Vorstellungskraft
ISBN 978-3-98568-029-0
eISBN 978-3-98568-030-6
1. Auflage 2022
© Kanon Verlag Berlin GmbH, 2022
Umschlaggestaltung: Anke Fesel / bobsairport
unter Verwendung eines Ausschnitts des Bildes »OSO«
von Thomas Scheibitz
Herstellung: Daniel Klotz / Die Lettertypen
Satz: Marco Stölk
Druck und Bindung: Pustet, Regensburg
Printed in Germany
www.kanon-verlag.de
Was meine Kunst ist?
Katarina Holländer im Gespräch mit Max Dax
Rindsgulasch Brooklyn
Horst Scheuer
Ich werde also noch einmal nach Neapel reisen
Tony Bennett
Ein Tabu!
Mimmo Siclari
Am anderen Ufer des Hudson River
Steven Van Zandt
Wir waren Rassisten, wir haben nur schwarze Musik gehört
Joe Zawinul
Aber ich darf die zerstörten Gebäude nicht betreten
Irmin Schmidt
Was mache ich mit einer Treppe, wenn sie mir gehört?
Thomas Scheibitz
Tatsächlich habe ich sehr viel Kaffee getrunken
Hans Ulrich Obrist
Ich denke, Sie liegen in diesem Punkt falsch
Yoko Ono
Die Zeit wird dann scharf wie eine Bombe
Okwui Enwezor
Bevor die Lava alles überdeckte
Björk
Ich glaube dann, die Wälder sind verwunschen
Grimes
Da spricht mein Vater zu mir
Andrej Tarkowskij Jr.
Möchten Sie eine Erdbeere?
Grace Jones
Was ich sah, war die freie Welt
Eine Oral History über das schönste Restaurant der Welt
»Hey motherfucker! How do you like your eggs?«
Quincy Jones
Ich persönlich kleide mich eher schlampig
Helena Bonham Carter
Ich mag es kompakt
Isabella Rossellini
»Wass a guin mom u dig me?«
Ed Ruscha
Wie ein Spieler setze ich auf die stärksten Zeilen
Nick Cave
Und zum Abschied bot er mir die Rolle des Satans an
Marianne Faithfull
Glaubenskrieg. So modern!
Nina Hagen
Lyon hatte immer eine eigene Meinung
Jean-Michel Jarre
Natürlich glaubst du dann an Gott
Alva Noto
Quellenangaben
Was meine Kunst ist?
Katarina Holländer im Gespräch mit Max Dax
Max, wo bist du?
Ich grüße dich, Katarina. Ich bin in Berlin, ich sitze in meiner Küche, die zugleich mein Arbeitszimmer ist. In einem Tannenkranz brennen zwei Kerzen. Heute ist der 4. Dezember 2021, der zweite Advent, bald ist Weihnachten. Das Jahr fühlt sich an, als sei es bereits zu Ende. Ich bin so erschöpft wie in anderen Jahren erst zu Silvester. Das Jahr habe ich zu einem Gutteil damit verbracht, Menschen zu treffen, um mit ihnen zu sprechen. Diese Arbeit beinhaltet einerseits, mich ausgiebig auf diese Gespräche vorzubereiten. Ich lese Texte, schaue Filme, besuche Ausstellungen oder Konzerte. Dann muss ich fast immer – und oft weit – reisen, um meine Gesprächspartner zu treffen. Dann folgt das Gespräch selbst, immer in anderen Städten und Räumen. Schließlich, zurück in der Küche, am Tisch, transkribiere ich diese Gespräche und bringe sie in eine Schriftform, die den Leserinnen und Lesern eine größtmögliche Transparenz und Klarheit vermittelt. Für mich ist das eine wunderschöne, meditative Arbeit am Wort. Dieser Prozess führt mit sich, dass ich die Stimmen meiner Gesprächspartner, die ganzen Gespräche, beim Transkribieren ein zweites, oft auch ein drittes Mal höre. Beim Ringen um die bestmögliche Niederschrift des Gesagten werde ich zu einer Art Medium. Und nach jedem Gespräch und dessen Verschriftlichung bin ich ein anderer Mensch geworden, gibt es eine neue Schicht Weltverständnis.
Eine kleine Frage – »Wo bist du?« – genügt, und bereitwillig öffnest du deinen Privatraum, zumindest in einer verbalen Inszenierung: Das ist die Kraft einer Interview-Situation. Dabei ist unsere Situation so: Wir befinden uns im zweiten Jahr der Pandemie, und unser Plan, einander in Person zu treffen, ist dadurch vereitelt worden. So führen wir dieses Gespräch per E-Mail, anders als die folgenden Interviews in diesem Buch, die von Angesicht zu Angesicht oder am Telefon stattfanden – Danke für den Einblick. Deine Antwort erreicht mich in der Schweiz, und wir schreiben gemeinsam ein Vorwort zu deinem zweiten Band mit Gesprächen. Nach dem 2008 erschienenen Band »Dreißig Gespräche« folgt jetzt ein zweiter mit 24 Gesprächen. Beiden Bänden stellst du ein ergänzendes Interview mit dir selbst voran. Wobei sich in einer solchen Reihe von Interviews die fragende Person doch stets auch selbst schon porträtiert. Du hast aber offenbar den Wunsch, dich bei den Interviewten einzureihen. Als Primus inter Pares? Als sichtbarzumachende Absenz? Als Fragekünstler?
Gute Frage. Da zünde ich mir erst einmal eine Zigarette an. Du hast bestimmt in allem recht, was du sagst, aber so ein Vorwort kann auch wie eine Art Grundierung unter einem Ölgemälde sein. Wer hat schon die Zeit, ein langes Buch ein zweites Mal zu lesen? Wenn das Vorwort, also unser Gespräch hier, erkenntnisstiftende Gedanken liefern kann, die zum Verständnis der 24 Gespräche beitragen, dann ist das doch gut. Wichtig ist für mich, dass gleich von Anfang an klargestellt wird, dass es sich bei dieser Gesprächssammlung nicht um eine Best-of-Compilation handelt, sondern es um echte Fragen geht, die ich an die Menschen und die Welt habe. Ich stelle solche Fragen natürlich auch Gästen beim Abendessen – Tischgespräche werden aber nie aufgezeichnet. Das ist die Besonderheit von Interview-Situationen: Sie erfahren einen Medientransfer. Aus dem gesprochenen Gespräch wird ein in Schriftform, oft auch in eine andere Sprache übersetzter Text. Vor allem aber lege ich mit den Gesprächen eine Art rhizomatische Mindmap offen: Das sind die Fragen, die mich interessieren, und diese Fragen stelle ich, oft neu formuliert, daher immer wieder. Es handelt sich nicht um einen feststehenden Fragenkatalog, sondern um eine Art Repertoire von Fragen an die Welt, aus dem ich, abhängig von meiner eigenen Stimmung, aber auch von meinen jeweiligen Gesprächspartnern, spontan schöpfen kann. Diese Fragen muss ich mir auch nicht aufschreiben.
Bob Dylan tourt wieder, und er hat ein ergreifendes und zugleich tänzelndes »When I Paint My Masterpiece« in seine aktuelle Setlist aufgenommen. Das Schaffen des Meisterwerks legt der Song in eine ewige Zukünftigkeit. Du schreibst, dass dieses Buch für dich ein Gemälde ist, aus den Farben der Interviews, die im Verlauf von zwei Jahrzehnten entstanden sind. Dylan hat unvergesslich geschildert, wie er sich als junger Mensch mit den Folksongs geradezu »aufgefüllt« hat. Als habe er eine Tradition vermisst, auf die er hätte aufbauen und von der er hätte abheben können. In verschiedenen der hier versammelten Gespräche kommt das auch zur Sprache, dieses Aufbauen auf etwas – sei es auf die Musik eines Vaters, die Filme eines anderen Vaters, auf die Jazz-Tradition oder auf Haikus. Sind die Gespräche deine Palette? Welche Art von Kunst ist die deine?
Was meine Kunst ist? Ich verwende viel Zeit und Arbeit darauf, Gespräche auf ihre Essenz zu reduzieren, sodass aus diesem Extrakt etwas Bleibendes entstehen kann. Es ist Konsens, dass wir Gemälde und Skulpturen der Kunst zuordnen. Ob Gespräche auch Kunst sind? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass sie meine Kunst sind, dass ich dem gesprochenen, aber auch dem gesungenen Wort viel abgewinnen kann. Dass du Bob Dylan erwähnst, freut mich, denn seine Rede, sein Singen, spricht zu mir. Er taucht immer wieder in den Gesprächen auf. Denn Dylan ist für viele, inklusive mir, ganz klar ein Rollenmodell. Er will weiterkommen. Don’t look back! Es geht um den vor einem liegenden Gestaltungsraum. Das habe ich mir von ihm vielleicht angeeignet. Du sprichst vom Resonanzkörper oder dem Referenzuniversum der Folksongs, mit denen sich Dylan »aufgefüllt« habe. Er glänzt nicht zuletzt, weil er aus einem riesigen Reservoir der Zeichen und Bilder schöpft. Das geht Malern wie Thomas Scheibitz oder Ed Ruscha ebenso, wie sie im Gespräch erzählen, wenn sie, jeder auf seine Weise, beschreiben, wie einem fertigen Bild immer ganz eigene Gedanken, Vorstellungen und Utopien vorangehen oder zugrunde liegen. Ganz klar kann ich sagen, dass die Gespräche meine Universität waren und sind. Ich habe nie studiert, meine Schule ist die Summe der Begegnungen. Und wenn ich verschiedene Menschen mit denselben Fragen konfrontiere, baut sich bald eine Mehrstimmigkeit auf – vielleicht eben das, was du als »Palette« bezeichnest. Gute Geschichten und Gedanken, die in Gesprächen erzählt werden, sind mindestens ebenso interessant wie prosaisch in Form gebrachte Geschichten – oder, wenn man sie aneinanderreiht, wie Kapitel in einem Roman.
Du hast ja neben den Interview-Büchern auch angefangen, Romane zu schreiben. Ist da vielleicht ein Prozess im Gang? Warum beharrst du denn auf der Interview-Form, diesem Spiel mit der Ehrlichkeit, mit der ominösen »Authentizität«, mit Voyeurismus? Wir sehen dich hier bewusst dein Selbstbild malen. Als Grundierung oder auch nicht. Warum schreibst du keine Porträts?
Warum sollte ich? Ich war und bin am Gedankenaustausch mit anderen interessiert. Ich kann mich wie ein Kind für die Utopien und Vorstellungswelten Dritter begeistern. Diese Utopien erfahre ich nicht durch Recherche, sondern durch das Gespräch. Eigentlich eine Binsenweisheit, aber Interviews entstehen unter aktiver Teilnahme der Gesprächspartner, sie sind eben keine Interpretationen. Im Autorisierungsprozess bearbeiten wir die Gespräche, kürzen und fügen hinzu – immer gemeinsam. So handhaben wir es ja auch mit diesem Gespräch in Schriftform. Es gibt aber tatsächlich eine Methode, die ich an dieser Stelle nicht verschweigen möchte: Ich kürze die Interviews stets auf ihr Skelett, auf das Unentbehrliche. In einer solchen skelettartigen Fassung bekommen diese wenigen Worte dann sehr oft eine große Wucht, die sie im Singsang des Gesprächs vielleicht nicht auf den ersten Blick hatten. Erst die Niederschrift bringt den Punch. Ich möchte in meinen Gesprächen stets einen reinen Gedankenstrom ausstellen, die Essenz einer Begegnung. In meinem ersten, bei Merve erschienenen Roman »Dissonanz« habe ich zum Beispiel Gespräche auf wenige Sätze reduziert, wie in einem Haiku. Einige dieser in »Dissonanz« so maximal reduzierten Gespräche, etwa mit Yoko Ono oder Jean-Michel Jarre, können in diesem Buch jetzt in voller Länge nachgelesen werden.
Im Gespräch mit Grimes benutzt du unter anderem den Begriff »Avantgardeszene«. Außerhalb der Musik war die Vorstellung der Möglichkeit einer Avantgarde verschwunden, und der Begriff verweist paradoxerweise auf historische Ausrichtungen. Wäre das in deinen Augen heute eine avantgardistische Stoß- oder Flussrichtung – das Fluide, die uferlose Globalisierung, Verflechtung, Vernetzung und Inter- und Hypertextualität?
Du triffst ins Schwarze. Intertextualität ist für mich ganz klar die Erzählform des 21. Jahrhunderts, auch im Kontext des Internet 3.0, und den neuen Rezeptions- und Konsumgewohnheiten der Lesenden wie auch der Schreibenden. Als Methode lässt sich dies aber nur bedingt auf Interviews anwenden, denn ihnen liegt ja stets ein konkret geführtes Gespräch zugrunde. Für mich persönlich fällt unter den Begriff »Avantgarde« jeder Künstler und Musiker, der oder die an neuen Ausdrucksformen, Stilistiken, Gedanken arbeitet und alte Formen und Genres überwindet. Ich selbst komme aus der weiten und rauschhaften Welt der Popmusik. Im Pop-Diskurs wird der Avantgarde-Begriff etwas lockerer verwendet als in der akademischen Welt. Aphex Twin oder die Gruppe Autechre gehen problemlos als Avantgarde durch, obwohl beide mit dem historischen Avantgarde-Begriff nichts mehr zu tun haben. Gleichwohl stehen sie, und auch Grimes, für Experimentierfreudigkeit und den Wunsch, die Musik weiterzuentwickeln. Im besten Falle sind solche Musiker dann ganz in der Gegenwart, weil sie an der Musik der Zukunft mit den Mitteln von heute forschen. Zugleich leben solche Musiker heute oft nicht mehr von ihren Plattenverkäufen, und seit der Pandemie auch nicht mehr von den Gagen ihrer Live-Auftritte. Sie sind gezwungen, sich zu öffnen und in anderen Feldern zu arbeiten. Neuartige Bücher werden im Angesicht dieser gesellschaftlichen Verschiebungen und Verwerfungen geschrieben, neuartige Theaterstücke inszeniert, Ausstellungen kuratiert, Filme gedreht oder Bilder gemalt. Denn viele probieren sich in einer neuen Disziplin aus – mit den Erfahrungen, die sie in einem anderen Feld gesammelt haben. Automatisch wird die Kunst hierdurch hybrider. Und dann gibt es ja noch das Wissensarchiv, die Echokammer des Internets. Jede Kunst im 21. Jahrhundert steht massiv unter diesem Einfluss. Und gerade in der Literatur, aber auch in der Musik und in der bildenden Kunst werden diese Einflüsse in neuen Werken hör- und sichtbar, da sie sich immer auch mit den neuen Rezeptionsgewohnheiten und nicht zuletzt neuen Aufmerksamkeitsspannen auseinandersetzen müssen.
Mich interessiert das Fragenstellen an sich. Warst du schon ein Kind mit vielen Fragen?
Darüber muss ich nachdenken. Ich habe als Kind Flugzeugentführungen, brennende Ölplattformen und Kriegsszenen in der »Tagesschau« gesehen, die mich tief erschütterten. Zugleich bildete ich mir ein, ich besäße die Antwort darauf, wie die Menschheit dieses Elend überwinden könnte. Ich dachte, die müssen sich doch bloß einfach vertragen! Ich fragte mich, warum die Politiker und Wirtschaftsbosse diese für mich als Kind so offensichtlichen Antworten eigentlich nicht kannten.
Da hast du aber dich selbst gefragt, nicht andere. Du hattest, gemäß deiner Erinnerung, also die Antworten, nicht Fragen. Wie kam es dann zu diesem umfassenden, anhaltenden Fragenstellen?
Das liegt an Andy Warhol. Ich stolperte eines Tages in einer Bahnhofsbuchhandlung über eine Ausgabe von Andy Warhols Interview-Magazin. Mir gefiel das riesige Format sofort, und auch Richard Bernsteins Pastellkreideporträt von Don Johnson auf dem Cover. Ich blätterte mich durch gefühlt endlose Modestrecken – doch dazwischen gab es diese Interviews mit Leuten, deren Namen mir nichts sagten. Doch, einen kannte ich: Michael Mann, der Regisseur des Films »Band of the Hand«. Ich hatte den Film zwar noch nicht gesehen, aber ich wusste, dass Bob Dylan, der mich bereits damals faszinierte, den Titelsong geschrieben hatte. Ich kaufte mir also das Magazin, und eine neue Welt, die mich bis heute faszinierende Popwelt, tat sich für mich auf, indem ich ein Interview nach dem anderen las – und auf diese Weise das Gefühl bekam, all die mir zuvor fremden Leute kennenzulernen. Das inspirierte mich so sehr, dass ich begann, selbst Interviews zu führen. Hierfür gründete ich als 15-jähriger umgehend mein eigenes Magazin. Musiker wie Billy Cobham oder Manfred Maurenbrecher konnte ich treffen, wenn sie auf ihren Tourneen in meiner Heimatstadt Kiel Konzerte gaben. Und wie Andy Warhol brauchte ich bloß ein paar Fragen zu stellen und erhielt ausführliche, oft lehrreiche, absurde Geschichten als Antworten. Entscheidend war, glaube ich, dass ich vor allem zuhörte – und nur Fragen stellte, wenn eine Geschichte beendet war, oder ich mehr davon hören wollte. Bald begriff ich: Ich brauche ein Aufnahmegerät, um diese Geschichten festzuhalten.
Also ein Wunsch, Menschen kennenzulernen, Einblick in fremde Welten zu erhalten. Und die Ikone, Andy Warhol … Ein Fragensteller, der mit der Absicht fragt, das Erfragte zu veröffentlichen, löst bei seinem Gegenüber unweigerlich eine in sich widersprüchliche Bewegung aus: Exhibitionismus bei gleichzeitigem Verschließen. Meine Eingangsfrage an dich war übrigens ein Zitat des allerersten Interviews unseres Kulturkreises. Schon jene erste Frage jedoch war uneigentlich. Der Fragende »weiß« bereits, wo Adam ist, seine Frage ist nicht echt. Es geht gar nicht um eine Suche, der Schöpfer in Genesis 3 hatte den Satellitenblick schon. Und natürlich verrät sich der von der Frage Getroffene mit seiner Antwort sofort. Und ist in der Falle: »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist?« In diesem Sinne hat der Fragende immer schon vor-gedacht, seine Frage gibt eine Richtung vor. Die kann der Antwortende abzulenken versuchen, doch scheint es ein unausgesprochenes Recht des Fragenden zu geben, solche Ablenkungen nicht anzuerkennen und auf Rückkehr zur vor-geschlagenen Richtung zu pochen. Die Position des Fragenden ist stets auch eine Position der Macht. Dagegen ist mir bei deinen Interviews immer wieder ein sanfter Umgang mit dieser Macht aufgefallen.
Gespräche können alles sein, sie haben im Idealfall tausend Plateaus oder Ebenen. Sie können sein wie Schachpartien, in die man sich ja gewappnet begibt. Sie können sich im besten Falle aber auch völlig ergebnis- und vor allem verlaufsoffen aus dem Momentum heraus entwickeln. Andy Warhols gütige Art, alles genial zu finden und nie etwas zu kritisieren, schon gar nicht Erfolg, Genialität und Reichtum, wurde mir schnell zum Vorbild. Bei seinen Interviews bekam ich oft den Eindruck, dass ich ein Zeitdokument lesen darf, weil es mich schon immer interessierte, wie sich die »Celebrities«, deren Leben nun einmal anders getaktet ist als das von uns Normalsterblichen, nach getaner Arbeit im Restaurant bei Essen und Wein unterhalten. Diese Natürlichkeit, auch in Form einer vertraulichen, echten und vor allem immer am Anderen interessierten Tonalität, habe ich ja selbst als Jugendlicher bei Abendessen meines Vaters mit anderen Künstlern erlebt, und man kann solche Momente der Intimität – du hast vorhin das Wort »Authentizität« verwendet – vielleicht auch beschwören. Ich bemühe mich in Gesprächssituationen grundsätzlich immer um eine empathische Atmosphäre. Ich suche nie nach einem Scoop, und ich stelle auch keine rhetorischen Fallen. Ich versuche auch Fragen zu vermeiden, die dem Befragten schon tausend Mal gestellt wurden. Viel mehr bin ich an der Weisheit und Lebenserfahrung meiner Gesprächspartner interessiert. Oft entsteht bei diesen bald die Bereitschaft, sich zu öffnen und ganz aufrichtig über Weltanschauungen und die eigene Vorstellungskraft, die eigenen Beweggründe und die eigene Geschichte zu reflektieren, genau dadurch – weil eben nicht hart und konfrontativ gefragt wird. Viele Fragen sind durch ihre existenzielle Natur ohnehin per se hart. Genau so, wie Bebop oft härter ist als Metallica.
Das »Harte« in deinen Gesprächen kam mir oft wie ein Stein vor, der sich in den Bach, den Fluss, legt und so das Wasser dazu veranlasst, Buckel aufzuwerfen, Formen zu bilden, die ohne den Stein nicht entstanden wären, oder Spritzer.
So habe ich das noch nie gesehen. Aber es ist ein schönes Bild. Ich erinnere mich an einen Fernsehbeitrag aus den Neunzigerjahren über die ’Ndrangheta in Kalabrien. Eine Reporterin im Business-Anzug interviewte in der glühenden Mittagshitze auf der Piazza eines kalabresischen Dorfes einen stämmigen Mann, der etwas über die ehrenwerte Gesellschaft zu sagen hatte. Er trug eine einfache Hose und ein offenes weißes Hemd. Er schwitzte sehr, aber er schien mit seinen Füßen fest auf dem Boden zu stehen, mehr noch, er wirkte, als hätte er Wurzeln, die tief in das Erdreich gingen. Die Reporterin konnte fragen, was sie wollte. Sie wirkte gegen diesen Fels von einem Mann wie ein flüchtiger Windhauch. Ich versuche, kein Windhauch zu sein.
Dieses Buch hat verschiedene Spannungsbögen. Es schreitet unter anderem vom Belcanto zu einem nicht identifizierbaren irritierenden Geräusch. Bereits im zweiten Gespräch – mit Tony Bennett – gibt es ein einprägsames Bild, wie ein Mann vor der Emigration nach Amerika zu Hause in Kalabrien aus seinem Dorf hinausschreitet. Von dem Berg, den er erklimmt, singt er in den Himmel hinauf und ins Tal hinunter, wo seine klare Stimme durchs Dorf weht und seinen Söhnen zeigt, was es bedeutet zu singen. Und im letzten Gespräch mit Alva Noto – das uns in die Gegenwart der Pandemie zurückführt –, taucht aus dem Nichts eine Art »aufgekratzter Donner, ein schabendes, knatterndes Geräusch« auf. Es zeigt sich, dass es sich um ein zur Kenntlichkeit editiertes, augmentiertes Zwischenraumgeräusch handelt, um den verstörend hörbar gewordenen Zwischenraum. Das Buch hat dabei einen deklarierten kuratorischen Aspekt, es handelt sich um »24 Gespräche über die Vorstellungskraft«. Der Aspekt dieser Kraft ist ein Attribut, das die Gespräche in ein bestimmtes Licht rückt. Ich möchte dich daher zum Schluss fragen, was du denn über die Vorstellungskraft beim Zusammenstellen dieser Interviews gelernt hast.
Die Vorstellungskraft ist etwas sehr Mächtiges. Nur wenn wir hören – oder lesen –, was für Gedanken jemand über die Welt hat, können diese anschließend in uns arbeiten. Mit offenem Ausgang. Hans Ulrich Obrist bezeichnet Gespräche als »Reality Production«. Es ist außerdem ein Privileg, dass ich diese berühmten Menschen treffen darf. Das verpflichtet. Auch weil die Gespräche anschließend veröffentlicht werden, bin ich vielleicht so etwas wie eine Erkenntnisschnittstelle. Und genau deshalb will ich von meinen Gesprächspartnern Antworten bekommen, die wirklich auf die Conditio humana zielen, auf unser künstlerisches Selbstverständnis, auf unseren Kodex, auf unsere Bereitschaft zur Selbstermächtigung. Das ist dann vielleicht die »Vorstellungskraft«, die die Gespräche in diesem Buch hoffentlich fest zusammenhält. Es gibt so viele Interviews, die in all den Jahren entstanden sind, bestimmt um die Tausend. Das waren, wenn man so will, meine Privataudienzen mit meinen permanent wechselnden Gastprofessoren. Wenn diese Menschen anfangen zu erzählen, dann verschwimmen Legende, Vergangenheit, Gegenwart, Wunschbiografie und Zukunftsahnung zu einer Vorstellungskraft, die bei jedem Gesprächspartner in eine andere Richtung tendiert, aber immer fein granuliert ist und immer auch unbekannte Türen öffnet. Nicht nur biografisch, auch was die Interessen angeht. Als mich Gunnar Cynybulk fragte, ob es mir bei der Zusammenstellung der Gespräche leichter fallen würde, wenn ich diese unter das Dach eines übergreifenden Begriffs stellen würde, dachte ich gleich an die »Vorstellungskraft«. Sie ist es, die uns Menschen einzigartig macht und uns vielleicht auch von den Tieren und Pflanzen unterscheidet. Menschen, die in ihrem Leben alles auf eine Karte setzen und ihrer Vorstellung von – künstlerischem – Leben opferbereit und konsequent, sich selbst hinterfragend und ehrgeizig nachgehen, denen höre ich einfach gerne zu. Sie haben viel erlebt. Ich muss ihnen zuhören und sie dazu bringen, einfach immer weiterzuerzählen. ~
1.
Rindsgulasch Brooklyn
Horst Scheuer
2021, Wien
Horst Scheuer, wo erreiche ich Sie gerade?
Ich sitze an Tisch 13. Wenn Sie das Berger & Lohn betreten und an der Bar nach links in den großen Speiseraum blicken, dann ist es gleich der zweite Tisch links. Ich sitze am Fenster.
Und was trinken Sie zum Gespräch?
Ein Glas Sauvignon.
Auf Ihr Wohl! Sie gehören in meinen Augen zu den selten gewordenen Gastronomen, die Prinzipien haben, die eine Haltung haben. Was für eine Haltung steckt hinter dem Berger & Lohn?
Kennen Sie das Musso & Frank in Los Angeles?
Das kenne ich tatsächlich! Und wenn ich ein Lokal in einer Stadt mag, gehe ich dort immer wieder hin. Die Zahl meiner Reisen nach Los Angeles lässt sich leider an einer Hand abzählen. Und wenn man nicht aufpasst, ist das Musso & Frank irgendwann verschwunden. Es ist eines dieser Lokale, die den Geist einer vergangenen Epoche atmen, die schon immer da waren. Es entspricht auf alle Fälle meiner Vorstellung von einem Amerika vergangener Tage.
Nun, das Berger & Lohn ist in gewisser Hinsicht meine Version des Musso & Frank. Man stelle sich umgekehrt vor, das Berger & Lohn hätte seinen Sitz in New York oder Los Angeles. Dort könnte es nicht ganz so sein wie hier. Aber es wäre mit Sicherheit der Versuch einer größtmöglichen Annäherung an Wien. Und diese Annäherung an ein Wien im Exil, diese Beschwörung eines Alten Europa in der transatlantischen Ferne, die gibt es jetzt genau hier als Umkehrschluss im 18. Bezirk. Ich sehe es immer wieder an Reisenden, die mein Restaurant besuchen, die lieben diesen Twist ganz besonders. Die erkennen dieses Spiel, das der Ort und sein Konzept mit ihnen spielen, oft sehr schnell und geradezu intuitiv. Sie begreifen, dass ich hier am Abend eine Stimmung zu erreichen versuche, wie meine Gäste sie vielleicht auch in einem wienerischen Restaurant eines Wiener Exilanten in Manhattan erleben würden.
Mir ging es ja ebenso, als ich das Berger & Lohn zum ersten Mal betreten habe. In der Musik würde man von Saudade sprechen – ich spürte die Anwesenheit einer Abwesenheit. Wie übersetzt man ein so abstraktes, fast schon lyrisches Restaurantkonzept konkret in einen Raum, eine Speisekarte und in eine Atmosphäre?
Es gibt ein weiteres Vorbild. Das ist der Philosoph und Wiener Aktionist Oswald Wiener, der in den Siebzigerjahren als Staatsfeind aus Österreich flüchten musste, und in Westberlin das Restaurant Exil am Paul-Lincke-Ufer eröffnete. Und dieses Restaurant war das traditionsvollste wienerische Restaurant, das ich mir hätte ausmalen können. Nur dass es eben in Westberlin lag und nicht in Wien. Und meine Idee ist eben, ein solches Restaurant aus der Diaspora zurück ins Wien der Gegenwart zu verpflanzen. Es ist auch bezeichnend, dass die ganzen Kellner, die im Exil gearbeitet haben, heute fast alle ihre eigenen Restaurants aufgemacht haben, oder wie Bruno Brunnet in Berlin die Galerie Contemporary Fine Arts, CFA. Mein Partner, der Michi Lohn, war früher der Jungkellner im Exil. Und Attila Corbaci betreibt jetzt das Corbaci im Wiener Museumsquartier. Und Michel Würthle machte nach dem Exil mit der Paris Bar in Berlin weiter. Und dann ist da ja auch noch Ingrid Wieners Tochter Sarah. Es zeugt von einer unglaublichen Qualität, wenn die Crew nach dem Ende eines Restaurants auf einem derart hohen Niveau weitermacht. Sie alle wurden von Oswald Wiener und seiner Frau Ingrid auf eine Fährte gebracht und sind alle auf ihre Weise erfolgreich geworden. Und mehr noch: Sie bewahren nicht bloß, sie führen eine Idee weiter. Oswald Wiener hatte einen guten Draht zu seinen Kellnern. Er nahm sie selbstverständlich mit auf Ausstellungseröffnungen und auf Kunstmessen. Und das führte dazu, dass auch die Kellner mit der Zeit ein Kunstverständnis entwickelten und – nur als Beispiel – nicht nur David Bowie und Iggy Pop gut behandelten, sondern auch die manchmal unscheinbaren, oft mittellosen Künstler oder auch den amerikanischen Kunstsammler, der gerade ein paar Hunderttausend Mark für einen Cy Twombly ausgegeben hatte. Es gibt Legionen von Kellnern, die sich über den Kunsthändler hinter dessen Rücken lustig gemacht hätten. Oswald Wiener und seine Crew hatten dagegen ein anderes Verständnis und einen anderen Horizont.
Kennt Oswald Wiener Ihr Restaurant?
Ja. Er war zwei Mal hier und ist stets bis in die Nacht geblieben. Ihn bewirten zu dürfen war mir schon eine besondere Ehre.
Haben Sie selbst mal in Amerika gelebt?
Ich habe drei Jahre in New York gelebt und dort auch gearbeitet. Das war die härteste und zugleich die schönste Zeit meines Lebens. Auf unserer nächsten Karte wird übrigens wieder ein Rindsgulasch stehen, das ganz klassisch serviert wird. Es wird aber »Rindsgulasch Brooklyn« heißen, weil ich einen Eingriff vornehmen werde, den ich genau so in Brooklyn habe erleben dürfen, als ich dort in einem wienerischen Restaurant gearbeitet habe. Dazu muss man wissen: Jedes zweite ernsthafte Restaurant in New York hat einen mexikanischen Küchenchef. In Mexiko gibt es zwei Kochschulen: die französische Küche und die italienische Küche. Mexiko stand für eine kurze Zeit aber auch unter österreichischer Herrschaft, zwischen 1864 und 1867 – da hatte Mexiko für drei Jahre mit Maximilian I. einen österreichischen Kaiser. Der wurde zwar anschließend an die Wand gestellt und erschossen, aber diese drei Jahre haben offenbar gereicht, dass es das eine oder andere österreichische Nationalgericht auch in Mexiko gibt, wenn auch in einer mit der Zeit vielleicht verwässerten oder angepassten Form. Und unser mexikanischer Küchenchef in Brooklyn hat damals ein ganz tolles Wiener Saftgulasch gekocht, wenngleich mit Modifikationen. Traditionell wird das Saftgulasch mit nicht so edlem Fleisch gekocht. Es hat Sehnen und ist durchaus flachsig. Die Sehnen und die gelierten Teile sind aber sehr wichtig für die Konsistenz des Saftes. Will man dieses Gericht also aufwerten, kocht man es mit besagtem flachsigen Fleisch, um den Saft aufzubauen, nimmt es anschließend raus und gibt stattdessen magereres Fleisch von der Schulter hinzu.
Und was ist an dieser Methode jetzt so typisch mexikanisch?
Er hat den Saft mit Kakaobohnen und schwarzer Schokolade, mit Zimt, Rohrzucker und Cayennepfeffer verändert. Das Gericht wurde durch die Schokolade viel dunkler, und durch die beigefügten Gewürze entwickelten sich im Zusammenspiel mit dem mageren Fleisch unglaubliche, nie zuvor geschmeckte, mollige Nuancen im Gaumen. Für mich, der ich dachte, jede Darreichungsform von Gulasch zu kennen, war das als Sensation kaum zu toppen.
Gibt es einen Gulasch-Goldstandard in Wien?
Nein, aber die Messlatte hier liegt hoch. In jeder Beisl gibt es ein Gulasch, und überall schmeckt es ein bisserl anders. Und von daher ist es grundsätzlich also auch erlaubt, beim »Rindsgulasch Brooklyn« mit einer Nuance dunkler Schokolade zu arbeiten, zumal der Gast ohnehin nie auf die Idee käme, dass diese Geschmacksexplosion auf Schokolade und Zimt zurückzuführen ist.
Wir sprechen also über den vorläufigen Endpunkt einer nachvollziehbaren Tradition, die bloß eine halbe Weltreise hinter sich hat. Und wer einmal das Gulasch in Brooklyn gegessen hat, hätte dann also bei Ihnen potenziell eine Art Proust’sches Madeleines-Moment?
Darum geht es! Auch ich hatte einmal einen solchen Moment, als ich in ein Brötchen gebissen habe. Da war er wieder, dieser Geschmack aus der Kindheit! Da hat die Kruste so eine leichte karamellartige Süße, die einfach unnachahmlich ist. Diese Sensation habe ich in Zürich erlebt mit einem Schweizer Bürli – am Stern-Wurststand am Zürcher See.
Den kenne ich! Der Senf dort ist legendär scharf.
Ja, aber es waren die Bürli, die mich in meine Kindheit zurückkatapultiert haben. Es handelt sich übrigens um die gleichen Bürlis, die auch in der Kronenhalle serviert werden. Ich will damit sagen: Wenn man ein Produkt auf den Punkt bringt, dann kann man es nicht mehr verbessern. Das gilt für ein Brötchen genauso wie für hochkomplexe Saucen. Und jetzt kommt die Pointe: Wir wollten die Zürcher Bürlis auch im Berger & Lohn backen. Wir haben es sechs Wochen lang jeden Tag versucht. Wir haben Buch geführt über kleinste Änderungen, die wir am Rezept vorgenommen haben, um unseren Prozess nachvollziehen zu können. Aber nach diesen sechs Wochen haben wir es aufgegeben, obwohl ich sogar das identische Mehl aus der Schweiz hatte kommen lassen. Lag es am Wiener Wasser oder am Luftdruck? Ich weiß es nicht. Wir bekamen es einfach nicht auf demselben hohen Niveau hin.
Ich kenne diese Diskussion zwischen Römern und Neapolitanern, die sich über Espressokaffee streiten.
Kennen Sie das Buch »Heat!« von Bill Buford? Das ist ein ehemaliger Redakteur der New York Times, der mit vierzig Jahren in einem Restaurant in Manhattan ganz unten in der Hackordnung als Küchenlehrling angeheuert hat. Er zieht die Lehre durch, reist anschließend für ein paar Monate nach Italien, wo er von alten Damen lernt, wie man perfekte Gnocchi zubereitet – und schreibt anschließend sein Buch. Er beschreibt darin, wie er es in New York nicht vermag, dieselben Gnocchi hinzubekommen wie in Italien. Also lässt er sich Mehl und Eier aus Italien einfliegen und sogar das Wasser. Aber es gelingt ihm trotzdem nicht. Bill Buford hat also das gleiche Waterloo mit seinen Gnocchi erlebt wie ich mit meinen Bürli.
Inwiefern geht es Ihnen auch um ein kulinarisches Weltkulturerbe, dem Sie sich vielleicht verpflichtet fühlen?
Ich möchte es mal so sagen: Ein heute 22-Jähriger wird in der Regel nicht mehr so von seiner Großmutter bekocht wie ein damals 22-Jähriger meiner Generation. Wenn aber die Erinnerung an den spezifischen Geschmack von Familienrezepten verschwindet, weil man sich an industriell prozessiertes Essen gewöhnt, dann verlieren wir einen wichtigen Teil unserer Identität.
Kochen Sie also mit einem selbst auferlegten Auftrag?
Ja. Aber es gibt auch Momente, in denen ich ins Zweifeln komme. Wenn zum Beispiel amerikanische Food-Redakteure der Meinung sind, dass wir im Berger & Lohn nicht mehr wienerisch genug sind und uns mit dieser Begründung verreißen, dann werde ich nachdenklich. Aber am Ende des Tages bleibt der Wunsch, auf ihr aufbauend und sie analysierend, die Tradition ein Stück weit aufzubrechen.
Was ist in diesem Zusammenhang Ihre Position zum Wiener Schnitzel?
Wir haben das Schnitzel hier zwei Jahre lang wie eine Parodie begriffen. Die Panade haben wir so zubereitet, dass sie nicht am Schnitzel anliegt, sondern sich aufbläht wie ein Ballon. Und vor allem: Es war nicht zu fett, auch weil wir es nicht in Butterschmalz gebraten hatten. Vor drei Monaten haben wir mit diesem Bruch der Tradition gebrochen. Ein Vierteljahr lang sind wir also zurückgekehrt zur klassischen Zubereitungsmethode mit Butterschmalz. Und was passiert? Unsere Gäste forderten das von uns modifizierte Wiener Schnitzel zurück! Das war ein irrer Moment. Wir hatten es glatt verpasst wahrzunehmen, dass uns mit unserem Wiener Schnitzel eine eigene Signatur gelungen war. Wie viele Diskussionen haben wir in den zwei Jahren zuvor im Team geführt, was genau diese, unsere eigene Signatur sein könnte, wegen derer die Menschen immer wiederkommen würden? Und wir bemerkten gar nicht, dass wir dieses Gericht, diese Signatur längst auf unserer Karte stehen hatten!
Es war also gewissermaßen ein »Kommentar zum Wiener Schnitzel«?
Was für ein schöner Name! »Kommentar zum Wiener Schnitzel« … Das schreibe ich mir auf.
Wie wichtig ist neben den eingedeckten Tischen, der Einrichtung und der Kochphilosophie des Kommentierens von Klassikern eigentlich die Ausstattung der Kellner: Sie selbst, aber auch alle Kellner, Sie servieren in weißen Anzügen, die an Smokings erinnern. Wenn man aus Deutschland kommt, kennt man das gar nicht mehr – livrierte Kellner …
Das ist abermals ein Kommentar zur Tradition. In Wien trägt der Kellner klassisch einen schwarzen Smoking. Das irritiert natürlich wieder die durchreisenden Amerikaner. Denn für sie ist der Black Tie der Inbegriff eleganter Abendgarderobe. Dass in Wien der Waiter einen Smoking trägt – das begreift der Amerikaner nicht. Wir haben den Smoking beibehalten, aber aus Schwarz Weiß gemacht. Gemäß dem Dresscode aber trägt im Wiener Kaffeehaus der Piccolo Weiß – also nicht der Kellner, der kassiert, sondern der Kellner, der bloß zuträgt. Wir sind natürlich keine Piccolos hier, aber wir wollen die Tradition trotzdem zitierend aufbrechen.
In Italien tragen Baristas oft weiße Jacketts.
Ich wollt’s gerade sagen: In diesem Sinne verweist das Tragen eines weißen Smokings auch auf einen Hauch von Italienurlaub. Von Rimini bis Palermo tragen die Kellner weiße Jacketts. Aber Wien ist eine Stadt, die einen Hang zur Hässlichkeit hat. Codes, die eine gewisse Eleganz vermitteln – wie weiße Tischwäsche und eben weiße Jacketts – werden oft missverstanden und als teuer und überkandidelt wahrgenommen. Dieser Zugang ist in Italien oder Frankreich undenkbar.
Soll dieses Spiel mit den Codes und der Umkehrung des Gewohnten verwirren?
Ich empfinde es ja tatsächlich eher als Vereinfachung. Alles ist klassisch, alles baut auf methodischen Bausteinen auf, die in ihrer Summe die gastronomische Geschichte Wiens definieren. Die Küche ist einfach und ehrlich, wobei dies natürlich Begriffe sind, die man noch besprechen müsste, denn »einfach« bedeutet natürlich nicht, dass es einfach wäre, die Küche zu kopieren.
Hinter dem »Einfachen« steckt also abermals ein Code, eine Komplexität? Ganz genau. Jedes Gericht besticht zunächst aber durch seine Qualität. Der Materialeinsatz ist anspruchsvoll, aber keine Speise wird künstlich verziert oder aufgeblasen. Dasselbe könnte ich über ein weiteres Lieblingsrestaurant von mir sagen, das Odeon in Tribeca, New York. Gegründet wurde es von drei New Yorkern, Lynn Wagenknecht und den Brüdern Keith und Brian McNally. Sie waren sich darüber einig, dass es in ihrer Stadt keine Brasserie gab, die ihren Ansprüchen genügt hätte. Und zu dritt haben sie in Manhattan einen Brasserie-Klassiker geschaffen, der kaum zu toppen ist, und den es zugleich trotzdem so nicht in Paris gibt. Der Ort ist also einzigartig. Mich interessiert das Vertraute im Fremden, aber auch das Fremde im Vertrauten. Im Odeon wird das Steak Frites heute noch so serviert wie 1979, als das Restaurant eröffnete. Wer das Odeon heute betritt, spürt, ähnlich und doch anders, noch immer die Präsenz der vergangenen Jahrzehnte. Weil alles so geblieben ist, wie es einmal war. Ich könnte ein halbes Buch füllen mit den Erinnerungen an die Details, die ich bei meinen Besuchen dort bemerkt habe.
Mit was für einem Blick betrachten Sie als Gast einen solchen Ort?
Ich begebe mich in solche Räume immer alleine, nie in Begleitung. Oder wenn doch, dann bitte nicht mit einem anderen Gastronomen. Nur so kann ich selbst erkennen, dass im Odeon alles auf den Punkt gebracht ist, und zwar bis hin zur zwanglosen Lässigkeit in der Körpersprache der Kellner. Hier wird nicht zwangsneurotisch nach Perfektion gesucht. Sondern die Perfektion liegt in der Selbstverständlichkeit, mit der hier jahrein, jahraus das Tagewerk verrichtet wird. Diesem Ballett zuzuschauen ist der reinste Genuss.
Diese Liebe zum Detail kennen wir aus europäischen Flaggschiffen der Gastronomie – etwa Harry’s Bar in Venedig.
Gutes Beispiel. Ich bin mir sicher, dass sich Arrigo Cipriani lange darüber Gedanken gemacht hat, welche Farbe seine Tischtücher haben sollen, damit der Teint in den Gesichtern der Frauen durch die Lichtreflexion am besten zur Geltung kommt. Arrigo Ciprianis Tischdecken sind aprikosenfarben aus genau diesem Grund. Und wenn man bei ihm Jahre später wieder als Gast einkehrt, merkt man verblüfft: Hier servieren immer noch dieselben Kellner wie beim letzten Mal.
Das ist ein Selbstverständnis, das einem Lebensentwurf nahekommt. Damit geht ein Berufsethos einher.
Es gibt vermutlich zwei Gründe, weshalb man im Odeon oder in Harry’s Bar als Kellner anfängt: Man will sein Leben lang Kellner sein. Oder man möchte Schauspieler werden. Oder vielleicht fängt man auch als Kellner an, weil man perspektivisch eines Tages selbst einen Laden aufmachen möchte. ~
2.
Ich werde also noch einmal nach Neapel reisen
Tony Bennett
2015, New York
Buona sera, signor Bennett, come sta?
Molto bene, grazie. Che bello, dass Sie auf Italienisch fragen. Das ist die Sprache meiner Familie.
Stimmt es, dass die erste Platte, die Sie hörten, eine Schellackplatte von Enrico Caruso war?
Ich weiß nicht, ob es meine erste Platte war, aber wir hörten viel Caruso zu Hause, vor allem im Radio. Als mein Vater als italienischer Einwanderer den Boden Amerikas betrat, ging es ihm leider gesundheitlich nicht besonders gut. Aber von daheim, von Podargoni, einem kleinen Dorf in der Nähe von Reggio Calabria, da brachte er einen guten Ruf mit. Man schätzte ihn dort für seine schöne Stimme. Er pflegte, als er noch dort lebte, zu Fuß den Berg hinaufzusteigen, der Podargoni überragt, und von weit oben hinunter ins Tal zu singen – wo ihn jeder laut und klar hören konnte. Die schöne Gesangsstimme meines Vaters wiederum beflügelte sowohl meinen älteren Bruder John als auch später mich, ebenfalls die Technik des Belcanto-Gesangs zu erlernen. John war erst zehn Jahre alt, als er seine ersten Erfolge verbuchte. Das war noch vor dem Zweiten Weltkrieg und vor dem Siegeszug des Fernsehens. Tatsächlich durfte John regelmäßig im Radio singen. Die ganze Familie war stolz. Bald rief man ihn »Little Caruso«. Mein Vater mag ein gebrechlicher, kränklicher Mann gewesen sein, der viel zu früh verstarb – aber er hat dazu beigetragen, dass seine Söhne und indirekt auch seine Enkelkinder zu leidenschaftlichen Sängern wurden. Die Liebe zum Singen hat nie aufgehört. Ich bin jetzt 89 Jahre alt, und meine Stimme ist noch immer nicht hinüber. Ich finde sogar, dass sie mit jedem Jahr besser wird. Mit jedem Jahr, das vergeht, kann ich mehr Erfahrung in meinen Vortrag legen.
Hat es Sie eigentlich jemals nach Neapel verschlagen? Haben Sie Zeit dort verbracht, um auf Carusos Spuren zu wandeln?
Leider nein. Das heißt: Noch nicht, sollte ich vielleicht besser sagen, denn ich könnte mich ja jederzeit dazu entschließen, doch noch mal nach Neapel zu reisen. Und dann könnte ich mich vor Ort nach Carusos Erbe umsehen.
Es gibt sie also noch, die möglichen Abenteuer, nach einem mehr als erfüllten Leben?
Ich werde also noch einmal nach Neapel reisen. Danke für die Anregung. Da haben Sie’s. Auch im Alter kann man noch Weichen stellen. Und natürlich habe ich in Neapel schon gesungen. Aber ich sehe auf Konzertreisen selten mehr als den Konzertsaal, ein Restaurant und das Hotel, in dem man mir eine bequeme Suite gebucht hat.
Die Städte gleichen sich auf diese Weise an?
Ganz genau. Auf hohem Niveau.
Umso interessanter, wie präsent hingegen auch Jahrzehnte später noch Kindheitserinnerungen sein können.
Da haben Sie recht! Ich wuchs in einem Städtchen namens Astoria auf. Das ist heute eingemeindet in den New Yorker Stadtteil Queens. Da lebten früher die Familien derer, die in Manhattan arbeiteten. Ich habe dort als junger Mann in Restaurants als singender Kellner mein bescheidenes erstes Geld gemacht, und ich habe auch in kleinen Clubs gesungen. Und wenn man mal einem Star begegnete – etwa Frankie Laine, der einen Hit mit »That Lucky Old Sun« gehabt hat –, dann gab es stets eine große Bereitschaft, dass der Berühmte dem Novizen half. Mit Tipps, mit Ermunterung, vielleicht sogar mit einer Empfehlung. So läuft das heute nicht mehr. Leider. Aber die Erinnerungen, die ich mit Astoria verbinde, die sind einfach fabelhaft. Das waren wundervolle, einfache Menschen dort.
Sie leben nach wie vor in New York. Hier haben Sie auch in den letzten Jahren eine Folge von Alben aufgenommen, in denen Sie die Songs des Great American Songbook singen – dabei widmen Sie ein Album stets einem der Songautoren.
Das ist richtig. Manhattan war und bleibt einfach das Zentrum der Musik. Für mein neues Album habe ich eine Auswahl von Songs von Jerome Kern aufgenommen, der für mich zu den größten Komponisten der Vereinigten Staaten zählt. Jerome Kern hat seine großen Lieder in den Zwanzigerjahren geschrieben – also vor fast einhundert Jahren. Das war ein Moment in der amerikanischen Geschichte, als die besten Komponisten zur selben Zeit am selben Ort wirkten. Ich rede von Ikonen wie Irving Berlin, George und Ira Gershwin und Cole Porter. Diese Konzentration von Talent gab es in der Intensität vielleicht nur im Frankreich vor der Jahrhundertwende – und zwar nicht in der Musik, sondern in Gestalt der Bewegung der Impressionisten um Claude Monet. Jerome Kern im Besonderen prägte die Broadway-Musicals wie kaum ein Zweiter, und einige der Songs, die er schrieb, gehören zu meinen ewigen Favoriten. Er war es, der den Jazz, das Musical und den Pop als erster zusammenbrachte. Er starb im November 1945 – er hat das Ende des Krieges noch erlebt.
Auf Ihrem neuen Album »The Silver Lining« singen Sie ausgewählte Lieder Kerns – und Ihre Stimme klingt immer noch wunderschön. Wie haben Sie es geschafft, sie so in Schuss zu halten?
Ich mag alt sein, aber wenn ich singe, dann singe ich mit der Leidenschaft eines 19-Jährigen. Dass ich Belcanto von der Pike auf gelernt habe, hat dabei sehr geholfen. Es geht nichts über eine solide Grundausbildung. Ich bin aber nach wie vor der Meinung, dass ich trotz meines Alters noch viel lernen kann und sollte. Das ist eine Geisteshaltung, die mich hungrig bleiben lässt. Hungrig nach Erfahrungen und nach Erfolg. Und es zahlt sich ja auch aus. Wo auch immer ich auf dieser Welt singe – ich singe vor ausverkauften Häusern.
Erst kürzlich haben Sie ein Duett-Album mit Lady Gaga – bürgerlich Stefani Germanotta – veröffentlicht. Das war nicht nur mal wieder ein Nummer-Eins-Album für Sie in den Billboard-Charts. Es war zugleich auch eine Konfrontation mit der Gegenwart.
Lady Gaga erzählte mir, ihr sei stets eingetrichtert worden, nicht normal, also mit ihrer eigenen Singstimme zu singen, sondern dass sie diese zu verstellen hätte. Um eines gewissen Effekts willen. Als wir aufeinander trafen, ermutigte ich sie, auf ihre normale, unverstellte Art zu singen. Am Ende der Sessions sagte sie zu mir: »Sie waren der erste, der mir das erlaubt hat.« Für mich war das aber gar keine große Sache. Man schont seine Stimme, wenn man in seiner natürlichen Stimmlage, also unverfälscht singt. Mir war klar, dass Stefani sich, indem sie ihre wirkliche Stimme erstmals zuließ, zugleich einem älteren Publikum empfehlen würde. Sie schlug eine Brücke von ihren jungen Fans zu meinem Publikum. Und natürlich war mir klar, dass ich auch selbst dank ihrer Hilfe von einer ganz neuen Generation wahrgenommen würde, die sich bis dato für mich als Opa gar nicht interessiert hat. Und Sie erwähnten so lapidar in Ihrer Frage, dass wir mit »Cheek to Cheek« die Billboard-Charts geknackt haben. Wir haben gemeinsam mehrere Millionen Platten verkauft! Das ist die eigentliche Leistung.
Wie gefällt Ihnen das moderne Showbiz? Sie haben bestimmt mal ein Konzert von ihr gesehen?
Leider nein. Aber dafür haben wir gemeinsam vier Nächte lang im Hollywood Bowl in Los Angeles und vier weitere Nächte in der Radio City Music Hall in New York vor ausverkauftem Publikum gespielt. Das sind nicht nur verdammt große Spielorte – das sind die wichtigsten Bühnen der Welt! Wir sind im Laufe dieser Zusammenarbeit zu Freunden geworden. Das verbindet uns.
War es von Bedeutung für Sie, dass Lady Gaga italienische Wurzeln hat?
Irgendwie schon. Wir haben ähnliche Familiengeschichten, auf die wir zurückblicken. Das hilft enorm, wenn es darum geht, das eigene Ego zurückzustellen und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Es ging bei uns zum Beispiel nie um die Frage, wer von uns beiden jetzt berühmter ist – wir waren einfach beide vor allem stolz darauf, es als Italiener in Amerika zu etwas gebracht zu haben.
Sie erinnern sich bestimmt an die Zeiten, als Musik noch eine Kluft zwischen den Generationen markierte, ich sage nur: Elvis und Sinatra. Heute scheint es diese Kluft gar nicht mehr zu geben.
Und das ist ein Segen! In der Vergangenheit gab es Grabenkämpfe, heute scheint es eine größere Offenheit zu geben. Wissen Sie, ich bin im Grunde meines Herzens ein Jazzsänger. Ich improvisiere ständig, wenn ich singe. Meine Band mag dieselben Noten spielen, aber ich singe jeden Abend anders. Ich habe mich mit Stefani darüber unterhalten. Sie sagte zu mir: »So würde ich auch gerne singen dürfen. Aber die Leute sagen mir, dass diese Art zu singen nicht mehr populär sei.« Und ich entgegnete ihr: »Dafür gibt es das Great American Songbook.« Das ist ein Standard, an dem wir alle uns bis an unser Lebensende werden abarbeiten können.
Aber wie war das damals, als Elvis die Regeln des Spiels auf den Kopf stellte? Sie haben das ja miterlebt. Mit einem Mal gab es den Rock ’n’ Roll – und somit neue Regeln. Sie sind dadurch, das schreiben Sie selbst in Ihren Memoiren, ins Hintertreffen geraten.
Elvis ist Elvis. Er war ein sehr schöner Mann. Und ich hatte zum Zeitpunkt seines Erfolgs Vorbilder, die ich nicht gegen ihn einzutauschen bereit war. Ich spreche von Frank Sinatra und von Nat King Cole und von Ella Fitzgerald. Das ist die Generation derjenigen, die zehn Jahre älter waren als ich. Und vergessen Sie nicht Europa: Da, wo Sie leben, hat man die Jazzsänger immer geliebt. Wir alle waren zeitweise viel populärer in Europa als in Amerika.
Hier in Europa beneiden wir hingegen die Amerikaner dafür, mit dem Jazz als Selbstverständlichkeit aufgewachsen zu sein. Jazz war und ist Mainstream – Big Business.
Der Jazz wurde in Amerika erfunden – von den Afroamerikanern. In New Orleans. Aber das bedeutet leider nicht, dass heutzutage noch viele junge Amerikaner Jazz hören würden. Genau deshalb war es ja auch so wichtig, gemeinsam mit Stefani, mit Lady Gaga, die Fronten aufzubrechen. ~
3.
Ein Tabu!
Mimmo Siclari
2001, Reggio Calabria
Mimmo Siclari, Sie sind 2000 bekannt geworden mit dem Album »Il Canto di Malavita – La Musica della Mafia«, einer Compilation mit traditionellen Mafialiedern und -balladen. Diese Lieder haben Sie in den Siebzigerjahren in Ihrem Studio in Reggio Calabria wie ein Anthropologe aufgenommen. In ihnen geht es um Respekt und Loyalität, aber auch um Blutrache und gewaltsame Einschüchterung. Es gibt Lieder, in denen inhaftierte Mörder singend berichten, dass sie »unschuldig« im Gefängnis sitzen: Sie hätten schließlich in Übereinstimmung mit dem Gesetz gemordet – dem Gesetz der Mafia.
Da muss ich Sie korrigieren. Alle diese Lieder handeln ausschließlich von Respekt und Ehre. Ich würde sogar so weit gehen, die Inhalte dieser Lieder einer noblen, aristokratischen Weltanschauung zuzuschreiben. Wir Kalabrier haben große Herzen. Freundschaft – und die Loyalität, die mit ihr einhergeht – bedeutet uns mehr als alles andere. Unsere Gesellschaft ist auf gegenseitigem Respekt aufgebaut. Unsere Lieder kann man daher auch als die Geschichte der ungeschriebenen Gesetze Kalabriens lesen. Sie erklären, weshalb bestimmte Phänomene stattfinden konnten. Kalabrien ist immer unterdrückt worden. Ein Staat mit funktionierender Rechtsprechung hat in Kalabrien nie existiert. Wir haben hier immer nur Willkür erlebt. Kein Wunder, dass es irgendwann dazu kam, das bestimmte Leute rebelliert haben. Und wo rebelliert wird, gibt es Tote. Und diejenigen, die getötet haben, wurden in den Bergen von der Bevölkerung aufgenommen und versteckt, sie wurden zu »Latitanten«. Aus einigen wenigen Latitanten wurden viele, es wurden Geheimbünde gegründet, Banden gebildet – um die Ungerechtigkeit zu bekämpfen, mit der wir hier in Kalabrien konfrontiert waren. In England ist Robin Hood zur mythischen Heldenfigur aufgestiegen, weil er seine Würde behalten hat. Das Gleiche ist hier passiert. Wer genug hatte von der Demütigung, wandte sich an die ehrenwerte Gesellschaft, die den Mut hatte, den Besatzern die Stirn zu bieten.
Über welches Jahrhundert reden wir hier eigentlich?
Wir reden über eine Zeit, die mehr als ein Jahrhundert zurückliegt. Heute ist alles anders. Es gab den Faschismus, die Dinge haben sich seitdem geändert. Nach dem Faschismus hatte sich die Situation hierzulande ein wenig beruhigt, aber dann kam das Geld. Und mit dem Geld kam die Ungewissheit, ob ein Politiker nicht auch ein Mitglied der Mafia sein könnte, und die Unsicherheit, ob die Mafia bestimmt, wer Politiker wird, um das viele, mit einem Mal verfügbare Geld zu kontrollieren. Wenn man sich die politische Landschaft heute anguckt, dann ist das eine völlig andere Welt als jene des 19. Jahrhunderts, von der unsere Lieder handeln.
Wie sind Sie vor dreißig Jahren auf die Musik der Mafia aufmerksam geworden?
Diese Musik ist in Kalabrien allgegenwärtig. Und ich habe sie geliebt, weil sie sichergestellt hat, dass eine historische Wahrheit über unser Land, die nicht in den Geschichtsbüchern abgebildet ist, ans Licht kommt. Und wenn eine Organisation wie die ’Ndrangheta imstande ist, diese Geschichtsschreibung mittels einer eigenen Musik zu gewährleisten, dann muss man doch von einer Kultur oder zumindest einer Subkultur des Verbrechens sprechen. Für mich wurde die Angelegenheit bald zu einer Besessenheit. Zuerst nahm ich auf meiner Revox-Bandmaschine in meinem Studio alle Lieder auf, die ich finden konnte. Dann habe ich in den Achtzigerjahren angefangen, diese Lieder auf Kassetten zu verkaufen. Ich bin durch das Land gefahren und habe auf Dorffesten und Wochenmärkten, bei Prozessionen und religiösen Zusammenkünften Kassetten mit Malavita-Musik verkauft. Ich habe dabei eine Welt erlebt, die einiges gemein hatte mit der Welt, von der diese Lieder handeln: Wenn ich Kassetten verkaufen wollte, musste ich stets erst den örtlichen Boss um Erlaubnis bitten. Immer hat man mir geholfen. Ich hatte ja auch gute Manieren. Ich wusste mich gut zu benehmen. Das begreifen viele Jugendliche heute nicht mehr. Oft behandeln sie andere Menschen nicht mit dem Respekt, der ihnen zusteht. Ich frage nie nach Dingen, die mich nichts angehen. Ich misstraue jeglicher Bürokratie und vertraue lieber den Männern, die sich durchsetzen können: Hätte ich mich anders verhalten, hätte ich auf meine Rechte gepocht, die mir der Staat in irgendwelchen Gesetzestexten garantiert, hätte ich meine Kassetten nie verkaufen können. So eine Erfahrung prägt.
Für jemanden, der nicht in Kalabrien aufgewachsen ist, klingen die Lieder der ’Ndrangheta wie eine Romantisierung von Gewalt und Selbstjustiz.