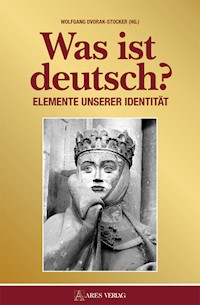
Was ist deutsch? E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ares Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Moderne Medien, Kommunikation und Reisemöglichkeiten haben die Welt kleiner werden lassen. Die Unterschiede zwischen Völkern und Kulturen schwinden – und bestehen doch nach wie vor. Die Frage nach der nationalen Identität, der eigenen Eigenart, aber auch nach Unterschieden zwischen den einzelnen Regionen ist daher von größerer Bedeutung als je zuvor. Auch wenn sich Identität aus verschiedenen Quellen speist und Nation, Staat, Region und Heimat nur einige von ihnen darstellen, bleibt die Beschäftigung mit den verschiedenen Aspekten der ethnischen Identität für den Selbstfindungsprozess des Einzelnen unverzichtbar. In diesem Sammelband beleuchten zahlreiche Artikel unterschiedliche Elemente dieses Themas, ohne freilich Vollständigkeit anzustreben. Entnommen sind sie 20 Jahrgängen der Quartalsschrift "Neue Ordnung", seit 2020 "Abendland". Die anthropologische und genetische Stellung des deutschen Sprachgebietes in Europa beleuchtet Andreas Vonderach, der sich in seinem Beitrag über den Völkerpsychologen Willy Hellpach auch den Unterschieden zwischen den einzelnen Stämmen und Regionen widmet. Dr. Hrvoje Lorković erkundet aus psychiatrischer Sicht das Phänomen von "Neurotischen Nationen". Grundlegenden Fragen widmen sich auch Dr. Björn Clemens mit seinem Beitrag über die Liebe zu Volk und Heimat als unverzichtbarer Stufe der Menschheitsentwicklung, Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker, der die Bedeutung und Funktionsweise nationaler Mythen darlegt, und Manfred Müller, der die christlichsoziale Idee der Volksgemeinschaft erläutert. Um kulturelle Fragen geht es Sigrid Müller mit ihrem Beitrag über "Die unübersetzbaren Worte. Ein Schlüssel zum Wesensgrund der Völker", Univ.-Prof. Dr. Wilhelm Pinder, der über "Das Deutsche in der deutschen Kunst" schreibt, und Dr. Eduard Huber, der die Unterschiede zwischen französischer und deutscher Baukunst herausarbeitet. Dem Christentum als wesentlichem Bestandteil der deutschen Identität widmen sich Beiträge von Manfred Müller, Dr. Eduard Huber und Univ.-Doz. Dr. Friedrich Romig. Mit einzelnen Aspekten wie Ritterlichkeit und Gründlichkeit sowie den unterschiedlichen Konzepten von Freiheit, Volk, Nation und Staat in Frankreich und Deutschland befassen sich General Dr. Franz Uhle-Wettler und Dr. Eduard Huber. Einzelnen Regionen und Staaten wenden sich Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker in seinem Artikel über den "Mythos Preußen" und Dr. Ulrich March zu, der Norddeutschland und die Alpen-Donau-Region miteinander vergleicht. Dem "Geheimen Deutschland" wiederum sind Artikel von Sebastian Pella und Univ.-Prof. Dr. Paul Gottfried gewidmet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wolfgang Dvorak-Stocker (Hg.)
Was ist deutsch?
ELEMENTE UNSERER IDENTITÄT
Umschlaggestaltung: DSR – Digitalstudio Rypka, 8143 Dobl/Graz, www.rypka.at
Umschlagabb. Vorderseite: WikiMedia Commons / Linsengericht (CC BY-SA 3.0)
Wir haben uns bemüht, bei den hier verwendeten Bildern die Rechteinhaber ausfindig zu machen. Falls es dessen ungeachtet Bildrechte geben sollte, die wir nicht recherchieren konnten, bitten wir um Nachricht an den Verlag. Berechtigte Ansprüche werden im Rahmen der üblichen Vereinbarungen abgegolten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet unter https://www.dnb.de abrufbar.
Anmerkung des Verlags:
Das Recht zu einem Abdruck in einem Sammelband wurde uns von den Autoren in der Regel bereits zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung ihres Beitrags in der Zeitschrift „Neue Ordnung“ eingeräumt. Da hier alle Beiträge in der ursprünglichen Fassung ohne weitergehende Aktualisierung wiedergegeben sind, müssen sie im einzelnen nicht dem heutigen Wissensstand bzw. der heutigen Auffassung ihrer Verfasser entsprechen.
Hinweis
Dieses Buch wurde auf chlorfrei gebleichtem Papier gedruckt. Die zum Schutz vor Verschmutzung verwendete Einschweißfolie ist aus Polyethylen chlor- und schwefelfrei hergestellt. Diese umweltfreundliche Folie verhält sich grundwasserneutral, ist voll recyclingfähig und verbrennt in Müllverbrennungsanlagen völlig ungiftig.
Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne kostenlos unser Verlagsverzeichnis zu:
Ares Verlag GmbH
Hofgasse 5 / Postfach 438
A-8011 Graz
Tel.: +43 (0)316/82 16 36
Fax: +43 (0)316/83 56 12
E-Mail: [email protected]
www.ares-verlag.com
ISBN 978-3-99081-076-7
eISBN 978-3-99081-106-1
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.
© Copyright by Ares Verlag, Graz 2021
Layout: Ecotext-Verlag Mag. G. Schneeweiß-Arnoldstein, Wien
Inhalt
Wolfgang Dvorak-Stocker: Vorwort. Ich bin nicht „stolz“, Deutscher zu sein
Wolfgang Dvorak-Stocker: Der Mythos Preußen
Fortschrittlichkeit
Widerstand
Wille zum Staat
Kolonistenland
Gemeinschaftssinn
Pietismus
Toleranz
Effizienz
Das Ende von Preußen
Der preußische Mythos
Hrvoje Lorković: Neurotische Nationen?
Zur Terminologie und zu einigen Analogien
Die zwei Modelle
Schichtung des neurotischen Verhaltens von Gemeinschaften
Die geschichtliche Entwicklung des deutschen Verhaltens
Die Ur-Umerziehung
Perfektionismus als bitterer Preis
Protest und Reformation
Politische Folgen der Reformation
Die Romantik als Euphemismus
Die Gegenwart
Ausblick
Sigrid Müller: Die unübersetzbaren Worte. Ein Schlüssel zum Wesensgrund der Völker
Heimat, Ferne, Fremde
Gemüt und Mut
Das eigenartige „Wesen“
Das Deutsche als philosophische Sprache
Wilhelm Pinder: Das „Deutsche“ in der deutschen Kunst. Anmerkungen zur Kunstgeschichte
Gotik
Barock
Das Dorf
Plastik
Der Flügelaltar
Raum als Person – Landschaftsmalerei
Linie statt Farbe
Kunstgewerbe
Erst- und Sonderleistungen
Das Unsichtbare zeigen
Sebastian Pella: Das geheime Deutschland
Seinen Kaisern und Helden Das geheime Deutschland
Hölderlin, Schiller, Hebbel
Das Land, auf das sich der Adler Gottes herabließ
Die Brüder Stauffenberg
Es lebe das Geheime Deutschland!
Manfred Müller: Glieder einer großen Volksfamilie. Volksgemeinschaft als Zielvorstellung christlich-nationaler Politik
Volksgemeinschaft meint nicht Kollektivismus
Andreas Vonderach: Die anthropologische und genetische Stellung des deutschen Sprachgebiets in Europa
Ahnenverlust
Grundlagen der anthropologischen Forschung
Physiognomische Merkmale der Deutschen
Typologie
Nordisch-fälisch-alpin-dinarisch-osteuropäisch
Schädelform und Körpergröße wandeln sich
Die Stellung Deutschlands und Österreichs zu ihren Nachbarn
Franz Uhle-Wettler: Bemerkungen zum deutschen Militarismus
Wendemarke 1870/71
Wehrdienst gestern und heute
Was ist Militarismus?
Militarist Ludendorff?
Franz Uhle-Wettler: Gründlichkeit. Größte Tugend und größter Fehler der Deutschen
Rassebewußtsein – Rassismus
Vergangenheitsbewältigung
Amnestia
Wie die VB im Ausland gesehen wird
Franz Uhle-Wettler: Ritterlichkeit in unserer Zeit. Antithese zum modernen Fanatismus
Deutsche Ritterlichkeit in den Weltkriegen
Ritterliches Japan
England wandelt sich
Sowjets und Westallierte
Kreuzzug im 20. Jahrhundert
Was entfesselt mörderischen Fanatismus?
Manfred Müller: Heldischer Christus – wehrhaftes Christentum. Für eine christlich-nationale Neubesinnung in der deutschen Kultur
Heliand
Der „Krist“ als Sieghelfer
Soldatische Heilige
Militia Christi
… oder Schlaffi-Christentum?
Wieder kämpferisch werden
Eduard J. Huber: Französische und deutsche Baukunst. Facetten einer europäischen Kultur
Romanik als deutscher „kaiserlicher Stil“
Gemeinsames Erbe der Antike
Romanischer Zaubergarten Burgund
Wiege und Hochblüte der Gotik
Norddeutsche Backsteingotik
Renaissance als Schloßbaustil
Der süddeutsche Spätbarock
Vorwärts zurück
Eduard J. Huber: Von der Freiheit. Verschiedene Entwicklungen in Frankreich und Deutschland
Deutsches Freiheitsdenken
Die Französische Revolution
Fürstenherrschaft in Deutschland
Die Tradition der Freiheit reicht ins Mittelalter
Unterschiede zu Frankreich
Ulrich March: Norddeutschland und die Alpen-Donau-Region. Ein historisch-landeskundlicher Vergleich
Politische Zersplitterung
Freiheitsstreben und Selbstorganisation
Entfremdung und Antagonismus
Vom Nord-Süd- zum Süd-Nord-Gefälle
Eduard J. Huber: Volk, Nation, Staat. Was Frankreich von Deutschland unterscheidet
Distanz zum Staat
Keine „Einbürgerung“ der Dichter
Deutsche Begriffe: „Gemeinschaft“ und „Reich“
Andreas Vonderach: Der Völkerpsychologe Willy Hellpach. Gedanken zu Stammescharakter und Assimilationskraft
DDP-Minister
Der Mensch lebt in Völkern
Ansteckende Stammescharaktere
Der deutsche Charakter
Wolfgang Dvorak-Stocker: Nationale Mythen. Warum wir ohne Mythen keine Zukunft haben
Mythische Weltsicht
Das emotionale Fundament der Nation
Wie Mythen wirken
Wahre und falsche Mythen?
Der tragende Mythos der BRD
Gezeitenwechsel
Die Heimat
Der Zweite Weltkrieg
Europas Identität
Friedrich Romig: Was ist deutsch? Deutsch sein heißt Christ sein
Heiliges Reich und Aufklärung
Konsequenzen für Europa
Paul Gottfried: Antideutsch sind erst die Enkel. Günter Rohrmoser über die Frankfurter Schule
Erkenntnistheoretische „Wühlarbeit“
Vorwurf des „falschen Bewußtseins“
Von der Ökonomie zur „Kultur“
Vernunft und Freiheit nicht ernst genommen
Faschismus immer gegenwärtig
Natur kommt vor dem Geistigen
Der „eindimensionale Mensch“
Die Frankfurter Schule ist keine Verschwörung
Konservative Regungen bei Max Horkheimer
Habermas reformiert die FS
Nicht vorgesehen – der Antiamerikanismus
Björn Clemens: Liebe zu Volk und Heimat. Unverzichtbare Stufen der Menschheitsentwicklung
Roman Herzog: völkische Zusammengehörigkeit
Volk und Nation – Ernest Renan
Zum gleichen Volk gehört, wer von denselben Mythen durchdrungen ist
Individuum – Volk – Menschheit
Heimat
Der deutsche Wald
Schicksalsorte und Erinnerungskultur
Die Botschaft der vaterländischen Dichtung
Homo bundesrepublicaniensis
Manfred Müller: Wenn alle untreu werden. Treuebekenntnis inmitten von Furchtsamen und Opportunisten
Novalis’ Ursprungsgedicht
Nach den Befreiungskriegen
Der Traum der Herrlichkeit
Welche Melodie?
Vom Kaiser und vom Reich
Eduard J. Huber: Christus bei den Deutschen. Die verlassenen Altäre
Die christliche Durchwurzelung Deutschlands
Der Investiturstreit führt zur Reformation
Christus wird fremder
Die verlassenen Altäre werden von Dämonen bewohnt
Was ist noch christlich am christlichen Abendland?
Paul Gottfried: Nochmals das Geheime Deutschland. Ernst Kantorowicz und der George-Kreis
Claus Graf von Stauffenberg
Ernst Kantorowicz
Das ewige Deutschland
Autorenverzeichnis
Abendland
Quartalszeitschrift
Jahresbezugspreis:Österreich / Deutschland
Fordern Sie Ihr kostenloses Probeheft hier an:
Ares Verlag GmbH,Hofgasse 5, 8010 Graz, Tel. +43 (0)316 82 16 36,E-Mail: [email protected]
VORWORT
Ich bin nicht „stolz“, Deutscher zu sein
Eigentlich mag ich das Wort „Stolz“ nicht. Stolz kann natürlich ein positives Gefühl der erhebenden Freude meinen, wenn jemand etwa sagt, er sei stolz auf seine Kinder. Oft meint Stolz aber (begründete oder unbegründete) Überheblichkeit. Stolz ist man dann auf etwas, das einen über andere Menschen erhebt. Man kann Stolz auf seinen Erfolg hegen, oder darauf, ein guter Tänzer zu sein, weil es andere eben nicht sind.
Ich habe Menschen getroffen, die stolz darauf waren, Städter zu sein, und auf die in ihren Augen so viel primitivere Landbevölkerung herabblickten. Mit welchem Recht, wenn doch ihr einziges „Verdienst“ ein bestimmter Geburtsort war? Wer tatsächlich kultiviert ist und sich um Verfeinerung des eigenen Verhaltens bemüht, wird jedenfalls nicht pauschal auf ganze Bevölkerungsgruppen herabblicken. Und in der Tat habe ich Bauern kennengelernt, die vielleicht ihr Lebtag nie ein Museum oder Theater besucht haben, aber dennoch feinere Menschen waren als manch einer, für den der Kulturgenuß zum täglichen Brot zählt. Herzensbildung nennt man das wohl. Und nicht nur Herzensbildung: Ich habe am Land viele ganz einfache Menschen kennengelernt, die nur acht oder neun Jahre lang in die Schule gegangen sind, aber doch ein tiefes Wissen über alle Blumen und Kräuter, Vögel und sonstiges Getier an ihrem Wohnort besaßen. Und ich habe in der Stadt genauso wie am Land unglaublich primitive Menschen kennengelernt. Abgesehen von einem erstaunlichen Maß an Dumpfheit und Kulturlosigkeit haben sich diese vor allem durch ungeheures Selbstbewußtsein und ebensolche Überheblichkeit gegenüber allem „Fremden“ ausgezeichnet. Das hat mir zu denken gegeben. Schon innerhalb Österreichs gibt es gar nicht so wenige Regionen und Orte, deren Bewohner eine aggressive Art der Fremdenfeindlichkeit hegen: Wer nicht so spricht wie sie, wer nicht so ißt wie sie, wer sich nicht verhält wie sie, ist in ihren Augen ein Untermensch. Das können dann schon die Bewohner des nächsten Bundeslands, ja des nächsten Tals sein. Und es sind immer die besonders primitiven, kulturlosen Einheimischen, die diese Art von „Stolz“ pflegen, während die Gebildeteren, Feinsinnigeren, Welterfahreneren in der eigenen Art, zu sein, nicht das Maß aller Dinge erblicken, sondern den „Anderen“, den „Fremden“ das Recht auf eigene Art zugestehen.
In dieser Hinsicht geht mir das Gefühl, „stolz“ darauf zu sein, Deutscher zu sein, völlig ab. Ich bewundere und beneide andere Völker: die Engländer, die im Bewußtsein leben, in den großen Kriegen des 20. Jahrhunderts auf der richtigen Seite, zumindest aber auf der Seite der Sieger gestanden zu sein, und die ein ungebrochenes Verhältnis zur großen Geschichte und Kultur ihres Landes haben, wenngleich man „objektiv“ den Vorwurf erheben kann, daß sich gerade ihr Land in den letzten Jahrhunderten – Stichwort Opiumkrieg oder Stichwort Irland – alles andere als „positiv“ verhalten hat. Oder die kleineren Völker Osteuropas, von Esten über Polen bis hin zu Ukrainern, die für sich in Anspruch nehmen, in der Geschichte immer wieder zu Opfern ihrer größeren und mächtigeren Nachbarn geworden zu sein, und daraus das Recht eines besonderen Nationalstolzes ableiten, obgleich ein genauerer Blick in die Geschichte beweist, daß auch diese Völker, wenn sie nur konnten, rasch zu Unterdrückern und Verfolgern schwächerer Bevölkerungsgruppen oder Minderheiten geworden sind. Mein Blick fällt auch auf Italien, das mit seiner faschistischen Geschichte um so vieles ungezwungener umgeht, als wir dies tun, und das die eigene nationale Identität ungeachtet des Verhaltens des demokratischen italienischen Staats in Südtirol hochhält. Ob Engländer, Italiener oder Osteuropäer, ob Franzosen, Spanier oder Skandinavier: Das Verhältnis zur eigenen Nation und deren Geschichte scheint überall einfacher, leichter und unbelasteter zu sein als unser eigenes.
Nein, ich bin wirklich nicht besonders stolz darauf, deutsch zu sein. Um wie viel einfacher wäre es, einem der genannten Völker anzugehören? Doch stellt sich diese Frage nicht. Ich bin nun einmal, was ich bin, und habe mir dies ebensowenig ausgesucht wie meine Eltern und die familiären Verhältnisse, in denen ich aufgewachsen bin. Nationalität läßt sich nicht abstreifen wie ein getragenes Hemd. Nationalität kann man nicht wechseln. Sie ist einem aufgegeben und aufgetragen, oft in Schmerzen, oft in Konflikten, manchmal sogar im Widerwillen. Doch ist sie wie die eigene familiäre Herkunft, die regionale Herkunft und auch die Geschlechtsidentität vorgegeben und kann nur im Ausnahmefall gewechselt werden. Daher ist es eigentlich nur natürlich und selbstverständlich, daß jeder Mensch in Liebe an seinem Volkstum hängt. Meine Mutter, die in einer sehr nationalen und zeitweise auch nationalsozialistischen Familie aufgewachsen ist, wurde daher mit folgendem Leitsatz erzogen, den sie selbst wiederum in der Erziehung ihrer Kinder angewandt hat: „Liebe dein Volk, die anderen aber achte!“ Und in der Tat habe ich sie niemals negativ über irgendein anderes Volk sprechen hören. Liebe zum eigenen Volk, positive Zuwendung zur eigenen Nationalität und frohes Bekenntnis zur eigenen Identität bedeuten eben nicht, andere Nationen herabzuwürdigen oder zu bestreiten, daß deren Angehörige mit Recht ähnliche Gefühle für ihr Volk hegen können. Man kann sogar noch einen Schritt weiter gehen und eingestehen, daß andere Nationalitäten Vorzüge besitzen, die der eigenen mangeln, und daß man daher deren Angehörige in einer gewissen Weise beneidet und bewundert. Mir sind solche Gedanken jedenfalls nicht fremd, was meinen positiven Bezug zur eigenen Identität jedoch in keiner Weise trübt.
Man kann die großen Leistungen der eigenen Nation auch nicht von den dunklen Seiten ihrer Geschichte abscheiden. Die Geschichte des eigenen Volks ist ein Ganzes; nicht nur das, was einen mit Freude oder sogar mit Stolz erfüllt, gehört dazu, sondern auch das, was man – objektiv oder subjektiv – als negativ empfindet, was einen mit Scham oder Trauer erfüllt. Nationale Identität ist in diesem Sinne etwas Ganzes, zu dem man – so oder so – ein Verhältnis finden muß. Sie ist uns vorgegeben und ein essentieller Bestandteil der persönlichen Identität eines jeden, der nicht ohne Schaden für die eigene seelische und geistige Gesundheit geleugnet oder abgetan werden kann. Zumindest in unserer Zeitschrift wurde dieser Standpunkt immer entschieden vertreten. Heute wird anderes propagiert, und tatsächlich gewinnt man bei vielen Zeitgenossen den deutlichen Eindruck, daß sie nur „zufällig“ hier sind, ohne jeden tieferen Bezug zum eigenen Volk und Land. Als ich in den 1990er Jahren in Stuttgart arbeitete, hatte ich eine junge, linke Kollegin, die sich intensiv für den Erhalt indigener Indianerkulturen Südamerikas einsetzte. An dieser Stelle glaubte ich, sie argumentativ packen zu können, und sagte: „Siehst du, so wie du dich für den Erhalt der südamerikanischen Indianerkulturen einsetzt, setze ich mich für den Erhalt unserer eigenen, deutschen Kultur ein.“ Sie sah mich völlig entgeistert an und antwortete: „Aber in unserer Kultur gibt es doch nichts, was erhaltenswert wäre!“ Darauf gab es nun freilich kein Argument mehr, ich war sprachlos. Dabei lag die Schuld an der völligen Ignoranz meiner (durchaus attraktiven) Kollegin durchaus nicht bei ihr selbst, sondern bei Elternhaus, Schule und Medien. Mit einer solchen Geisteshaltung haben wir freilich zu kämpfen. Viele Menschen haben keinerlei positives Verhältnis zu ihrer volklichen und nationalen Identität entwickeln können, weil ihnen jedes Wissen darüber bewußt vorenthalten wurde.
Doch es gibt auch eine Gegenbewegung: Gerade in der gegenwärtigen Zeit der zunehmenden Entortung, der global gleichen Serien etwa, die die Menschen sehen, und der gleichen Hits, die sie hören, der forcierten Migrationsbewegungen und des zunehmenden Heimatverlusts, sind viele Menschen, junge im besonderen, auf der Suche nach ihrer volklichen, nationalen und heimatlichen „Identität“. Oft gerade solche, die in Elternhaus und Schule wenig oder nichts darüber gehört haben. Die Massenmedien kämpfen dagegen an und respektieren gerade noch die stärkste, die regionale Identität. Unsere Zeitschrift und der nun erscheinende Sammelband „Was ist deutsch?“ halten dagegen und versuchen, gerade auch die volklich-nationale Identität von verschiedenen Seiten zu beleuchten.
Nationale Identität hat dabei drei Komponenten:
Da ist die genetische zu nennen. Völker sind nicht zuletzt Abstammungsgemeinschaften, und Untersuchungen haben gezeigt, daß eheliche Verbindungen innerhalb eines Volks, und zwar auch solche von Wien nach Hamburg, um Zehnerpotenzen häufiger waren als Verbindungen über nationale Grenzen hinweg. Dies mag sich in der heutigen, modernen Welt geändert haben. Gerade rechte Aktivisten, denen die Bewahrung der Identität des eigenen Volks besonders am Herzen liegt, sind aber überdurchschnittlich häufig mit Frauen aus anderen Ländern verheiratet: mit Russinnen, Lettinnen und Ukrainerinnen, Japanerinnen und Inderinnen, Türkinnen, Amerikanerinnen, Französinnen oder Polinnen. Warum ist das so? Vielleicht, weil ein positiver Bezug zur eigenen nationalen Identität für Frauen aus diesen Ländern ganz selbstverständlich ist und sie diesen auch nicht bei ihren Männern in Frage stellen, was viele deutsche Frauen tun würden?
Von entscheidender Bedeutung ist der geistige Aspekt. Zwar darf die Biologie nicht unterschätzt werden, doch wir Menschen sind vor allem Geistwesen, und wer den Geist auf die Biologie reduzieren will, unterbietet diesen. Identität hängt also ganz wesentlich mit der bewußten (oder anerzogenen) Aneignung bestimmter kultureller Muster zusammen: Sprache, Sprachfärbung, Dialekt und Ausdrucksweise, Kleidung, Verhalten und Freizeitgewohnheiten, Lebensart, Sitten und Gebräuche. Diese sind natürlich (nicht nur) national; gerade, was die deutsche Nation betrifft, sehen wir hier viele Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen: Der Österreicher, der Bayer, der Sachse und der Norddeutsche unterscheiden sich diesbezüglich tiefgreifend. Und schon innerhalb Österreichs wird man große Unterschiede zwischen Tirol und dem Burgenland, Kärnten und Wien feststellen. Es gibt Völker, und nicht nur kleinere, die ein weit geringeres Maß an innerer Vielfalt aufweisen als das deutsche, was natürlich vor allem historische Wurzeln hat.
Der dritte Aspekt, oft nicht bedacht, ist der der zeitlichen Dauer. Ich könnte zum Beispiel mit meiner Familie nach Japan auswandern, ich und meine Kinder könnten die japanische Kultur intensiver verinnerlichen und bewußter leben, als dies der Durchschnittsjapaner tut, aber auch wenn wir uns vollkommen in die japanische Kultur einzufügen versuchten, fehlte uns doch die historische Dimension: Die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki blieben für uns wie die Meiji-Restauration bloß Daten aus den Geschichtsbüchern und wären keine Ereignisse, die mit der Geschichte unserer Familie eng verknüpft sind.
Nationale und regionale Identität läßt sich also nicht abstreifen wie die Kleidung des letzten Tags. Sie ist uns in essentieller Weise vorgegeben, und wir müssen uns ihr so oder so stellen. Natürlich können wir sie auch ablehnen und etwa versuchen, durch Emigration in ein anderes Land dessen nationale Identität anzunehmen. Gelingen wird dies in vollkommener Weise jedoch nie und bliebe immer Aufgabe für Generationen.
Berechtigt ist freilich die Frage, warum gerade eine österreichische Zeitschrift die Frage „Was ist deutsch?“ stellt. Nur mehr eine kleine Minderheit wird das Bewußtsein hochhalten, daß wir Österreicher Teil der deutschen Kulturnation sind, daß wir zum deutschen Volk gehören. Noch vor einigen Jahrzehnten, bis in die 1960er Jahre hinein, war das anders. In der Zwischenkriegszeit wurde dieser Standpunkt sogar von allen politischen Parteien, die Kommunisten ausgenommen, vertreten. Volksabstimmungen in Tirol und Salzburg erbrachten mehr als 97 % der Stimmen für einen Anschluß an Deutschland. Und die Wiener Sozialdemokraten beschlossen, daß alle Volksschüler außer der Bundeshymne auch das Deutschlandlied auswendig zu lernen hatten. Gegen den (von den Westmächten verbotenen) Anschluß an Deutschland stellten sich nur die monarchistischen Teile der Christlich-Sozialen, doch auch sie hätten damals die deutsche Identität der Österreicher nicht bestritten. Heute ist das freilich anders, doch wie weiter oben festgestellt ist es unsere Überzeugung, daß man aus seiner nationalen Identität nicht so ohne weiteres aussteigen kann. Die Holländer und nun auch die Schweizer beweisen freilich, daß ein solcher Prozeß nach einer gewissen Zeitdauer gelingen kann.
Der große österreichische Sozialdemokrat und spätere Grüne Günther Nenning hat einmal definiert, daß das heutige Österreich am Schnittpunkt zweier Ellipsen liege: Die eine ist der Kulturkreis der alten Donaumonarchie. Und tatsächlich finden wir in ukrainischen Städten wie Lemberg und Czernowitz vieles wieder, das uns vertraut ist. Die andere ist der große deutsche Kulturkreis. Dem ist nichts hinzuzufügen. Natürlich sind die „Österreicher“ nicht ganz einfach „Deutsche“, wie Westfalen oder Badenser. Sie sind schon allein aufgrund ihrer Geschichte etwas Eigenständiges. Mit Günther Nenning hat mich eine tiefe Sympathie verbunden, und vieles haben wir sehr ähnlich gesehen. Daher war er auch bereit, mehrfach anläßlich politischer Buchpräsentationen unseres Verlags aufzutreten und zu sprechen. Verrechnet hat er dafür nie etwas.
Den drei Aspekten der nationalen Identität – dem biologischen, dem geistigen und dem historischen – widmet sich der Sammelband „Was ist deutsch?“, ohne jedoch auch nur annähernd Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Wollte man die gestellte Frage abschließend beantworten, wäre wohl ein weit umfangreicheres Buch nötig. Auch die gerade in der deutschen Nation so vielfältigen und unterschiedlichen regionalen Identitäten werden in einigen Artikeln beleuchtet, wenngleich der besonderen Frage nach der österreichischen Identität aus Platzgründen nicht gesondert nachgegangen wird. Zwei Jahrzehnte habe ich nun die von Ernst Graf Strachwitz und Franz Frank schon in den 1950er Jahren begründete Zeitschrift „Neue Ordnung“ im Ares-Verlag herausgegeben, die 2020 in „Abendland“ umbenannt wurde, ohne daß damit jedoch eine inhaltliche Änderung verbunden gewesen wäre. In all diesen Jahren hat sich die „Neue Ordnung“ bzw. das „Abendland“ immer und immer wieder mit der Frage der „deutschen Identität“ auseinandergesetzt. Die wichtigsten diesbezüglichen Artikel sind nun in einem Sammelband zusammengefaßt. Weitere Sammelbände sollen folgen.
Mag. Wolfgang Dvorak-Stocker
Der Mythos Preußen
Am 25. Februar 1947 erklärte der Alliierte Kontrollrat das Land Preußen für aufgelöst, da es seit jeher „Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland“ gewesen sei. Keine 250 Jahre umspannt damit die eigentliche Existenz Preußens, eine Episode nur in der Weltgeschichte und auch in den über 1100 Jahren deutscher Geschichte. Seine Bedeutung aber für diese deutsche Geschichte war eine besondere, und zwar nicht nur in machtpolitischer, sondern auch in geistiger Hinsicht. Das rechtfertigt die Frage, was denn das Wesen des Preußischen ausmacht und welche Bedeutung es für das heutige Deutschland oder jenes der Zukunft haben mag.
Der Vorwurf des Militarismus an Preußen liegt nahe, war doch die besondere Bedeutung des Militärischen stets ein Merkmal des Landes. Und doch klingt dieses Verdikt aus dem Mund der Sieger des Zweiten Weltkriegs etwas seltsam, belegt doch die nüchterne Statistik, daß an allen zwischen 1701 und 1945 geführten Kriegen Frankreich mit 28 %, England mit 23 % und Rußland mit 21 %, aber Preußen (bzw. Deutschland) nur mit 8 % beteiligt gewesen ist.
Fortschrittlichkeit
Noch viel weniger freilich trifft der Vorwurf der „Reaktion“ zu, wenn man darunter ein bewußtes Sich-Stellen gegen die Zeittendenz oder die allgemeine gesellschaftliche Entwicklung, ja den Versuch eines Zurückdrehens des geschichtlichen Rades versteht. Im Gegenteil kann Preußen für die meiste Zeit seiner Geschichte als geradezu besonders fortschrittlich gelten. Schon die Staats- und Verwaltungsreformen unter dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. und seinem Sohn Friedrich II. haben aus Preußen einen der modernsten und effizientesten Staaten seiner Zeit gemacht, auf dessen Vorbildwirkung sich sogar das Reformwerk Maria Theresias in weiten Teilen zurückführen läßt. Folgte auch in der Spätzeit des „Alten Fritz“ und unter seinem Nachfolger eine Phase der Erstarrung, so konnte das von Napoleon besiegte und gedemütigte Land rasch wieder Vorbildwirkung entfalten: durch die weitreichenden Reformen, die unter dem Freiherrn vom Stein und dem Fürsten Hardenberg, den Militärs Scharnhorst und Gneisenau sowie dem Kulturpolitiker Wilhelm von Humboldt in Angriff genommen wurden. Noch unsere heutigen Universitäten gehen im wesentlichen auf Humboldts Konzept zurück.
Mit der Schaffung eines deutschen Nationalstaates in den Einigungskriegen von 1866 und 1871 lag Preußen wieder voll im Trend der allgemeinen Entwicklung des 19. Jahrhunderts: Fast zeitgleich wird die italienische Einheit verwirklicht, 1878 werden Rumänien, Bulgarien, Montenegro und Serbien endgültig unabhängig, 40 Jahre später folgt ihnen die Mehrzahl der kleinen Völker Ostmitteleuropas auf diesem Weg.
Preußen-Deutschland war auch der erste Staat der Welt, der – wie es dann europaweit nachgemacht wurde – zu Beginn der 1880er Jahre eine Kranken-, Unfall- und Pensionsversicherung für die Arbeiterschaft einführte und damit die drückendste Not linderte.
Widerstand
Für „Reaktion“ stand das Preußentum in seiner Geschichte im wesentlichen nur einmal: am 20. Juli 1944. Mit Yorck und Moltke, Witzleben und Schulenburg, Schwerin und Stülpnagel, Dohna und Lehndorff waren fast alle klingenden Namen des Landes an der Verschwörung beteiligt, wie überhaupt mehr als die Hälfte der Männer des 20. Juli aus altpreußischen Familien stammten.
Dies war kein Zufall: Der Nationalsozialismus muß geistesgeschichtlich überhaupt als Kind des katholischen, süddeutsch-österreichischen Raumes betrachtet werden. Gerade traditionsbewußten Preußen galt Hitler als „Österreichs Rache für Königgrätz“, und dieser selbst hat während seiner zwölf Berliner Jahre nie die Zeit zu einem Besuch in Sanssouci gefunden (bezeichnenderweise wohl aber zu einem in Paris, einer reinen Besichtigungstour, die in der Morgendämmerung durchgeführt wurde, um die Bevölkerung der besetzten Stadt nicht zu demütigen).
Wille zum Staat
Schon ein flüchtiger Blick in die Geschichte hat also vom Verdikt der Alliierten nicht viel übriggelassen. Wichtiger ist allerdings die Frage, was denn nun wirklich das Wesen Preußens, den Geist, das Ethos dieses Staates ausgemacht hat. Denn, und das allein ist schon eine faszinierende Feststellung, was „preußisch“ ist, gilt als definierbar, und zwar weit präziser, als das bei anderen wichtigen deutschen Staaten, wie Sachsen, Bayern oder Hannover, der Fall ist. Ein bestimmter Kanon staatsbezogener Tugenden, wie Pflichtbewußtsein, Bescheidenheit, Respekt vor der Obrigkeit, Disziplin und Gehorsam etc., macht das „preußische Wesen“ aus, während andere deutsche Stämme nur mit Eigenschaften wie „schweigsam“ oder „leichtlebig“, „sparsam“ oder „bodenständig und eigensinnig“ charakterisierbar sind.
Preußen ist also das Urbild des Staates in der deutschen Geschichte. Preußen ist der Wille zum Staat.
Jahrhundertelang waren die brandenburgischen Kurfürsten aus dem Hause Hohenzollern, das wie die Habsburger aus dem schwäbischen Raume stammt, nicht mehr und nicht weniger als deutsche Reichsfürsten und in keiner Hinsicht herausragend. Während der Reformationszeit zählten sie, erst spät Mitte/Ende der 1530er Jahre protestantisch geworden, zum gemäßigten Lager, oft vermittelnd, oft sogar an der Seite des Kaisers stehend. Kein Vergleich etwa mit den sächsischen Herzögen, denen man damals weit eher zutrauen durfte, in einem protestantischen Deutschland die Führungsrolle einzunehmen.
Das ändert sich erst nach dem Dreißigjährigen Krieg. Friedrich Wilhelm, dem Großen Kurfürsten, gelingt es, das darniederliegende Land durch Schaffung eines stehenden Heeres, Zentralisation der Verwaltung und eine erfolgreiche Schaukelpolitik zwischen den konkurrierenden Großmächten Frankreich, Schweden und Polen zu einem regionalen Faktor zu machen. Hinzu trat das Schicksal in Gestalt einer bedeutsamen Erbschaft: Ausgerechnet zur Zeit Luthers war ein Hohenzoller Hochmeister des Deutschen Ordens, und dieser trat schon 1522, lange vor den brandenburgischen Kurfürsten, zum neuen Glauben über, um das Ordensland in ein persönliches Herzogtum unter polnischer Oberhoheit zu verwandeln. Doch diese Linie starb 1618 aus, und Brandenburg trat in die Erbschaft ein, konnte sie halten, ja sie 1657 sogar aus dem Verband der polnischen Krone zur eigenen Souveränität lösen.
In nur kurzer Zeit haben die Hohenzollern dann erstaunlich viele bedeutende Könige hervorgebracht, die mehr als die Herrscher anderer deutscher Länder ihr Amt als Dienst an Volk und Staat auffaßten, in je individuell verschiedener Weise freilich. Auf den Großen Kurfürsten folgte Friedrich III., der zugleich der erste preußische König werden sollte. Ganz und gar Barockmensch, findet sich an ihm noch nichts „typisch Preußisches“, und doch ist das abwertende Urteil etwa seines Enkels, des Großen Friedrich, zu hart gegriffen: Sein Streben nach der Königskrone war durchaus nicht nur Resultat persönlicher Eitelkeit, sondern gespeist aus der Erkenntnis, daß dieser Schritt eben nur zum damaligen historischen Zeitpunkt – während des Spanischen Erbfolgekrieges – aussichtsreich und dann lange nicht mehr möglich sein würde. Ja, in Verhandlungen mit dem Kaiser war er sogar bereit, auf das Führen des Königstitels für 30 Jahre zu verzichten, womit die Standeserhöhung für ihn selbst wohl keine Bedeutung mehr gehabt hätte und nur noch seinen Nachkommen, der Dynastie zugute gekommen wäre.
Mit seinem Sohn, dem Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I., beginnt dann so recht die preußische Geschichte, er war auch der erste echte Preuße im heutigen Verständnis. Aus christlich-pietistischer Glaubensüberzeugung heraus verstand er sein Amt als Dienst an Gott, dem er Rechenschaft schuldig war, und empfand sich als verantwortlich für das Wohl und Weh seiner Bürger; der preußische Tugendkatalog geht im wesentlichen auf diesen Herrscher zurück.
Sein Sohn Friedrich II. sah sich als „erster Diener des Staates“, säkularisierte also die Dienstauffassung gemäß den aus der aufklärerischen Philosophie stammenden Ideen von Gesellschaftsvertrag und Naturrecht. Die Persönlichkeit dieses Königs, seine militärischen Siege und seine unerschütterliche Haltung in bitteren Niederlagen, genauso aber auch seine unermüdliche Arbeit an einer Verbesserung der Lebensbedingungen in seinem Land und sein Streben nach einer Verwaltung, die jedem, auch dem einfachsten Bürger, sein Recht zukommen läßt, haben dann den preußischen Tugenden jenen Glanz verliehen, der ihre deutschlandweite Ausstrahlungskraft bis in unsere Zeit hinein begründet.
Friedrich Wilhelm IV., der „Romantiker auf dem Königsthron“, verstand seine Aufgabe wiederum ganz aus einem tiefen Glauben und der mittelalterlichen Lehre des Gottesgnadentums heraus. Dies hat ihn, der sich stets als Vater seiner Untertanen verstand, auch zu einer zutiefst reichischen und habsburgfreundlichen Haltung geführt; noch 1848 erklärte er offen seine Bereitschaft, „mit Freuden […] das silberne Waschbecken dem Kaiser bei seiner Krönung halten“ zu wollen.
Beeindruckend an der preußischen Geschichte ist der systematische Aufbau des Landes, der, beim Großen Kurfürsten beginnend, über Jahrhunderte unternommen wurde und aus einem in jeder Hinsicht kargen und bevölkerungsarmen Gebiet einen blühenden und mächtigen Staat gemacht hat. Dieser Aufbauwille und die Tatsache, daß er über Generationen durchgehalten wurde, sind das, was die Hohenzollern von anderen deutschen Reichsfürsten unterschied, und zugleich die Verbundenheit mit dem eigenen Land, während etwa die Wittelsbacher mehrfach versuchten, Bayern gegen ein belgisches Königtum einfach einzutauschen, oder den Wettinern zwar kurzzeitig der Sprung auf den polnischen Königsthron glückte, aber dabei die Kräfte des heimischen Sachsen nur erschöpft und nicht erweitert wurden.
Kolonistenland
Preußen ist ein junges Land, sowohl die Mark Brandenburg als auch das zu „Ostpreußen“ gewordene Deutschordensland. Im 12. Jahrhundert von Angehörigen verschiedener deutscher Stämme langsam besiedelt das eine, erst im 13. Jahrhundert das andere, sind sowohl die „Märker“ als auch die Ostpreußen weit jünger als die westdeutschen Stämme, die im wesentlichen aus der Völkerwanderungszeit hervorgegangen oder wie die Friesen und (Nieder-)Sachsen gar noch älter sind.
Die preußischen Tugenden sind letztlich die typischen Tugenden eines Kolonistenlandes: Arbeitsfleiß, Bescheidenheit, Strebsamkeit, Disziplin. Das Schwarz-Weiß der preußischen Farben geht auf den Deutschen Orden zurück, der im Auftrag von Papst und Kaiser, gerufen von polnischen Herzögen, das Land der heidnischen Pruzzen christianisierte und einer Einwanderung aus dem Reich öffnete. Aber auch schon die Mark Brandenburg war durch das Schwarz-Weiß der Zisterzienser geprägt worden, deren Bedeutung für den Aufbau der jungen Provinz kaum überschätzt werden kann. Askese, Gehorsam, persönliche Armut und eine strenge Dienstauffassung standen damit schon an der Wiege Preußens, aber auch die Strenge der Organisation, die Nüchternheit der Planungen und die klare Umsetzung der Aufgaben, wie sie im Mittelalter eben nur bei den Ordensgemeinschaften zu finden waren.
Kein Wunder, daß dann ein Immanuel Kant aus diesem Boden erwuchs und die Moralität der Handlungen, ja den reinen, kategorischen Pflichtbegriff als solchen in den Mittelpunkt seiner Philosophie stellte. Von dieser Ebene der rein zwischenmenschlichen Moralität in die Sphäre der Gesellschaft, der Sittlichkeit und des Staates gehoben wurde die Kantsche Philosophie dann von Hegel, der, obzwar gebürtiger Schwabe, dennoch als der preußische Philosoph par excellence gelten kann: Seine Überzeugung von der Wirklichkeit des Vernünftigen und der Vernünftigkeit des Wirklichen könnte preußischer nicht sein.
Gemeinschaftssinn
Preußen konnte nur Preußen werden, weil es den Herrschern gelang, die gesellschaftliche Elite – den Adel – auf das gemeinschaftliche Ideal des Dienstes am Staat einzuschwören. Und wie so oft in der Geschichte war es gerade die große Herausforderung, die die große Lösung bewirkte. Als die Hohenzollern 1417 mit Brandenburg belehnt wurden, war der einheimische Adel verwildert und an Unabhängigkeit gewöhnt. Er wußte genau, daß er Jahrhunderte länger als die neuen Markgrafen im Lande saß, und das ließ er diese auch reichlich spüren. Mehr als ein Jahrhundert sollte es dauern, bis das letzte wilde Raubrittergeschlecht gezähmt war und Frieden im Lande einkehrte. Zu einer ähnlichen Fronde kam es dann auch nach dem Erbfall Ostpreußens, doch war diese dank des harten Durchgreifens des Großen Kurfürsten nur von kurzer Dauer. In Ritterakademien und durch den Offiziersdienst wurden die Söhne dieses widerständigen Adels dann nach und nach zu treuen Dienern des Königs und überzeugten Trägern einer preußischen Gesinnung erzogen. Auch dies, die starke Verpflichtung des Adels auf den Staat, fehlt in anderen deutschen Territorien.
Preußen entfaltete nicht zuletzt dadurch eine starke Anziehungskraft über seine Grenzen hinaus, die viele bedeutende Männer in den Dienst seiner Könige treten ließ – so war von den Reformern, die nach der Niederlage gegen Napoleon bei Jena und Auerstedt (1806) darangingen, das neue Preußen zu bauen, nur einer – Humboldt – ein Preuße von Geburt, während Scharnhorst und Hardenberg Hannoveraner waren, Stein ein Franke und Gneisenau gar aus einer österreichischen Familie stammte.
Pietismus
Wesentlich zur Herausbildung des Preußentums war auch die Religion. Hier ist als erstaunlich anzumerken, daß das Herrscherhaus trotz seiner calvinischen Konfession keine puritanisch-strengen Persönlichkeiten hervorgebracht hat. Stark von religiöser Überzeugung geprägt erschienen eigentlich nur zwei preußische Könige: Friedrich Wilhelm I. und Friedrich Wilhelm IV. War letzterer ein von der Wiederherstellung der christlichen Einheit träumender Romantiker (mit einem Katholiken als zeitweise engstem persönlichen Freund und Ratgeber: Josef Maria von Radowitz), war der Soldatenkönig ganz und gar pietistisch geprägt. Eben dieser Pietismus ist als eine der wesentlichen Quellen des Preußentums auszumachen, ist er doch – sich damit der katholischen Position stark nähernd – der Überzeugung, daß die Gnade Gottes doch das menschliche Zutun fordert: Gehorsam gegen die Obrigkeit, Selbstzucht, Fleiß, Ordnung, Sauberkeit und Pünktlichkeit würden zur „Heiligung des Alltags“ führen, womit erst die Gnade Gottes gewiß werde.
Toleranz
Preußentum bedeutete nicht einseitige Bindung, sondern muß als Synthese zwischen Bindung und Freiheit betrachtet werden. Toleranz ist somit ein wesentlich preußischer Begriff. Schon 1613 war der damalige brandenburgische Kurfürst Johann Sigismund vom lutherischen zum reformierten evangelischen Glauben konvertiert, ohne dabei von seinen Untertanen denselben Schritt des Glaubenswechsels zu verlangen. Damit verstieß er aber schon gegen den Augsburger Religionsfrieden von 1555, der den Untertanen vorschrieb, die gleiche Konfession wie ihre jeweilige Obrigkeit zu haben. Mehr noch: Johann Sigismund verzichtete auch nicht auf die Ausübung seiner landesherrlichen Kirchenhoheit bzw. seiner oberbischöflichen Rechte über die lutherische Kirche. Und dabei blieb es. Brandenburgs Herrscher waren calvinisch, leiteten aber gleichzeitig die lutherische Kirche ihres Landes, ohne dabei irgendeinen Druck auszuüben.
© Wolfgang Dvorak-Stocker
Das neue Palais in Potsdam (im Bild die Gartenseite) errichtete Friedrich II. zwischen 1763 und 1769 als architektonische Manifestation der endgültig gefestigten preußischen Machtstellung nach dem siegreichen Ausgang des Siebenjährigen Krieges.
Daß der Große Kurfürst dann mehr als 20.000 aus Frankreich vertriebene Calvinisten, die Hugenotten, in seinem Land aufnahm, versteht sich aus dieser Konstellation heraus fast von selbst. Aber Friedrich Wilhelm öffnete Preußen auch für 50 aus Wien vertriebene Judenfamilien und sogar für Sekten, wie die verfolgten Waldenser und Mennoniten. (Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, daß dann 1731/32 noch fast 20.000 vertriebene Salzburger Protestanten dazukamen.) Friedrichs II. Satz, daß in seinem Lande jeder nach seiner Façon glücklich werden solle, galt also auch schon unter seinen Vorgängern. Und das nicht ohne Grund: Zur „Peuplierung“ der durch den Dreißigjährigen Krieg und Pestepidemien entvölkerten Landstriche war eine Zuwanderung dringend nötig. Zur Zeit Friedrichs waren dann auch mehr als 10 % der Bevölkerung Zuwanderer bzw. deren Nachkommen.
Friedrich spannte den Bogen dieser Toleranz noch weiter als seine Vorgänger. Auch „Türken und Heiden“ wären in seinem Lande willkommen, und er würde ihnen „gerne Moscheen bauen“, so ließ er bereits im Jahr seiner Thronbesteigung erklären. Und in bescheidenem Rahmen kam es sogar dazu: Im Siebenjährigen Krieg fochten Bosniaken für Preußen, die in Potsdam Wohnstatt und Gebetsraum erhielten, sogar einen eigenen Heeresimam.
Friedrichs Toleranzidee wurzelte in zwei aus der Philosophie der Aufklärung stammenden Überzeugungen: einerseits, daß allen höherstehenden Religionen eine im wesentlichen gleichgeartete Moral innewohne, andererseits – man vergleiche Lessings Ringparabel –, daß der Mensch prinzipiell nicht zur Erkenntnis letzter Wahrheiten gelangen kann. Von daher verachtete Friedrich auch die Geistlichkeit aller Konfessionen mit ihren dogmatischen Streitereien und gab sie, zumal an seiner Tafel in Sanssouci, dem gnadenlosen Spott preis. Vor Gott aber, so bezeugte selbst der verbitterte Voltaire, machte der Spott von Friedrichs Tischrunde stets halt. Und im Gegensatz zu Josef II., dem Friedrich in vielem Vorbild gewesen ist, tastete letzterer die Volksfrömmigkeit, ja selbst den Aberglauben seiner Zeit, in keiner Weise an.
Auch die Katholiken – die es in Preußen immer gegeben hat – wurden nie beschränkt, selbst der in den meisten katholischen Ländern verbotene Jesuitenorden fand hier eine Zuflucht. Die in Schlesien mächtige katholische Kirche spürte den Herrscherwechsel dann auch nur durch Steuererhöhungen, und die während der Zeit der Habsburger teils arg bedrängte evangelische Kirche hoffte sogar in jenen Gebieten, wo sie über 90 % der Bevölkerung stellte, vergeblich auf eine Rückstellung ihrer konfiszierten Gotteshäuser. Nur dort, wo sich katholische Bischöfe als Agitatoren für Österreich entpuppten, ließ Friedrich Maßnahmen bis hin zur Arretierung ergreifen.
Und damit sind wir am wesentlichen Punkt für das Verständnis von Friedrichs Toleranzbegriff: Ihm waren die Religionen einerlei, sofern sie – mit heutigen Worten – gute Staatsbürger hervorbrachten. Den Staat selbst führte er in absolutistischer Weise, hier konnte es keine Kritik, kein Abseitsstehen geben, und auch die früheren Formen ständischer Mitbestimmung waren aufgehoben. Wer sich einem Befehl des Königs widersetzte, fiel in Ungnade, wie es Johann Friedrich von der Marwitz erging, der sich weigerte, das sächsische Schloß Hubertusburg zu brandschatzen. Damit entspricht Friedrichs Toleranzverständnis erstaunlich dem heutigen. Auch heute werden die wesentlichen Entscheidungen – etwa die Einführung des Euro – von einer kleinen Führungsschicht getroffen, ohne jede Möglichkeit der politischen Mitbestimmung durch die Bürger. An diesen Entscheidungen ist auch Kritik nur mehr eingeschränkt und unter Gefahr der öffentlichen Ächtung möglich.
Effizienz
Strenge der Organisation, Nüchternheit, rationale Zielfixierung und effiziente Tüchtigkeit sind nicht unbedingt urdeutsche Tugenden. Im Gegenteil ist, vergleicht man die deutsche Geschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit etwa mit der Entwicklung in England und Frankreich, geradezu ein Mangel an jenen Tugenden feststellbar. Es sind preußische Tugenden, vorgebildet vielleicht in der norddeutschen Kaufmannschaft der Hanse, und erst durch den wachsenden Einfluß Preußens sind sie deutsche Tugenden – zumal ab der Mitte des 19. Jahrhunderts – geworden.
Das, was das Deutschtum in den Augen der anderen Völker für viele Jahrhunderte ausmachte, ist hingegen gerade nicht preußisch: das Schwärmerische und der Überschwang, die Romantik, das Träumerische und Künstlerisch-Weltfremde, der Hang zum Mythos und zur Mystik. Dieses „Preußentum der Sachlichkeit“, diese „Sachlichkeit des Preußentums“ werden schon in der Architekturgeschichte manifest. Preußischer Stil ist fast immer, auch im Barock, verhältnismäßig nüchtern, klassisch, an Palladio orientiert. Der eigentliche preußische Stil ist der Klassizismus, allerdings nicht im Sinne einer sklavischen Nachahmerei, sondern im Sinne einer Klassizität, die sich in allen Stilepochen findet, aber in jener des Klassizismus am deutlichsten auszudrücken vermag.
Durch Preußen ist Deutschland selbst sachlicher, effizienter, nüchterner geworden. Und hier wirken die preußischen Tugenden bis heute fort, nun freilich individualistisch vereinzelt und nicht mehr gemeinschaftsbezogen: Die Zweckrationalität, der Arbeitseifer und die Strebsamkeit, eine nüchterne Lebensgestaltung sind auch für die bundesrepublikanische Gesellschaft von heute ein wesentlicher Maßstab. Diese preußischen Tugenden allerdings sind klassische „Sekundärtugenden“ und sagen ebensowenig wie das Fortwirken der friderizianischen Toleranzauffassung etwas über die innere Verfaßtheit eines Staatswesens aus.
Das Ende von Preußen
Die Alliierten haben Preußen 1947 aufgelöst. Doch damals war dieser Staat schon mehr als ein Jahrzehnt nicht mehr existent: Gestorben ist er freilich noch viel früher. Sein staatsrechtliches Ende datiert auf das Jahr 1934 und wurde durch die Nationalsozialisten vollzogen, indem die einzelnen Länder dem Reiche direkt unterstellt wurden.
Das eigentliche Sterbejahr Preußens aber war jenes seines größten Stolzes: das Jahr der Reichsgründung 1871, in dem am 18. Jänner der preußische König Wilhelm I. im Spiegelsaal von Versailles zum Deutschen Kaiser proklamiert wurde. Wilhelm hegte schon damals klarsichtig ebendiese Befürchtung, und so sahen es auch die altpreußischen Eliten, wie Theodor Fontane es in seinem „Stechlin“ schildert. Auch Arthur Moeller van den Bruck verknüpft den Tod Preußens mit der Epoche der Reichsgründung: Denn damals erlosch der preußische Stil, die Klassizität, die die Epochen preußischer Baugeschichte durchzog, und Berlin verlor sein Gesicht.
Aus dem preußischen „Mehr sein als scheinen“ wurde das auftrumpfende Gehabe des wilhelminischen Gründerzeitbürgers.
Und in der Politik machte die preußisch-nüchterne Lagebeurteilung rasch einer romantischen Großmannssucht ohne Blick für die tatsächlichen Zeitumstände und Bedingungen Platz und ermöglichte damit die Katastrophe des Ersten Weltkriegs.
Der preußische Mythos
In der Zeit des Zweiten Deutschen Reiches wurde der Kaisergedanke des Mittelalters von preußischen Historikern wie Sybel systematisch kleindeutsch umgedeutet (und damit seiner universalen Bedeutung beraubt), wurde Preußen von Historikern wie Treitschke ein „deutscher Beruf“ fast seit Anbeginn, zumindest aber seit dem 17. Jahrhundert zugeschrieben. Dies alles läßt sich einfach widerlegen. So war Friedrich der Große zwar sicher ein preußischer, seinem eigenen Selbstbewußtsein nach aber kaum ein deutscher König, fand sich in seiner Bibliothek doch kein einziges
© gemeinfrei
Friedrich war klein, als er die Gunst der Stunde nutzte und der jungen Maria Theresia Schlesien raubte. „Groß“ wurde er nicht nur durch seine Anstrengungen, diesen Raub seinem Land zu bewahren, sondern vielmehr durch seine Reformen des preußischen Verwaltungs- und Rechtssystems, die auch für Österreich Vorbild werden sollten. Im 1772 erworbenen Westpreußen (Erste Polnische Teilung) konnte Friedrich in den 14 Jahren bis zu seinem Tod ohne notwendige Rücksichtnahme auf Adelsinteressen und ständische Rechte sein Bild eines modernen Staates am reinsten verwirklichen: Durch verschiedene Maßnahmen konnte er die Wirtschaftskraft des nach 200 Jahren polnischer Verwaltung vollkommen herabgekommenen Landes mehr als versechsfachen, die Zahl der Schulen verdoppeln und etwa im Netzedistrikt bei 100.000 Einwohnern die Zahl der Lehrer von 32 auf 422 erhöhen. Friedrich bestand in diesem gemischten Gebiet nachdrücklich darauf, daß die Beamtenschaft der polnischen Sprache mächtig sein mußte, und hob die Leibeigenschaft rigoros auf. Die Zahl der Fron-Tage, die unter polnischer Herrschaft bis zu 25 (!) pro Monat betragen hatte, ließ er auf fünf pro Monat festschreiben. In der Folge wurde Westpreußen mit Ostpreußen, wo sein Vater, der Soldatenkönig, eine ähnliche Kulturarbeit geleistet hatte, zur preußischen Kernprovinz, was sich gerade in der Zeit der tiefsten Demütigung nach der verlorenen Schlacht von Jena gegen Napoleon 1807 zeigen sollte.
Buch in deutscher Sprache, hatte er für die ältere deutsche Literatur nur Spott übrig und ging er an den jungen Genies Goethe und Kant ebenso achtlos vorüber wie an Leibniz, der doch einstmals der erste Leiter der Preußischen Akademie der Wissenschaften gewesen war. Und während die meisten preußischen Reformer noch zur Zeit des Wiener Kongresses eine Wiederherstellung des habsburgischen Kaisertums begrüßt und sich dann auch Friedrich Wilhelm IV. noch 1848 gern einem solchen untergeordnet hätte, war Wilhelm I. wiederum nur unter Druck bereit, die deutsche Kaiserkrone überhaupt anzunehmen, da ihm jene des preußischen Königs ungleich wertvoller schien.
Und doch hatte Preußen eine deutsche Aufgabe: Preußen ist der Inbegriff deutscher Staatlichkeit. Preußen war schon Staat, als das Reich noch existierte. Als die Habsburger dann im 19. Jahrhundert aus eigener Schuld mehrere Gelegenheiten verpaßt hatten, das Heilige Römisch-Deutsche Reich in neuer Form wiedererstehen zu lassen, wurde Deutschland Staat durch Preußen.
General de Gaulle merkte daher an, daß Deutschland ohne Preußen kein Staat sein könne, und Margaret Thatcher konstatierte, daß die Deutschen in Europa ein System anstreben, in dem sich kein Volk mehr selbst regiert, weil sie Angst vor der eigenen Selbstbestimmung haben.
Heute sind Preußen und sein Tugendkanon nur mehr ein Mythos. Ein Mythos, der freilich eines Tages geschichtsmächtig werden kann.
Wie die schwarze Bevölkerung Nordamerikas noch vor wenigen Jahrzehnten ohne jedes kulturelle Selbstbewußtsein war und sich dieses, fast aus dem Nichts, in der „Black-consciousness“-Bewegung selbst schuf, wie in Israel eine Sprache, die jahrhundertelang zu sakralen und philosophischen Zwecken gebraucht, aber von keiner Bevölkerung mehr wirklich gesprochen wurde, plötzlich zur allgemeinen Verkehrssprache eines modernen Staates wurde, wie in Irland ein fast ausgestorbenes Idiom durch den Schulunterricht wieder neu belebt wurde, so kann auch die deutsche Kultur wiedererstehen, solange es noch in biologischer Hinsicht Deutsche gibt. Eine solche „Deutschbewußtseinsbewegung“ kann dann freilich an mehreren Punkten anknüpfen: am universalen, katholisch geprägten Reichsgedanken, der bis in die Romantik, ja bis ins 20. Jahrhundert hinein für viele Deutsche bestimmend war, an den heute in manchen Kreisen gepflegten naturreligiösgermanischen Vorstellungen, die das Deutschtum in Opposition zur römisch-christlichen, rational-aufklärerischen Gegenwart positioniert sehen möchten, oder auch an den verschiedenen konservativrevolutionären Strömungen, die schon einmal, nach 1918, den Versuch unternommen haben, deutsches Kulturbewußtsein und deutsche Staatsgesinnung unter den Bedingungen des modernen Massenzeitalters neu zu begründen.
Doch Preußen und das, was Preußen ausgemacht hat, wird ebenfalls immer einer der wesentlichen Anknüpfungspunkte jeder deutschen Erwekkungsbewegung sein. Und wahrscheinlich kann eine solche Erweckungsbewegung nur dann erfolgreich sein, wenn sie die richtige Kombination aller der genannten Elemente trifft.
Wolfgang Dvorak-Stocker, „Neue Ordnung“ I/2001
Neurotische Nationen?
Ausdrücke wie „Neurose“ oder „neurotisch“ wurden seit dem Zweiten Weltkrieg oft benutzt, um das deutsche politische Verhalten zu charakterisieren. Zunächst waren es die politisch motivierten Psychoanalytiker, die, im Rahmen der Bemühungen, eine Neuauflage des Nationalsozialismus zu verhindern, vom neurotischen Verhalten sprachen. Damit sollten unter anderem die „fremdartigen“ und „unerklärbaren“ deutschen Neigungen einem nichtdeutschen Publikum nähergebracht werden. Als „neurotisch“ wurde das gesellschaftliche und kulturelle Erbe bezeichnet, aus welchem der Nationalsozialismus hervorgekommen ist, sowie die Folgen, die er hinterlassen hat. Auf lange Sicht hatten solche Bemühungen wenig Aussicht auf Erfolg, da die wesentliche Voraussetzung jeder tiefenpsychologischen Analyse – politische wie auch moralische Neutralität – mit der Aufgabe der Umerziehung der Deutschen kaum vereinbar war.
Nachdem die gezielte Aufarbeitung der Vergangenheit aus der Sicht der Betreiber ihre Ziele ausreichend erreicht hatte, verlagerte sich das Interesse an tiefenpsychologischen Deutungen zu jenen deutschen Kreisen, die sich in der bestehenden geistigen Atmosphäre nicht zurechtfinden konnten. Als „neurotisch“ wurde jetzt nicht das Klima bezeichnet, aus welchem das nationalsozialistische Verhalten hervorkam, sondern die sich selbst geißelnde Kritik der besiegten Deutschen. Die Unmöglichkeit, den Anspruch, ein souveränes Volk zu sein, mit der Bereitschaft zu versöhnen, sich einer nie endenden Umerziehung zu unterwerfen, sollte dabei eine Rolle gespielt haben. Wie bei den Analytikern der Kriegsursachen und der Kriegsschuld, so konnten auch bei diesen besorgten Deutschen die Bedingungen einer politisch neutralen Analyse nicht erfüllt werden. Die Gefahr, das deutsche Volk durch psychologische Analysen als ein geistig krankhaftes erscheinen zu lassen, hat z. B. in den Ergebnissen der seitens der Carl-Friedrich- von-Siemens-Stiftung organisierten Vortragsreihe über „Die deutsche Neurose“1 dazu geführt, daß der entsprechende Diskurs als ungeeignet abgewiesen wurde. Fragen wie „Sind neurotische Züge ein Spezifikum der Deutschen“ oder „Was unterscheidet die deutsche Neurose von vergleichbaren Sachverhalten in anderen Ländern“ mußten folglich unbeantwortet bleiben.
Zur Überwindung der Schwierigkeiten, die solche Fragen aufwerfen, ist ein Minimum an theoretischen Erörterungen erforderlich. Schwierigkeiten bereitet schon das Problem, das etwa so formuliert werden kann: „Ist es erlaubt oder nur möglich, Begriffe, die in der Sphäre der individuellen Psyche ihre Anwendung finden, auf Gruppen oder Gemeinschaften zu übertragen?“ Für eine Antwort müßte zunächst sichergestellt werden, daß neurotische Phänomene in der Tat nur in der Sphäre des Individuellen auftauchen. Der Eindruck, es sei so, entsteht aus der problematischen Einordnung von Neurosen als Krankheiten.
Allgemein können pathologische Zustände durch individuelle Anlagen bedingt und von physischen oder biologischen Schäden verursacht werden. Das mag auch für die Neigung zum neurotischen Verhalten gelten, verursacht und ausgelöst wird jedoch solches Verhalten durch zwischenmenschliche Beziehungen, die mehrere Personen umfassen; sie entstehen in einer „neurotischen Situation“. Angesichts der Unterschiede zwischen dem, was als Krankheit bezeichnet wird, und neurotischen Phänomenen ist es somit kaum angebracht, von „logischen Fehlern“ zu sprechen, wenn neurotisches Verhalten mit gesellschaftlich-politischen Zuständen in Zusammenhang gebracht wird.
Dazu kommt, daß politisch interessant nicht jene Phänomene sind, die als „Neurosen“ benannt werden (Zustände, z. B. Verdauungsstörungen oder Herzbeschwerden, bei denen krankheitsähnliche Phänomene ohne merkliche Organschäden auftreten), sondern solche, bei denen das gesellschaftliche Verhalten gestört ist, die dementsprechend auch mit dem Terminus „neurotischer Charakter“ bezeichnet werden. Die mangelnde Übereinstimmung zwischen dem auffälligen politischen Verhalten und der Häufigkeit von quasiorganischen Neurosen kann darauf zurückgeführt werden, daß der neurotische Charakter nicht, so wie Neurosen, von der medizinischen Statistik erfaßt wird.
Gegen die Annahme, neurotisches Verhalten könne auch bei Gruppen auftreten, hat Erich Fromm2 behauptet, ein Neurotiker sei immer ein Einzelfall. Solch eine Person leide daran, daß sie nicht „normal“ (so wie die anderen) sein kann. In einer politisch diskriminierten Gruppe seien dagegen alle Mitglieder betroffen, und durch den „Schutz der Masse“ sei dem Ausbruch des neurotischen Verhaltens vorgebeugt. Offensichtlich wurde dabei angenommen, der politische Druck auf eine Gruppe oder Gemeinschaft würde sich bei allen ihren Mitgliedern in ähnlicher Weise äußern und sich etwa in Form von Massendemonstrationen oder Aufständen manifestieren. Dies ist jedoch nur selten der Fall. Weit häufiger wird das politische Verhalten einer Gemeinschaft, die unter Druck steht, gespalten, wobei Aufruhr und konformes Verhalten einander stoßen. Das „Neurotische“ ist unter solchen Bedingungen effektiv gleichbedeutend mit einer Schwächung der Gemeinschaft durch äußeren Druck und durch überspitzte Konflikte unter den von ihr umfaßten Parteien. Vom „Schutz der Masse“ kann dabei nicht viel erwartet werden.
Zur Terminologie und zu einigen Analogien
In der klinischen Psychologie unterscheidet man Neurosen und Psychosen. Diese Termini sind mehrfach irreführend. Erstens wird der Eindruck erweckt, Neurosen hätten nur mit Nervenschäden, Psychosen dagegen nur mit Seelenschäden zu tun. Was beobachtet wird, sind jedoch nur unterschiedliche Typen von abnormem, d. h. der Lage nach übertriebenem Verhalten. Übertriebene Aufregung gehört genauso dazu wie unangemessene Regungslosigkeit oder Passivität. Vermutungen über mögliche Zusammenhänge zwischen Symptomen, die als neurotisch oder psychotisch bezeichnet werden, und Funktionsstörungen bestimmter Nervenzellen haben auf die psychiatrische Theorie noch keinen entscheidenden Einfluß. Es wird angenommen, daß Neurosen und neurotischer Charakter auf Störungen beim Programmieren (und der Inbetriebnahme) des Nervensystems zurückzuführen sind, wobei die Natur der Programmierung noch weitgehend unbekannt ist.
Wenn Ausdrücke wie „Neurose“ nur im Sinne einer Analogie zu bekannten neuralen Phänomenen zu verstehen sind, gilt das in noch größerem Maße für „nationale Neurosen“. Dennoch sind solche Analogien nicht wertlos. Zu behaupten, ein Volk sei neurotisch, bedeutet nicht viel mehr, als daß sich in typischen politischen Situationen bei einem Volke ein dem Neurotischen ähnliches Verhalten bemerkbar macht. Die Analogie kann aber zur Suche nach Hypothesen über die geschichtlichen Ereignisse verleiten, welche mit dem Auftreten des charakteristischen Verhaltens ursächlich verbunden sein könnten. Mit Hilfe solcher Hypothesen kann das in den Sozialwissenschaften unerwünschte, weil öfters sogar mehr als tautologische Gerede von National- oder gar „Rassencharakter“ vermieden werden.
Charakteristisch für manche theoretischen Richtungen ist, daß die entscheidende Rolle bei der Entstehung psychischer Störungen im Bereich der kulturellen Bemühungen gesucht wird. Dieser Begriff wird dabei nicht nur im Sinne einer dekorativen „persönlichen Kultur“ geprägt, sondern auch im Sinne dessen, was erwartungsgemäß einen Beitrag zum Ansehen der Gemeinschaft leisten kann. Kultur stellt Aufgaben und fordert das Wetteifern um ihre Erfüllung, wirkt aber auch, ähnlich wie die Moral, hemmend und verbietend. Schon aus der allgemein anerkannten Rolle, die den Kulturen zugebilligt wird, von welchen ganze Gemeinschaften durchdrungen sind, ist ersichtlich, daß neurotische Phänomene keineswegs nur eine Frage des Privatlebens einzelner Personen sein können. Die Vorstellungen darüber, wie Kultur wirkt, sind jedoch unterschiedlich. Zwei Konzepte werden hier dargelegt, die von Freud3 und von Karen Horney4.
Die zwei Modelle
Für Freud ist Kultur ein Ausdruck der „Sublimierung“ von Trieben, welche die Lebenserhaltung von Individuen sichern, sich aber in der Gemeinschaft als störend, gelegentlich sogar als zerstörend erweisen können. Die „Energie“ der Triebe wird durch Sublimierung in Richtung Kultur umgeleitet. Dazu ist eine besondere psychische Struktur erforderlich, das „Über-Ich“, welches Idealforderungen stellt, die mit der jeweiligen Kultur konform sind. Die Nichtbefolgung dieser Forderungen wird mit „Gewissensangst“ bestraft. Neurotische Störungen entstehen, wenn der Konflikt zwischen Trieb und Ideal unerträglich wird. Die unerfüllten Triebwünsche können mit Hilfe der Analyse zum Bewußtsein gebracht und durch solche Katharsis aufgelöst werden. Den Gedanken, nicht nur Individuen, sondern auch manche Gemeinschaften seien in ihrem Streben nach Kultur neurotisch geworden, hielt Freud für fruchtbar und einer Erforschung wert.
Horney dagegen mißt den Trieben eine untergeordnete Rolle bei. Ihrer Meinung nach sind die stärksten Motive des menschlichen Handelns im Streben nach Einfluß und Anerkennung zu suchen. Anders als Freud hält Horney kulturbedingte Abwehrmechanismen gegen Angst, so wie religiöse Handlungen, nicht für neurotisch.
Im Vergleich zum breiten Zuspruch, den Freuds Konzept genießt, hat der Zugang Horneys wenig Anhänger, scheint sich aber als Ausgangspunkt für Analysen des politischen Lebens eines Volkes zu eignen. Man kann dies am Verhaltenstyp illustrieren, den Horney als Beispiel des Neurotischen anführt: ein Angestellter bemüht sich übermäßig, jedoch erfolglos, um die Anerkennung seiner Verdienste. In seinen Tagträumen rächt er sich an seinem Chef; dank seiner Aufmerksamkeit wird der Chef gestürzt, seine Position wird vom Angestellten übernommen. Sobald jedoch der Chef in Wirklichkeit vor ihm erscheint, macht er sich durch seine Unterwürfigkeit nur noch mehr verhaßt. Durch den Konflikt zwischen dem Begehren nach Sympathie und der aggressiven Rachsucht wird er innerlich zerrissen, d. h. neurotisch. Das Streben nach Herrschaft hat zwar den Ursprung in ihm allein, für die Auswirkungen dieses Strebens ist jedoch eine kulturell strukturierte Situation erforderlich. Der Vergleich mit politischen Gegebenheiten ist hier offensichtlich voll berechtigt.
Unterschiede zwischen den Konzepten Freuds und Horneys führen zu gegensätzlichen Voraussagen über die Wirkung der Kultur. Bei Freud ist die Neurose eine direkte Funktion der erreichten Kulturmacht, bei Horney dagegen scheint sie eher eine Funktion des Mangels an kultureller Anpassungsfähigkeit zu sein. Seitens der betroffenen Person wird dieser Mangel verschleiert (d. h. ins Unterbewußte verdrängt) oder übertrieben bewußt und aufgeblasen. Weiterhin sollten nach Freud Völker mit hochentwickelter Kultur mehr anfällig für Neurosen sein als unterentwickelte, während bei Horney ein kulturell frustriertes Volk eher betroffen sein sollte.
Die breite Popularität des Freudschen Modells beruht auf seinen liberalen Implikationen. Wo jedoch ethnologische Überlegungen mit tiefenpsychologischen gekoppelt werden, gestaltet sich das Ergebnis oft in Einklang mit den Vorstellungen Horneys. Während noch in der klassischen Theorie des Ethnozentrismus und in ihrer psychoanalytischen Erweiterung (für eine Übersicht siehe Anmerkung 5) jedes Volk nur die eigene Kultur schätzt und unerwünschte Verhaltenseigenschaften (Aggressivität, Unberechenbarkeit, Tücke) auf die umgebenden Völker projiziert (wobei dem Neurotischen ähnliches Verhalten auf beiden Seiten zu erwarten ist), befassen sich Ethnopsychologen zunehmend mit gefährdeten Minderheiten (wie den Juden Europas, den Indianern und Negern Amerikas6). Neue Begriffe wurden in die Psychosoziologie eingeführt, z. B. die „marginale Persönlichkeit“, „Unterdrückungsneurose“ und „sozialer Negativismus“. Von besonderem Interesse ist die Referenztheorie (Übersicht in Anmerkung 5), wonach in manchen Völkern eine fremde Kultur als Vorbild und Maßstab für die eigene steht.
Spannungen zwischen Völkern werden bei den genannten Analysen nicht aus moral-agogischen Gründen heruntergespielt. Kultur wird z. B. nicht als eine von Eros beschützte, die Menschheit brüderlich vereinigende Festlichkeit verstanden, eher wird sie als Substrat des Wettbewerbs zwischen verschiedenen Gemeinschaften und als Stütze des politischen Selbstvertrauens gedeutet. Ein Volk kann sich demnach als erniedrigt, beleidigt und bedroht fühlen, wenn seine Kultur nicht in gebührender Weise anerkannt wird.
Schichtung des neurotischen Verhaltens von Gemeinschaften
Da das neurotische Verhalten (d. h. auffallend unzweckmäßige, rational und bewußt nicht kontrollierbare Abwehrreaktionen) aus besonderen zwischenmenschlichen Beziehungen entsteht, ist es a priori wahrscheinlich, daß in einem erweiterten Rahmen von Beziehungen, wie sie in einem Volke vorkommen, ein breiteres Spektrum neurotischer Phänomene als z. B. in einer Familie zu beobachten wäre. Man kann dabei vier Stufen unterscheiden. Es sind Verhaltensweisen zu beachten, die den neurotischen Charaktereigenschaften ähnlich sind und durch häufiges Auftreten in einem Volke für dieses als charakteristisch gelten. Daß Volkscharakter als „nationale Beschränktheit“ gewertet werden kann, hat Goethe schon erkannt. Eine Liste von solchen wurde von G.K. Kaltenbrunner7 für die Deutschen aufgestellt. Sie enthält Eigenschaften, von denen fast alle jenen des neurotischen Charakters entsprechen. Man ist sich dessen nur selten bewußt geworden, weil einerseits neurotische Eigenschaften mit „nervösem“ Verhalten vermengt wurden, andererseits alles, was mit Nationalcharakter verbunden ist, als (rassistisches) Vorurteil gilt. Da jedoch psychische Beschränkungen aus traumatischen Situationen herrühren und unter günstigen Bedingungen wieder verschwinden, dürften sie nicht mit Rasseneigenschaften vermengt werden. Die von Kaltenbrunner gesammelten Aussagen über den Charakter der Deutschen können kaum als persönliche Vorurteile gedeutet werden. Obwohl sie von anerkannten Schriftstellern unterschiedlicher Volkszugehörigkeit stammen, sind die Aussagen hochgradig übereinstimmend. Allein diese Tatsache verleiht ihnen den Status eines wissenschaftlich wertvollen Fundus: die hohe Konsistenz konnte kaum durch gemeinsame Vorurteile oder durch Zufall entstanden sein.
Auf dieser Stufe werden Massenphänomene zusammengefaßt, die durch gegenseitige Verstärkung des Verhaltens von Einzelpersonen ihr Ausmaß erreichen. Beeinflussung durch private Mitteilungen wie durch öffentliche, mehr oder weniger filtrierte Berichterstattung gehören dazu. Durch unkritische Deutung bewußt oder unbewußt entstellter geschichtlicher Erfahrungen kann die politische Empfindlichkeit eines Volkes politisch wirksam gesteigert werden. Euphorischer Aufschwung wie auch lähmende Bedrücktheit können so übertriebene Ausmaße erreichen.
Dem neurotischen analog ist das Verhalten eines Volkes auch, wenn unter Druck von außen entgegengesetzte Ausweichstrategien entwickelt werden und sich als gegenseitig extrem feindselige, organisierte Parteien herauskristallisieren, so daß die politische Einheit des Volkes fraglich wird. Die Wahrscheinlichkeit der Entstehung solcher Spaltungen ist um so höher, als auf der einen Seite tradierte, und auf der anderen aufgegriffene Werte zur Stütze des Selbstvertrauens herangezogen werden, je weiter in die Ferne die Verwirklichung der Wünsche rückt und je höher das Bedürfnis, der eigenen Schuld an der Misere auszuweichen. Bei andauernder Ohnmacht eines Volkes leidet die Autorität und damit die Wirksamkeit der führenden Schichten. Zwangsneurotische autoritäre Übergriffe wie chaotische Zustände werden dadurch möglich.
Jedes neurotische Phänomen trägt in sich seine Geschichte. Analysen zeigen, daß traumatische Erfahrungen eines Kindes Störungen im reifen Alter verursachen können. Analog dazu kann angenommen werden, daß auch bei der Gestaltung der Völker Phasen auftreten, die den Gang der weiteren Entwicklung kritisch bestimmen.
Eine wichtige Rolle fällt dabei den jeweils waltenden Autoritäten zu. Als Vorbild kann für ein sich formendes Volk die Kultur eines anderen wirken, die mehr Selbstvertrauen verspricht als die eigene. Kulturschocks, die etwa bei Volkswanderungen auftreten, sind auch für Geschichtswissenschaftler (z. B. Toynbee) kein unbekanntes Thema. Die Identität eines Volkes kann dabei neu geprägt werden, aber auch für längere Zeit gespalten bleiben.
Die Aufnahme jeder Kultur ist mühsam und verlangt einen hohen Einsatz von Energie. Die Übernahme einer fremden Kultur ist umso mühsamer, als es oft scheinen mag, der ursprüngliche Krafteinsatz hätte sich nicht gelohnt. Kein Wunder, daß eine fremde Kultur auf Widerstände stößt, besonders bei jenen, die sich von ihr keinen Gewinn versprechen





























