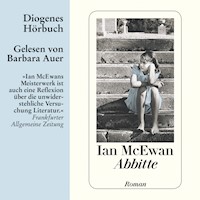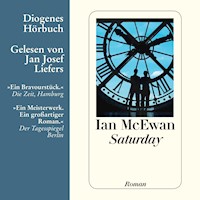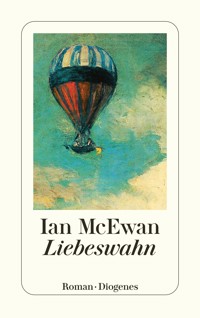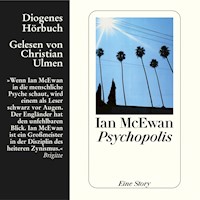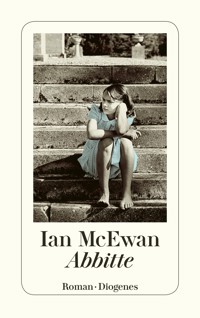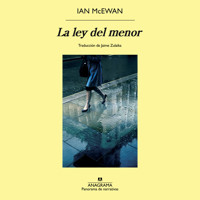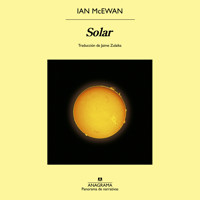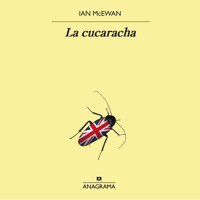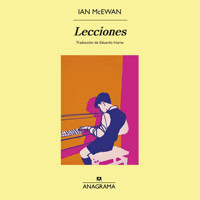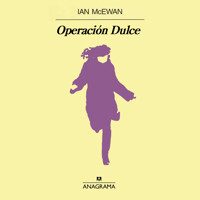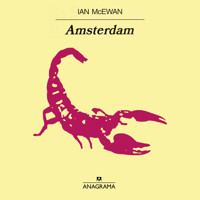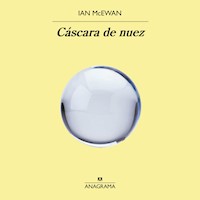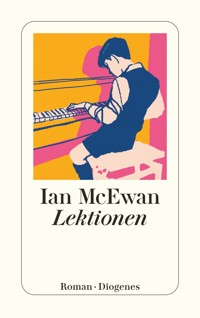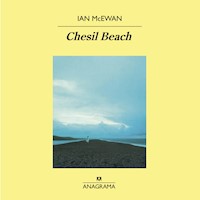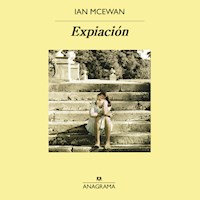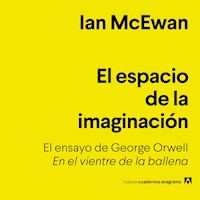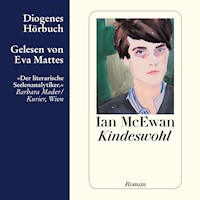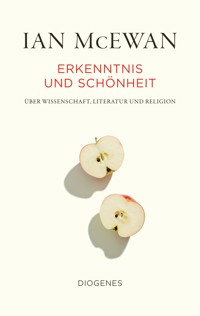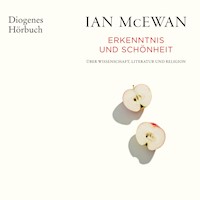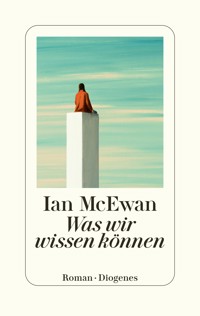
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Im Jahr 2119: Die Welt ist überschwemmt, Europa eine Insellandschaft, Freiheit und Reichtum unserer Gegenwart – ein ferner Traum. Der Literaturwissenschaftler Thomas Metcalfe sucht ein verschollenes Gedicht von Weltrang. Der Dichter Francis Blundy hat es 2014 seiner Frau Vivien gewidmet und nur ein einziges Mal vorgetragen. In all den Spuren, die das berühmte Paar hinterlassen hat, stößt Thomas auf eine geheime Liebe, aber auch auf ein Verbrechen. Ian McEwan entwirft meisterhaft eine zukünftige Welt, in der nicht alles verloren ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 540
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ian McEwan
Was wir wissen können
Roman
Aus dem Englischen von Bernhard Robben
Diogenes
Für Timothy Garton Ash
Es geht um jene Art menschlicher Wahrheit, schwebend zwischen Fiktion und Tatsache, wie sie ein Biograf erschaffen kann, wenn er die Lebensgeschichte eines anderen Menschen erzählt und sie dadurch ebenso zu seiner eigenen macht (gleich einer Freundschaft) wie zu einer öffentlichen (gleich einem Verrat). Sie fragt, was wir wissen können und was wir glauben können und letztlich, was wir lieben können.
Richard Holmes, Dr Johnson & Mr Savage (1993)
1. TEIL
Eins
Am 20. Mai 2119 nahm ich in Port Marlborough die Nachtfähre und erreichte am späten Nachmittag den kleinen Anlegesteg nahe Maentwrog-under-Sea, der zur Bodleian-Snowdonia-Bibliothek gehört. Es war ein warmer, ruhiger Frühlingstag, und die Reise war glatt verlaufen, auch wenn es, wie jedermann weiß, eine Qual ist, in sitzender Haltung auf einer Holzbank zu schlafen. Ich folgte dem pittoresken Pfad zwei Meilen weit hinauf zu der von Wasser- und Schwerkraft betriebenen Seilbahn. Vier weitere Bibliotheksnutzer schlossen sich mir an, und wir plauderten über dies und das, während wir in dem ächzenden, blank polierten Eichenwaggon tausend Fuß hoch den Berg hinaufgefahren wurden. Ich aß in der Bibliothekskantine allein zu Abend und telefonierte anschließend mit Rose Church, meiner Freundin und Kollegin, um sie wissen zu lassen, dass ich wohlbehalten angekommen war. In dieser Nacht schlief ich gut in meiner Zelle. Anders als bei meinem ersten Aufenthalt machte es mir diesmal nichts aus, das Bad mit sieben weiteren Gästen zu teilen.
Nach dem Frühstück führte mich Donald Drummond, einer der Assistenzarchivare, zu meiner Lesekabine. Sein Forschungsbereich schloss meinen Zeitraum ein, die Jahre 1990 bis 2030, weshalb er großes Interesse an meinem Thema zeigte, das unzutreffend sogenannte Zweite Unsterbliche Abendessen sowie Francis Blundys berühmtes verschollenes Gedicht »Ein Sonettenkranz für Vivien«. Es war nützlich, jemanden zu haben, der das eine oder andere aus dem Magazin holte, nur irritierte mich Drummonds wohlmeinende Art und auch seine Angewohnheit, mitten im Satz nach unbedeutenden Wörtern wie ›von‹ oder ›das‹ mit offenem Mund eine Pause einzulegen. Ich verdächtigte ihn, furchtbar schlau zu sein. Allzu oft redete er von seiner vierzehnjährigen Nichte, einem Mathegenie. Er stellte mir unzählige Fragen, was den Gedanken nahelegte, dass er selbst an einem Buch schrieb. Und dass ich mich übertrieben freundlich gab, um meine Abneigung zu kaschieren, machte alles nur noch schlimmer.
Wie gewünscht brachte er mir aus dem Archiv die zwölf Bände von VivienBlundys Tagebüchern, die aus ungeklärten Gründen bei den Papieren ihres Gatten untergebracht waren wie im Marsupium eines Beuteltiers. Kaum war ich allein, öffnete ich den luftdichten Ordner und wählte Band fünf. Ich blätterte zu Seite zweiunddreißig. Ich musste mir die Stelle einfach noch mal ansehen. »Zwischen Francis und mir ist alles geklärt. Ich bin hier zumeist glücklich. So weit, so gut.« Sie bezieht sich auf den tragischen Fall von Percy Greene, ihrem ersten Mann, der an Alzheimer litt.
Sie glaubte, dass Francis sie liebte, und obwohl beide nicht mehr jung waren, er sogar zehn Jahre älter, hatten sie ein »annehmbares Sexleben«, und es gab stets genug zu reden. Nirgendwo in ihren Tagebüchern bedauert sie, den großen Dichter geheiratet zu haben, auch wenn er viel Zeit in seinem Arbeitszimmer verbrachte. An einer Stelle schreibt sie: »Ich frage mich manchmal, ob es mir gefällt, ihn nicht zu mögen.« In Band sieben sind sie seit neun Jahren verheiratet. Anfangs hat sie die Recherche für ihr zweites, später aufgegebenes Buch »bei Verstand gehalten«. Als sie noch ihre Stelle in Oxford hatte, veröffentlichte sie eine akademische Biografie über den Dichter John Clare, eine Überarbeitung ihrer Dissertation. Sie unterrichtete gern. Jahre später sorgte ihre Situation bei Freunden für Verwunderung. Verschiedene Entscheidungen hatten nach und nach dazu geführt, dass sie am Rand eines kleinen Tals im ländlichen Gloucestershire in einer höhlenartigen Scheune wohnte, ohne bezahlte Arbeit, sechs Kilometer entfernt vom nächstgelegenen Dorf, zusammen mit siebentausend Büchern. Sie selbst hätte niemals von sich geglaubt, dass sie einmal ihre Karriere, gar ihre Berufung, aufgeben würde, um einem Genie zu Diensten zu sein.
An einem frühen Nachmittag im Oktober 2014 – »durch den Baum vor meinem Fenster fuhr ein kräftiger Wind« – saß VivienBlundy in ihrem Arbeitszimmer, einer umgebauten alten Molkerei ein wenig abseits der Scheune. Sie schrieb vermutlich eine Einkaufsliste für das Essen, das am nächsten Tag zu ihrem Geburtstag stattfinden sollte. Sie hatte acht Freunde zum Abendessen eingeladen. Die Sitzordnung dürfte schon fertig gewesen sein. Später würden sie alle zuhören, wie ihr Mann ein neues, langes Gedicht vortrug, sein Geburtstagsgeschenk. Einkaufen und Kochen empfand sie durchaus nicht als unter ihrer Würde. Sie war von Natur aus großzügig und machte anderen gern eine Freude. Ein gelungenes Essen aufzutragen und ein geordneter Haushalt verschafften ihr Befriedigung. Francis hatte sie nie gedrängt, seine Sekretärin zu werden oder ihre Karriere aufzugeben, auch wenn ihm dies sichtlich zugutekam. Bei jedem einzelnen Schritt hatte sie ihre Entscheidung aus nachvollziehbaren Gründen getroffen, die ihr heute allerdings schwächer als damals erschienen. Der Prozess hatte Jahre gedauert. Sie war einmal ein Don gewesen, eine Kandidatin für eine Professorenstelle, dann lehrte sie nur noch in Teilzeit, später hielt sie gelegentlich Vorlesungen in einer amerikanischen Sommerakademie und arbeitete an ihrem zweiten Buch, bis sie sich eingestand, dass daraus nichts werden würde. Es aufzugeben war eine Befreiung. Sie hatte stets das Gefühl gehabt, die Kontrolle zu haben. Im Rückblick aber überraschte es sie, wie sie sich selbst um ihren Ehrgeiz und ihr Gehalt gebracht hatte, um Status und Erfolge, anfangs, weil sie sich um ihren ersten Mann gekümmert hatte, und später im Namen der Freiheit, aus Ernüchterung über die Universitätsverwaltung oder aus Begeisterung für die Lyrik von FrancisBlundy.
Dass ihre Tagebücher dem Nachlass des Dichters in der Bodleian Library in Oxford, später Snowdonia, zugeordnet worden waren, könnte aus Versehen geschehen oder dem Versäumnis geschuldet sein, rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Vor langer Zeit hatte irgendein Bibliothekar den Nachlass des Ehepaars schließlich in separate Kisten eingeordnet und nebeneinandergestellt. Viviens sporadische und von Kummer geprägte Bemerkungen über ihren ersten Mann, Percy, einen Geigenbauer, den sie liebevoll gepflegt hatte und der nach einem unglücklichen Sturz gestorben war, habe ich sehr aufmerksam gelesen. Viele Einträge sind verblüffend banal und verraten weder dem Blundy-Gelehrten noch sonst jemandem, was sie doch vor allem über den Geburtstagsabend herausfinden wollen, nämlich Näheres über das berühmte, ihr gewidmete Gedicht und was mit dem Exemplar – dem einzigen Exemplar – geschehen war, mit Francis’ Geschenk, das er ihr nach dem Vortrag überreicht hatte.
Wir dürfen annehmen, dass sie an jenem Nachmittag mit ihrer Einkaufsliste zwölf Kilometer weit zum Marktflecken Cirencester fuhr, um beim Metzger »fünf vorbestellte, ungewöhnlich pralle« Wachteln abzuholen. Sie würde sie später mit Schinkenspeck umwickeln und zusammen mit den Steinpilzen, die eine Freundin in den Buchenwäldern der Chiltern Hills gesammelt und zur Scheune gebracht hatte, in einer Kräuter-Rotweinsoße schmoren lassen. Außerdem kaufte sie vier Kilo Ofenkartoffeln und beim selben Gemüsehändler auch drei Köpfe Blumenkohl, deren Röschen sie in einer großen Paellapfanne mit »Olivenöl, Knoblauch, klein geschnittenen grünen Chilis, Sardellen, Kirschtomaten, schwarzem Pfeffer, Thymian und Semmelbröseln« köcheln ließ. Das waren noch Zeiten.
Auf dem Heimweg war die einspurige Landstraße von einem durch die Oktoberstürme herabgestürzten Eichenast versperrt. Im Mündungsarm des Severn hat man bereits Winde von hundertfünfzig Stundenkilometern gemessen. Vivien und ein weiterer Autofahrer, ein ihr flüchtig bekannter Bauer, hoben den Ast von der Straße und »legten ihn behutsam im hohen Gras ab wie einen Leichnam, der er eigentlich ja auch war«.
Inmitten der häuslichen Details gibt es einige wenige Einsprengsel, düstere, leise Schreie ehrlichen Gefühls, die von den Blundy-Spürhunden meist übersehen werden. Ich beugte mich gerade über einen dieser Sätze, ebenfalls aus Band fünf. Die nach vorn geneigte Handschrift ist kleiner als sonst, die Zeichensetzung freier. »Ich habe ihn nie gehasst. Nie! Nur …« Man kann über den abgebrochenen letzten Satz rätseln oder über den mittleren Buchstaben des »nur« sinnieren, als würde er an seinen Scharnieren aufwärtsschwingen und ein Guckloch freigeben, durch das man ein enttäuschtes, durch versäumte Gelegenheiten verkümmertes Herz sehen kann.
Neben Rezepten, Gartennotizen und Erwähnungen ihres Neffen Peter hielt Vivien im Lauf ihrer Jahre in der Scheune auch häufig Wetterbeobachtungen fest. Dass mehrere milde Winter aufeinanderfolgten, bedrückte sie. In einem Februar sank die Temperatur während drei Wochen kaum unter neun Grad. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann sie zuletzt Eiszapfen an den Dachrinnen gesehen hatte. Selbst Schnee war ungewöhnlich. Sie vermerkte, dass die Narzissen zu früh austrieben, genau wie die Rosen, und dass die Äpfel und Birnen in einem Nachbargarten zu früh reif wurden. Sie reagierte erleichtert, als der Bach über die Ufer trat und die Weiden überschwemmte, »genau, wie es sich gehört«. Zwei Jahre später registrierte sie aufgebracht, dass das klare Wasser stank und sich zu einem »widerlichen Milchgrün« verfärbt hatte. Schmutzwasser von den Höfen, eine Abwassereinleitung, vielleicht auch beides. Weder Francis noch sie gehörten zu denen, die sie ›politisch Engagierte‹ nannten. Sie hätten sich nie einer der örtlichen Umweltgruppen angeschlossen, den Anglern oder Wanderfreunden, um zu protestieren oder sich für Veränderungen einzusetzen. Ihnen genügte die Beobachtung, der Eintrag ins Tagebuch. Vivien wartete darauf, dass sich die Igel »wie üblich« blicken ließen, und wurde enttäuscht. Das Keulen der Dachse empörte sie. Der starke Wind, der neuerdings durchs Tal fegte, machte sie gereizt. Als bei einer kurzen Hitzewelle im Juli 35 Grad erreicht werden, schrieb sie, es sei »unmöglich, nachts zu schlafen«. Diese diversen Disruptionen fügten sich für sie nicht zu einem größeren, besorgniserregenden Muster zusammen, das auf Klimawandel oder eine aus den Fugen geratene Natur verwies, doch jenes eine Wort, mit dem sie die Hitze beschrieb – »unheilvoll« –, deutete an, dass sie besorgt war und begann, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen.
Es war ihr 54. Geburtstag. Außer von ihrem Einkauf wissen wir nur wenig über die Vorbereitungen für das, was als das Zweite Unsterbliche Abendessen in die Geschichte eingehen sollte. Das erste war von seinem Gastgeber, dem Maler Ben Haydon, so benannt worden und hatte am 28. Dezember 1817 in London, 22 Lisson Grove, stattgefunden. Zu den Gästen gehörten WilliamWordsworth, John Keats und Charles Lamb. Laut Haydons zwanzig Jahre später verfasstem und fraglos gründlich aufpoliertem Bericht war es ein Abend voller Witz, Tiefsinn, Gelächter, Sarkasmus und Sympathie gewesen. In einem viel beachteten, im Jahr 2000 veröffentlichten Buch von P. Hughes-Hallett findet sich eine gute Wiedergabe dieser Begegnung.
Vivien hatte mit den Vorbereitungen höchstwahrscheinlich bereits am Vorabend begonnen, vermutlich, indem sie das Wohnzimmer geputzt und aus dem Garten das Grün für die Tischdekoration geholt hatte. Ein Besucher der Scheune beschrieb ein Jahr zuvor, dass sie ebendies an einem Samstagabend vor dem sonntäglichen Mittagessen getan hatte. Wie an den meisten Nachmittagen dürfte sich Vivien vermutlich ab vier um die Angelegenheiten des Dichters gekümmert haben – um Briefe und E-Mails von Bewunderern und Gelehrten, Einladungen zu Vorträgen, um die vielen guten Zwecke, für die Blundys Unterstützung erbeten wurde, oder um die komplizierte Zusammenfassung seines Agenten betreffs der Rechte an seiner Anthologie. Vor allem jüngere Gäste zeigten sich angesichts eines häuslichen Arrangements verblüfft, in dem eine gebildete, belesene Frau derart viele Aufgaben übernahm. Francis setzte sich nicht mehr selbst ans Steuer, also fuhr sie ihn, wohin er wollte. Sie kochte, räumte auf und machte den Abwasch, während Blundy arbeitete, las, schlief oder sich mit Freunden unterhielt. Sie schenkte ihm und seinen Gästen nach. Noch mit Mitte sechzig mähte sie den Rasen, trug im Winter das Brennholz ins Haus. In einem Interview erklärte eine Freundin später: »Bei denen da draußen, also das war wie mittelalterliche Leibeigenschaft, auch wenn man sich nach einer Weile dran gewöhnte. Wenn ich Hilfe anbot, hat Vivien stets gutmütig abgelehnt. Francis saß in seinem Sessel, die Hände im Schoß. Ich glaube nicht, dass es ihm je in den Sinn gekommen ist, der Haushalt, die Mahlzeiten oder gar der Zustand seiner Unterwäsche könnten irgendwas mit ihm zu schaffen haben. Schließlich war er ein Genie.«
Die Freundin, die die Steinpilze gesammelt hatte, hörte das Interview und schrieb einen heiteren Artikel für den Spectator, eine politische Wochenzeitung. Die Männer, die jungen Dichter, die dem Meister zu Füßen saßen, waren insgeheim neidisch auf Blundys Leben, in dem er keinen Finger zu rühren brauchte. In jener Generation, die in den 1950ern und frühen 60ern erwachsen wurde, lehnten sich die Männer, insbesondere Schriftsteller, gern im Sessel zurück und träumten – ganz wie in jeder vorangegangenen Generation –, während ihre Frauen im Haus fleißig waren. Niemand beschwerte sich darüber oder bemerkte es auch nur. Dann, welch ein Jammer für die armen Kerle, setzte in den frühen 1970ern die zweite Welle des Feminismus ein und fegte dieses ach so zivilisierte Arrangement hinweg. Die Blundys waren vornehme Überlebende einer anderen Zeit und, so die Freundin: »Die missliche Wahrheit lautet, dass seine Frau weit glücklicher und fitter ist und ihn vermutlich überleben wird.«
Die Berichte verraten, dass der Wind am 14. Oktober nachgelassen hatte; der Tag war wolkenlos und warm. Das Thermometer an der Nordwand der alten Molkerei zeigte eine Höchsttemperatur von dreiundzwanzig Grad an. Während Vivien am Vormittag im Garten späte Rosen für den Tisch schnitt, fuhr der Postbote mit seinem Lieferwagen vor und brachte ein schweres Paket, das er ihr freundlicherweise in die Küche trug. Es war an Francis adressiert. Sie ahnte, was es war. Sie ahnte auch, dass jemand fälschlich annahm, es sei Francis’ Geburtstag und nicht ihrer. Vor dem Mittagessen zeigte sie ihrem Mann das Paket und half ihm, das Packpapier zu entfernen. Ein rechteckiger Kasten aus hellem Holz mit einem Schiebedeckel wie ein überdimensioniertes Federkästchen. Als sie es aufmachte, stöhnte Francis.
Er glaubte, alles zu haben, was er brauchte, und er brauchte nicht viel. Ein Geschenk bedeutete nicht nur unnützen Krempel, es beanspruchte auch Raum in seinen Gedanken, eine weitere störende Verpflichtung, der ungewollte Appell, an jemand anderen zu denken, an dessen Wohlwollen, und das senkte sich wie eine düstere Wolke über ihn. Die Dankesbriefe, die er manchmal unterschrieb, setzte meist Vivien auf. Das hier war jedoch etwas anderes, eine Magnum Champagner von ihrem Neffen Peter. Er war in der Huntington Library in Pasadena, Kalifornien, bei einer Konferenz über Schleifenquantengravitation. Worum es dabei ging, verstand trotz Peters geduldiger Erklärungen niemand. Francis glaubte immerhin begriffen zu haben, was mit ›hintergrundunabhängig‹ gemeint war, hatte es aber schon wieder vergessen. Es war anständig von Peter gewesen, ihnen an einem Abend im Sommer, als sie draußen im Garten gesessen hatten, zu versichern, dass kaum hundert Menschen auf der Welt wirklich kapierten, worum es bei der Loop-Theorie ging.
Er, vielleicht auch seine Mutter, hatte dafür gesorgt, dass diese Flasche von einem Weingeschäft in Oxford für sie ausgesucht und ihnen zugeschickt worden war. Blundy war erleichtert. Der Champagner kam nicht von einem jungen Lyriker, der hoffte, er würde seine Gedichte lesen. Vivien, die es ärgerte, dass ihr Mann ihr nicht zum Geburtstag gratuliert hatte, hielt folgenden Wortwechsel fest:
Er: »Stell sie am besten in den Kühlschrank.«
»Da ist nicht genug Platz. Ich stelle sie später in den Eiskübel. Oder ich leg sie ins Gefrierfach. Darf ich nur nicht vergessen.«
Francis nahm sich vermutlich einen Apfel aus der Schale, ehe er die Küche verließ und über den Flur in sein Arbeitszimmer ging, um sich etwas zu notieren und sich um letzte Vorbereitungen für das Geburtstagsgeschenk zu kümmern. Seine Papiere füllen 135 Kisten. Diesmal ließ ich sie mir nicht alle aus den Archiven kommen, da ich mir über den Oktober 2014 bereits Notizen gemacht hatte. Bei den meisten Einträgen handelt es sich um Ideen für Gedichte, Werknotizen und erste Entwürfe, Gedanken über die eigenen Arbeitsprozesse. Verweise auf andere Leute sind selten. Familiendramen und persönliche Beziehungen finden keinen Platz in Blundys Betrachtungen. Am Tag des Sonettenkranzdinners war ihm fraglos etwas aus Peters Erklärungen eingefallen. Er machte sich Notizen für sein Gedicht String.
Raum und Zeit sind aus winzigen Schleifen zu einem Gewebe verwoben, Billionen Mal feiner als Seide. Die Schleifen sind so klein, wie es die Physik nur zulässt.
Auf der nächsten Seite erwähnte er einige der bedeutsamsten Denker dieser Disziplin:
Ashtekar, Rovelli, Smolin – Namen wie edle Gin-Sorten … Spielfeld der Spekulationen ist offenbar »die Natur des Universums«. Folglich auch Thema für die Lyrik. Man muss die undurchdringlichen Konzepte nicht verstehen, um sie zum Singen zu bringen. Schließlich muss man auch nichts über das Gehirn wissen, um Gefallen an einem Sonett oder Sonnenuntergang zu finden. Eine Blackbox! Aber wenn selbst Wystan die Physik begreift, wer sollte sie dann nicht verstehen?
Zwei
Ich sah Drummond in meine Richtung kommen. Es war spät am Vormittag, viele hatten ihren Tisch verlassen, um einen Eichelkaffee im Gemeinschaftsraum zu trinken. Ich stöhnte, als er tatsächlich an meinen Tisch trat. Der Archivar musste glauben, ich würde in Snowdonia Urlaub machen.
Er beugte sich über die Trennwand meiner Kabine. »Tom. Wegen der Zahlen.«
Das schon wieder. »Tut mir leid. Hab ich völlig vergessen.«
In VivienBlundys letztem Tagebuch findet sich in der rechten Ecke der vorletzten Seite eine Ziffernfolge, die wie eine Telefonnummer aussieht: 05144142418. Nur hat es diese Vorwahl nie gegeben. Außer Drummond interessierte sich kein Mensch dafür. Er meinte, wir könnten doch zusammen daran arbeiten, was mich nicht sonderlich reizte, doch hatte ich ihm bei meinem letzten Besuch versprochen, die Zahlenfolge an unsere Kommunikationsabteilung weiterzuleiten, ein leeres Versprechen, das ich gleich wieder vergaß. Ich wusste, damit verplemperte ich nur meine Zeit. Außerdem fand ich es deprimierend, ›die andere Seite‹ aufzusuchen, wie wir in den Geisteswissenschaften die Physik- und Technikgebäude nannten, die so viel größer und schöner als unsere waren.
»Ich habe da eine Idee. Könnte Sie interessieren.«
»Sicher, aber nicht jetzt, Donald. Muss weitermachen.«
»Klar doch. Vielleicht nach dem Abendessen?«
Ich nickte. Er wirkte nicht beleidigt, als er ging. Ich fragte mich, ob er es gewohnt war, zurückgewiesen zu werden, unterdrückte aber meine Schuldgefühle und wandte mich wieder meiner lang vergangenen Welt zu.
Als das öffentliche Interesse für den Abend bei den Blundys zunahm, sorgte dies in den Medien für allerhand rechtschaffenes Gespött. Ein Großteil davon findet sich in der National Press Library in den Pennines. Anfangs faszinierte die Gästeliste weit mehr als die Lyrik. Die Allgemeinheit nahm davon zwar kaum Notiz, oder es kümmerte sie nicht, eine Minderheit aber begann, sich daran zu stören. Ihr gefiel dieser ›Scheunen-Klüngel‹ nicht: hetero, weiß, einflussreich, eine gut situierte literarische Elite aus der London-Oxford-Achse. Warum, fragten sich Journalistinnen und Blogger, diese Begeisterung für ein Treffen älterer, selbstzufriedener, mittelmäßiger Leute? Es war noch schlimmer als die längst vergessene Obsession mit der Bloomsbury-Gruppe. Zwölf Jahre später erschien in der landesweiten Zeitung Telegraph ein Artikel, der den Abend in ein anderes Licht rückte: Es sei eine private Feier ohne jegliche soziale Verpflichtungen hinsichtlich der Zusammensetzung gewesen. Die Blundys hatten in erster Linie Freunde eingeladen, die sie seit Jahren kannten, auch schon, ehe etwas von ihnen veröffentlicht worden war. Blundy galt neben Seamus Heaney als einer der größten englischsprachigen Dichter des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts. Sicher, zu seinen Freunden gehörte die Romanautorin Mary Sheldrake; ein weiterer Gast war sein Verleger und Schwager Harry Kitchener. Zwei der übrigen Gäste waren schwul, zwei unter vierzig, keiner war reich oder besaß politischen Einfluss, und die Hälfte der Anwesenden hatte noch nie etwas veröffentlicht.
Damit war die Debatte aber keineswegs beendet. Der Abend mochte einmal eine private Angelegenheit gewesen sein, doch war er das längst nicht mehr. Und es ging auch nicht mehr allein um ein verschollenes, nach dem Abendessen vorgetragenes Gedicht, sondern um das, was aus diesem Gedicht dank seiner Nichtexistenz geworden war: ein Reservoir an Träumen, überbeanspruchte Nostalgie, nutzlose retrospektive Wut und Brennpunkt haltloser Verehrung. Allein Blundys Wahl der Gedichtform, hieß es, sage doch alles. Ein Sonettenkranz sei im 21. Jahrhundert ein verschnörkelter Anachronismus gewesen. Durch keinerlei eigenen Verdienst, vielmehr allein dank der Torheit seiner Bewunderer habe das Gedicht alle Grenzen gesprengt, um in den Sumpf politischer Ökonomie, globaler Historie und Leids abzugleiten. Vergleiche mit dem ›Unsterblichen Abendessen‹ von 1817, so wurde argumentiert, entbehrten jeder Grundlage. Esprit sei größtenteils ein Vorrecht der geistesgewandten Jugend. Und bei den Blundys habe es an jenem Abend niemanden gegeben, der sich vergleichen ließe mit Leigh Hunt oder Keats, dem nur noch vier Jahre bis zum Ende seines kurzen Lebens blieben. Niemand in der prachtvoll umgebauten Scheune hätte es mit Wordsworths Gelehrsamkeit aufnehmen können, der Unmenge an Gedichten, die er auswendig kannte, oder mit der Kraft seiner Persönlichkeit.
Und so stolperte die Debatte dahin, und der Ruhm des Abends bei Blundy wuchs im Laufe jener Jahre, in denen Städte, Landschaften und Institutionen verkümmerten oder überflutet wurden. Dabei hat ein Unmaß an Informationen in zahllosen Schichten unwichtiger Details überdauert. Viele Gelehrte erstickten unter dem Gewicht trivialer Fakten. So wissen wir zum Beispiel, dass FrancisBlundy gern Äpfel aß. Jeden Spätsommer und Herbst bekam er von dem großzügigen Nachbarn mit Obstwiese einen reichhaltigen Vorrat. Es gibt drei Blundy-Gedichte über Äpfel. Das bekannteste und in vielen Anthologien erschienene On Floral Street handelt von einem langen, zu Ende gehenden Leben, in dem nach und nach Freunde, Familie, Besitztümer – und letztlich Bedeutung verloren gehen. Das zentrale Bild zeigt uns einen Straßenjongleur, den Blundy einmal in einem als Covent Garden bekannten Bezirk gesehen hatte. Statt Bällen oder Keulen warf er Äpfel in die Luft. Jedes Mal, wenn ein Apfel fiel, schnappte sich der Jongleur einen Bissen, bis kaum mehr erkennbare Stücke aus Apfelfleisch und -schale rotierten, ein über seinem Kopf kreisendes Memento mori. Im Finale warf er die Reste dann zu einer senkrechten Säule hoch, legte den Kopf in den Nacken, öffnete den Mund weit wie ein willkommen heißender Gott – und dann folgte nur noch die Verbeugung des Jongleurs. So endet es, dieses heitere Gedicht über den Tod.
Kaum war das Gespräch mit Vivien beendet, aß Francis seinen Apfel, setzte sich an den Schreibtisch und machte sich Notizen zum ersten Entwurf von String. Neben dem Ellbogen lag sein Geschenk, ein großes, rechteckiges Stück Pergament, bei William Cowley in Newport Pagnell gekauft, dem einzigen Hersteller von behandeltem Kalbsleder in diesem Land. In winziger Handschrift und mit schwarzer, haltbarer Tinte hatte Blundy darauf das lange Gedicht übertragen, das in den vergangenen fünf Monaten vielfach von ihm überarbeitet worden war. Etwa 2500 Wörter standen auf dem Zuschnitt aus geschlagenem weichen Leder. »Ein totes Tier übertrug neue Sinnlichkeit auf meine Worte. Jetzt sind sie lebendig.« Auf dem Schreibtisch lag auch ein grünes Seidenband. In einem Notizbuch (datiert 2013/14 in Kiste 110 im Archiv Snowdonia) hatte er sich geschworen, sämtliche Notizen und Entwürfe zu vernichten, damit sein kostbares Geschenk wirklich einzigartig bliebe. Sobald er es vorgelesen hatte, würde er das Pergament zusammenrollen, mit dem Seidenband verschnüren, eine kurze Rede halten und es Vivien übergeben.
Er fand, das Gedicht gehörte zu seinen besten, und freute sich darauf, es am Abend den Freunden vorzutragen. Er brauchte auch nicht zu üben. In den vergangenen vierzig Jahren hatte er in mehreren Dutzend Ländern dem Publikum aus seinem Werk rezitiert. Und man fand, er lese gut. Er schlug nicht wie Yeats den herablassenden Singsangton eines Hohepriesters an, auch nicht Eliots verlogenes Gesäusel, und er verachtete den schluffigen Ton, der heutzutage vorzuherrschen schien. Er hatte ein Faible für Dramatik. Sein Ton konnte eindringlich sein, witzig, schneidend. Dass er irgendwo gelesen hatte, ihm stünden offenbar hundert verschiedene Tonlagen zur Verfügung, hatte ihm gefallen. Wie seine Zeitgenossen James Fenton und Alice Oswald kannte er seine Gedichte auswendig. Sich vom Mikro abzuwenden, an den Rand der Bühne zu treten und dem Publikum in Auge und Herz zu sehen, während er seinen von ausdrucksstarken Gesten begleiteten Bariton dahinschweben ließ, aufzutreten – das war es, was ihm gefiel.
Für sein Geburtstagsgeschenk – er machte selten Geschenke, dies hier aber war auch für ihn selbst – hatte er eine andere Art der Darbietung gewählt, eine Gedichtform der Renaissance (manche behaupten des Rokoko), eine von anspruchsvollen Kompositionsregeln diktierte Sonettenfolge. Das Arbeitsmaterial gefiel ihm. Ebenfalls auf Pergament geschrieben hat die Magna Charta (heute Bestandteil der Mendips Historical Collection) neun Jahrhunderte überdauert. Seine winzige Schrift, die er ohne Brille nicht lesen konnte, endete in der rechten unteren Ecke kurz vor dem Ende der Seite und machte einen »antiken, zeitüberdauernden Eindruck«.
Ein Sonettenkranz ist ein eindrucksvolles Unterfangen. Die letzte Zeile jedes Sonetts wird mit der ersten Zeile des nächsten wiederholt. Das fünfzehnte Sonett, der ›Kranz‹, muss die je erste Zeile der vorhergehenden vierzehn wiederholen und Sinn ergeben. Francis hatte sich für Petrarcas Sonettform entschieden: zwei Strophen, die erste aus acht Zeilen, die zweite aus sechs. Das Reimschema war das traditionelle ABBAABBA CDECDE. Schön und schlicht. Die Aufgabe bestand darin, ein langes Gedicht zu schreiben – üblicherweise einer verehrten Person gewidmet –, das leicht dahinfloss und nicht unter dem Druck der Regeln ächzte. Blundy fand, es war ihm gelungen. Wir wissen das von seinem triumphierenden Eintrag, Notizbuch 2014–15, Kiste 111. »Ich stelle fest: Meine fünfzehn sind John Donnes bescheidenen sieben überlegen.«
Er schrieb: »Heute Morgen habe ich das Pergament vom Schreibtisch hochgehoben und mir unter die Nase gehalten. Kein Geruch nach Blut oder Fleisch. Nur die schwache Erinnerung an ein Internatstintenfass, eingelassen in einen mit eingeritzten Obszönitäten übersäten Schreibtischdeckel. Ich spürte das sanfte Gewicht der Tierhaut in meinen Händen und wusste nicht mehr, wann ich zuletzt so unbeschwert, heiter und unzweideutig mit mir zufrieden gewesen war.«
Dass auch noch ein Jahrhundert später über seinen ›Sonettenkranz für Vivien‹ geredet wurde, hätte ihm gefallen, wenn auch nicht überrascht. Weniger gefallen hätte ihm vermutlich, wäre ihm gleichfalls gesagt worden, dass das einzig existente Exemplar verschwunden war. Soweit wir wissen, hat es nur seine Frau gelesen. Sicher war er davon ausgegangen, dass sein Gedicht veröffentlicht werden würde, wenn auch womöglich erst nach seinem Tod.
Zu seinen Lebzeiten verglich die Kritik FrancisBlundys Lyrik jedenfalls mit der von T.S. Eliot, ein recht oberflächlicher Vergleich, der einzig darauf fußte, dass Blundy in einigen Gedichten wie Eliot einen vermeintlichen, wohl nicht überbrückbaren Riss in der Zivilisation zwischen Intellekt und Gefühl beklagte. Doch fanden sich weitere Parallelen. Im Leben beider Dichter gab es eine Vivien, wenn auch in anderer Schreibweise, und oberflächlich gesehen eine komfortable englische Existenz, hinter der sich allerhand Unruhe und Achtlosigkeit im Umgang mit dem Leben anderer verbargen. Dessen, was falsch war und andre schmerzte. Sie teilten ein gefährliches Schicksal, das alle Schriftsteller zu vermeiden hoffen. In Worte gefasst wurde es von einem Kritiker, einem Zeitgenossen von Francis, der über die Beliebtheit literarischer Biografien schrieb und die verbreitete Neigung bedauerte, eher vom Leben der Autoren als von ihrem Werk fasziniert zu sein. Ihre Affären, ihr Elend im Leben, die versoffenen Wochenenden, beruflichen Eifersüchteleien, Statusängste und Sinnkrisen befreiten eine größere Leserschaft davon, sich mit der Lyrik selbst befassen zu müssen.
Drei
Anders als Eliots Vivienne war BlundysVivien nicht psychisch krank. Sie stand in der Küche, schälte Kartoffeln. Dass wir wissen, um welche Sorte Kartoffeln es sich handelte, wirft erneut die Frage der Information auf. Fluch oder Segen? Letztes Jahr wies ein angesehener Gelehrter auf die offensichtliche Tatsache hin, dass uns von Vivien und FrancisBlundy ein ebenso großer Zeitraum trennt wie die Blundys von Oscar Wilde. Ende der viktorianischen Zeit waren Briefeschreiben und Tagebuchführen gang und gäbe, geht man aber weiter zurück, in die Zeit vor der Penny Post, werden Belege über das alltägliche Leben immer seltener. Gelangt man schließlich zum Beginn des 17. Jahrhunderts, ist man auf eine Handvoll wohlhabender und gut vernetzter Individuen angewiesen, oft Aristokraten, die über ausreichend Muße verfügten, Tagtägliches oder die Vorgänge am Hofe zu beschreiben. Auf den Bücherregalen in der Scheune fanden sich ein Dutzend Shakespeare-Biografien und weitere dreißig Bücher über das Leben elisabethanischer und jakobinischer Schriftsteller, jedes bemüht, ein angemessenes Maß an Vertrautheit mit seinem Thema zu vermitteln. Der Fall Shakespeare kann jedoch stellvertretend für all die übrigen gelten. Wir wissen immer noch sehr wenig über ihn. Die stete Hinterfragung und Prüfung des eigenen Ichs, wie in der Figur des Hamlet dargestellt – ein revolutionärer Moment in der Weltliteratur –, musste sich in der weitverbreiteten Gewohnheit reflektierten Tagebuchschreibens erst noch niederschlagen. Von Hand geschriebene Briefe neigen dazu, verloren zu gehen. Auch als es die Drucktechnik schon gab, interessierte sich keine Zeitung für Leben und Denken eines bloßen Stückeschreibers. Autoreninterviews waren noch in weiter Ferne. Spuren von Shakespeares Existenz finden sich meist in behördlichen Unterlagen. Er hinterließ Jahrhunderte des Disputs. Er war ein Atheist, nein, ein Katholik. Er hatte eine viel geliebte ›zweite‹ Ehefrau in London. Er reiste nach Polen. Er ist gar nicht der Verfasser der Stücke.
Unsere Biografen, Historiker und Kritiker, deren Forschung in die Zeit nach dem Jahr 2000 fällt, erben über ein Jahrhundert dessen, was die Ära der Blundys so wolkig die ›Cloud‹ nannte: ein riesiger, sich stetig ausweitender Sommerkumulus, bei dem es sich natürlich nur um Datenspeicher handelte. Wir haben fast zwei Jahrhunderte Fotografie und Film geerbt. Zahllose Vorträge von FrancisBlundy, Interviews und Lesungen wurden aufgezeichnet und bleiben uns dank des nigerianischen Internets erhalten. All die Artikel über ihn in Zeitungen und Zeitschriften existieren in digitaler Form. Nachdem ab etwa 2004 die Handys der Blundys auch zu Kameras wurden, vervielfältigten sich Aufnahmen der Scheune, der Innenräume und der umgebenden Landschaft. Weder er noch Vivien waren in den sozialen Medien aktiv, doch verschickten sie in ihren späteren Lebensjahren Abertausend digitale Nachrichten. Ihnen verdanken wir, dass sich die tagtäglichen Belanglosigkeiten verfolgen lassen, und sie geben uns einen akkuraten Bericht über Freunde und Bekannte, abgeschlossene Gedichte und das Auf und Ab ihrer Stimmungen. Sie erzählen uns, was Vivien bekümmerte und bedauerte, alles, was sie ihre Schwester Rachel und enge Freunde wissen lassen wollte. Wir können uns außerdem die Nachrichten ansehen, die ihre Zeitgenossen beunruhigten, die Skandale, die davon ablenkten, die alten Triumphe im Sport. Wir wissen genau, was zwischen Francis und seinem Agenten, seinen Verlegern und Übersetzern, seinem Steuerberater, Arzt oder Anwalt vorging. Selbst seine und Viviens Surfgewohnheiten sind heute nachvollziehbar, und wir können Ende-zu-Ende-verschlüsselte Nachrichten einsehen. Wie unser Dean in einer Ansprache einmal sagte, haben wir der Vergangenheit ihre Privatsphäre geraubt.
In der großzügig erfüllten Erwartung, sein Archiv einst an eine Bibliothek verkaufen zu können, hatte Francis seit Mitte der 1980er-Jahre Kopien aller verschickten und erhaltenen Briefe aufbewahrt. Die Bibliothek der Scheune wurde katalogisiert und online gestellt. Beide, Francis und Vivien, führten Tagebücher. Wir kennen ihre Stimmen genau, ihre Kleider, die sich im Lauf der Zeit verändernden Gesichter. Die Unterschiede zwischen privatem und öffentlichem Selbstbild sind offenkundig. Die Forschenden sehen, hören und wissen mehr von ihnen, ihren privatesten Gedanken, als wir von unseren engsten Freunden.
Dennoch hat unsere Kenntnis deutliche Grenzen. In einer Mail oder SMS finden sich selten so interessante und subjektive Reflexionen wie in einem gedankenschweren Brief des 19. oder 20. Jahrhunderts. Wenn Francis und Vivien an einem Sommermorgen vor die Scheune traten und auf das üppig wuchernde Grün im Tal blickten, unterschied sich dies gar nicht so sehr von der Art Landschaft, die Shakespeare gesehen hatte, wenn er London in Richtung Westen verließ, um durch Oxfordshire zum Haus seiner Familie in Stratford zu reiten. Und wenn die Blundys das ferne Grollen der Verbrennungsmotoren ignorierten, das der Wind von Osten herübertrug, erlebten sie eine im Grunde unveränderte und in einer ungebrochenen, 500 Jahre währenden Tradition von Dichtern beschriebene Umwelt. Überall gab es schmale Landstraßen, längst asphaltiert und nicht mehr sandig oder staubig, die denselben uralten Routen folgten und von Bäumen derselben Art überschattet wurden. Wildblumen waren meist durch Brennnesseln verdrängt. Vogelpopulationen, Schmetterlinge und kleinere Säugetiere waren stark dezimiert, hätten sich theoretisch bei guter Umweltfürsorge aber wieder erholt. Hinter dem nächsten Hügel konnten Strommasten oder eine industrielle Hühnerfarm sein, und der Friede mochte durch das Kreischen einer Kettensäge oder das Donnern eines tieffliegenden Düsenjägers vom nahen Militärflughafen gestört werden, doch befanden sich an diversen Stellen am Horizont die Türme fast tausend Jahre alter normannischer Dorfkirchen, und das Land durchzog ein Netz eifersüchtig bewahrter alter Fußwege, die durch Wälder und über letzte verbliebene Weiden entlang unsauberer Bäche führten. Auch sie hätten eines Tages gerettet werden können. Solange man sich nicht ausschließlich in Städten aufhielt, gab es eine Kontinuität, die das Verständnis jeden Dichters geprägt haben musste und die uns heute nicht mehr zur Verfügung steht. Von Shakespeare trennen uns zu viele unüberbrückbare Brüche, kulturell wie materiell. Die Blundys und ihre Zeitgenossen konnten sich ihm auf eine Weise nahe fühlen, die sie für selbstverständlich hielten und die wir mit digitalen Mitteln allein nie nachvollziehen können.
Dennoch wissen wir über das 21. Jahrhundert mehr, als es selbst über seine Vergangenheit wusste. Literaturspezialisten der Zeit vor 1990, wie etwa unsere Kollegen weiter unten im Fachbereichsflur, wissen über die Schriftsteller ihres Zeitraums nur so viel wie die Gelehrten zu Blundys Zeit. Die seit jeher spärlichen Quellen sind vor langer Zeit ausgetrocknet. Für sie gibt es keine neuen Fakten, nur neue Blickwinkel. Und doch reden sie über ihre fünfhundert Jahre alten Forschungsthemen, über ihre Dramatiker und Dichter, als würden sie sie so gut kennen wie ihre Nachbarn. Wir an unserem Ende des Flurs, im Abschnitt »Englische Literatur von 1990 bis 2030«, verfügen dagegen über mehr Fakten und Interpretationsmöglichkeiten, als sich in einem Dutzend Leben erläutern ließen. Und für die vielen Forschenden der Zeit nach 2030, die den größten Teil des Fachbereichs ausmachen, gibt es sogar noch mehr. Sollte es der Zivilisation gelingen, irgendwie ein weiteres Jahrhundert zu überstehen, so wie wir das letzte mit Ach und Krach geschafft haben, werden wir weitere hundert Meter Flur benötigen.
Und so wissen wir, dass VivienBlundy2014, also vor hundertacht Jahren, eine Kartoffel der Sorte Rooster in der Hand hielt, um sie für das Essen an ihrem Geburtstag zu schälen. »Ich finde, sie eignen sich zum Braten besonders gut«, hatte sie kurz zuvor ihrer Schwester Rachelgeschrieben. Wir dürfen annehmen, dass die Angelegenheit der fehlenden Geburtstagswünsche seitens ihres Mannes bei einem leichten Mittagessen geregelt wurde.
Graham und Mary Sheldrake, die ersten Gäste, sollten über Nacht bleiben und trafen am späten Nachmittag ein. Der Himmel war noch wolkenlos, und an jenem Oktobertag ging die Sonne nicht vor sechs Uhr unter. Im orangefarbenen Licht des frühen Abends hätten die Fachwerkscheune, die geziegelte alte Molkerei und ihre Umgebung für die beiden Londoner Besucher einfach herrlich aussehen sollen. Taten sie aber nicht. Es gab eine Krise. Marys E-Mails zufolge hatten die beiden auf der dreistündigen Fahrt erbittert gestritten. Der Anlass war banal genug. Trotz eindringlicher Fragen und Beschuldigungen leugnete Graham seit fast einem Jahr, dass er eine Affäre hatte. Jetzt aber, aufgebracht und vom zäh fließenden Verkehr gereizt, verlor er mit seiner Frau und den eigenen Lügen die Geduld. Sie wollte es wissen, also gut. Nimm dies! Voller Wut verkündete Mary daraufhin das Ende ihrer Ehe. Als sie beide aus dem Wagen stiegen, knallten die Türen. Graham stand einige Schritte abseits mit dem Rücken zur Scheune, als würde er die Aussicht genießen, das strahlende Herbstlicht, während er sich für die unvermeidlichen Augenblicke in Gesellschaft sammelte, die freundschaftlichen Umarmungen, die dahingeplapperten Fragen nach der Fahrt, dann weiter zu Tee und Scones. Alles, was er jetzt gerade nicht wollte. Mary dagegen gelang der Übergang mit Leichtigkeit. Sie fühlte sich auf triumphale Weise befreit, als hätte sie ein schwieriges Schachspiel gewonnen. Wie eine Tänzerin tippelte sie über den Kies zur Haustür der Blundys. Sie selbst hatte auch eine Affäre, wovon aber Graham, so beschäftigt mit seiner eigenen, nichts bemerkt hatte. Es war perfekt. So konnte sie ohne schlechtes Gewissen ihre Ehe auflösen (sie neigte zu schlechtem Gewissen) und in nicht allzu ferner Zeit mit Leonard zusammenleben, einem Architekten. Sie würde ihm eine Nachricht schicken, sobald sie allein war.
Graham, ebenfalls ein eifriger E-Mailer, der weiterhin zu den im Abendlicht leuchtenden Bäumen hinübersah, bedauerte sein im Auto abgelegtes Geständnis. Er hatte Mary nicht erzählt, dass er sein Verhältnis mit June Thompson vor drei Monaten beendet hatte. Aufgebracht wie er war, hatte er geglaubt, das würde sich wie der Versuch einer Versöhnung anhören, die doch nur scheitern konnte. Er drehte sich um und fand, seine Frau sah mit dreiundfünfzig noch jung aus, hübsch; sie wirkte leichtfüßig, als sie mit einem Freudenschrei Vivien die Arme um den Hals schlang. Schon bald umarmte auch er das Geburtstagskind, dann seinen alten Freund Francis. Nachdem sie ihr übliches Zimmer zugewiesen bekommen und ausgepackt hatten, um dann mit Vivien durch den Garten zu schlendern, machte ihn Marys Heiterkeit zunehmend misstrauisch. Er entschuldigte sich und ging ins Gästezimmer, wo er im Schrank ihre Handtasche fand. Er nahm ihr Handy und brauchte kaum fünf Minuten, um auf Leonard zu stoßen. Ehe er aber den Schock verkraften oder das Telefon zurück in die Tasche stecken konnte, kam Mary ins Schlafzimmer.
Ihrer beider Geschichte ist allerdings weniger von Belang als ihre Gemütsverfassung, da Letztere ihre jeweilige Reaktion auf den Sonettenkranz zum Geburtstag bestimmte. Mary Sheldrake war eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Generation. Weltweit übersetzt, Gewinnerin aller üblichen Preise, geradezu nationales Kulturgut. Ein minimaler Stil, ohne jede deskriptive Färbung, und viel zu vorsichtig für irgendwelche fiktionalen Tricks, irreführenden Plots oder falsche Fährten. Manch einer fand sie zu ›intellektuell‹, andere beklagten ihren trockenen Ton, das Fehlen von Sex oder Liebe in ihren Romanen. Wieder anderen gefielen solche Erzählungen wie die vom vertrackten Kidnapping, in dessen Verlauf das Opfer zum Täter wird, einem Finanzbetrug, bei dem alle absahnen und alle unschuldig sind, oder jene berühmte Geschichte, in der ein beliebtes Küchengerät, eine Mikrowelle, eine Art böswilliges Bewusstsein entwickelt. Zwanzig Jahre nach ihrem Tod war sie noch populär, dann wandelten sich die Geschmäcker oder Bedürfnisse, und sie geriet in Vergessenheit, und heute kennen ihren Namen nur noch eine Handvoll akademischer Spezialisten. Die Erzählung von einem komplizierten Bankraub geht auf Graham zurück, einen Finanzberater, der wenige bis keine Kunden und auch kein eigenes Geld zu haben schien. Er interessierte sich für Wein, Kochen und Golf, einen Sport, für den man große Rasenflächen benötigte und der sich unmöglich noch länger rechtfertigen ließ, nachdem das Meer so viel Land an sich gerissen hatte. Allgemein ging man davon aus, dass Mary für Grahams Hobbys aufkam.
Sie waren ein beliebtes Paar. In Gesellschaft verbreiteten sie eine Fröhlichkeit und ein Draufgängertum, das Literaturinteressierten gefiel. G & M, wie man sie allgemein kannte, besaßen eine Vorliebe für Modedrogen und belebten einen Abend oft mit psychotrophen Neuheiten, einer Microdose von etwas, das noch zu neu war, um illegal zu sein, meist aus einem Labor nahe dem kalifornischen Big Sur. Es kursierten noch immer Gerüchte über ein experimentierfreudiges Sexleben, obwohl das Paar schon auf die sechzig zuging. Insider vermuteten, dass Mary in ihren Romanen auf Sex verzichtete, um ihre Privatsphäre zu schützen.
Vier
Während Vivien ein Telefonat sich verspätender Gäste entgegennahm und Tee mit G & M trank, stand Francis unter der Dusche. Er kannte seine eigene Arbeitsweise und deren Resultate gut genug, um überzeugt zu sein, »etwas Außergewöhnliches an Schönheit und Widerhall« geschaffen zu haben. Unter einem unzureichenden Getröpfel – die Duschpumpe war defekt –
liefen mir bestimmte Zeilen durch den Kopf wie altmodische Papierstreifen. Dann hörte ich sie vorgelesen vom hellen Tenor eines jüngeren Mannes, meines jüngeren Selbst. Ich war längst nicht mehr jung, konnte mich aber noch daran erinnern, wie es sich einmal angefühlt hatte.
Wieder spielte er mit dem Gedanken, das Gedicht zu veröffentlichen. Vivien würde nichts dagegen haben, nur würde es die Intimität und Bedeutung seines Geschenks schmälern.
Sein Vorhaben blieb so verrückt wie tollkühn. Der Sonettenkranz war ihr gewidmet, ihr ganz allein. Er musste sich an den ursprünglichen Plan halten, und in einem Anfall von Selbstlob gab er sich einer begeisterten Betrachtung seines Werks hin, dieser zweihundertzehn Zeilen, die, unverkrampft trotz aller Forderungen der Form,
einen herzlichen, fast plauderhaften Ton bewahrten, lyrisch, aber auch weise, auch liebevoll, auch verspielt. Es ehrt die natürliche Welt mehr, als ich es tue. Gut, was den Fluss der Zeit, die Natur, den Mord, alles, was sie liebt, betrifft. Ungezwungene Reime. Der Rhythmus wie eine Melodie von Purcell, ein schöner Schwung vor jambischem Hintergrund.
Er fand es zu gut, um es nicht eines Tages doch in die Öffentlichkeit entkommen zu lassen. Nur musste er nicht derjenige sein, der das Gedicht freigab, aber damit hatte es keine Eile.
Er stand am Schlafzimmerfenster, trocknete die zitternden Glieder. Halb von Bäumen verborgen kroch ein alter Renault das Tal herauf, ein Wagen mit Trittbrettern, der ihn stets an Chicagoer Gangsterfilme erinnerte. Standfläche für Ganoven mit Maschinenpistole. Er sah einen Ellbogen im weißen Hemd aus dem offenen Fahrerfenster ragen. Der Wagen fuhr langsam, kaum zwanzig. Tony Spufford, Professor für Botanik, und John Bale, Tierarzt, genossen das herrlich rostrote Licht. Bestimmt würden sie sein Gedicht lieben. Sie würden es nicht verstehen, Vivien aber schon.
Rasch zog er sich an, griff nach dem aufgerollten Pergament auf dem Tisch und ging ins Wohnzimmer. Vivien war mit Mary in den Garten zurückgekehrt, Graham nirgendwo zu entdecken. Durch die Schiebetür sah Francis, wie die Autorin sich vorbeugte, um die Hochbeete zu betrachten. Auf einen Ruf hin drehten sich die beiden Frauen um und begrüßten Tony und John. Sie kannten sich seit den gemeinsamen Jahren im nördlichen Oxford. Francis wandte sich ab. Er fühlte sich wohl in seinen Gedanken und wäre lieber ohne Gesellschaft geblieben, alte Freunde eingeschlossen. Bald aber wurde es sechs, Zeit für einen Drink. Dann würde er sich besser fühlen. Mit der arthritischen Rechten konnte er keinen Korken ziehen, wohl aber mit den Daumen den Verschluss einer Ginflasche öffnen, sich die Kanne greifen und Eis, Zitrone und Tonic einfüllen. Er ging weiter ins Esszimmer und schob die Pergamentrolle hinter die Kaminuhr. Wir wissen von digitalen Aufnahmen, dass das gelbe, sonnenverblichene Ziffernblatt von zwei Putten gehalten wurde. Ein Riss im polierten Holz verzerrte das pausbäckige Lächeln der einen in eine zahnlose Schmerzgrimasse. So war es schon seit dreißig Jahren, die andere blickte weiterhin fröhlich drein.
Bis auf Mary und Graham, die noch auf ihrem Zimmer waren, standen eine Viertelstunde später alle in der Küche. Wer gut hörte, konnte vielleicht laute Stimmen vernehmen. Vivien goss die halbgaren Kartoffeln ab und schob die Wachteln bei niedriger Hitze in den Herd. Tony und John verfolgten Francis’ Methode, ihre Drinks zu mixen. Er hatte eine Zwei-Liter-Thermoskanne mit Eis, einem Drittel Gin und zwei Dritteln kaltem Tonic gefüllt, gab in vier der zehn aufgereihten Trinkgläser ein Zitronenstück und schenkte ein. Es blieb mehr als genug für eine zweite Runde, auch für die noch nicht eingetroffenen Gäste. Sie hoben gerade die Gläser, um auf Vivien anzustoßen, als G & M auftauchten, hochrot; sie konnten einen Schluck dringend gebrauchen. Alle hoben die Gläser zu einem Geburtstagstoast. Ein ziemlich starker Drink, darin war man sich einig, und die Kräuter im Gin waren deutlich herauszuschmecken. Als jemand John Bale fragte, wie seine Praxis lief, erzählte er von einer Operation, die er am Morgen an der Schildkröte eines kleinen Mädchens durchgeführt hatte. Das Tier litt an einem Magenverschluss. Auf dem OP-Tisch hatte er das Tier auf den Rücken gedreht und es festgehalten.
»Ich wollte gerade Saffan geben, ein Betäubungsmittel, als der alte Knabe langsam den Kopf aus seinem Panzer schob und mich mit diesem langen Blick musterte. Wir starrten uns an. Er sah so klug aus, wisst ihr. Wie ET. Eine Million Jahre alt. Als wollte er mich fragen: Muss ich sterben? Weißt du wirklich, was du da tust? Und einen Moment lang habe ich mich das tatsächlich gefragt. Ich gab die Spritze, und die ledrigen Lider klappten über seine Augen. Erster Schnitt, danach verlief alles ganz unkompliziert. Das Innere einer Schildkröte, wisst ihr, ist wirklich wunderschön.«
Laut Mary Sheldrakes Tagebuch musste Francis an Larkin denken: »Die Schildkröte hatte recht. ›Die Betäubung, aus der niemand mehr erwacht.‹«
»Das Mädchen kam nach der Schule mit ihrem Dad vorbei, um nach dem schläfrigen Patienten im Käfig zu sehen. Sie nahm ihn in den Arm, drückte ihn zärtlich an sich und weinte vor Freude. Gerade mal acht Jahre alt. Was für ein Anblick.«
Bei diesem Detail wandte Vivien sich ab, um Olivenöl, Salz und Pfeffer auf die Kartoffeln zu geben.
Die folgenden Wortwechsel wurden von Vivien und Mary erfunden oder schriftlich festgehalten. Tony sagte: »Bevor ich John kennenlernte, hatte ich gar nicht gewusst, dass man Reptilien operieren kann. Erst kürzlich hat er eine Schlange mit gebrochenem Rücken behandelt.«
»Ringelnatter, zermalmtes Rückgrat. Aber sie hat es geschafft.«
Nachdem John seinen Bericht von der Operation an der Schlange beendet hatte, fragte Francis: »Wer möchte noch einen Drink?«
»Vor einigen Jahren«, erzählte John Bale, »hat mir in Buffalo, New York, ein Tierarzt alter Schule gesagt, Schildkröten würden keinen Schmerz empfinden. Um seinen Patienten schläfrig zu machen, hatte er ihn am Abend vorher in den Kühlschrank gelegt, und sich tags darauf ans Werk gemacht.«
Als Francis zur Thermoskanne griff, war Graham der Erste, der ihm sein Glas hinhielt. Er sagte: »Lebt man in unserer Welt als Tier, ist man mit Fell und großen Augen besser dran.«
»Was uns nicht daran hindert, Schafe zu schlachten.«
Sie hörten draußen einen Wagen vorfahren, und in der Küche machte sich Erleichterung breit. Schildkröteninjektionen, zermalmte Schlangen, geschlachtete Schafe hatten die festliche Laune deutlich gedämpft. Mary bekam das Bild nicht aus dem Kopf, wie John sich mit seinem Skalpell über eine blutende Schlange mit herausgequollenem Gedärm beugte. Reifenspuren auf der gemusterten Haut! Sie glaubte nicht, dass sie etwas essen konnte. Leise bat sie um ein Glas Wasser.
Vivien nahm an, dass Graham und Mary irgendetwas verstimmt hatte. Sie klangen so tonlos, so bedrückt.
Gemeinsam gingen sie mit ihren Drinks nach draußen, um die Kitcheners zu begrüßen, Harry und Jane, Francis’ Schwester, beide groß gewachsen und mit guter Figur. Es hatte etwas Faszinierendes, ihnen dabei zuzusehen, wie sie aus dem Auto stiegen und sich im Dämmerlicht entfalteten, die Arme streckten. Harold T. Kitchener war gleichfalls Dichter, allerdings kaum bekannt, da seine Werke als schwierig galten und viele Anspielungen auf Gemälde und Skulpturen der italienischen Renaissance oder auf hinduistische Gottheiten enthielten. Zudem war er Blundys Lektor bei einem großen Verlag, ein heftiger Verfechter moderner Lyrik und Fürsprecher des Werkes seines Schwagers, über das er zwei Bücher geschrieben hatte. Ob ihre Freundschaft davon unberührt war oder ob es sie gerade deswegen gab, sorgte in einer jüngeren Generation von Dichtern für allerhand Gesprächsstoff. Doch war das letztlich unwichtig. Sofern es um Blundys Werk ging, teilten beide dieselbe hohe Meinung. Nach längerer Diskussion hatte Harry eingewilligt, die Biografie seines Schwagers zu schreiben, aus unbekannten Gründen aber kürzlich seine Ansicht geändert, wovon er Francis jedoch noch nichts erzählt hatte. Jetzt umarmten sich die beiden Männer, dann kam Jane, eine Keramikerin, an die Reihe, und kaum war die Umarmerei erledigt – keiner war hier fremd –, ging man ins Haus; Francis schenkte den Neuankömmlingen ihren Begrüßungsdrink ein. Die Kitcheners hatten reichlich aufzuholen, trotzdem blieb genug für das letzte Paar übrig, das sich verspätete, weil ihr Baby keine Ruhe finden wollte.
Die Sonne war untergegangen. Bei klarem Himmel sank die Temperatur, so steht es in den Unterlagen, innerhalb einer Stunde auf elf Grad. Meine Quellen für diesen Abend beziehen sämtliche Beteiligten mit ein und sind hier zusammengefasst. E-Mails und alle Vorgänge auf den sozialen Medien werden heutzutage zentral gespeichert und sind für jeden Mitarbeiter eines Instituts leicht zugänglich. Wo immer nötig, habe ich Kleinigkeiten ergänzt, natürlich stets im Rahmen des überaus Wahrscheinlichen.
Vivien ging durchs Zimmer zum Kamin, als sie von John und Tony abgefangen wurde, die sich Sorgen machten, weil sie sich so viel aufbürdete und sie sie gern damit aufzogen. Während John und Tony das Feuer in Gang brachten und mehr Holz aus dem Schuppen holten, kehrte Vivien in die Küche zurück, um den Salat anzurichten. Jane und Mary bestanden darauf, ihr zu helfen. Wie immer lehnte sie dankend ab, gestattete ihnen dann aber, den Tisch zu decken. Francis, Graham und Harry, die sich vage bewusst waren, dass um sie herum gearbeitet wurde, schützten ihr Gespräch, indem sie einige Schritte beiseitetraten. Zwei Jahre zuvor hatte sich Sir ›Jimmy‹ Savile – ein bekannter Radio- und Fernsehmoderator, Freund junger und benachteiligter Menschen, Unterstützer vieler Wohltätigkeitsorganisationen, enger Vertrauter einiger Mitglieder des Königshauses und der früheren Premierministerin Mrs. Thatcher, geadelt von der Königin – als Monster erwiesen, als Vergewaltiger und vielfacher Kinderschänder, sogar von sehr kranken Kindern. Gerüchte über Nekrophilie waren im Umlauf. Eine Fernsehdokumentation war vor Kurzem wiederholt worden. Vor wenigen Monaten musste sich der Innenminister im Parlament bei all jenen entschuldigen, die als Kinder in einem der staatlichen Krankenhäuser oder Pflegeheime missbraucht worden waren.
Harry sagte: »Wisst ihr noch, wie viele Leute behaupteten: ›Ich hab immer schon gewusst, was für ein falscher Fuffziger das ist. Ich hab mir immer schon gedacht, dass mit dem Dreckskerl irgendwas nicht stimmt‹? Aber wo waren sie, als wir sie gebraucht hätten?«
»Savile hat sich vor aller Augen versteckt«, sagte Graham. »Machte auf grotesk. Und jetzt seht selbst.«
Francis sammelte die leeren Gläser ein. »Noch einen? Kann das denn wirklich wahr sein? Wie konnte er unerkannt mit Toten Sex in der Leichenhalle haben?«
»Niedere Freunde in hohen Positionen.«
Ein düsteres Lachen, im selben Moment aber hörten sie ein Krachen und Jane, die in der Küche laut »Scheiße!« rief. Mary war eine große Salatschüssel aus den feuchten Händen gerutscht, eine, die Jane vor zehn Jahren als Hochzeitsgeschenk für ihren Bruder und Vivien getöpfert und bemalt hatte. Sie war zerbrochen, die Scherben lagen über die Fliesen verstreut. Jane und Mary bückten sich, um die Bruchstücke einzusammeln. Vivien bemühte sich, beide zu trösten.
»Ist doch nicht schlimm.«
»Aber das war so verdammt blöd. Tut mir leid. Tut mir wirklich leid!«
»Schon okay, ehrlich.«
»Ich kann eine neue machen«, sagte Jane.
»Ich schäme mich so!«
»Mary, es ist wirklich okay.«
Sobald sie die größeren Stücke auf eine Zeitung gelegt hatten und Tony mit Besen und Kehrblech fertig war, nahmen Vivien und JaneMary in den Arm, Savile war vorerst vergessen, und alles schien wieder gut, als sie zusammen an den Kamin zurückkehrten.
Fünf
In der Bodleian frage ich mich manchmal, ob ich nicht an einer milden Form von Demenz leide. Blicke ich von meinen Papieren auf und schaue über die Trennwand meiner Kabine in den Raum mit den stummen Wissenschaftlern, kann ich mir einreden, dass ich träume, dass meine wache Realität innerhalb dieser Seiten stattfindet und ich bei den Freunden in der Scheune bin für einen Abend, um Viviens Geburtstag zu feiern und ein neues Gedicht von FrancisBlundy zu hören. Ich hätte dort sein können. Ich bin dort. Ich weiß alles, was sie wissen – und mehr noch, denn ich kenne einige ihrer Geheimnisse und ihre Zukunft, ihren Todestag. Dass sie zugleich abwesend und für mich so lebendig sind, ist schmerzlich. Sie können mich rühren, mich berühren, nur ich komme nicht zu ihnen durch. Langfristige historische Recherche ist ein Tanz mit Fremden, die ich lieben gelernt habe; und es fehlen immer noch zwei Gäste.
Das Baby namens Todd war acht Monate alt und wollte nicht aufhören zu weinen. Chris Gage, der Vater des Jungen, ging mit ihm im Wohnzimmer auf und ab. Die fünfzehnjährige Babysitterin, Jess, sah vom Sofa aus zu. Dank der zweiten Ehe ihrer Mutter hatte sie drei jüngere Geschwister und meinte zu wissen, was zu tun war, hätte es aber unhöflich gefunden, etwas zu sagen. Harriet, Todds Mutter, hastete mit einer Flasche mit seimiger, rosafarbener Flüssigkeit und einem Plastiklöffel zum Kind. Es folgten gemurmelte Anweisungen und ein Gerangel um den weit geöffneten Babymund, während das Geschrei immer lauter wurde, ein überwältigender Lärm im beengten Wohnzimmer des kleinen Reihenhauses in OxfordsObservatory Street. Die Eltern waren verzweifelt. Todd war ihr erstes Kind, und sie fanden die Liebe für ihr Kind unerwartet verwirrend. Sich der eigenen Inkompetenz und Hilflosigkeit vor einer jungen Fremden bewusst zu werden hatte zudem eine betäubende Wirkung. Unentschlossen standen sie mitten im Zimmer, das Baby zwischen sich, und sahen sich verletzt an, als das Geschrei des Kleinen den bislang höchsten Ton erreichte. Dies sollte seit seiner Geburt ihr erster freier Abend sein. Offenbar zu früh.
Schließlich stand Jess auf, erbot sich mit lauter Stimme, es ihrerseits mal zu versuchen. Leise sang sie ein Kinderlied, anscheinend in fließendem Französisch, ging mit dem Kind aus dem Zimmer und langsam die Treppe hoch, dann wieder hinunter, verharrte auf halber Strecke, dann erneut nach oben, und fünf Minuten später kam sie wieder runter; diesmal mit leeren Händen. Stille. Sie hatte Todd in die Wiege gelegt.
»Auf den Rücken?«, fragten beide Eltern rasch.
Fünfzehn Minuten später saßen Chris und Harriet im Wagen und verließen die Stadt Richtung Norden. Sie waren nur etwa eine Stunde zu spät, versicherten sie sich immer wieder.
»Also kein Grund, so zu rasen«, sagte Harriet.
Schweigend stellten sie sich einen Verkehrsunfall vor und Todds Leben als Waise. Chris war dreißig. Er und seine Altersgruppe erregten – laut Viviens Tagebuch – seit einiger Zeit die Aufmerksamkeit der Soziologen, weil sie sich den üblichen Kategorien entzogen und für eine interessante Veränderung innerhalb der Bevölkerung standen: durchaus gebildet, wenn auch selten überragend, keine feste Karriere, mehr Fokus auf Lebensqualität als auf hohem Einkommen, häufige Jobwechsel, keine offizielle Qualifikation, sie lasen Bücher und sahen sich gelegentlich Arthousefilme an, folgten den Trends in der Musikszene, verreisten gern, waren sozial tolerant, politisch nicht engagiert, gingen selten wählen, nahmen Drogen, ohne groß drüber nachzudenken, verfügten über keine nennenswerten Ersparnisse und erfreuten sich eines großen Freundeskreises. Chris war mit sechzehn von der Schule abgegangen, hatte sich einen Platz in einer Landwirtschaftsschule erschwindelt und nach einem Jahr aufgegeben. Während der nächsten sechs Jahre war er Lagerarbeiter, stellvertretender Inspizient in einem Repertoiretheater, arbeitete beim Bürgertelefon der Stadtverwaltung, dann in einem Rennradladen, ließ sich zum Herrenfriseur ausbilden und jobbte in einem der New-Wave-Barbershops rund um Bloomsbury oder Farringdon (Industriebeleuchtung, weiß geflieste Wände, blanke Dielen, angesagte Musik im Hintergrund). Zwei Jahre später zog er weiter. Er war geschickt mit den Händen und arbeitete für einen Freund, der sich als Ladenbauer selbstständig machte. Seit er Harriet geheiratet hatte, eine Freundin aus der Schulzeit, und sie nach Oxford gezogen waren, in ein Haus, das Harriets Maklereltern für sie gefunden hatten, baute oder reparierte Chris Dinge, organisierte Dinge und lieferte Dinge, war ein guter Tischler, wusste die richtigen Leute zu besorgen und war im Norden und Osten Oxfords allgemein als patenter Kerl bekannt, dem man vertrauen konnte.
Immer noch Vivien: Harriet war eher Mainstream. Ein Abschluss in Anglistik an der Universität von Newcastle, anschließend eine Weile bei der Lokalzeitung, danach freiberuflich in London, bis sie begann, Porträts für Zeitschriften zu schreiben. Sie war eher wegen ihrer Verlässlichkeit als wegen ihres brillanten Stils gefragt. FrancisBlundy besaß den Ruf, gegenüber der Presse ausfällig zu werden. Drei Journalisten hatten es abgelehnt, über ihn für eine Zeitschrift namens Vanity Fair ein Profil zu schreiben, bis sich der verzweifelte Redakteur schließlich an Harriet wandte. Niemand wusste, dass der Dichter damals eine Periode des Selbstzweifels durchmachte, um seinen Ruf besorgt war und untypischerweise unter allen Umständen von der jungen Frau gemocht werden wollte, die mit einem Strauß Blumen und einer Schachtel Pralinen zur Scheune kam.
Sie war schön und intelligent und redete einfühlsam über sein Werk. Hinterher ging Vivien mit ihr durch den Garten und mochte sie ebenfalls. Harriets Artikel stellte FrancisBlundy als schroffes Genie dar, dessen harte Schale ein gütiges Herz barg, als eine zutiefst sensible, humorvolle und weise Persönlichkeit, als einen Mann auf der unvergleichlichen Höhe seiner Kunst. Der Dichter war zufrieden. Harriet und Chris wurden zum Essen eingeladen, und es lief gut. Den jungen Mann mit dem leichten Cockney-Akzent verstand Francis allerdings nicht so ganz und wusste ihn auch nicht recht einzuordnen. Er wirkte ein wenig begriffsstutzig und hatte noch nie ein Buch gelesen. Erst nachdem Chris das undichte Dach der Scheune repariert, die Downloadgeschwindigkeit des Internets erhöht, ein Update auf dem alten Computer durchgeführt und den Dichter mit einem ausgezeichneten Physiotherapeuten bekannt gemacht hatte, der willens war, von Oxford zu ihm rauszufahren, wurde er akzeptiert. Vivien gefiel das Paar. Als Chris Interesse für Physik an den Tag legte, arrangierte sie ein Abendessen mit den Gages und ihrem Neffen Peter. Und mit Harriets Schwangerschaft wurde ihre Freundschaft noch enger. Eine Tochter, endlich, ein Enkelersatz in Aussicht. Die Gages fragten die Blundys, ob sie nicht Todds Taufpaten werden wollten.
Harriet und Chris fühlten sich in der Scheune so sehr zu Hause, dass sie ohne anzuklopfen eintraten. Als sie hereinkamen, standen alle auf. Gin und Tonic waren längst Geschichte. Drei leere Weinflaschen standen auf einem kleinen Tisch. Kaum hatte man die Umarmungen hinter sich – alle kannten das Paar gut –, fragte Vivien, wie es dem armen Todd gehe. Harriet antwortete, er sei weder tot noch wach, was allseits ein freundliches Lächeln auslöste, und man machte ihnen am Kamin Platz.
Man redete über den Klimawandel, so der verharmlosende, damals noch gebräuchliche Ausdruck. Schon wieder. Eines von Francis’ Lieblingsthemen. Harriet hatte seine Ansichten dazu im Porträt taktvollerweise ausgeklammert. Der Dichter war, wie es mal jemand formulierte, ein nuancierter Leugner, doch wenn man ihm widersprach, wurde er zum eingefleischten Leugner. Er besaß die Fähigkeit, eine abweichende Meinung im Gespräch wie persönliche Feindschaft klingen zu lassen. Kaum einer seiner Freunde teilte seine Meinung, und so waren etliche ihrer Treffen durch laute Stimmen getrübt worden. Wenn nun das Gespräch darauf kam, neigte man dazu, ihn reden zu lassen, bis das Thema gewechselt werden konnte, da man fand, dass die Ansichten eines einzelnen Dichters keinen großen Unterschied für das Schicksal der Erde bedeuteten und dass es sich nicht lohnte, den alten Blundy wütend zu machen. Seine Erkenntnisse bezog er aus der Presse – von einem Kolumnisten, vordem Anwalt, einem australischen Dichter und Kritiker sowie einem ehemaligen Finanzminister.
Diesmal beschäftigte Francis ein morgendlicher Radiobeitrag über ein Leak aus dem zwischenstaatlichen Ausschuss der UN. Der fragliche Bericht war noch gar nicht veröffentlicht, doch hatte jemand von ziemlich weit oben durchsickern lassen, dass sich unter den vielen Hundert teilnehmenden Klimawissenschaftlern Alarmstimmung breitmachte. Die Völkergemeinschaft steuere immer schneller in die falsche Richtung. Dann folgte die lähmende Aufzählung: Überflutungen, Dürren, Taifune und Wirbelstürme, Waldbrände – und dies in zunehmender Häufigkeit; Messungen in diversen wissenschaftlichen Disziplinen bestätigten die fortschreitende Übersäuerung der Meere, schmelzendes Polareis, Gletscherrückzug, Anstieg des Meeresspiegels, immer höhere Oberflächentemperaturen. Kolossale Migration, Pandemien, Ressourcenkriege und prognostiziertes Artensterben – und so weiter und so weiter. Francis zeigte sich zugleich aufgebracht und unbeeindruckt. Zum Glück hatte Harriet das gesamte Interview vom Tonband abgeschrieben und aufbewahrt. Wir dürfen daher annehmen, dass seine Argumente an diesem Abend dieselben waren.
Bemerkenswert ist, dass man seit Mitte der 2030er-Jahre allgemein von ›DISRUPTION‹ spricht, respektvoll meist in Großbuchstaben geschrieben, eine Kurzform für die übliche Liste der Folgen globaler Erwärmung, deren Litanei Aktivisten wie Skeptiker gleichermaßen anödete. In dem Ausdruck klingt ebenso eine Ahnung von geistiger Disruption an wie auch die rachsüchtige Wut der Wettersysteme. Zudem schwingt darin der Hinweis auf eine kollektive Verantwortung für unsere angeborene kognitive Verzerrung mit, die bewirkt, dass uns kurzfristige Bequemlichkeit wichtiger ist als langfristiger Nutzen. Die Menschheit selbst ist anomal. Allerdings erstreckt sich die Bedeutung dieses Wortes nicht auf den damit zusammenhängenden metaphysischen Trübsinn – den Zusammenbruch des Glaubens an eine Zukunft oder, genauer gesagt, des schwindenden Glaubens an einen Fortschritt.
Blundy legte noch nach, während das junge Paar sich einen Platz suchte und einen Drink nahm. Jeder Trottel müsse doch sehen, dass es hier nur ums Absahnen gehe. Aberhundert linksliberale, sogenannte Wissenschaftler und deren bürokratische Vorgesetzte jagten uns unablässig Angst und Schrecken ein, damit der lukrative Strom der Fördergelder nicht verebbte. Natürlich wurden die entsprechenden Daten frisiert. So drohe etwa Tuvalu keineswegs wegen des steigenden Meeresspiegels unterzugehen. Da war die Geologie eindeutig. Die Insel selbst sank!